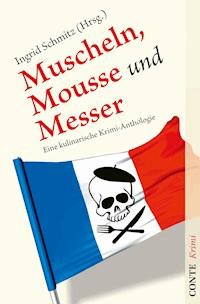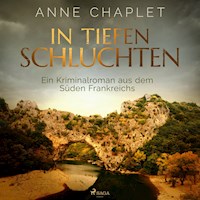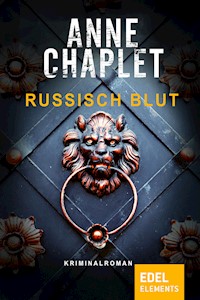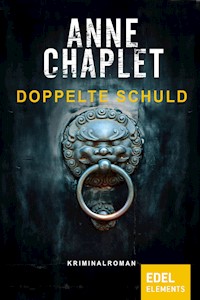9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tori Godon ermittelt
- Sprache: Deutsch
Tödliche Geheimnisse lauern in den Tiefen der Cevennen... In der wilden, elementaren Landschaft des Vivarais am Fuße der Cevennen wohnen Rebellen und Eigenbrötler, Aussteiger und Propheten. Und seit einigen Jahren auch Tori Godon, ehemalige Anwältin, 42 Jahre alt, frisch verwitwet und auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Als ein holländischer Höhlenforscher, der sich bei ihrer Freundin einquartiert hat, verschwindet, ist Tori beunruhigt. Als der alte Didier Thibon, der ihr von sagenhaften Schätzen und Schmugglerverstecken in den Höhlen erzählte, tot aufgefunden wird, ist Tori alarmiert. Und als sie auf der Suche nach dem Holländer auf dem Karstplateau in eine Felsspalte stürzt, ist plötzlich auch ihr Leben in Gefahr. Wie hängen die Aktivitäten des Holländers mit den Hugenotten zusammen, die in dieser Region einst Zuflucht fanden? Und was hat das alles mit der Geschichte des Dorfes zu tun? »In tiefen Schluchten« ist ein packender Krimi vor der faszinierenden Kulisse Südfrankreichs, der die Leser tief in die Geheimnisse der Cevennen eintauchen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anne Chaplet
In tiefen Schluchten
Ein Kriminalroman aus dem Süden Frankreichs
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Anne Chaplet
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Anne Chaplet
Anne Chaplet ist das Pseudonym von Cora Stephan, unter dem sie mittlerweile zehn preisgekrönte Kriminalromane veröffentlicht hat.
Cora Stephan ist seit mehr als dreißig Jahren freie Autorin und schreibt Essays, Kritiken, Kolumnen – und Bücher. Neben zehn Sachbüchern erschien 2016 der Roman »Ab heute heiße ich Margo« bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In der wilden, elementaren Landschaft des Vivarais am Fuße der Cevennen wohnen Rebellen und Eigenbrötler, Aussteiger und Propheten. Und seit einigen Jahren lebt auch Tori Godon, ehemalige Anwältin aus Deutschland, die frisch verwitwet und trauernd auf der Suche nach Frieden und neuem Lebenssinn ist, im Dorf. Als der Höhlenforscher Adriaan, der sich bei ihrer Freundin einquartiert hat, verschwindet, ist Tori beunruhigt. Als der alte Didier Thibon, der ihr von sagenhaften Schätzen und Schmuggler-Verstecken in den Höhlen erzählt hat, tot aufgefunden wird, ist Tori alarmiert. Und als sie auf der Suche nach dem jungen Forscher auf dem Karstplateau in eine Felsspalte stürzt, ist plötzlich auch ihr Leben in Gefahr. Hängt das Verschwinden Adriaans mit den Widerstandskämpfen der Hugenotten zusammen, die hier im 18. Jahrhundert Zuflucht fanden? Oder mit der Résistance-Bewegung gegen die deutsche Besatzung? Als noch ein Mord passiert, ist es mit Toris Ruhe im beschaulichen Paradies der deutschen 68er-Aussteiger vorbei.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Anette Kühnel
Karte: Markus Weber / Guter Punkt, München
ISBN978-3-462-31661-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/buecher/specials/karten-in-tiefen-schluchten.html
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Kapitel I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Kapitel II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Kapitel III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Kapitel IV
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Kapitel V
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Kapitel VI
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Dank
Adressen
Für Rudolf
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver?
Jean Ferrat
Kapitel I
Belleville, im Frühjahr
1
In dieser Nacht blieb der Hund still. Tori horchte in das Rauschen des Regens hinein. Da war nichts. Kein Laut. Kein Heulen.
Unter Schirm und Regencape geduckt, lief sie das Gässchen hinunter zur Straße, wo ihr Auto stand, schloss den Schirm, schüttelte ihn aus und schob sich auf den Fahrersitz. Es regnete, wie es nur in den Cevennen regnete: Es schüttete. Den Toufache, der Bach, der das Wasserbecken im Waschhaus speiste, hatte man vor Jahren in ein Betonbett unter der Straße gesperrt, aber es würde nicht mehr lange dauern, bis er die Gullydeckel hob, hinauskletterte und seinen alten Platz zurückeroberte. Im vergangenen Herbst hatten die Wassermassen eines Abends sämtliche Mülleimer, die für die Müllabfuhr am Straßenrand standen, gepackt und ins Tal geschwemmt.
Tori startete den Motor. Warum jaulte der Hund nicht? Hatten seine herzlosen Besitzer ihn ins Trockene geholt? Normalerweise ließen sie ihn bei jedem Wetter draußen und stellten den Fernseher so laut, dass sie weder das Gejaule noch das Klingeln entnervter Nachbarinnen hörten. Tori löste die Handbremse, schaltete in den ersten Gang, ließ den Motor einmal kurz aufheulen und fuhr los.
Die müden Blätter ihres Scheibenwischers kamen gegen den Wasserschwall kaum noch an. Die Scheinwerfer tauchten die Welt da draußen in ein milchig-graues Licht, das nur Schatten erkennen ließ. Sie fuhr im Schritttempo die enge Gasse vom Unterdorf hinauf zum Oberdorf. Die Hausmauern rückten dem Wagen viel zu nah und sie betete, dass ihr niemand entgegenkommen möge.
Das Wasser schnellte ihr wie ein graues pockennarbiges Band entgegen, Gebirgsbäche, die sich auf die Straße verirrt hatten und nun den Toufache suchten, der unten ungeduldig rumorte. Tori kämpfte gegen die Angst an, in irgendeinem Wasserloch zu landen oder gar von den Wassermassen hinuntergespült zu werden.
Nur nicht daran denken. Sie steuerte das Auto entschlossen auf die Dorfstraße, die selbstbewusst »Grande Rue« hieß, und nahm an der Kreuzung mit der Marienstatue den Weg nach rechts. Vor ihr zerriss ein schartiger Blitz den Himmel und erleuchtete regenschwangere Wolken. Hinter ihr grollte der Donner. Die Kiefern rechts und links der schmalen Straße warfen ihre Äste hoch und ließen sie über die Straße peitschen. Wenn einer von ihnen die Stromleitungen erwischte, die in den Sturmböen hin- und herpendelten, gäbe es wieder einmal stunden- oder gar tagelang keinen Strom.
Man sollte bei diesem Wetter nicht unterwegs sein, wirklich nicht, und sie hatte das auch keineswegs vorgehabt. Aber was tun, wenn Eva anrief? »Hier ist Land unter. Kannst du kommen? Schnell?«
Tori hatte auf dem Sofa gesessen und gelesen, bemüht, nicht auf das Klopfen über ihr zu hören, das immer fordernder wurde. Dem Regen war es wieder einmal gelungen, sich einen Weg durch das marode Dach zu bahnen. Wo es dann durch die Decke tröpfelte, war stets eine Überraschung, denn die Rinnsale nahmen nie denselben Weg.
Als sie sich einmal bei Monsieur Champenard, von dem Carl und sie das Haus gekauft hatten, über das undichte Dach beschwerte, dessen Zustand man ihnen beim Kauf verschwiegen hatte, gab er ihr die unsterbliche Antwort, sie hätten schließlich ein Sommerhaus erworben. Als ob sie das Fehlen einer Zentralheizung moniert hätte!
Am liebsten hätte sie Eva gefragt, ob ihre Mieter ihr nicht beistehen könnten bei welcher Katastrophe auch immer. Aber sie wusste nicht, wie viele der fünf Ferienwohnungen jetzt, in der Vorsaison, überhaupt belegt waren. Außerdem hatte Eva ihr so oft schon geholfen. Sie war Toris erster Anker gewesen hier im wilden Süden, in der kühnen Ardèche, im alten Vivarais. In dieser magischen Gegend zwischen Karstebenen und Vulkanbergen, Flusstälern und Gebirgsketten, mit ihren gewaltigen Gewittern, den heißen Sommern und dem scharfen Nordwind.
Die Straße machte eine scharfe Kehre nach links, die Steigung war hier so steil, dass Tori immer absteigen musste, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs war und nicht rechtzeitig auf den niedrigsten Gang heruntergeschaltet hatte. Der Wagen schlingerte, ihr Herzschlag stolperte, doch die Reifen fanden schnell wieder Halt. Sie atmete auf. Zu irgendetwas musste so ein aufgebrezelter Einkaufswagen wie ihr Landrover ja gut sein.
Kurz nach einer scharfen Rechtskurve ging es hinunter nach Fayet. Das Dorf lag im Dunkeln. Keine Straßenbeleuchtung, kein Licht in den Häusern, nur ein einsamer Lichtkegel schwenkte über die Straße. Tori ließ den Wagen langsam näher rollen. Im Scheinwerferlicht erkannte sie eine kleine vermummte Gestalt in Gummistiefeln, die etwas Schweres schleppte. Eva.
Sie hielt am Straßenrand und parkte das Auto so, dass das Licht der Scheinwerfer die Szenerie erhellte. Das alte Steinhaus links der Straße, zusammengebacken aus mindestens drei verschiedenen Häusern, so, wie es hier üblich war, beherbergte mittlerweile vier Ferienapartments, drei große und ein kleines. Unterhalb von Haus und Straße verlief ein Fußweg, eine Ruelle, wie man die gepflasterten Gässchen nannte, die in jedem alten südfranzösischen Dorf von Haustür zu Haustür führten. Von der Ruelle ging eine Treppe hinauf zum kleinsten der Apartments, genannt »Bellamie«.
Tori schlüpfte in ihr klammes Cape, zog sich die Kapuze über den Kopf und stieg aus. Eva hatte sich umgedreht und winkte. In ihrem Regenumhang sah sie aus wie ein Zwerg aus dem »Herrn der Ringe«. Offenbar versuchte sie, eine Holzplanke von der Straße zum Treppenabsatz des Apartments zu legen, um den reißenden Bach zu überbrücken, zu dem die Ruelle geworden war. Das Wasser war bereits die Treppenstufen hinaufgeklettert, nicht mehr lange und es würde die Eingangstür erreichen.
Tori lief hinüber. Eva setzte ihre Last ab und amtete auf. »Danke, dass du kommst. Es ist sonst keiner da. Wir müssen wenigstens den Kühlschrank retten und was der Herr sonst noch so herumliegen hat. Möchte wissen, wo der Kerl ist bei diesem Wetter. Ich hab ihn seit gestern früh nicht mehr gesehen.«
Sie brachten das Brett gemeinsam in die richtige Position.
»Adriaan aus Rotterdam. Interessiert sich für Höhlen und wandert gern«, sagte Eva und prüfte mit dem Fuß die Belastbarkeit der Planke, bevor sie hinüberbalancierte. »Netter Kerl, würde dir gefallen.«
Tori kannte das schon, immer gab es irgendeinen Mann, der ihr gefallen sollte, als ob das Leben ohne Kerle, wie nett sie auch immer waren, undenkbar wäre. Höhlenforscher waren außerdem nicht ihr Ding, davon gab es hier in jeder Saison mehr als genug, es wurden regelrechte Touren in alle möglichen unterirdischen Öffnungen angeboten. Was auf den Bergen der Skilehrer, war in den Bergen der Höhlenführer.
Eva klopfte höflichkeitshalber, bevor sie die Tür zum Apartment aufschloss. Ein Geruch nach ungewaschenen Socken, leckgelaufener Kläranlage und feuchtem Mörtel stieg Tori in die Nase. Hier musste dringend gelüftet werden.
Eva stellte die Taschenlampe auf den Tisch neben der Tür. Tori schälte sich aus ihrer Regenjacke und hängte sie an den Türhaken. Sie kannte die kleine Ferienwohnung gut, zu gut. Die Erinnerung an die Tage, die sie hier mit Carl verbracht hatte, überfiel sie mit Macht und drückte ihr die Luft ab. Fayet war die erste Station auf ihrer Reise in die Vergangenheit gewesen, so hatten sie Eva kennengelernt. Für einen Sommer hatten Carl und sie hier gewohnt, einen wunderbaren, viel zu kurzen Sommer lang. Von Fayet aus waren sie durch die Gegend gestreift, bis sie ihr eigenes Haus entdeckt und gekauft hatten, Maison Sarrasine in Belleville.
»Bellamie« bestand aus einem einzigen großen Gewölbe mit unverputzten Steinwänden und unebenen grauen Steinplatten auf dem Boden. Direkt hinter dem Eingang ging es zu Klo und Dusche. An der Wand eine gut ausgestattete Küchenzeile. Vor dem Kamin ein Tisch mit zwei Stühlen. Noch weiter rechts ging es durch einen Vorhang und ein paar Stufen hoch zum Bett.
Auf einem der Stühle lagen eine Jeans und ein schmuddeliges weißes T-Shirt, darunter Turnschuhe. Immerhin: keine weißen Socken. Sie hob das T-Shirt hoch. Vier Pferdeköpfe zierten die Brustseite, ein wenig ungelenk gezeichnet, aber deutlich erkennbar. Eva schaute kurz zu ihr herüber. »Ach! Die gibt’s jetzt auch als T-Shirt? Die berühmten Pferde aus der Grotte Chauvet?«
»Träumt dein Holländer etwa auch davon, eine Grotte mit Höhlenmalereien zu finden? Ich dachte, sämtliche dafür infrage kommende Öffnungen wären mittlerweile erkundet?«
Tori kannte die Geschichte der Grotte Chauvet, natürlich. Die Entdeckung der riesigen Höhle mit einer Fülle von Wandmalereien, darunter Zeichnungen von Nashörnern, Löwen, Bären, Mammuts und Pferden, war eine Weltsensation. Der Fund inspirierte wahrscheinlich viele, die nicht des Kanufahrens oder herausfordernder Radstrecken wegen in die Ardèche gekommen waren.
»Alle Jungs suchen nach dem Einhorn«, sagte Eva.
»Nach dem Einhorn?« Tori zog die Augenbrauen hoch.
»Dummer Spruch. Sagt man hier so. Aber Adriaan ist in Ordnung.«
Vielleicht. Der Holländer schien sich nicht nur für die Höhlen und Grotten des Vivarais zu interessieren. Auf dem anderen Stuhl lag ein Stapel Bücher. Das oberste stammte von Stephen King, bei »Dodenwake« musste es sich um den »Friedhof der Kuscheltiere« handeln. Darunter lagen eine illustrierte Geschichte der Cevennen, ein englisches Buch über Frankreich in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, ein Reiseführer und zwei topographische Karten.
»Kannst du mal eben?«
Tori blickte auf. Eva mühte sich vergebens, den Kühlschrankstecker aus der Dose zu ziehen, die hoch oben über der Spüle angebracht war, ein nicht ganz einleuchtender Platz, selbst wenn man bei der Montage an Hochwasser gedacht hätte.
Sie war in zwei Schritten bei ihr. Wie immer in Evas Gegenwart kam sie sich wie ein ungeschlachter Riese vor. Eva, einst Blumenkind aus Deutschland, kleidete sich auch mit 75 noch wie ein Hippie und färbte ihre Haare hennarot, sie hatte eine zarte, mädchenhafte Figur und reichte Tori bis zur Brust. In ihrer Gegenwart fühlte Tori sich mit ihrem Gardemaß von einem Meter einundachtzig entsetzlich groß und knochig.
»Wir sollten den Kühlschrank ausräumen und nach oben neben das Bett stellen. Bis dahin ist das Wasser noch nie gekommen.« Eva öffnete die Kühlschranktür. »Männer!«
Im Inneren fanden sich Flaschen mit irgendetwas Isotonischem, Bierdosen, eine angetrocknete Rolle Ziegenkäse und ein paar Scheiben Schinken, die sich im Papier bereits rollten.
Tori rückte den Kühlschrank vor und zur Seite und schob und hievte ihn die zwei Stufen hoch in den Schlafraum.
Das Bett war gemacht, erstaunlich für einen Mann. Auf dem Tischchen neben dem Bett stand hinter einem Nasenspray und einem Päckchen Taschentücher ein gerahmtes Foto, offenbar eine Studioaufnahme, es zeigte einen älteren Herrn mit vollem weißem Haar und hellen blauen Augen. Seinen Vater hatte er also auch lieb. Noch erstaunlicher.
Sie lief wieder nach unten, packte den Bücherstapel und trug ihn hoch zum Bett, auf das Eva schon Jeans und T-Shirt gelegt hatte. Dabei fielen ihr eine der Karten und ein Blatt Papier hinunter. Sie hob die Karte auf – eine topographische Wanderkarte der Gorge de l’Ardèche. Der Holländer hatte einen Ausschnitt daraus kopiert und etwas hineingemalt: Kreise und Striche, am Rand Notizen mit Bleistift.
Eva trat neben sie und griff nach der Kopie. »Grotte des Huguenots. Pont d’Arc. Grotte Chauvet. Sag ich doch. Er wandert gern.«
Tori wollte Karte und Kopie auf den Stapel legen, als aus der zusammengefalteten Karte ein Foto glitt, ein kleines Schwarzweißfoto mit gezacktem Rand. Es zeigte eine junge Frau in einer Art Blouson und hochgekrempelten Arbeitshosen, an den Füßen Stiefel. Die Haare trug sie zurückgebunden, eine Strähne hatte sich gelöst und fiel ihr in die Stirn. Sie lächelte in die Kamera.
Tori kam sich plötzlich wie ein Eindringling vor. Was hatten sie hier zu suchen, im Leben eines anderen Menschen? Sie legte das Foto zurück und half Eva, den bunten Vorleger zusammenzurollen, der unter dem Tisch gelegen hatte, und nach oben zu tragen.
»Ich denke, das reicht.« Eva blickte sich noch einmal um. »Wir können wieder hinaus ins Nasse.« Sie schloss die Tür hinter ihnen zu.
Der Wolkenbruch hatte sich in einen gemäßigten Platzregen verwandelt, doch das Wasser würde noch eine Weile steigen, die oberste Treppenstufe hatte es schon erreicht. Sie waren gerade noch rechtzeitig fertig geworden.
Eva musterte Tori im Scheinwerferlicht des Autos. »Nass siehst du noch dünner aus, als du bist. Kommst du mit auf ein Glas? Es gibt auch trockene Handtücher bei mir.«
Und Kerzen. Die hatte man in dieser Gegend sicherheitshalber immer im Haus. Tori nickte.
Sie war nicht mehr ganz nüchtern, als sie sich zwei Stunden später wieder ins Auto setzte. Der Sitz war klamm, aber es regnete nicht mehr. Mit heruntergelassenen Fenstern fuhr sie los. Im Wald duftete es nach feuchter Erde, und als sie in Belleville einfuhr, stieg ihr aus den Gärten der staubig-wilde Geruch verblühter Mimosen und der Marzipanduft von gerade aufgeblühtem Schneeball in die Nase. Es wurde Frühling. Das erste Gewitter in diesem Jahr war sein lautstarkes Entree gewesen.
Belleville lag ins gelbe Licht der Straßenlampen getaucht, hier hatte es offenbar keinen Stromausfall gegeben. Die Straße, an der sie immer parkte, glänzte nass, war aber nicht überspült, der Toufache hatte es also nicht aus seinem Bett herausgeschafft – oder er hatte sich bereits wieder zurückgezogen. Dennoch stellte Tori den Wagen vorsichtshalber dort ab, wo die Straße leicht anstieg. Als sie die Autotür öffnete, hörte sie den Hund. Er jaulte und heulte nicht. Er winselte. Es schnitt ihr ins Herz.
Mit ein paar Schritten war sie am Gartentor und ging in die Hocke. »Komm, Kleiner«, flüsterte sie. Ein überraschter Japser, tappende Hundepfoten.
Sie streckte die Hand aus, durch die Zaunlatten hindurch. Warmer Atem. Eine feuchte Zunge. Seidenweiches Fell. Sie kraulte das Tier unter der Kehle, bis ihre Finger müde waren. Der Hund gab einen langen Seufzer von sich, als sie sich von ihm trennte und durch den engen Gang zwischen den Steinmauern der Nachbarhäuser hoch zu ihrem Haus lief, leicht schwebend, wie erlöst.
Im Schlafzimmer trat sie in eine Pfütze. Diesmal hatte es über dem Türstock hineingeregnet. Egal, Hauptsache das Bett war trocken. Tori schlief sofort ein.
2
Der Mistral weckte sie. Er rüttelte an den Fensterläden und rauschte durch die Bäume am gegenüberliegenden Hang. Tori blinzelte durchs Schlafzimmerfenster ins Blaue. Der Wind hatte den Himmel blitzblank geschrubbt, aber es war eisig kalt geworden. Der Frühling machte Pause.
Sie zog sich ihren wärmsten Pullover an und tappte nach unten. Die Terrasse war noch nass vom Regen gestern Abend, der Nordwind hatte die seidenpapierfeinen Blütenblätter von den Pfingstrosen gerupft und den Topf mit dem Oleander umgeweht. Der musste warten, bis sie Kaffee getrunken und sich angezogen hatte.
Sie hockte sich auf einen Stuhl an den Küchentisch, die Hände um den Becher mit heißem Kaffee gelegt, und dachte über ihren Traum nach. Sie war auf den steilen Höhen über der Ardèche gewandert, hatte einen unterirdischen Fluss rauschen gehört und Stimmen vernommen. Im Traum hatte sie den opaken Schleier gesehen, der manchmal hochstieg, wenn ihre empfindliche Nase etwas roch, was keiner sonst roch. Ganz zu schweigen davon, dass niemand außer ihr je den feinen Schleier gesehen hatte. Sie sprach nicht darüber. Geruchshalluzinationen und Visionen passten nicht zu einer Juristin, von der man annehmen sollte, dass sie an nichts glaubte außer an Recht und Gesetz.
Irgendwann hatte sich der Schleier gelüftet und sie hatte das fahle Gesicht einer jungen Frau mit dunklen Augen und dunklem Haar gesehen. Davon war sie aufgewacht.
Das Bild, das sie im Zimmer des Holländers gefunden hatte, hatte sich in ihren Traum geschlichen. Überhaupt: Das Verschwinden des Mannes beschäftigte sie. Eva nahm das alles viel zu leicht, es konnte doch immerhin sein, dass ihrem Mieter etwas passiert war. Warum ließ sie nicht nach ihm suchen?
Lustlos biss sie in ein zähes Stück Brot von gestern, das sie mit einem Rest Chèvre belegt hatte, und spülte es mit Kaffee herunter. Den Kopf zurückgelegt, schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf ihr inneres Bild der Karte, die sie im Apartment gefunden hatten, die Kopie, in die der Holländer Kreise und Striche hineingemalt hatte. Kurz vor dem Pont d’Arc, auf dem Weg zur Grotte Chauvet, hatte er etwas dick umrandet, was Eva als Grotte des Huguenots identifiziert hatte. Die Hugenottengrotte war einen Ausflug wert.
Ein Ausflug, den sie mit Carl hatte machen wollen – wie so vieles andere. Carls Vorfahren waren Hugenotten aus dem Vivarais gewesen, er war mit ihrer Geschichte aufgewachsen, mit Erzählungen von unendlichem Schrecken und übermenschlichem Heldenmut. »Wir haben durchgehalten bis zuletzt«, pflegte er das Familienmotto zu zitieren, mit einer Mischung aus Stolz und Ironie. Sie hatten viel auszuhalten gehabt, die Godons, Wollwirker aus den Cevennen, einer Landschaft geprägt von wilder Natur und Glaubenskriegen. Die Familiengeschichten handelten von Folter und Tod und Willkür der Obrigkeit. Deshalb waren sie hier gelandet: um gemeinsam auf die Suche nach Carls Ahnen zu gehen. Doch Carl hatte sie damit allein gelassen.
Sie zog ihre Wanderhose an und packte Wanderstiefel und Windjacke ein. Das Wetter war genau richtig, schwitzen würde sie mit Sicherheit nicht.
Die Fahrt von Belleville zur Hugenottengrotte ging über eine schmale Straße, die am Hang über dem Flusstal klebte, vorbei an hoch aufragenden säulenförmigen Felsmassiven, aufeinandergeschichteten Wulsten, die an Baumkuchen oder Stapel irdener Teller erinnerten. Es hätte Tori nicht verwundert, wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, die Gesichter verflossener französischer Präsidenten, Könige, Kaiser und Tyrannen in die Steinsäulen zu meißeln. De Gaulle, Napoleon, Robespierre und Ludwig XIV., der Sonnenkönig.
Die Straße wurde immer schmaler, bis sie nur noch einspurig verlief. An einer roten Ampel musste Tori stehen bleiben. Erst kamen ihr zwei Kleinbusse mit Fahrradanhängern entgegen, danach ein Motorradfahrer und schließlich lange gar nichts mehr, bis die Ampel endlich gelb blinkte und sie in den »Défilé de Ruoms« einfahren konnte. Der Tunnel wurde nach wenigen Metern zu einer halb offenen Galerie. Rechts nackter Felsen, links blickte man durch die Öffnungen in der Felswand auf den Fluss, in dem sich der blaue Himmel spiegelte.
Als Tori aus der Galerie herausfuhr, erfasste sie der Nordwind, der durch die Schlucht der Ardèche fauchte. Von der Brücke vor Ruoms aus blickte man auf einen wild schäumenden Fluss und die Überreste der alten Hängebrücke, die der von wochenlangen Regenfällen angeschwollene Fluss vor ein paar Jahren hinweggefegt hatte. Im Städtchen selbst war kein Tourist zu sehen, was ungewöhnlich war, normalerweise galten die Besucher dieser Gegend als wetterfest, die meisten waren schließlich wegen Aktivitäten hier, bei denen man frieren und nass werden konnte.
Jenseits vom Zufluss der Beaume und des Chassezac in die Ardèche begann der touristische Teil des wilden Südens. Campingplätze und Kanuverleihstationen säumten den Fluss bis Vallon Pont d’Arc. Richtung Gorge de l’Ardèche wurde die Straße wieder schmaler, links Felswand, rechts der breiter werdende Strom. Im Schatten des Felsens hätte Tori die Hugenottengrotte beinahe verpasst.
Der Fels öffnete sich wie in einen Empfangssaal. Links hinauf ging es zur Grotte, doch der Zugang war versperrt. Man hatte noch geschlossen, die angezeigten Führungen gab es nur in der Hochsaison. Rechts ging es einen Abhang hinunter, der unter der Straße hindurch zum sonnenbeschienenen Fluss führte. Obwohl ein verwittertes Schild davor warnte, stieg Tori hinab.
Sie setzte sich ans Ufer des Flusses und stellte sich vor, wie zu früheren Zeiten andere hier gesessen haben mochten: Menschen, die sich zu heimlichen Gottesdiensten trafen oder sich hier verstecken mussten. Hatten sie auf das andere Ufer geblickt und bang Ausschau gehalten nach den königlichen Soldaten? Hinter dem gegenüberliegenden Ufer erhob sich ein bewaldeter Bergrücken, unvorstellbar, dass durch dieses Gelände Truppen vorrücken konnten mitsamt Pferden und Kanonen. Der Ort kam ihr uneinnehmbar vor.
Was für ein Leben in solcher Abgeschiedenheit. Vielleicht vermisste man ja nichts, wenn man die ganze Zeit betete oder in der Bibel las. Doch Carls Vorfahren hatten nicht zu den passiven Duldern gehört, den Märtyrern, die sich für ihren Glauben zum Opfer brachten. Als man sie zwingen wollte, zum katholischen Glauben zu konvertieren, waren sie in den Untergrund gegangen. »Sie gehörten zu den Letzten, die Frankreich verließen«, hatte Carl erzählt. »Nach zwei Jahren Widerstand.«
Was für ein Leben in einer Welt voller Geheimnisse, Verbote und Verstecke, von der Carl erzählte: Die Bibel und das Gebetbuch landeten unter dem Holzfußboden, wenn Fremde sich näherten, und in vielen Häusern gab es eine doppelte Wand, hinter der sich Prediger und Rebellen verbergen konnten. Auch fehlten in keiner seiner Geschichten unterirdische Gänge, durch die in düsterer Nacht mit blakenden Fackeln die Gläubigen strömten, um sich zu geheimen Gottesdiensten in Steinbrüchen oder Höhlen zu treffen. Höhlen wie die Hugenottengrotte.
Sie ging zurück, stieg wieder ins Auto und folgte der Straße, die sich in weiten Bögen den Berg hinaufwand. Am Aussichtsplatz, von dem aus man auf den Pont d’Arc schaute, tat sie es den Touristen gleich, parkte, stieg aus und blickte auf die tief unter ihr mäandernde Ardèche, die sich in Millionen von Jahren durch den Felsen gefressen und ihn ausgehöhlt hatte, bis er sich wie eine Brücke über den Fluss spannte.
Schönheit war so schwer zu beschreiben – und so schwer festzuhalten, weshalb sie es gar nicht erst versuchte. Neben ihr stand ein junger Mann, der seine hübsche Frau mit dem Smartphone fotografierte, die Landschaft bloße Kulisse. Unten im Fluss drei Kanus, eines war gekentert und seine Insassen schwammen ans Ufer, während die in den beiden anderen Kanus dem umgekippten Boot hinterherjagten. Bienen taumelten um den Flor eines Weißdorns, daneben Palisaden-Wolfsmilch, die Blüten wie fragende Augen. Schrundige Kalksteinfelsen glühten rot und golden, sie sahen aus wie mit einem stumpfen Messer abgeschnitten, doch in der zerklüfteten Wand reihten sich weich ausgewaschene Nischen wie kleine Balkons aneinander.
Da hinaufzuklettern. Sich in einen der Balkons im warmen Felsen legen, windgeschützt in der Sonne. In den Himmel schauen, dem in der Thermik sich hinaufschraubenden Bussard hinterher. Den Blick wieder hinuntergleiten lassen zum Fluss, dessen tiefes Grün hier und da von Stromschnellen mit weißen Sahnehäubchen durchbrochen wurde. Und wieder hinauf zum Horizont.
Magie, oben, unten, überall. Wie konnte man angesichts dieses Naturschauspiels den Tag mit geschlossenen Augen verbringen, beim Beten, oder mit gesenktem Blick, beim Lesen? Doch sie hatten nicht nur gebetet, sie hatten sich nicht nur verkrochen, Carls Vorfahren. Sie hatten gekämpft. Wogegen? Die Antwort schien ihr klar – gegen die Obrigkeit im fernen Paris. Aber wofür? War ihr Glaube das wert gewesen?
Gedankenverloren ging sie zum Wagen zurück und fuhr wieder hinunter zur Brücke über den Ibie, einem weiteren Zufluss der Ardèche. Von hier aus ging ein Wanderweg hoch zur Grotte Chauvet. Sie parkte und zog Wanderstiefel und Windjacke an.
Der Weg führte steil hinauf, über Schotter und Steine, durch wucherndes Grün aus Wacholder, Buchs und grüner Eiche, dazwischen dicke Büschel blühender Thymian und zarte weiße Zistrosen. Es dauerte, bis sie so hoch oben war, dass sie das Panorama um sich herum erfassen konnte. Bewaldete Höhen und zerklüftete Felswände, dazwischen der Fluss, der sich um sandige Inseln wand, bis er sich durch das Tor des Pont d’Arc schlängelte.
Es gab keine gänzlich unberührte Natur, Menschen hatten sie geformt, nicht nur an der Oberfläche. Doch die Landschaft formte auch die Menschen. Tori versuchte, sich Carls Vorfahren vorzustellen, dachte an frühzeitig gealterte bärtige Männer und Frauen in langen grauen Kleidern mit Schürzen und Hauben, aber es wollte ihr nicht gelingen.
Die Stille währte nicht lange. Laute Stimmen und Geklapper kündigten einen Trupp Wanderer an, Frauen in Wanderstiefeln und mit Wanderstöcken vorweg, in ihrem Gefolge Männer mit voluminösen Rucksäcken. Wozu man Stöcke auf diesen ausgetretenen Pfaden benötigte, war Tori schleierhaft. Und was war wohl in den Rucksäcken? Hoffentlich alles, was man für ein ausgedehntes Picknick brauchte.
Tori grüßte und ließ den Trupp vorbeimarschieren. Dann schlug sie den Pfad ein, der dem Wegweiser zufolge zur Grotte Chauvet führte. Sie wusste, dass die Höhle nur noch für Wissenschaftler geöffnet wurde, doch es gab ein Museum, in dem man die Grotte mitsamt den Höhlenmalereien so originalgetreu wie möglich nachgebildet hatte, in weit kleinerer Form natürlich, genannt Caverne du Pont d’Arc.
Nach einer halben Stunde war sie dort. Die Anlage war, nach dem riesigen Parkplatz zu urteilen, offenbar für Hunderte von Touristen angelegt und das Restaurant konnte gewiss ganze Busladungen von Besuchern aufnehmen. Das Museum selbst sah aus wie eine zu einer Art Vase gefaltete Papiertüte aus Beton. Eigentlich war es ratsam, sich für einen Besuch vorher anzumelden, doch heute war der Andrang nicht allzu groß, weshalb sie eine Karte für eine schon in zwei Stunden beginnende Führung bekam.
Sie kaufte sich ein Heft über die Entdeckung der Grotte und setzte sich ins Café. Die Geschichte war so phantastisch, dass sie einen Moment lang all die Menschen verstehen konnte, die auf eine ähnliche Entdeckung hofften. Es war die Geschichte von Jean-Marie Chauvet, der im Alter von zwölf Jahren mit einem Wehrmachtshelm auf dem Kopf in seine erste Höhle stieg.
Jemand, der hier aufgewachsen war, nahe der bizarren und überwältigenden Landschaft des Kalkplateaus des Bas Vivarais, wusste natürlich, dass unter der Oberfläche noch eine andere Welt existierte. Es gab unzählige Höhlen, in manchen hatten in unvordenklichen Zeiten Menschen gewohnt, andere, in denen man neben Skeletten auch Grabbeigaben fand, Töpfe, Waffen, Schmuckstücke, hatten als Friedhof gedient. Viele standen unter Wasser – außer in den heißen Sommermonaten, in denen selbst die Ardèche nur ein trübes Rinnsal war. Andere wurden jahrhundertelang als Schafställe genutzt.
Doch Jean-Marie und seine Freunde entdeckten im Laufe der Jahre etwas für die Geschichte der Menschheit viel Wichtigeres, nämlich zwölf der 28 »Bilderhöhlen« in der Schlucht der Ardèche. Der Begriff Bilderhöhle war Tori neu, so nannte man offenbar alle Höhlen, in denen es steinzeitliche Malereien gab. Was die Höhlenforscher am 18. Dezember 1994 fanden, übertraf allerdings alle vorherigen Entdeckungen.
Die drei Freunde laufen auf einem Maultierpfad in der Nähe des Pont d’Arc auf halber Höhe am Felshang entlang. Alle drei wissen, dass nicht jedes Loch im Kalkstein eine Pforte zum Untergrund ist und nicht jeder Fuchsbau in eine Tropfsteinhöhle führt. Vor einer Öffnung im Felsen sagt ihnen ein Luftzug, dass hier mehr zu erwarten ist. Sie klettern hinein, räumen Geröll und Steine weg, spüren dem Luftzug hinterher, arbeiten sich Zentimeter für Zentimeter ins Unbekannte vor, rufen, hören ein Echo, das auf eine riesige Galerie schließen lässt … Der Rest ist Geschichte.
Keine Entdeckung war so großartig wie diese: In einer grandiosen Kathedrale im Untergrund sind bislang um die vierhundert Wandbilder gefunden worden, die meisten entstanden im Aurignacien, in der jüngeren Altsteinzeit, etwa 36000 Jahre vor unserer Zeitrechnung.
Der Kaffee, den Tori sich an der Selbstbedienungstheke geholt hatte, schmeckte nicht, sie ließ ihn kalt werden. Außerdem war die Zeit für den Rundgang durchs Museum gekommen.
Ihre Gruppe hatte sich bereits vor dem Eingang versammelt, im Gänsemarsch ging es hinein. Tori war auf Enttäuschungen gefasst: Wie konnte man das, was in der riesigen Höhle gefunden worden war, auf so kleinem Raum wiedergeben? Wie sollte man sich in den Anblick steinzeitlicher Malereien versenken können, wenn man nicht nur die Stimme der eigenen Begleiterin, sondern auch die der vorausgegangenen Gruppe hörte?
Sie versuchte, den Abstand zu ihrem Trupp ein wenig größer werden zu lassen. Wie beeindruckend musste der Anblick der unterirdischen Welt wohl für Jean-Marie Chauvet und seine Freunde gewesen sein, wenn selbst der Nachbau ihr den Atem nahm? An gelben Wänden in Rot und Schwarz die Umrisse von Mammuts und Bären, Pferden und Hirschen, Berglöwen und Nashörnern, oft den Wölbungen, Nischen und Spalten in den Felsen angepasst, dazwischen Zeichen, die sich der Broschüre zufolge niemand so recht erklären konnte, sowie die Abdrücke von Händen. Hände von Menschen, die vor Zehntausenden von Jahren hier gelebt und die Grotte zu einem magischen Ort gemacht hatten. Wollten sie mit dem Handabdruck ihre Malereien signieren? Oder, wie es in der Broschüre hieß, Kontakt aufnehmen mit dem Kraftfeld des Ortes?
Tori fühlte ein Prickeln in den Fingerspitzen, einen schier unwiderstehlichen Drang, sich ebenfalls mit diesem Kraftfeld zusammenzuschließen, nicht hier, natürlich nicht, anderswo, tief im Inneren des Felsens, unter der Erde, im Untergrund, es musste nicht die Grotte Chauvet sein. Ihr ganzer Körper schien sich zu sehnen nach der Verbindung mit einer ursprünglichen Kraft. War es das, was Höhlenforscher bewegte? Nicht nur die Suche nach Gold und Kohle, nicht bloß Entdeckerdrang, Abenteuerlust und Sensationsgier, sondern ebenso sehr der Wunsch nach einem magischen Bündnis mit dem Elementaren? Nach Verbindung über Jahrtausende hinweg? Der Wunsch nach Verbrüderung nicht nur mit den Ahnen, sondern mit der Erde selbst? War es das, was Menschen religiös werden ließ? Und war das gemeint mit der Suche nach dem Einhorn?
Sie spürte dem Gefühl nach, diesem leisen Schauer, diesem Moment der Ehrfurcht. Irgendetwas hatte sie berührt, hier, im profanen Nachbau einer womöglich heiligen Stätte.
Sie schloss zu ihrer Gruppe auf, die vor einer Wand stehen geblieben war, auf der in einer präzisen Zeichnung Löwen Bisons jagten, was man sogar ohne die Erläuterungen der Führerin erkennen konnte. Löwen am Rande der Cevennen? Mammuts? Dieses Damals war nicht bloß Vergangenheit, es war ein anderer Kontinent.
Tori verließ das Museum als Erste. Draußen hatte der Wind nachgelassen und die Sonne begann die kühle Luft zu erwärmen. Noch immer ein wenig betäubt von ihren Gefühlen, machte sie sich auf den Rückweg. Der Pfad war steil und steinig, ihre Knie schmerzten, als sie endlich unten angelangt war. Stöhnend ließ sie sich auf den Fahrersitz ihres Autos fallen, zog die schweren Wanderstiefel aus und streckte die Beine. Nach einer Atempause machte sie sich auf den Heimweg nach Belleville.
Sie hatte den Mikrowellenfraß verschmäht, den das Restaurant oben beim Museum anbot, doch mittlerweile knurrte ihr Magen derart, dass sie sich sogar mit einem Croque Monsieur zufriedengegeben hätte. Die Erlösung kam wenige Kilometer hinter dem Pont d’Arc. Fast hätte sie abrupt gebremst: Direkt neben der Straße mit Blick auf den Fluss sah man Menschen auf einer hölzernen Terrasse sitzen, vor ihnen Speisen und Getränke. Die Küche war gegenüber in einer Höhle in der Felswand untergebracht, der Kellner musste mit beladenem Tablett über die Straße laufen, was bei vermehrtem Verkehrsaufkommen spannend sein dürfte. Das war eine Kneipe genau nach ihrem Geschmack.
Tori genoss den kühlen Wein, als ob er ein guter Riesling wäre, und fiel ausgehungert über einen Teller Pommes mit Mayo her. Der Blick auf den Fluss entschädigte für alles, was die Küche zu wünschen übrig ließ.
Noch immer war sie überrascht von den Gefühlen, die der Besuch im Museum ausgelöst hatte. Die unterirdischen Kathedralen mussten imposanter als alles Menschenwerk sein, die Kirchenbauer späterer Zeiten hatten sie nur nachgeahmt. Was hatten die Steinzeitmenschen gespürt, wenn sie ihre Hände an die Wände legten, welchen Zauber sollten die Malereien bewirken, was wollten sie beschwören?
Leicht angeheitert fuhr sie nach Hause und parkte wie immer unten auf der Straße. Sie lauschte auf den Hund, aber nichts rührte sich hinter dem Gartenzaun. Sie wartete noch einen Moment, dann ging sie die schmale Gasse zwischen den Häusern hinauf zu ihrer Burg, in der sie sich vor der Welt verkriechen konnte, wenn ihr danach war.
Das Maison Sarrasine hatte etwas von einer Festung. Das Haus – oder die Häuser, aus denen es zusammengebacken war – schmiegte sich an einen Felsen, auf dessen höchstem Punkt die Kirche stand. Man betrat es nicht unten von der Straße her, dort gab es nur zwei Kellerräume, sondern über eine steile Treppe zwei Ebenen höher, durch ein massives Hoftor aus Holz, blassblau gestrichen, wie das Blau der Glyzinen. Das Tor öffnete sich auf einen kleinen Hof, nicht groß genug, um Garten genannt zu werden, in dem eine bejahrte Kletterrose wuchs, die sich an der Treppe entlang emporrankte. Von diesem Hof aus ging es geradeaus in ein langgestrecktes Gewölbe, links Kellerräume, rechts der nackte Fels, aus dem bei Regen das Wasser trat; Caves, wie es sie in jedem anständigen alten Haus hier in der Gegend gab, Kreuz- und Tonnengewölbe aus nacktem Stein, Katakomben und Grüfte, Lagerstätten für edle Weine, Refugien für Fledermäuse.
Im hintersten Teil des Gewölbes hatten Carl und sie im sandigen Boden den Kieferknochen eines Schafs gefunden, hier war wohl einst ein Stall gewesen. In einer rußgeschwärzten Nische wohnte eine Fledermauskolonie. Abends war Tori schon oft ein ganzer Schwarm geräuschlos entgegengeflattert, im Unterschied zu Carl liebte sie die winzigen Tiere mit den enormen Flügeln.
Rechts von Carls Werkstatt hatte der Fels ein Loch, eine beinahe mannshohe Öffnung, die tief in den Berg zu führen schien. Carl vermutete hier einen geheimen Gang, der bis hinauf zur Kirche verlief, aber keiner von ihnen hatte Lust verspürt, hineinzukriechen.
Der bewohnte Teil begann ein Stockwerk höher, vom Hof aus führte eine Treppe hinauf, erst auf eine überdachte Veranda, dann ins Esszimmer, von dem aus man auf eine große Terrasse gelangte. Die beiden Schlafzimmer und das Bad lagen wieder einen Stock höher.
Tori verriegelte das Hoftor und ging in den Keller, in dem zwei Kisten Sauvignon Blanc von der Cave de Lablachère standen. Eine Flasche nahm sie mit nach oben und stellte sie in den Kühlschrank. Nachdem sie heiß geduscht und sich warm angezogen hatte, würde der Wein richtig temperiert sein für einen Abend auf der Terrasse.
Der Himmel war noch immer klar, als sie wieder heruntergekommen, die Flasche geöffnet und sich ein Glas eingeschenkt hatte. Die Abendsonne vergoldete die Hügelkette am Horizont und die Mauersegler läuteten die letzte Runde ein. Bald würden die Fledermäuse sie ablösen.
Tori ließ sich in den Korbstuhl fallen und legte die Beine auf den Verandatisch. Blütendüfte aus den Gärten unterhalb ihres Hauses zogen zu ihr hoch und eine Nachtigall begann ihr Rufen nach einem paarungswilligen Partner. Der Wind hatte gedreht, nur noch ein laues Lüftchen zog über die Veranda. Langsam verging das Tageslicht zu einem rotgoldenen Schimmer. Hinten bei den Schrebergärten schrie der Esel des Schulhausmeisters den Mond an.
Ihre Gedanken kreisten um das Land der Vergangenheit, in dem Löwen und Mammuts über die Hügel zogen und Menschen in Höhlen hockten und Bildnisse und Zeichen an die Wände malten. Sie drifteten weiter, zu Carl, und mit einer Mischung aus Sehnsucht und Belustigung stellte sie sich vor, wie sie als Steinzeitmenschen in Bärenfelle gehüllt gemeinsam auf dem Berg säßen und dem Schwinden des Lichts zusahen.
Dann fielen ihr die Augen zu. Als sie aufschreckte, erwischte sie gerade noch den Zipfel eines Traums, bevor er sich auflöste.
Sie nahm einen letzten Schluck aus dem Glas und ging nach oben. Die Pfütze an der Schlafzimmertür war noch da, war aber kleiner geworden. Aufwischen? Morgen.
3
Das Tier hatte sich in sein Bein gekrallt und ihm die Zähne ins Fleisch geschlagen, es biss und riss und schlug mit scharfen Krallen zu, immer wieder, knurrend und grunzend. Aus der Ferne Schreie, die als Echo zurückkamen. Ein Chor von Schreien.
Ein Albtraum. Er musste aufwachen, sofort.
Er schlug die Augen auf und stierte in tiefste Schwärze. In seinem Bein brüllte der Schmerz, und aus seiner Kehle quälte sich ein dumpfer Laut. Er tastete nach dem Schalter der Lampe auf dem Nachttisch und griff in feuchtes Gestein. Er war aus dem Bett gefallen, das musste es sein. Er versuchte sich aufzurichten, während der Schmerz an ihm riss. Das war kein Tier. Aber was dann? Er konnte sein Bein nicht bewegen und seine Hand reichte nicht bis da hin, wo der Schmerz seinen heißen Kern hatte, der Lavaströme ausschickte.
Er war aus dem Bett gefallen und hatte sich am Bein verletzt. Das war es. Er lag auf dem kalten Steinfußboden, genau. Und er konnte nichts sehen, weil …
Weil. Er hielt sich die Hand vor die weit geöffneten Augen. Schmerz und Panik trieben ihm den Schweiß aus allen Poren. Er sah die Hand vor Augen nicht.
Jetzt erst nahm er ein Geräusch wahr, das nicht zu einem Schlafzimmer passte. Etwas plätscherte. Wasser, keine drei Meter von ihm entfernt. Er versuchte, seine Umgebung zu ertasten. Feuchter Stein, uneben. Er hob den Arm über seinen Kopf. Hinter ihm eine raue Felswand.
In diesem Moment wusste er, was geschehen war.
4
Vom Siebenuhrläuten der Kirche wachte Tori auf. Langschläfer fanden in Belleville kein Erbarmen. Sämtliche Hunde des Dorfes heulten mit, sich gegenseitig übertreffend, immer lauter und inbrünstiger, bis zum letzten Glockenton. Dann herrschte wieder Stille.
Tori blinzelte schlaftrunken durchs Schlafzimmerfenster. Der Himmel war wolkenlos und blankgeputzt. Sie drehte sich auf die Seite und wartete auf all die anderen vertrauten Morgengeräusche. Der Hahn vom Hühnerstall am gegenüberliegenden Hang krähte pflichtbewusst seine Hennen zusammen. Minuten später dumpfe Schläge aus dem Keller des Nachbarhauses: Hugo fertigte mit der Axt feine Holzscheite für den Küchenherd seiner Frau. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er sein antikes Moped sattelte und zur Bar knatterte, auf einen kleinen Schwarzen mit Schuss.
Vom Kirchturm läutete es wieder, diesmal nicht mit dem jubelnden Crescendo des Morgenläutens. Einem einsamen Ton folgte ein tieferer, der eine Weile stehen blieb und ausatmete, bis der erste Ton wieder übernahm. Es klang wie ein Bedauern, das Totenläuten.
Wieder einer weniger. Die alten Menschen starben weg, wenn auch die meisten von ihnen erst im hohen Alter. Ganz allmählich wurden sie seltener, die gutgeschminkten resoluten Frauen, die beim Metzger ewig lange über das beste Stück Fleisch für dieses oder jenes Gericht fachsimpelten. Die feinen und weniger feinen alten Herren mit den blitzenden Brombeeraugen unter der keck schräg getragenen Baskenmütze. Menschen, die wussten, wie man Feuer macht, Gänse rupft und Kaninchen ausnimmt.
Doch vielleicht wuchsen sie ja nach? Auf den Märkten wurden die Männer in den Baskenmützen immer jünger, aber sie hatten bereits die roten Nasen und schrundigen Hände ihrer Väter. Nein, nicht alles starb aus.
Mit diesem tröstlichen Gedanken beschloss Tori, aufzustehen. Und war heute nicht Mittwoch? Dann war Markt in Joyeuse. Der war Pflicht.
Als sie aus der Dusche kam und in die Jeans stieg, merkte sie, wie recht Eva gehabt hatte. Sie war schon wieder dünner geworden, die Hose hing auf ihren Hüftknochen, und wenn sie nicht aufpasste, würde sie ihr in einem unbedachten Moment herunterrutschen, am besten, natürlich, vor Publikum.
Sie lief die Treppe hinunter, griff nach Portemonnaie und Hausschlüssel auf der Anrichte, zog das Jackett an und nahm den Einkaufskorb vom Haken. Auf dem Weg zum Auto hörte sie den Hund Laut geben, doch er war sofort still, als sie am Zaun vorbeiging. »Bonjour, mon ami«, flüsterte sie.
Den Besitzern des Tieres begegnete sie selten. Er war ein kleiner runder Mann mit dunklem Schnurrbart und dunklen Locken, der sie nie grüßte und immer mürrisch wirkte. Sie blieb unsichtbar, ebenso die Kinder. Man hörte sie höchstens, aber man sah sie nicht, Bastmatten hinter dem Zaun schützten den Hof vor Blicken. In seiner Garage und auf der Straße flickte der Mann bei gutem Wetter die Autos der Kumpane, die alle so ähnlich aussahen wie er und kein Französisch sprachen, jedenfalls keins, das Tori verstand. Seinen Hund rief er mit einem langgezogenen »I« zur Ordnung, gefolgt von ein, zwei Konsonanten. Es klang nicht wie ein Name, eher wie eine Verwünschung.
Algerier? Marokkaner? Egal, auch die meisten französischen Alteingesessenen behandelten ihre Hunde schlecht, sie benutzten sie zum Jagen und ließen sie in der restlichen Zeit in stinkenden Zwingern hocken, wo sie jeden, der vorbeikam, sehnsüchtig anjaulten.
Tori ließ die Fenster herunter und genoss die Sonne auf dem Gesicht, während sie nach Joyeuse fuhr. Nur, wenn sie nicht einkaufen musste, nahm sie für die sechs Kilometer das Rad. Die Beaume wälzte sich braun aufgeschäumt unter der Brücke hinter Rosières in Richtung Ruoms, wo sie sich mit der Ardèche zusammentat, die sich nach etwa hundert Kilometern in den Rhône ergoss, der bei Arles ins Mittelmeer mündete. Normalerweise war das Wasser der Beaume klar, in heißen Sommern blieb von ihr allerdings oft nur ein Rinnsal. Heute jedoch, nach all den Regentagen, spielte sich der Fluss als Wildwasser auf und schäumte sogar über die Felseninseln, auf denen man sonst trockenen Fußes ans andere Ufer gelangte. Die Gärten der Anwohner waren überflutet, der große Baum auf einem Fels in der Flussmitte stand bis zur Krone im Wasser.
In Joyeuse fuhr sie von der Hauptstraße ab an den Fluss und parkte ihr Auto an der Uferstraße. Von dort ging es zum Markt auf dem großen Platz unter den Platanen. Am ersten Stand verkaufte ein Gärtner Gemüsepflanzen und Blütenstauden, es duftete nach Flieder und Jasmin. Hinter ihm reihten sich die Stände mit Fisch, Obst und Gemüse, mit Käse, Hühnern und Kaninchen, mit Gewürzen, Honig und Marmelade, Pesto, Schinken und Würsten. Der Duft vom Stand mit den Grillhähnchen vermischte sich mit dem scharfen Geruch von Knoblauch und altem Ziegenkäse, Kopfnote: Zimt und Curry.
Hinter einem Café zweigte eine Gasse ab, in der es nach Lavendel roch, dort gab es Stände mit Seife und Spielzeug, mit geflochtenen Körben, indischen Schals und bunten Kleidern. Zwei weitere Cafés lagen einander schräg gegenüber: Chez Marie-Theres hieß das eine, Café De La Grand Font das andere.