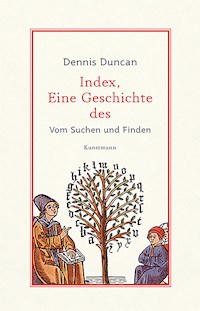
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Index, eine Geschichte des« ist eines der seltenen Beispiele fröhlicher, lebenszugewandter Wissenschaft, ein Buch der Bücher, voller Entdeckungen, die man in einem Register zuletzt vermutet hätte. Die meisten von uns machen sich kaum Gedanken über den Anhang eines Buchs. Aber hier versteckt sich vor unseren Augen ein unerschöpfliches Reich von Ehrgeiz, von Obsession, Streit, Politik, Vergnügen und Spiel. Hier können wir »Metzger, die wir meiden sollten« finden, oder »Kühe, die Feuer scheißen« und sogar »Calvin, mit einer Nonne in seiner Kammer« erwischen. Das Register ist ein unbesungenes, außergewöhnliches Alltagswerkzeug, eine geheime Welt mit einer ruhmreichen, kaum bekannten Vergangenheit. Dennis Duncan erkundet das Register in den Klöstern und Universitäten vom Europa des 13. Jahrhunderts bis in die Gegenwart des Silicon Valley und zeigt, wie durch den Index Ketzer vor dem Scheiterhaufen gerettet, Politiker von hohen Ämtern abgehalten und wir alle zu den Leser:innen gemacht wurden, die wir heute sind. Wir folgen dem Autor in Druckereien, in Kaffeehäuser, in die Wohnzimmer von Schriftstellern und in die Labore der Wissenschaft, begegnen auf diesem Weg Kaisern und Päpsten, Philosophen und Ministerpräsidenten, Dichtern, Bibliothekaren und natürlich Indexern. Und wir erfahren, welch bedeutende Rolle das Register in der sich entwickelnden literarischen Kultur gespielt hat. Duncan macht klar, dass wir alle auch im Zeitalter der Internet-Suche im Grunde noch immer am Register hängen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DENNIS DUNCAN
Index,eine Geschichte des
VOM SUCHEN UND FINDEN
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer
Verlag Antje Kunstmann
Für Mia und Molly
INHALT
Einführung
1Das Ordnungsprinzip. Über die alphabetische Anordnung
2Die Geburten des Registers. Predigen und Lehren
3Wo wären wir ohne sie? Das Wunder der Seitenzahl
4Karte oder Gebiet. Das Register vor Gericht
5»Lasst keinen verdammten Tory das Register zu meiner History machen«. Kämpfe in Büchern
6Register zu Belletristik. Benennen war schon immer eine schwierige Kunst
7»Ein Schlüssel zu sämtlichem Wissen«. Das Universalregister
8Ludmilla und Lotaria. Das Buchregister im Zeitalter der Suche
Coda. Archive der Lektüre
Danksagung
Anmerkungen
Verzeichnis der Abbildungen
Ein computergeneriertes Register
Register
EINFÜHRUNG
»Ich für meinen Teil verehre den Erfinder der Register … jenen unbekannten Literaturarbeiter, der als Erster die Nerven und Arterien eines Buchs offengelegt hat.«
ISAAC D’ISRAELI, Literary Miscellanies
Man kann sich schwer vorstellen, mit Büchern zu arbeiten – einen Essay zu schreiben, einen Vortrag, einen Bericht, eine Predigt –, ohne in der Lage zu sein, schnell und leicht zu finden, was man sucht: ohne, nun ja, die Hilfe eines guten Registers. Die Hilfe beschränkt sich natürlich nicht auf Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Schreiben verdienen. Sie erstreckt sich auch auf andere Disziplinen, in den Alltag, und einige der frühesten Register finden wir in Gesetzeswerken, medizinischen Texten und Rezeptbüchern. Das bescheidene Register hinten in einem Buch ist jedoch eine der Erfindungen, die so erfolgreich sind, so sehr zu unserem alltäglichen Leben gehören, dass sie beinahe unsichtbar werden. Wie jede Technologie hat das Register eine Geschichte, und diese Geschichte war fast 800 Jahre lang eng mit einer bestimmten Form von Buch verknüpft, dem Kodex: einem Stapel Blätter, die gefaltet und am Rücken gebunden werden. Inzwischen ist das Register in der digitalen Ära angekommen und unterstützt uns beim Online-Lesen. Die erste Website war schließlich ein Sachregister.1 Mit Blick auf Suchmaschinen, die so oft der Ausgangspunkt unserer Wanderungen durch das Internet sind, hat Matt Cutts, Ingenieur bei Google, gesagt: »Als Erstes muss man begreifen, dass man, wenn man eine Google-Suche startet, nicht wirklich das Internet durchsucht. Man durchsucht Googles Register des Internets.«2 Heute organisiert das Register unser aller Leben, und dieses Buch zeichnet seinen wundersamen Weg von den Klöstern und Universitäten im Europa des 13. Jahrhunderts bis in die aus Glas und Stahl errichteten Firmensitze im Silicon Valley des 21. Jahrhunderts nach.
Eine Geschichte des Registers ist tatsächlich eine Geschichte über Zeit und Wissen und die Beziehung zwischen beiden. Es ist eine Geschichte unseres wachsenden Verlangens nach schnellem Zugang zu Informationen und des parallelen Verlangens, die Inhalte eines Buchs sollten teilbare, einzelne, eigenständig herauslösbare Wissenseinheiten sein. Das ist Informationswissenschaft, und das Register ist ein fundamentales Element der Architektur dieser Disziplin. Aber die Entwicklung des Registers präsentiert uns auch eine Geschichte des Lesens im Kleinen. Sie ist mit dem Aufstieg der Universitäten und der Erfindung des Buchdrucks verbunden, mit der Philologie der Aufklärung und mit der Lochkartentechnologie, dem Aufkommen der Seitenzahl und des Hashtags. Das Register ist mehr als einfach eine Datenstruktur. Selbst heute, angesichts des Vormarsches der künstlichen Intelligenz, werden Register für Bücher immer noch hauptsächlich von Menschen aus Fleisch und Blut gemacht, Profis auf ihrem Gebiet, deren Aufgabe es ist, zwischen dem Autor und dem Publikum zu vermitteln. Als Produkte menschlicher Arbeitskraft hatten Register Konsequenzen für Menschen, sie haben Häretiker vor dem Scheiterhaufen bewahrt und Politiker von hohen Ämtern ferngehalten. Außerdem haben sie natürlicherweise Personen mit einem besonderen Interesse an Büchern angezogen, und so werden auf unserer Liste der literarischen Registermacher und -macherinnen Lewis Carroll, Virginia Woolf, Alexander Pope und Vladimir Nabokov stehen. Die Zusammenstellung von Registern gehörte im Lauf der Geschichte nicht eben zu den glanzvollsten und lukrativsten beruflichen Tätigkeiten. In dem Zusammenhang fällt uns vielleicht Thomas Macaulays Klage ein, dass Samuel Johnson, der berühmteste Schriftsteller seiner Zeit, gleichwohl seine Tage mit »hungernden Flugblattschreibern und Registermachern«3 verbracht habe. Wenn Johnson es denn gewusst hätte, hätte er sich mit dem Gedanken trösten können, dass er im Kreis der Registermacher auch von den größten Schriftstellern früherer Zeiten umgeben gewesen wäre und dass die so sehr unterschätzte Technik, mit der sie hantierten, beim Anbruch des nächsten Jahrtausends entscheidende Bedeutung für das Leseerlebnis haben würde.
Was meinen wir, wenn wir von Register oder Index sprechen? Im allgemeinsten Sinn ist es ein System, das uns Zeit sparen helfen soll, weil es angibt, wo wir nach etwas suchen müssen. Der Begriff Index deutet auf eine räumliche Beziehung hin, eine Art von Karte: Etwas direkt vor uns weist auf etwas anderes hin, »indiziert« es. Diese Karte muss es nicht unbedingt greifbar geben, es genügt, dass sie in unseren Köpfen existiert. Mitte des letzten Jahrhunderts schrieb Robert Collison, immer wenn wir die Welt um uns herum so organisierten, dass wir Dinge wiederfinden könnten, erstellten wir tatsächlich einen Index oder ein Register. Er bringt ein paar Beispiele, die so perfekt in die Fünfzigerjahre passen wie Schuhe mit Kreppsohlen:
Wenn eine Hausfrau jedem Ding in der Küche seinen Platz gibt, macht sie einen lebendigen Index, denn nicht nur sie selbst, sondern alle Mitglieder ihres Haushalts werden sich nach und nach an das System gewöhnen, das sie ersonnen hat, und so die Dinge selbst finden können … Ein Mann wird sich angewöhnen, Kleingeld immer in die eine Tasche zu stecken und Schlüssel in die andere, die Zigarettenschachtel in eine dritte – eine elementare Gewohnheit des Indexierens, die ihm gute Dienste leistet, wenn er in Eile ist und sich auf dem Weg zum Bahnhof vergewissert, ob er seine Monatskarte dabeihat.4
Ein Index im Kopf: So finden Frauen den Zucker und Männer ihre Zigarettenschachteln. Von der prägnanten Formulierung einmal abgesehen, weist Collison hier auf einen wichtigen Punkt hin. Die Karte der Küche funktioniert nicht nur für die Hausfrau, sondern für »alle Mitglieder ihres Haushalts«, sie existiert in mehreren Köpfen. Was wäre, wenn jemand sie aufschreiben würde: »Mehl: oberstes Schrankfach rechts; Löffel: in der Schublade neben dem Kühlschrank« und so weiter? Dann hätten wir ein System, das sich sofort verwenden ließe, auf Anhieb, auch von einer Person, die in der Küche fremd wäre. Damit kommen wir dem näher, was wir uns vermutlich unter einem Index oder Register vorstellen, etwas, das nicht nur im Kopf existiert – eine Art Liste oder Tabelle, die uns sagt, wo verschiedene Dinge sind. Vermutlich erwarten wir eine Abkürzung. Eine Karte, die größer ist als das Gebiet, ist absurd, das Gleiche gilt für ein Register. Ein Bibliothekskatalog – in Kapitel 1 werden wir sehen, dass Bibliothekskataloge eine wesentliche Rolle in der Informationswissenschaft gespielt haben – wird die Bücher auf ihre hervorstechendsten Merkmale reduzieren: Titel, Autor, Genre. Genauso destilliert ein Register hinten im Buch das Werk zu einer Sammlung von Schlüsselwörtern: Namen, Orte, Begriffe. Also geht es um Abstraktion: das Material reduzieren, es zusammenfassen, um etwas Neues und Eigenständiges zu schaffen. Das Register ist keine Kopie des Gegenstands.
Was ist es dann? Wie Collison sagt, haben die meisten von uns den Grundriss einer Küche im Kopf. Wenn Sie aufschreiben müssten, was sich in Ihrer Küche befindet, wie lang würde Ihre Inventarliste werden? Wohl so, dass sie noch überschaubar wäre. Aber wie steht es mit einer umfangreicheren Liste? Zum Beispiel aller Gegenstände in Ihrem Haus? Aller Bücher in einer Bibliothek? Wenn die Liste eine bestimmte Länge erreicht, wird sie unhandlich: Es ist nicht mehr einfacher, die Liste zu durchsuchen, als die Regale zu durchsuchen. Wir brauchen eine Gliederung. Das Register muss so geordnet sein, dass die Nutzer die Ordnung erkennen, dass sie ihnen erleichtert, sich zurechtzufinden. Darin unterscheidet sich das Register vom Inhaltsverzeichnis.
Samuel Johnsons Dictionary ist hier eher nicht hilfreich. Es definiert Register als »das Inhaltsverzeichnis eines Buchs«, und auf den ersten Blick haben beide viel gemeinsam. Beides sind Listen von Bezeichnungen mit Stellenangaben, das heißt Seitenzahlen (aber wie wir sehen werden, hat die Seitenzahl ihre eigene Geschichte, und andere Arten von Positionsangaben – Kapitel in der Bibel beispielsweise – sind älter). Beide verweisen auf Stellen oder Abschnitte des Haupttextes, und im späten Mittelalter gab es sogar die gleichen Namen dafür – Register, Verzeichnis, Rubrik –, sodass man sie ohne genaueres Hinsehen nicht unterscheiden konnte. Als Chaucers Ritter rundweg ablehnt, darüber zu spekulieren, was einer Figur in seiner Erzählung nach dem Tod passiert ist – »drum nicht erraten kann ich’s noch erzählen / Ich führe kein Register über Seelen« (mit anderen Worten: Ich weiß nichts darüber, in meinem Register gibt es keinen Eintrag für Seelen) –, können wir nicht genau sagen, was für eine Art Liste er im Sinn hat. Dennoch sind Inhaltsverzeichnis und Register sehr unterschiedliche Teile eines Buchs – Teile, die in den Haupttext hineinreichen, einer vor dem Haupttext, der andere dahinter – mit jeweils eigener Funktion und Geschichte.
Selbst ohne Stellenangaben bietet das Inhaltsverzeichnis einen Überblick über die Struktur eines Werks: Es folgt der Anordnung des Textes und macht dessen Architektur erkennbar. Wir werfen einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis und können daraus einigermaßen zuverlässig schließen, um was es in dem Buch geht. Bis zu einem gewissen Grad ist ein Inhaltsverzeichnis deshalb nicht von einer bestimmten Plattform abhängig. Es ermöglicht eine grobe Orientierung selbst in einem Werk, das aus mehreren Buchrollen besteht – und tatsächlich reicht die Geschichte des Inhaltsverzeichnisses bis in die Antike zurück, in die Zeit, bevor es geheftete oder gebundene Bücher gab. Wir wissen von mindestens vier lateinischen Autoren und einem griechischen aus der klassischen Zeit, die ihre Werke mit Inhaltsverzeichnissen ausstatteten.5 Nehmen wir zum Beispiel Plinius den Älteren, den großen römischen Naturforscher, der sein Hauptwerk Naturkunde mit folgenden Worten Kaiser Titus widmete:
Da ich auf Deine durch den Dienst am Allgemeinwohl beschränkte Arbeitszeit Rücksicht nehmen mußte, habe ich Inhaltsangaben zu den einzelnen Büchern diesem Briefe beigeschlossen und mich mit der größten Sorgfalt bemüht, Dir die Lektüre zu ersparen. Dadurch verschaffst Du auch anderen die Annehmlichkeit, nicht das Ganze lesen zu müssen, sondern jeder, der etwas will, braucht nur darin nachzuschlagen, um dann sofort zu wissen, wo er es finden kann.6
Oder mit anderen Worten ausgedrückt: »Weil du so beschäftigt und so wichtig bist, weiß ich, dass du nicht das ganze Werk wirst lesen wollen. Deshalb habe ich ein handliches Verzeichnis beigefügt, sodass du dir einen Überblick verschaffen und dann die Kapitel herauspicken kannst, die dich interessieren.«
Ein umfangreiches Werk wie die Naturkunde musste aus vielen Rollen bestehen, womöglich Dutzenden. Wenn man einen bestimmten Teil des Werks suchte, musste man zuerst die richtige Rolle ausfindig machen, sie dann auf einen Tisch legen und sorgfältig bis zu dem gewünschten Abschnitt ausrollen. Das war kein unvorstellbar mühsamer Vorgang, sofern man wirklich beim gewünschten Abschnitt ankam. Durch Kapitel ist das Werk immerhin so weit unterteilt, dass sich die Mühe des Suchens lohnt. Aber erlauben wir uns kurz eine anachronistische Fantasie: Stellen wir uns vor, Plinius hätte zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis auch eine neue Funktion in sein Buch integriert, eine Innovation, die aus einem anderen Zeitalter 1000 Jahre später zu ihm gekommen wäre, etwas, das Plinius, ohne recht zu wissen warum, »Register« genannt hätte. Stellen wir uns weiter vor, dass Titus einmal spät am Abend hätte nachschauen wollen, was in der Naturkunde über einen seiner Vorgänger auf dem Thron, Kaiser Nero, den Mörder von Titus’ bestem Freund aus Kindertagen, geschrieben stand. (Im modernen Webjargon haben wir ein Wort für diese Art spätabendlicher Lektüre: doomscrolling, die Suche nach negativen Meldungen.) Bei Kerzenschein entrollt unser kaiserlicher Leser Plinius’ Register. In der Naturkunde wird Nero sechsmal erwähnt: dreimal in Buch VIII, einmal in Buch X, zwei weitere Male in Buch XI. Titus schreibt sich die Stellen auf, und nachdem er die Buchrolle gefunden hat, die Buch VIII enthält, verbringt er eine Ewigkeit damit, nach der ersten Erwähnung Neros zu suchen, einer beiläufigen Bemerkung über eine geringfügige architektonische Veränderung am Circus Maximus, die Nero in Auftrag gegeben hatte. Wieder wird eine Rolle ausgerollt und aufgerollt, aber die zweite Erwähnung ist noch beiläufiger und hat mit Titus’ Anliegen noch weniger zu tun. Es geht um das treue Heulen eines Hundes, der verzweifelt ist, weil Nero seinen Herrn hinrichten ließ. Titus stöhnt auf. Langsam frustriert ihn die Sache. Die Bilanz von Aufwand und Lohn, zwischen der mit Aus- und Aufrollen und der mit Lesen verbrachten Zeit, fällt nicht günstig aus. Er überprüft die dritte Stellenangabe, aber mehrere Minuten später weiß er lediglich, dass sein Vorgänger einmal 4 Millionen Sesterzen für wollene Bettdecken ausgegeben hat. Der Kaiser erlaubt sich ein kurzes Lächeln und geht dann unzufrieden zu Bett. Es ist leicht nachzuvollziehen, warum das Register eine Erfindung des Zeitalters der Kodexe, der gebundenen Bücher, und nicht des Zeitalters der Buchrollen ist. Es ist eine Technologie des Direktzugriffs, und als solche setzt es eine Form des Buchs voraus, das gleichermaßen mühelos in der Mitte, am Ende oder am Anfang aufgeschlagen werden kann. Der Kodex ist das Medium, bei dem ein Register zum ersten Mal sinnvoll war.
Darüber hinaus ist ein Register ohne Stellenangaben anders als ein Inhaltsverzeichnis in etwa so nützlich wie ein Fahrrad ohne Räder. Damit lässt sich nicht abschätzen, wo ungefähr man das Buch öffnen soll, und es stellt nicht grob die Argumentationslinie vor. Denn der wichtigste Mechanismus des Registers ist die Willkür. Die Hauptneuerung besteht darin, dass der Zusammenhang zwischen der Struktur des Werks und der Struktur der Liste aufgelöst wird. Die Ordnung eines Registers orientiert sich am Leser und nicht am Text: Wenn man weiß, wonach man sucht, bieten die Buchstaben des Alphabets ein universelles, textunabhängiges System, um es nachzuschlagen. (Wir könnten sogar sagen, dass die meisten Register doppelt willkürlich sind, weil die häufigste Stellenangabe – die Seitenanzahl – keine intrinsische Beziehung zu dem Werk oder seinem Gegenstand hat, sondern nur eine Beziehung zu dem Medium, dem Buch.)
Im vorliegenden Buch kommt das Inhaltsverzeichnis hin und wieder ins Spiel, aber es handelt vom Register, von der alphabetischen Liste, die ein Buch auf seine Bestandteile herunterbricht, seine Personen, seine Themen, sogar die einzelnen Wörter. Es ist ein technisches Werk – eine Zugabe –, das dazu dienen soll, eine bestimmte Art des Lesens zu beschleunigen, die im Jargon von Wissenschaftlern »Extraktlesen« heißt, gedacht für all jene von uns, die wie Kaiser Titus nicht die Zeit haben, mit der Lektüre am Anfang zu beginnen.
Zu der vertrackten Frage des Plurals – verwenden wir bei Index die anglisierte Form Indexe oder die lateinische Form Indizes – hat der große viktorianische Bibliograph Henry Wheatley in seinem Buch What is an Index? (1878) auf Shakespeares Troilus und Cressida verwiesen, wo von Indexen die Rede ist. Wenn die anglisierte Form für Shakespeare gut genug ist, so Wheatley, wird sie auch gut genug für uns sein, und in diesem Buch folge ich ihm. Indizes sind für Mathematiker und Ökonomen, Indexe finden wir hinten in Büchern.
Als ich begann, an der Universität englische Literatur zu lehren, fing ein Kurs typischerweise so an:
ICH: Schlagen Sie bitte Seite einhundertachtundzwanzig von Mrs. Dalloway auf.
STUDENTIN A: Welche Seite ist das in der Wordsworth-Ausgabe?
STUDENT B: Welche Seite ist das in der Penguin-Ausgabe?
STUDENTIN C (hält ein Buch in die Höhe: Mitte des Jahrhunderts, Hardcover, kein Umschlag): Ich weiß nicht, welche Ausgabe ich habe – das Buch gehört meiner Mutter. Welches Kapitel ist es?
Nach ein paar Minuten, in denen wir über Kapitel und Abschnitte das Ziel fanden, waren wir alle bereit, eine bestimmte Passage zu analysieren. Diese Prozedur wiederholte sich in jedem Kurs noch ein paarmal. Vor etwa sieben Jahren bemerkte ich jedoch, dass sich etwas veränderte. Ich bat immer noch, dass alle sich eine bestimmte Stelle in einem Roman anschauen sollten. Ich nannte immer noch, eher mit Hoffnung als mit Erwartung, die Seitenzahl der vorgeschriebenen Ausgabe. Immer noch gingen sofort etliche Hände in die Höhe. Aber inzwischen lautete die Frage anders: »Wie fängt der Abschnitt an?« Viele Studierende lasen jetzt auf digitalen Geräten – auf Kindles, auf iPads, manche auf ihren Smartphones –, und diese Geräte verwendeten keine Seitenzahlen, sondern hatten eine Suchfunktion. In vergangenen Zeiten lieferte eine besondere Form des Registers, die Konkordanz, eine alphabetische Liste aller Wörter in einem bestimmten Text – in Shakespeares Werken zum Beispiel oder in der Bibel – und aller Stellen, an denen sie vorkamen. In meinen Kursen fiel mir auf, dass sich die Macht der Konkordanz unendlich ausgedehnt hatte. Die Digitalisierung bedeutete, dass die Möglichkeit, nach einem bestimmten Wort oder einem bestimmten Satz zu suchen, nicht länger an ein einzelnes Werk geknüpft war, mittlerweile gehörte sie zur Software-Ausstattung eines eReaders. Was immer jemand liest, man kann jederzeit Strg+F drücken, wenn man etwas sucht: »Einer der Triumphe der Zivilisation, dachte Peter Walsh.«
Zugleich hat die Allgegenwart von Suchmaschinen die verbreitete Befürchtung entstehen lassen, die Suche könnte zu einer Geisteshaltung geworden sein, einer Form des Lesens und Lernens, die die alten Formen nach und nach ersetzen und dabei jede Menge schrecklicher Übel mit sich bringen werde. Man sagt uns, sie verändere unsere Gehirne, verkürze unsere Aufmerksamkeitsspannen und höhle unser Erinnerungsvermögen aus. In der Literatur hat der Romanautor Will Self erklärt, der ernsthafte Roman sei tot: Wir hätten nicht mehr die Geduld dafür.7 Wir lebten im Zeitalter der Zerstreuung, und daran sei die Suchmaschine schuld. Vor ein paar Jahren wurde in einem aufsehenerregenden Artikel in der Zeitschrift The Atlantic die Frage gestellt: »Macht Google uns dumm?« Die Antwort war ein nachdrückliches Ja.8
Aber aus langfristiger Perspektive ist das nichts anderes als ein aktueller Ausbruch eines alten Fiebers. Die Geschichte des Registers ist voll von solchen Befürchtungen: dass niemand mehr richtig lesen wird, dass Extraktlesen die längerfristige Beschäftigung mit Büchern ablösen wird, dass wir neue Fragen stellen und neue Formen des Forschens praktizieren und die alten Formen des gründlichen Lesens vergessen werden, dass wir beklagenswert und unheilbar unaufmerksam werden – und all das wegen dieses infernalischen Werkzeugs, des Buchregisters. In der Zeit der Stuart-Restauration wurde in England die abwertende Bezeichnung index-raker (Indexharker) geprägt für Schriftsteller, die ihre Werke mit überflüssigen Zitaten aufblähten. Und auf dem europäischen Kontinent grummelte Galileo über die Philosophen auf ihren Lehnstühlen, die, »um Kenntnisse von Naturerscheinungen sich anzueignen, sich ins Studierzimmer zurückziehen, Indices und Lexica durchblättern, um nachzusehen, ob Aristoteles nichts darüber gesagt hat«.9 Seit dem 17. Jahrhundert gilt: Das Buchregister tötet die experimentelle Neugier.
Und dennoch ist uns vier Jahrhunderte später der Himmel immer noch nicht auf den Kopf gefallen. Das Register hat überdauert und mit ihm Leser, Wissenschaftler, Erfinder. Die Art, wie wir lesen (wir sollten eher sagen, die Arten, wie wir lesen, denn jeder und jede liest jeden Tag auf unterschiedliche Arten; Romane, Zeitungen, Speisekarten, Straßenschilder – alle verlangen unterschiedliche Formen der Aufmerksamkeit von uns), ist vielleicht nicht mehr die gleiche wie vor zwanzig Jahren. Aber vor zwanzig Jahren haben wir auch anders gelesen als, sagen wir, in der Generation von Virginia Woolf oder in einer Familie im 18. Jahrhundert oder während der ersten Blütezeit der Druckerpresse. Für Lesen gibt es kein platonisches Ideal (und wie wir sehen werden, war Lesen für Platon alles andere als ideal). Was wir als eine normale Praxis betrachten, war immer die Reaktion auf ein Konglomerat historischer Umstände, und jede Veränderung der gesellschaftlichen und technologischen Umwelt wirkte sich darauf aus, was »Lesen« bedeutete. Sich als Lesende nicht weiterzuentwickeln – zu wünschen, dass wir als Gesellschaft immer noch gewohnheitsmäßig mit der gleichen Versunkenheit lesen wie beispielsweise die Bewohner eines Klosters im 11. Jahrhundert, abgeschnitten von der Gesellschaft mit einer Bibliothek von einem halben Dutzend Bänden, ist genauso absurd, wie wenn wir uns darüber beklagen würden, ein Schmetterling sei nicht schön genug. Der Schmetterling ist so, weil er sich perfekt an seine Umwelt angepasst hat.
Die vorliegende Geschichte des Buchregisters wird also mehr leisten, als nur die schrittweisen Verbesserungen dieser scheinbar harmlosen Technik für den Umgang mit Texten nachzuerzählen. Sie wird zeigen, wie das Register auf andere Veränderungen im Ökosystem Lesen reagierte – die Verbreitung des Romans, der Unterhaltungszeitschrift, der wissenschaftlichen Zeitschrift – und wie die Lesenden und das Lesen sich jeweils verändert haben. Und sie wird zeigen, wie oft dem Register die Schuld für die Ängste derjenigen zugewiesen wurde, die die jeweils vorangehenden Formen des Lesens praktizierten. Sie wird das Schicksal von zwei Arten des Registers nachzeichnen, des Wortregisters (auch bekannt als Konkordanz) und des Sachregisters. Während Ersteres dem Text, dem es dient, in unverbrüchlicher Treue verbunden ist, schwankt Letzteres in seiner Loyalität zwischen dem Werk und der Gemeinschaft der Lesenden, die es benutzen werden. Beide sind zum selben Zeitpunkt im Mittelalter entstanden. Das Sachregister hat danach stetig an Statur gewonnen, sodass sich Mitte des 19. Jahrhunderts Lord Campbell damit brüsten konnte, er habe versucht, für alle neuen Bücher Register gesetzlich verpflichtend zu machen.10 Die Konkordanz hingegen blieb den Großteil des letzten Jahrtausends ein Werkzeug für Spezialisten und gelangte erst mit dem Aufkommen der modernen Computer zu neuem Ansehen. Doch sosehr wir uns heute auf digitale Suchwerkzeuge, auf Suchleisten und die Tastenkombination Strg+F verlassen – ich hoffe, das vorliegende Buch wird zeigen, dass das alte Sachregister am Ende eines Buchs, erstellt von Registermacherinnen und -machern, die höchst lebendig sind, immer noch sehr viel Leben enthält – genau das also: Leben. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, und bevor wir nun ernsthaft beginnen, will ich mit zwei Beispielen die Unterscheidung, die ich gerade darzulegen versucht habe, illustrieren.
Im März 1543 stürmte die geistliche Obrigkeit Heinrichs VIII. das Haus von John Marbeck, Domkapellmeister an der St. George’s Chapel in Windsor. Marbeck wurde vorgeworfen, eine religiöse Abhandlung des französischen Theologen Johannes Calvin kopiert zu haben. Damit hatte er gegen ein kürzlich erlassenes Gesetz gegen Häresie verstoßen. Als Strafe stand darauf der Tod auf dem Scheiterhaufen. Eine Durchsuchung von Marbecks Haus förderte Beweise für weitere fragwürdige Umtriebe zutage, handgeschriebene Blätter, die von einem gewaltigen und außergewöhnlichen literarischen Unterfangen zeugten. Marbeck hatte an einer Konkordanz der englischen Bibel gearbeitet und war ungefähr zur Hälfte fertig. Gerade einmal fünf Jahre zuvor war eine in Englisch verfasste Bibel noch verbotene Ware gewesen, und die Übersetzer kamen auf den Scheiterhaufen. Marbecks Konkordanz sah verdächtig aus, genau die Art unerlaubter Lektüre, die die Übersetzung der heiligen Schriften zu einer so umstrittenen Angelegenheit gemacht hatte. Die unerlaubte Abhandlung war sein ursprüngliches Verbrechen gewesen, aber nun geriet die Konkordanz ins Visier und war, wie Marbeck schrieb, »nicht eines der geringsten Dinge … das die Ursache meiner Schwierigkeiten vergrößerte«.11 Er wurde ins Gefängnis Marshalsea gebracht und sollte dort hingerichtet werden.
In Marshalsea wurde Marbeck verhört. Die Würdenträger wussten von einer calvinistischen Sekte in Windsor und hielten Marbeck für eine nicht sehr bedeutende Figur, jemanden, der unter Druck Namen nennen könnte. Für Marbeck war das eine Chance, seine Unschuld zu beteuern. Das Statut, das die calvinistische Abhandlung verbot, war erst vier Jahre zuvor, 1539, Gesetz geworden. Aber, so beteuerte Marbeck, er habe die Kopie vor diesem Datum verfasst. In dem Fall war die Verteidigung einfach. Die Konkordanz stellte ein größeres Problem dar. Marbeck war von glühender Frömmigkeit erfüllt und studierte eifrig die Schriften, aber er war auch Autodidakt. Er besaß keine tiefer gehenden Kenntnisse in Latein, sondern hatte gerade genug gelernt, um sich in einer lateinischen Konkordanz zurechtzufinden, die er nach den Stellenangaben durchforstete, den Fundstellen für die einzelnen Wörter. Die schlug er dann in einer englischen Bibel nach, und auf diese Weise trug er seine englische Konkordanz zusammen. Den Männern, die Marbeck verhörten, erschien es unvorstellbar, dass er mit zwei Sprachen arbeitete, von denen er keine fließend beherrschte. Ein theologisches Projekt wie dieses konnte gewiss nicht das Werk eines einzelnen Amateurs sein, der zwar Hingabe mitbrachte, aber zu wenig Bildung dafür besaß. Bestimmt war Marbeck nur der Kopist und bekam Anweisungen von anderen, war der Handlanger einer größeren Gruppe. Bestimmt steckte hinter der Konkordanz eine geheime Absicht, eine häretische Auswahl oder Neuübersetzung von Begriffen, etwas ganz anderes als die harmlose, rein technische Übertragung, von der Marbeck sprach.
Ein Bericht über das Verhör, der vermutlich direkt von Marbeck stammt, findet sich in John Foxes Actes and Monuments (1570). Der Ankläger ist hier Stephen Gardiner, der Bischof von Winchester:
Welche Helfer hattest du bei deiner Arbeit an dem Buch?
Verzeihung, mein Herr, sagte er, keine.
Keine, sagte der Bischof, wie kann das sein? Es ist nicht möglich, dass du es ohne Hilfe getan haben sollst.
Wahrhaftig, mein Herr, sagte er, ich kann nicht sagen, wie Ihr es versteht, aber wie es auch sei, ich werde nicht abstreiten, dass ich es ohne die Hilfe eines Menschen und allein mit der Hilfe Gottes getan habe.12
Die Befragung geht in dieser Weise weiter, und auch andere erheben Vorwürfe:
Dann sagte der Bischof von Salisbury, wessen Hilfe hattest du bei der Verfassung dieses Buchs?
Wahrhaftig, mein Herr, sagte er, ganz und gar keine Hilfe.
Wie konntest du, sagte der Bischof, ein solches Buch ersinnen oder wissen, was eine Konkordanz ist, ohne jemanden, der dich angeleitet hat?
Bei allem Zweifel schwingt auch eine seltsame Form von Bewunderung mit. Als der Bischof von Salisbury einige Blätter der verdächtigen Konkordanz hervorholt, untersucht sie einer der anderen Inquisitoren und bemerkt: »Dieser Mann hat besser gearbeitet als die meisten unserer Priester.«
Und jetzt spielt Marbeck seine Trumpfkarte aus. Er bittet die versammelten Bischöfe, ihn auf die Probe zu stellen. Wie sie alle wussten, war die Konkordanz erst bis zum Buchstaben L gekommen, bevor man Marbeck festgenommen und seine Papiere beschlagnahmt hatte. Wenn nun die Inquisitoren einige Wörter weiter hinten im Alphabet auswählten und Marbeck in der Lage wäre, die Einträge dafür zusammenzustellen – ganz allein in seiner Gefängniszelle –, dann könnte er damit beweisen, dass er absolut in der Lage war, ohne Hilfe von anderen zu arbeiten. Die Würdenträger stimmten zu. Marbeck wurde eine Liste von Registerbegriffen übergeben, dazu eine englische Bibel, eine lateinische Konkordanz und Schreibutensilien. Am nächsten Tag hatte er die Aufgabe triumphal gelöst.13
Marbeck wurde vergeben, aber die Entwürfe seiner Konkordanz vernichtete man. Unschuldig und unbeirrt machte er sich jedoch erneut an die Arbeit, und sieben Jahre nach seiner Verhaftung konnte er das Werk in den Druck geben, ohne dass weitere Einwände erhoben wurden. Sein Vorwort klingt dennoch sehr vorsichtig. Er bekräftigt, dass er die »gänzlich erlaubte Übersetzung« verwendet habe, weshalb keinerlei häretische Gedanken eingeflossen sein könnten. Außerdem erklärt er, er habe »nicht ein Wort der allerheiligsten Bibel verändert oder hinzugefügt«. Nichts hinzugefügt, nichts verändert und nichts neu übersetzt. Marbeck lebte noch weitere vier Jahrzehnte, ein Organist und Komponist, der sein Leben der Tatsache verdankte, dass seine Konkordanz nur das und nichts anderes war: eine vollständige Liste von Wörtern und ihren Fundstellen, ohne jegliche Interpretation und darum ohne Häresie.
Werfen wir als Kontrast einen kurzen Blick auf die letzten Seiten eines Geschichtswerks aus dem späten 19. Jahrhundert. Sein Autor ist J. Horace Round, und sein Titel lautet Feudal England. Ein Großteil von Rounds Untersuchung besteht darin, dass er sich bemüht, zu korrigieren, was er als die wissenschaftlichen Fehler von Edward Augustus Freeman betrachtet, Lehrstuhlinhaber für Neuzeitliche Geschichte in Oxford. Freeman wird zu Rounds Zielscheibe, Round macht ihn für eine wichtige Fehlentwicklung in der Erforschung des Mittelalters verantwortlich. Auf den 600 Seiten seines Werks bleibt die Feindseligkeit jedoch vage. Schließlich ist das feudale England Thema seines Buchs und nicht Edward Freeman. Im Register lässt er jedoch die Samthandschuhe fallen:
Freeman, Professor: nicht vertraut mit den Inq. Com. Cant. 4; kennt die Geldrolle von Northamptonshire nicht 149; verwechselt die Inquisitio geldi 149; seine verachtungsvolle Kritik 150, 337, 385, 434, 454; wann er sich irrt 151; sein Vorwurf gegen den Eroberer 152, 573; über Hugh d’Envermeu 159; über Hereward 160–4; seine »sichere« Geschichte 323, 433; seine »unbestrittene Geschichte« 162, 476; seine »Fakten« 436; über Hemings’ Kartular 169; über Mr. Waters 190; über die Einführung feudaler Lehen 227–31, 260, 267–72, 301, 306; über die Knight’s fee 234; über Ranulf Flambard 228; über die Aussagekraft des Domesday [Book] 229–31; unterschätzt den feudalen Einfluss 247, 536–8; über Schildgeld 268; übersieht Worcester Relief 308; beeinflusst von Wörtern und Namen 317, 338; über die Normannen unter Edward 318 ff.; seine Einseitigkeit 319, 394–7; über Richards Schloss 320 ff.; verwechselt Personen 323–4, 386, 473; seine Annahmen 323; über den Namen Alfred 327; über den Sheriff Thorold 328–9; über die Schlacht von Hastings 332 ff.; seine Pedanterie 334–9; seine »Palisade« 340 ff., 354, 370, 372, 387, 391, 401; macht Fehler in Latein 343, 436; seine Verwendung von Wace 344–7, 348, 352, 355, 375; über William of Malmesbury 346, 410–14, 440; seine Worte widerlegt 347, 393; über den Teppich von Bayeux 348–51; erfindet Dinge 352, 370, 387, 432; seine angebliche Genauigkeit 353, 354, 384, 436–7, 440, 446, 448; hat recht in Bezug auf den Schildwall 354–8; seine Mutmaßungen 359, 362, 366, 375, 378–9, 380, 387, 433–6, 456, 462; seine Theorie über Harolds Niederlage 360, 380–1; seine verworrenen Ansichten 364–5, 403, 439, 446, 448; seine Neigung zu Dramatik 365–6; geht Schwierigkeiten aus dem Weg 373, 454; sein Umgang mit Autoritäten 376–7, 449-51; über die Entsetzung von Arques 384; versteht Taktik falsch 381–3, 387; über Walter Giffard 385–6; sein Scheitern 388; seine besondere Schwäche 388, 391; seine grandiose Erzählung 389, 393; seine homerische Macht 391; über Harold und sein Feldzeichen 403–4; über Wace 404–6, 409; über Regenbald 425; über Earl Ralk 428; über William Malet 430; über die Grafschaften des Eroberers 439; seine Fehler und Irrtümer im Zusammenhang mit dem Domesday Book 151, 425, 438, 436–7, 445–8, 463; über die »Civic League« 433–5; seine wilden Spekulationen 438; sein besonderes Interesse an Exeter 431; über Legenden 441; über Thierry 451, 458; seine Methode 454–5; über Lisois 460; über Stigand 461; über Walter Tirel 476–7; über das Handeln des heiligen Hugo von Lincoln [1197] 528; über die Winchester Assembly 535–8; verfälscht den Feudalismus 537; über den Hof des Königs 538; über Richards Wechsel des Siegels 540; über die Kritikwürdigkeit seines Werks, xi., 353.14
Einen umfassenderen und vernichtenderen Angriff kann man sich kaum vorstellen, trotzdem ist es schwer, nicht davon amüsiert zu sein – von der Hartnäckigkeit, der obsessiven Intensität. Man kann die ironischen Anführungszeichen – »seine ›sichere‹ Geschichte … seine ›unbestrittene‹ Geschichte … seine ›Fakten‹« – kaum anschauen, ohne sich vorzustellen, wie er die Begriffe ausspricht, wie er das Register laut vorträgt mit von Sarkasmus triefender Stimme. Das ist das Sachregister in seiner extremsten Form, so weit wie nur möglich von der Konkordanz entfernt. Rounds Methode ist das komplette Gegenteil zu Marbecks akribischer Neutralität: Sie ist durch und durch persönlich, durch und durch Interpretation. Während Marbecks Konkordanz auf Vollständigkeit bedacht war, war Rounds Register einseitig. Man kann vollkommen zu Recht sagen, dass John Marbeck sein Leben dem Unterschied zwischen einer Konkordanz und einem Sachregister verdankte.
Aber Rounds Register ist ein Kuriosum, ein Ausreißer. Ein gutes Sachregister ist zwar unvermeidlich von der Persönlichkeit des Registermachers oder der Registermacherin geprägt – von seinen oder ihren Erkenntnissen und Entscheidungen –, aber auf eine sehr viel diskretere Weise. Wie bei einem Schauspieler ist es selten ein gutes Zeichen, wenn der gewöhnliche Zuschauer merkt, was alles in die Vorstellung eingeflossen ist. Das ideale Register nimmt vorweg, wie ein Buch gelesen, wie es verwendet werden wird, und stellt ruhig, klug eine Karte dafür zur Verfügung. Die vorliegende Geschichte des Registers wird unter anderem, so hoffe ich, eine Verteidigung des bescheidenen Sachregisters ergeben, das durch den digitalen Avatar der Konkordanz, die Suchleiste, unter Druck geraten ist. Wie es der Zufall will, sind die Konkordanz und das Sachregister um dieselbe Zeit entstanden, vielleicht sogar im selben Jahr. Beide begleiten uns mittlerweile seit fast acht Jahrhunderten. Beide sind immer noch lebendig.
1DAS ORDNUNGSPRINZIP
Über die alphabetische Anordnung
»(Stoop) if you are abcedminded, to this claybook, what curios of sings (please stoop), in this allaphbed.«
JAMES JOYCE, Finnegans Wake*
Im Sommer 1977 erschien im Literaturmagazin Bananas eine Kurzgeschichte des britischen Science-Fiction-Autors J. G. Ballard mit dem Titel »Der Index«. Die Geschichte beginnt mit einer kurzen Anmerkung des Herausgebers:
Aus zahlreichen internen Beweisen geht hervor, daß es sich bei dem nachfolgend abgedruckten Text um den Index der unveröffentlichten und möglicherweise unterdrückten Autobiographie eines Mannes handelt, den man durchaus zu den bemerkenswertesten Gestalten des zwanzigsten Jahrhunderts zählen kann … Er verbrachte seine letzten Lebensjahre vermutlich als Insasse einer nicht näher bezeichneten staatlichen Institution, wo er seine Autobiographie verfaßte, deren einziges erhaltenes Fragment dieser Index ist.1
Der Rest der Geschichte – Aufstieg und Fall eines gewissen Henry Rhodes Hamilton – besteht aus einem alphabetischen Register, aus dem sich der Leser allein anhand von Stichwörtern, kurzen Untereinträgen und den Anhaltspunkten für eine zeitliche Abfolge, die sich aus den Seitenzahlen ergeben, eine Geschichte zusammensetzen muss. Dieses indirekte Vorgehen liefert reichlich Gelegenheiten für ironischen Euphemismus. So bleibt es uns beispielsweise überlassen, ausgehend von diesen nicht aufeinanderfolgenden Einträgen Vermutungen über Hamiltons wahre Herkunft anzustellen:
Avignon, Geburtsort von HRH, 9–13.
George V., heimlicher Besuch in Chatsworth, 3, 4–6; Gerüchte über eine Affäre mit Mrs. Alexander Hamilton, 7; unterdrückt Hofnachrichten, 9.
Hamilton, Alexander, Britischer Konsul, Marseille … Depression nach der Geburt von HRH, 6; überraschend nach London zurückberufen, 12; erster Nervenzusammenbruch, 16; Versetzung nach Tsingtao, 43.
Aus weiteren Einträgen geht hervor, dass Henry Rhodes Hamilton zu den größten Alphamännern des 20. Jahrhunderts gehört haben muss:
D-Day, HRH geht am Juno Beach an Land, 223; wird ausgezeichnet, 242.
Hamilton, Marcelline (ehemals Marcelline Renault), verläßt Ehemann, den Industriellen, 177; begleitet HRH nach Angkor, 189; heiratet HRH, 191.
Hemingway, Ernest … porträtiert HRH in Der alte Mann und das Meer, 453.
Inchon, Korea, HRH als Beobachter bei der Landung mit Gen. MacArthur, 348.
Jesus Christus, Malraux vergleicht HRH mit, 476.
Nobelpreis, HRH nominiert für, 220, 267, 342, 375, 459, 611.
Unterdessen deutet das Muster der Einträge, die auf Staatsmänner und Religionsführer verweisen – anfängliche Freundschaften, gefolgt von Zerwürfnissen –, auf die klarste Linie der Geschichte hin, nämlich jene, die von Hamiltons Größenwahn handelt und seinem Wunsch, die Welt zu erobern:
CHURCHILL, WINSTON, Unterhaltungen mit HRH, 221; in Chequers mit HRH, 235; Rückenmarksschröpfung, durchgeführt von HRH, 247; auf Yalta mit HRH, 298; »Eiserner Vorhang«-Rede in Fulton, Missouri, von HRH vorgeschlagen, 312; greift HRH in öffentlicher Debatte an, 367.
DALAI LAMA, gewährt HRH Audienz, 321; unterstützt HRH’s Initiative bei Mao Tse-tung, 325; weigert sich, HRH zu empfangen, 381.
GANDHI, MAHATMA, wird von HRH im Gefängnis besucht, 251; unterhält sich mit HRH über die Bhagavadgita, 253; läßt sich von HRH Lendentuch waschen, 254; denunziert HRH, 256.
PAUL VI., PAPST, preist die Bewegung »Perfect Light«, 462; empfängt HRH, 464; wird von HRH angegriffen, 471; mißbilligt messianische Anmaßungen von HRH, 487; kritisiert das von HRH in Avignon wiederbelebte Anti-Papsttum, 498; exkommuniziert HRH, 533.
Bei der Geschichte von Hamiltons Fall zieht Ballard das Erzähltempo an, indem er die Ereignisse den letzten Buchstaben des Alphabets zuordnet. HRH begründet eine Religion, das Perfect Light Movement, das ihn zum Gott proklamiert und die UN-Versammlung unter seine Kontrolle bringt, wo er zum Weltkrieg gegen die USA und die UdSSR aufruft. Hamilton wird festgenommen und ins Gefängnis geworfen, aber verschwindet dann. Gleichzeitig stellt der Lord Chancellor Fragen zu seiner wahren Identität. Die letzten Einträge betreffen den mysteriösen Verfasser des Index: »Zielinski, Bronislaw, schlägt HRH vor, seine Autobiographie zu schreiben, 742; wird beauftragt, den Index zu erstellen, 748; warnt vor Bestrebungen, die Autobiographie zu unterdrücken, 752; verschwindet, 761.«
Ballards Einfall mit »Der Index« ist ziemlich brillant. Trotzdem erfasst er auf einer wichtigen Ebene nicht ganz, was ein Index wirklich ist, vielleicht geht das in einer unterhaltsamen Erzählung auch gar nicht. Ballard weiß genau, dass wir seinen Index von vorne bis hinten – von A bis Z – lesen werden, und so knüpft er seine Geschichte, wenn auch lose, an die Ordnung des Alphabets, das erste Ordnungssystem des Registers. Stichwörter vom Anfang des Alphabets berichten von HRHs frühen Jahren, seine Hybris wird pathologisch zwischen P und T, die wohlverdiente Strafe ereilt ihn zwischen W und Y. Zwei getrennte Ordnungssysteme, das alphabetische und das chronologische, sind hier weitgehend kongruent: Form und Inhalt des Registers decken sich mehr oder weniger. Aber darum geht es bei Registern gerade nicht.
Wenn wir das Register verstehen wollen, müssen wir in seine Vorgeschichte eintauchen, um ein Gefühl zu bekommen, was für ein seltsames, wundersames Ding die alphabetische Ordnung tatsächlich ist: etwas, das wir für selbstverständlich halten, das aber vor mittlerweile 2000 Jahren auf einmal aufgetaucht ist; etwas, das wir jeden Tag verwenden, das aber eine so große Zivilisation wie das Römische Reich mit ihrem Verwaltungsapparat komplett ignorieren konnte. Während wir diese seltsame Kluft noch ganz frisch vor Augen haben, beginnen wir mit unserer Geschichte nicht in Griechenland oder Rom, sondern in New York, und nicht in der Antike, sondern näher an unserer Zeit.
Am 10. April 1917 öffnete die Society of Independent Artists, die Gesellschaft der Unabhängigen Künstler, im Grand Central Palace an der Ecke Lexington und 46. Straße die Türen zu ihrer ersten Jahresausstellung. Genau wie ihr Vorbild, der Salon des Indépendants in Frankreich, der selbst wiederum eine Reaktion auf den strengen Traditionalismus der Französischen Akademie gewesen war, stand auch die Ausstellung der Unabhängigen in New York allen Interessierten offen. Es gab keine Jury, die eine Auswahl traf, und keine Preise. Die treibende Kraft bei den Independent Artists war Marcel Duchamp, der fünf Jahre zuvor sein Gemälde Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2 in Paris gezeigt (und nach Schmähungen wieder abgehängt) hatte.
Bei der Hängung führten die New Yorker Ausstellungsmacher eine Neuerung ein, die es bei dem französischen Vorläufer nicht gegeben hatte – ein Ansatz, der, wie Duchamps Freund Henri-Pierre Roché es ausdrückte, »zum ersten Mal überhaupt in einer Ausstellung« ausprobiert wurde: Die Werke sollten in alphabetischer Ordnung nach den Nachnamen der Künstler gezeigt werden.2 Im Ausstellungskatalog werden die Gründe dafür erläutert:
Die Anordnung aller Ausstellungsobjekte nach dem Alphabet, unabhängig von Stil und Medium, wurde gewählt, um das individuelle Exponat von der Kontrolle durch rein persönliche Urteile zu befreien, die unvermeidlich die Grundlage für jedes System der Gruppenbildung sind.3
Beatrice Wood, die für die Hängung verantwortlich war, schildert leicht chaotische Vorgänge, als am Tag vor Ausstellungseröffnung immer wieder Bilder außerhalb der Reihenfolge auftauchten und an ihren rechtmäßigen Platz geschleppt werden mussten:
Und dann das Durcheinander, wenn man versuchte, vierhundert Mal hintereinander das Alphabet richtig aufzusagen! Es war recht einfach, bis wir zu den Schmidts kamen – insgesamt acht an der Zahl. Aber kaum hatten wir beschlossen, dass sie alle an eine Stelle gehörten, da brachte sie jemand an eine andere, und eine Stunde lang verwandelte sich jedes Bild, das wir hin- und hertrugen, in einen Schmidt. Mit einem Seufzer zog ich Leinwände in schweren Rahmen über den Boden.4
Abbildung 1: Auf der Titelseite des Katalogs zur Ausstellung der Independent Artists werden drei einzigartige Besonderheiten angekündigt: »Keine Jury. Keine Preise. Hängung in alphabetischer Reihenfolge.«
Eine alphabetische Ausstellung. Es ist nicht schwer, die dahinterstehende Logik nachzuvollziehen: Jede ausstellende Person hat das Recht, einen Platz zu kaufen (»gegen Zahlung einer sehr geringen Summe«), um dort auszustellen, ohne sich von den Organisatoren der Ausstellung beurteilen – fördern, mit anderen zusammenfassen, verstecken – lassen zu müssen. Das Alphabet ist ein großer Gleichmacher: Seine Ordnung bedeutet nichts darüber hinaus. Aber was ist mit den Betrachtenden? Was ist mit uns als potenziellen Besuchern der Ausstellung? Was ist mit Kuratierung, mit der Vorstellung, dass eine intrinsische Organisation – durch Stil, Thema, Größe – zu einem kohärenten Seherlebnis führen und darum für den Kunden, der mehrere Hundert Werke betrachtet, befriedigender sein wird?
Hundert Jahre später können wir mit Fug und Recht sagen, dass die alphabetisch geordnete Ausstellung sich nicht durchgesetzt hat. Warum nicht? Wie wirkt die Idee heute auf uns? Als faul? Als alberne Spielerei? Vielleicht – und das ist meine Antwort aus dem Bauch heraus – als interessant, aber naiv, ein Ansatz, der zu bereitwillig die Tatsache ausblendet, dass in einer Sammlung von Kunstwerken Verbindungen bestehen werden; dass es Gruppen geben wird, deren Mitglieder wechselseitig Bedeutung füreinander haben; dass eine einfühlsame Anordnung etwas über die Sammlung mitteilen kann auf einer Ebene, die größer ist als die individuelle Einheit. Genau aus diesem Grund haben Galerien Kuratoren.
Falls etwas davon überzeugend klingt, vermittelt es uns vielleicht ein Gefühl, warum die alphabetische Ordnung im frühen Mittelalter zwar nicht unbekannt, aber extrem selten war. Wie die Mittelalterhistoriker Mary und Richard Rouse schreiben: »Das Mittelalter mochte die alphabetische Ordnung nicht, weil sie als die Antithese zur Vernunft erschien.« Den gleichen Widerwillen, den bei uns eine Ausstellung weckt, deren Hängung beliebig ist, einer zusammenhanglosen Abfolge überlassen wurde, verspürten die mittelalterlichen Gelehrten, wenn sie erwogen, wie Ideen in ihren Büchern geordnet werden sollten:
Gott hatte ein harmonisches Universum geschaffen, in dem alle Teile miteinander verbunden waren; Aufgabe der Gelehrten war es, diese rationalen Verbindungen zu erkennen – Verbindungen von Hierarchie, Chronologie, von Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit etc. – und sie in der Struktur ihrer Schriften widerzuspiegeln. Die alphabetische Ordnung bedeutete, dass sie sich dieser Aufgabe entzogen.5
Die Rouses meinen, dass es sogar die tiefere Angst gegeben haben könnte, das Aufgeben der Suche nach einer inneren Ordnung könnte bedeuten, dass eine solche Ordnung gar nicht existierte: »Bewusst die alphabetische Ordnung anzuwenden lief auf die stillschweigende Anerkennung hinaus, dass jeder Mensch, der ein Werk benutzte, es in eine persönliche Ordnung bringen konnte, die sich von den Ordnungen anderer und sogar von der des Autors unterschied.«
Heute können wir uns vielleicht nicht für eine alphabetische Kunstausstellung erwärmen, aber in anderen Zusammenhängen verwenden wir die alphabetische Ordnung durchaus gerne. Als Schulkinder werden unsere Namen jeden Morgen in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen; wenn wir älter sind, scrollen wir ohne groß nachzudenken durch die Kontaktlisten auf unseren Handys. Was könnte praktischer sein? Und wenn wir die Namen der Toten auf einem Gedenkstein sehen, kommt uns natürlich nicht in den Sinn, dass ihre Opfer dadurch geschmälert werden, dass ihrer in alphabetischer Reihenfolge gedacht wird. Beinahe ohne darüber nachzudenken wissen wir, wie wir eine Tabelle zu enutzen haben, bei der die alphabetische Reihenfolge das einzige Organisationskriterium ist (wie in den alten örtlichen Telefonbüchern) oder mit einer anderen spezialisierten oder kontextspezifischen Kategorisierung verbunden wird (wie in den alten Gelben Seiten, wo die Einträge erst nach Branche und dann innerhalb der Branche alphabetisch geordnet waren). Dieses System ist uns durch und durch vertraut, es ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, wir haben es so früh gelernt, dass es beinahe selbstverständlich erscheint. Können Sie sich erinnern, wann man Ihnen zum ersten Mal gezeigt hat, wie man etwas in einem Wörterbuch nachschlägt? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ich bin nicht einmal sicher, dass es überhaupt so passiert ist, dass ich es nicht einfach selbst herausgefunden habe. Und dennoch müssen wir alle diese Lektion gelernt haben, eine Lektion, die nicht immer als selbstverständlich angesehen wurde.
Im Jahr 1604 veröffentlichte Robert Cawdrey ein Werk, das gemeinhin als das erste englische Wörterbuch gilt. Wie bei vielen Büchern der damaligen Zeit mag uns heute der volle Titel, so wie er auf der ersten Seite steht, als außergewöhnlich lang und detailliert erscheinen:
Ein alphabetisches Verzeichnis (A Table Alphabeticall), welches die richtigen Schreibweisen enthält und lehrt und das Verständnis schwieriger englischer Wörter, die aus dem Hebräischen, Griechischen, Lateinischen oder Französischen etc. übernommen wurden. Mit Erläuterungen in einfachen englischen Wörtern, gesammelt zum Nutzen von Frauenzimmern, Damen oder anderen Personen mit geringen Fertigkeiten. Wodurch sie viele schwierige englische Wörter leichter und besser verstehen können, die sie in Schriften oder Predigten oder anderswo hören oder lesen, und darüber hinaus in die Lage versetzt werden, sie selbst treffend zu gebrauchen.
Hier gibt es viel Bemerkenswertes, nicht zuletzt die wenig charmante Wendung »Frauenzimmer, Damen oder andere Personen mit geringen Fertigkeiten«. Aber wenigstens erkennen wir, worum es Cawdrey im Kern geht: Das Buch soll Definitionen für Lehnwörter liefern, die im Englischen verwendet werden, aber »aus dem Hebräischen, Griechischen, Lateinischen oder Französischen etc. übernommen wurden«. Das Buch ist für Leser und Leserinnen, die nicht den Vorteil haben, in diesen Sprachen unterrichtet worden zu sein, sodass sie diese Wörter verstehen, wenn sie in englischen Büchern auftauchen. Obwohl die meisten Wissenschaftler heute von Cawdreys Table Alphabeticall sprechen, hat die Abkürzung des Titels in dieser Weise den merkwürdigen Effekt, dass wir erfahren, wie das Buch zusammengestellt ist, und nicht, was es enthält.
Angesichts der Tatsache, dass das Werk sich selbst zuerst und vor allem als eine alphabetische Liste vorstellt, ist man überrascht über die langatmige Erklärung auf den ersten Seiten, wie das Buch verwendet werden soll:
Wenn Ihr (geneigter Leser) wünschen solltet, dieses Verzeichnis und dergleichen richtig und leicht zu verstehen und Nutzen daraus zu ziehen, dann müsst Ihr das Alphabet erlernen, um die Reihenfolge der Buchstaben, in welcher sie stehen, ohne Buch einwandfrei zu erkennen und zu wissen, wo jeder Buchstabe hingehört: so wie (b) nahe dem Anfang, (n) ungefähr in der Mitte und (t) gegen das Ende hin. Wenn nun das Wort, das Ihr zu finden wünscht, mit einem (a) beginnt, dann schaut am Anfang dieser Liste, wenn es aber mit (v) beginnt, so schaut am Ende. Und ebenso, wenn das Wort mit (ca) beginnt, schaut am Anfang des Buchstaben (c), aber wenn es (cu) ist, dann schaut gegen das Ende jenes Buchstabens. Und so weiter für den ganzen Rest etc.6
Was wir hier vor uns haben, ist eine Unterweisung über die Verwendung eines alphabetischen Verzeichnisses, die die Grundprinzipien erläutert: Erstens, geneigter Leser, musst du das Alphabet lernen – wirklich lernen –, damit du es »ohne Buch« im Kopf hast. Es ist geradezu schockierend, zu erfahren, was für »geringe Fertigkeiten« Cawdrey bei seiner Leserschaft erwartet! Er erklärt etwas, das für moderne Leser selbstverständlich ist: dass es einen räumlichen Zusammenhang zwischen dem Alphabet und dem Buch gibt, sodass Einträge, die mit Buchstaben aus dem vorderen Teil des Alphabets beginnen, auch nahe dem Anfang des Buchs gefunden werden können. Darüber hinaus ist diese alphabetische Anordnung in sich gestaffelt, das heißt capable erscheint vor culpable, denn beide Wörter beginnen mit c, aber a kommt vor u, und so weiter.
Tatsächlich war Cawdreys alphabetische Anordnung 1604 gar keine neue Erfindung. Das gilt auch für seine Gebrauchsanweisung, ähnliche, wenngleich nicht ganz so bevormundende Anweisungen finden sich auch am Anfang der lateinischen Wörterbücher des Lombarden Papias (um 1050) und von Giovanni Balbi (1286).7 All diese Beispiele belegen jedoch, dass die alphabetische Ordnung nicht intuitiv war. Die Reihenfolge der Buchstaben zu nehmen, mit denen wir unsere Wörter zusammensetzen, und sie dafür zu verwenden, etwas ganz anderes zu ordnen – Bücher in einer Bibliothek, Bilder in einer Ausstellung, Klempner im Umkreis des eigenen Wohnorts –, stellt eine außerordentliche Leistung der Vorstellungskraft dar. Es ist ein Schritt in die Willkür, der die intrinsischen Eigenschaften des Materials, das geordnet werden soll, hinter sich lässt, der Schritt vom Inhalt zur Form, von der Bedeutung zur Schreibung.
Die Reihenfolge der Buchstaben des Alphabets gab es schon lange, bevor sie zu Verwaltungszwecken genutzt wurde. Tontafeln, die man in Nordsyrien gefunden hat, zeigen, dass die Reihenfolge der Buchstaben des Alphabets, das in der Stadt Ugarit verwendet wurde, um die Mitte des 2. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung festgelegt wurde.8 Die Tafeln sind Abecedaria, das heißt einfach Reihen von Buchstaben, die hintereinander geschrieben wurden, wahrscheinlich als Hilfe für Menschen, die lesen und schreiben lernen wollten, so wie viele Kinder in Großbritannien und Amerika heute die Buchstaben des Alphabets erlernen, indem sie sie nacheinander zur Melodie von »Twinkle Twinkle Little Star« singen.
Abbildung 2: Eine Tontafel aus dem 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zeigt die Reihenfolge der Buchstaben des ugaritischen Alphabets.
Ugarit war eine Keilschrift, ihre Buchstaben wurden gebildet, indem man einen keilförmigen Schilfrohrgriffel in weichen Ton drückte. Die Anordnung der Laute spiegelt jedoch ein anderes Alphabet wider, das Alphabet der Phönizier, das die uns besser vertraute Linearschrift verwendete. Und diese Reihenfolge durchzieht auch das hebräische, das griechische und letztlich das lateinische Alphabet.
Das früheste bekannte hebräische Abecedarium ist eine Inschrift, die man in Lachisch in Zentralisrael gefunden hat, die auf das Ende des 8. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung datiert wird. Neben dem Bild eines ziemlich grimmig aussehenden Löwen wurden die ersten fünf Buchstaben des Alphabets in die vermutlich noch feuchte äußere Wand eines Treppenaufgangs aus Ton gedrückt.9 Wie bei den Abecedaria aus Ugarit spricht sehr viel dafür, dass es das Werk eines Lernenden ist. Als der Archäologe Charles Inge unmittelbar nach der Ausgrabung die Entdeckung bei einem Vortrag in London vorstellte, formulierte er die Hypothese, es könnte »das Werk eines Schuljungen sein, der sein Wissen zur Schau stellen wollte, indem er die Entsprechung zu ABCDE an die Wand schrieb, bis er oben an der Treppe angekommen war«.10 Am Ende des 8. Jahrhunderts ist die alphabetische Reihenfolge allem Anschein nach immer noch nicht mehr als eine Erinnerungshilfe.
Ein paar Jahrhunderte später fand das Alphabet jedoch zunehmend für überraschendere Zwecke Verwendung. Teile der hebräischen Bibel, darunter die Sprichwörter 31, 10–31 und die Psalmen 25, 34, 37, 111, 119 und 145 sind in Form alphabetischer Akrosticha verfasst, das heißt, die Reihenfolge der Buchstaben bestimmt den ersten Buchstaben eines jeden Verses. Am bemerkenswertesten sind jedoch die Klagelieder Jeremias, bei denen vier von fünf Kapiteln so gestaltet sind, jedes bestehend aus 22 Versen, von denen der erste mit dem Buchstaben aleph beginnt, der zweite mit beth, der dritte mit gimmel und so weiter bis tav, dem 22. und letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets. (Kapitel 3, das aus 66 Versen besteht, verdreifacht die Anforderung: aleph, aleph, aleph, beth, beth, beth usw.) Die Reihenfolge der Buchstaben wird somit als eine Art poetisches Gerüst eingesetzt, und das Alphabet – so wie in der modernen Dichtung Reim oder Versmaß – bestimmt, was der Dichter tun darf.
Manchmal werden Akrosticha genau wie Anagramme, Leipogramme (das Weglassen einzelner Buchstaben) und andere Formen sprachlicher Einschränkungen als schrullig und affektiert abgetan, etwas, das eines ernsthaften Dichters unwürdig ist. Im frühen 18. Jahrhundert lieferte Joseph Addison ein Beispiel dieser Haltung, als er wetterte, Akrosticha seien ein Weg, wie die »unbestritten dümmsten Holzköpfe … sich als geschliffene Autoren ausgeben können«.11 Trotzdem gehören die Klagelieder Jeremias zu den bewegendsten Abschnitten der hebräischen Bibel. Sie wurden im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im Gefolge der Zerstörung von Jerusalem geschrieben und sind ein langer Schrei der Verzweiflung über das Schicksal der Stadt: »Weh, wie einsam sitzt da / die einst so volkreiche Stadt. / Einer Witwe wurde gleich / die Große unter den Völkern.« Zu kritisieren, dass sie in Form von Akrosticha abgefasst sind, wäre genauso absurd, wie darüber zu lamentieren, dass Shakespeare sich durch Pentameter einschränkte, und zu fragen, wie viel besser die Canterbury Tales hätten sein können, wenn Chaucer sich nicht durch den Reim selbst Fesseln angelegt hätte. Wir sollten lieber darüber staunen, dass ein Geist in der Reihenfolge des Alphabets mehr sehen konnte als eine Hilfe für Schulkinder, dass er sie nehmen und das Experiment wagen konnte, den brennenden Schmerz des Exils zu fassen, sie als Katalysator für literarische Kreativität verwenden konnte.
Aber damit sind wir immer noch nicht an dem Punkt, dass die alphabetische Ordnung als Hilfe dient, um etwas zu finden, an dem ihre besondere Eigenschaft genutzt wird, dass alle Menschen, die ihr aleph beth gimmel oder ihr alpha beta gamma gelernt haben, in der Lage sein werden, die Position in dieser Abfolge auf eine Position an ganz anderer Stelle zu übertragen, in einer Liste oder einem Buch oder einem Regal. Dazu müssen wir von den Klageliedern Jeremias drei Jahrhunderte vorspulen und von Jerusalem knapp 500 Kilometer nach Westen reisen.
Der Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 vor unserer Zeitrechnung hatte eine Reihe von Bürgerkriegen ausgelöst, in deren Verlauf das von ihm errichtete Reich unter seinen Nachfolgern aufgeteilt wurde. Ägypten fiel unter die Kontrolle eines seiner Generäle, Ptolemaios I. Soter. Er begründete eine Dynastie, die bis zu Kleopatras Niederlage gegenüber den Römern fast 300 Jahre später Bestand hatte. Ptolemaios’ Hauptstadt war die erst kurz zuvor fertiggestellte Stadt Alexandria, und hier schuf er Anfang des 3. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung eine Institution, in der die größten Gelehrten der damaligen Zeit leben, lernen und lehren sollten. Sie war eher wie eine moderne Universität – nicht zum letzten Mal wird eine Universität ein Angelpunkt für unsere Geschichte sein –, und sie sollte den Musen gewidmet sein, daher der Name Museion oder lateinisch Musaeum, worauf unser modernes Wort Museum zurückgeht. Den Mittelpunkt bildete die größte Bibliothek der antiken Welt, die Bibliothek von Alexandria. Sie hatte ihre Blütezeit unter der Herrschaft des Nachfolgers von Ptolemaios I., Ptolemaios II., als sie konservativen Schätzungen zufolge 40.000 Buchrollen beherbergte (andere Quellen sprechen gar von einer halben Million).12 Eine derart umfangreiche Sammlung musste in eine bestimmte Ordnung gebracht werden, damit man sie nutzen konnte. Bewaffnet mit den 24 Buchstaben des Alphabets, übernahm ein Mann namens Kallimachos die Aufgabe, der ausufernden Bibliothek Zügel anzulegen.
Kallimachos ist heute hauptsächlich für seine Dichtungen bekannt. Er ist Verfasser einer Elegie auf einen Dichterkollegen, Heraklit von Halikarnassos, die oft in der Übersetzung von William Johnson Cory zitiert wird: »Sie sagten mir, Heraklit, sie sagten mir, dass du tot seist.« Kallimachos bevorzugte die kürzeren Formen – Hymnen, Elegien, Epigramme –, und ihm wird das Bonmot mega biblion, mega kakon zugeschrieben, »großes Buch, großes Übel«, um seine Verachtung für epische Dichtung auszudrücken. Dennoch wird uns nicht sein dichterisches, sondern sein wissenschaftliches Werk beschäftigen, und in dem Bereich war Kallimachos verantwortlich für ein in der Tat sehr dickes Buch, die Pinakes, die angeblich 120 Papyrusrollen umfasst haben sollen. Viele Jahrhunderte lang dachte man, Kallimachos habe die Pinakes erstellt, während er als bibliophylax arbeitete, als Bücherwächter. Doch zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde in den gewaltigen Stapeln der Oxyrhynchus-Papyri ein Fragment entdeckt, das anscheinend eine Liste der Bibliotheksvorsteher in der Reihenfolge ihres Wirkens ist. Kallimachos’ Name steht nicht darauf.13 Stattdessen findet sich der Name eines seiner ehemaligen Schüler, Apollonius von Rhodos, ein Mann, mit dem Kallimachos einen bitteren literarischen Streit ausfocht und der – Zufall oder nicht – epische Dichtung schrieb.14
Kallimachos mochte bei der Auswahl des Bibliotheksvorstehers übergangen worden sein, aber mit der Zusammenstellung der Pinakes tat er am meisten von allen, um das Gedächtnis der Bibliothek zu bewahren. Pinakes heißt einfach »Tafeln«, wie in »Schreibtafeln«, und der vollständige Titel von Kallimachos’ Werk lautete Verzeichnis der Männer, die in jeder Literaturgattung Bedeutung hatten, und ihrer Schriften. Es war ein Katalog aller Werke in der großen Bibliothek. Damit diese Tafeln nützlich waren, mussten sie in einer Weise organisiert sein, dass ein Leser, der sie konsultierte, unter den vielen Tausend Einträgen das finden konnte, wonach er suchte. Von Kallimachos’ Pinakes selbst ist zwar nichts erhalten geblieben, aber aus etwa zwei Dutzend bruchstückhaften Erwähnungen in anderen Werken späterer klassischer Autoren, die Abschriften davon gesehen hatten, gewinnen wir eine Vorstellung, wie sie wohl ausgesehen hatten. Daraus können wir schließen, dass das Werk zunächst nach Gattungen geordnet war: Rhetorik, Recht, epische Literatur, Tragödie usw. Und wir wissen, dass die letzte Kategorie – die Sammelkategorie »Vermischtes« – in Unterkategorien unterteilt war wie deipna und plakuntopoiika, das heißt Gastmahle und Kuchenbacken, denn Athenaios von Naukratis schreibt Ende des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung: »Ich weiß aber, daß Kallimachos in seiner Aufstellung von Schriften aus allen Ländern auch Abhandlungen aufgeführt hat, die sich mit der Herstellung von Kuchen beschäftigen, und zwar von Aigimios, Hegesippos, Metrobios wie auch Phaitos.«15 Bei dieser Aufzählung fällt noch etwas Wichtiges auf. Sie lässt nicht nur erkennen, wie wichtig die Griechen ihre Kuchen nahmen, sie sagt uns auch, dass Kallimachos innerhalb der einzelnen Kategorien die Autoren in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen aufführte.16 Außer dieser zweistufigen Sortierung – nach Textgattung und alphabetisch nach Namen –, damit Leser einen Autor ausfindig machen konnten, lieferte Kallimachos noch weitere Informationen. Die biographischen Daten wurden genannt: beispielsweise Name des Vaters, Geburtsort, Beiname (hilfreich bei Autoren, die sehr häufige Namen hatten), Beruf, ob der Betreffende bei einem berühmten Lehrer studiert hatte. Danach kamen die bibliographischen Angaben: eine Liste der Werke des jeweiligen Autors nebst ihren incipits oder Anfangsworten (weil Werke damals nicht unbedingt einen Titel in unserem Sinn hatten) und die Länge des Werks in Zeilen. Dieses letzte Detail war wichtig in der Zeit vor dem Buchdruck, weil Bibliothekare so feststellen konnten, ob sie eine vollständige Kopie des fraglichen Werks besaßen, und weil Buchhändler abschätzen konnten, wie viel es kosten würde, eine Kopie anfertigen zu lassen.
Viel spricht dafür, dass der Titel von Kallimachos’ Katalog sich auf Tafeln bezog, die über den Schränken hingen, in denen die Buchrollen aufbewahrt wurden – dass sie im Wesentlichen Signaturen waren, die angaben, was sich an einer bestimmten Stelle befand. Wenn es tatsächlich so war, dann sagt uns die Bezeichnung »Pinakes« auf hübsche Weise etwas darüber, wie zukünftige Register funktionierten: durch die räumliche Beziehung von Bezeichnendem und Bezeichnetem. Etwas hier lokalisiert etwas anderes dort: Eine Überschrift im Katalog verweist auf ihr Äquivalent im Regal.
Ein kurzer Exkurs darüber, wie Buchrollen aufbewahrt wurden: Eine Tafel über den Regalen ist eine Möglichkeit, zu finden, was man in einer alten Bibliothek sucht, aber die Griechen hatten eine andere, eine, die die einzelne Buchrolle identifizierte. (Denken wir daran, dass Schutzumschläge, bedruckte Buchrücken und selbst Titelblätter – die Methoden, die uns heute erlauben, schnell ein bestimmtes Buch zu identifizieren – noch ziemlich jung sind, nicht älter als wenige Jahrhunderte, und dass sie alle mit dem codex zusammenhängen, das heißt einem Buch, wie wir es heute kennen, mit Seiten, die wir durchblättern können, die aufeinandergelegt und am Rücken gebunden werden.) Um herauszufinden, welche Buchrolle man entrollen muss, wurde ein kleiner Pergamentstreifen, praktisch ein Namensetikett, so an die Rolle geklebt, dass er herausragte und über Autor und Titel des Werks informierte. Dieser Anhänger hieß sittybos oder häufiger sillybos (darauf geht unser Wort Syllabus zurück, das wir verwenden, um die Inhalte eines Kurses zu bezeichnen, genau wie der Syllabos die Inhalte einer Buchrolle angibt).
Als Cicero, der große römische Staatsmann und Redner, beschloss, seine persönliche Bibliothek aufzuräumen, war eine der Aufgaben, an allen Buchrollen diese Etiketten zu befestigen. An seinen Freund Atticus schrieb er:





























