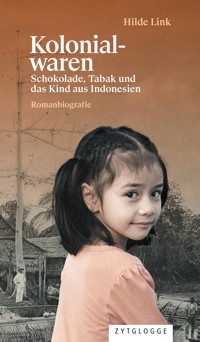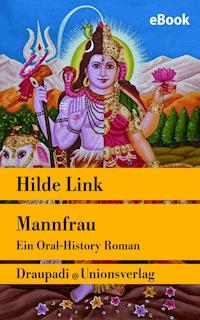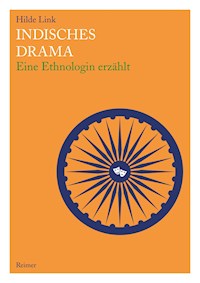
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dietrich Reimer Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie erlebt eigentlich eine Ethnologin ihre Feldforschung? Unter welchen Umständen werden die Daten gesammelt, die später in geordneter Form, z.B. in einem Buch, präsentiert werden? Hilde Link erzählt von der chaotischen Welt Indiens, in der sie fast zwei Jahre das sakrale Theater auf den Dörfern in Tamilnadu (Südindien) erforschte. Vor den Tempeln verschiedener Gottheiten werden des Nachts die großen indischen Epen szenisch umgesetzt – von professionellen Schauspielern oder Laien-Darstellern –, begleitet von Ritualen am Tag. Die Autorin berichtet von Nöten und Freuden im Alltag mit zwei kleinen Kindern, von interkulturellen Missverständnissen, von Liebe und Gewalt. Sie vermittelt damit ein vielschichtiges Bild vom Leben auf dem indischen Dorf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Ulrike Frömel
Hilde Link ist Ethnologin und forschte in Kambodscha und auf Mauritius, vor allem aber in Indien. Nach der Promotion im Hauptfach Ethnologie und in den Nebenfächern Philosophie und kath. Theologie war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie der Freien Universität Berlin. Sie lehrte am Institut für Ethnologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Pondicherry University und der Università della Svizzera Italiana in Lugano. Nach dem Tsunami 2004 gründete Hilde Link zusammen mit ihrem Mann das Prana-Hilfsprojekt in Indien.
Hilde Link
Indisches Drama
Eine Ethnologin erzählt
Reimer
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by Dietrich Reimer Verlag GmbH, Berlin www.reimer-verlag.de
Umschlaggestaltung: Alexander Burgold • Berlin
Satz: Dietrich Reimer Verlag GmbH • Berlin
Druck: Salzland Druck, Staßfurt
Papier: Lumisilk 115 g/qm, Schriftart: Palatino Linotype
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
ISBN 978-3-496-01649-6 (Druckfassung)
ISBN 978-3-496-03036-2 (PDF)
ISBN 978-3-496-03037-9 (EPUB)
ISBN 978-3-496-03038-6 (MOBI)
Für meine Familie
Inhalt
Vorbemerkung
Vorwort
Zur Schreibweise der Tamil- und Sanskrit-Begriffe
Indische Bürokratie
Der Dämon der Unwissenheit lässt mich hoffentlich nicht los
Der Beseitiger aller Hindernisse
Ein Spinnennetz: Jeder Knoten eine Aufführung
Entlaufene Enten
Künstler und Diplomaten
Vom Prinzen Rama, der schönen Sita und dem Großen Affen Hanuman
Gerade nochmal davongekommen
Trauerfeier auf Indisch
Ayurvedische Heilkunst
Silvesterparty
Ein Nachmittag am Meer und seine Folgen
Kontaktreise
Ein mystischer Ort
Kostbare Seidenkleidchen für die Kinder des Schneiders
Drama in der Lepra-Station
Ein Glückstag
Der Wahrsager hatte Recht
„Dein ärgster Feind ist der Zweifel“
Töten als Pflichterfüllung
Der Heilige Sankt Florian und der böse Blick
Der Löwe am Schnürchen
Sex and Crime
Das Gesicht muss gewahrt werden
Eine ausweglose Situation gibt es nicht
„Feuerlauf“
Ein Drama auf der Damentoilette
Keine Chance für Sittenstrolche
Ziegenopfer
Wer nicht sucht, der findet dennoch
Heißes Bratfett im Ohr und eine Zahnkrone in der Handtasche
Als Schneewittchen in Deutschland
Mitgiftmorde
Die Seele verlässt den Körper durch das rechte Knie
Ein Menschenopf er für die Gottheit
Nichts in der Welt kann für gut gehalten werden als allein ein guter Wille
Mein schönstes Ferienerlebnis
Babsi braucht einen Schnuller
Der Sensationsfund
Ali, der kleine große Zauberer und Hagenbeck‘s Völkerschau
Das menschliche Experimentierfeld
Die letzte Aufführung
„Wir alle sind Schauspieler im göttlichen Theater“
Abkürzungen
Dank
Vorbemerkung
Neben neun Aufsätzen in Fachzeitschriften habe ich zum sakralen Theater in Tamilnadu, nächtlich aufgeführten Dramen, auch ein Buch veröffentlicht. Das Universum auf der Bühne ist die Vorlage, an der entlang ich meine Erzählung geschrieben habe. Insofern stimmen die Namen der Orte, ebenso die zeitliche Abfolge, mit der wissenschaftlichen Publikation überein. Auf diese Weise kann jeder nachvollziehen, wie ich die Daten gesammelt und sie, um Objektivität bemüht, präsentiert habe.
In dieser „Hintergrundgeschichte“ erzähle ich von Dramen, die sich in meinem beruflichen Leben in dieser mir manchmal so fremden Kultur ereignet haben. Von ethischen Konfliktsituationen, in die ich geraten bin. Dilemmata, die sich für mich nie haben auflösen lassen.
Überdies erzähle ich vom alltäglichen Leben mit meiner Familie in Indien, in dem sich auch so manches Drama abgespielt hat.
Zu den Namen: Schauspieler sind Künstler, denen es wichtig war, mit ihren richtigen Namen genannt zu werden. Alle anderen Namen habe ich geändert, wenn ich keine nachdrückliche Zustimmung hatte.
Vorwort
Faszinierend, bezaubernd, mitunter erschreckend und befremdlich ist das, was Hilde Link wirklichkeitstreu als Zeitzeugin aus einem Indien der späten achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts erzählt. Wer mag, folgt ihr in die Werkstatt, nimmt teil an der Forschung vor Ort, erlebt die einzelnen Schritte, erkennt die Voraussetzungen, Hintergründe, Begleitumstände und Befindlichkeiten und kann so nachvollziehen, wie wissenschaftliche Ergebnisse zustande kommen. Es ist ein unmittelbares, eindrückliches Indien, von einer Sogkraft, der niemand entkommt. Wie für ethnographische Studien charakteristisch, werden uns hier dichte Begegnungen mit den Menschen der Gastgesellschaft beschrieben.
Und es ist ein Indien, das sich selbst darstellt im Drama, im Terukkuttu, im sakralen „Straßentheater“, und das den Menschen, jeden einzelnen, ins Geschehen auf der Bühne einbindet. Mitten hinein in das, was sich die ganze Nacht hindurch zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang abspielt. Zur Aufführung kommen die großen indischen Epen Mahabharata und Ramayana neben Themen aus weiteren heiligen Büchern, den Puranas. In Szene gesetzt wird das Libretto, das die Schauspieler nicht brauchen, weil sie die gesamte Handlung und Dramaturgie im Kopf und im Herzen tragen. So bleiben die Dramen offen für lokales Kolorit. Von Musik untermalt, tanzen sie, singen, sprechen in Reimen und in Prosa, halten sich streng an Vorgaben und passen gleichzeitig improvisierend die Darbietung an den Zweck der Aufführung, an die Rahmenbedingungen, an die Geschehnisse im Dorf und an das Publikum vor der Bühne an. Makrokosmos und Mikrokosmos, die Welt der Götter und Heroen und die des Dorfes treffen aufeinander, verbinden sich. Was die Menschen vernachlässigt, schlecht behandelt und zerstört haben, was sie haben verkommen lassen, das rückt das Drama wieder zurecht, und es versöhnt das Universum mit dem Dorf.
Der Brückenbauer zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, zwischen Kosmos und Dorf, zwischen Göttern, Heroen und Menschen ist im Drama der Kattiyankaran. Dieser Herold, ja, wer ist er, was ist seine Funktion, womit können wir ihn vergleichen? Er, der Regie führt, die Schminke und Kostüme der Schauspieler im Auge behält und bei Bedarf korrigierend eingreift, die ebenerdige Bühne auf der Straße weiht, bevor es losgeht, sie erneut weiht, wenn sich etwas Entweihendes ereignet, etwa ein Hund darüber läuft, das Spiel eröffnet, die Einsätze gibt, die Handlung erzählt, kommentiert und erläutert, der das Publikum ermahnt und im Zaum hält, der die Handlung unterbricht, um anhand der Ereignisse auf der Bühne einen zu rücksichtslosen Dorfchef, einen Geizhals, einen Tagedieb, einen Frauenheld, einen eitlen Angeber, einen Tunichtgut, jemanden mit zu losem Mundwerk dem Gespött preiszugeben oder eine gute Tat zu preisen. Anhand der Dramen von Göttern und Helden unterwirft er das Dorfleben, das Zusammenleben in der Familie, unter Partnern, im Beruf und im Alltag der Kritik und Würdigung, als Mahner, als moralische Instanz, Spötter und Zyniker, als Narr und Schalk, Spaßvogel und Conférencier. Er sorgt dafür, dass das Auditorium über Gültigkeit und Wandel der Normen nachdenkt, stellt an Beispielen die Richtschnur angemessenen Handelns zur Disposition, trägt selbst die Argumente für und wider vor, bis die Bandbreite dessen, was schicklich ist, von allen verinnerlicht worden ist. Er gibt dem Dorfleben Orientierung – ganz analog zum Göttergeschehen auf der Bühne, das dafür sorgt, dass die Welt, die der Mensch in gefährliche Schieflage gebracht hat, wieder ins Lot gerückt wird.
Wir sehen, das Terukkuttu ist kein Theaterstück nach abendländischem Verständnis, kein Beitrag zur Unterhaltung aus der Sparte ‚Kunst und Kultur‘. Nein, es ist ein kultisches Drama, bei dem Schauspieler, Musiker und Publikum in das Weltgeschehen eingebunden sind. Bei dem der Schöpfungsprozess, die Stiftung der Handlungs- und Verhaltensregeln, das Grundgesetz des Zusammenlebens, fortgeschrieben und veranschaulicht werden, bei dem die kosmische Ordnung sich erneuert und die kleine Dorfwelt einbezieht.
Wer unter kulturell fremden Menschen forscht, sieht sich unversehens in einer Rolle, die in manchen Aspekten der des Kattiyankaran ähnelt: beim Vermitteln, beim Erzählen und Interpretieren. Grundsätzlich ist die forschende Person gleichermaßen Beobachtungs- und Messinstrument, Phonogramm und Resonanzkörper mit wechselnder Eichung und Stimmung. Ihre Gefühle, ihre Fähigkeit zur Empathie, ihre Aufgeschlossenheit und Geschicklichkeit zu fragen sowie ihr eigener Wissensstand, all das beeinflusst, was sie wahrnimmt, wie sie diskutiert und modifiziert, was ihre Rezeptoren ihr zu erfassen erlauben und wie sie ihre Einsichten überprüft, etwa indem sie ihre Impressionen und Daten mit Einheimischen bespricht und deren Kritik verarbeitet. Die Forscherin muss erst selbst verstehen, bevor sie ihre Ergebnisse interpretiert und in den Wissenschaftsdiskurs einbringt.
Die Persönlichkeit der Wissenschaftlerin, des Wissenschaftlers, schlägt sich auf allen Ebenen in den Ergebnissen nieder. Das Gebot bleibt dennoch Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit, was angesichts des Bemühens um Wahrung der Persönlichkeitsrechte samt der Privatsphäre (rights of privacy), die grundsätzlich für alle gelten, eine Forderung ist, die oft der Quadratur des Kreises gleichkommt.
Hilde Link hat als Beitrag zur Nachvollziehbarkeit ihrer Forschungsergebnisse das dramatische Geschehen, die Terukkuttu-Ereignisse, filmisch, in Tonaufnahmen und fotografisch dokumentiert und im Institut für Indologie und Tamilistik der Universität zu Köln hinterlegt, wo diese Materialien archiviert und zugänglich sind.
In beschreibenden oder argumentativen wissenschaftlichen Abhandlungen verblasst oft genug die Lebenswirklichkeit, und das in einer Wissenschaft, in der es doch um das Leben geht. Der vom einzelnen Menschen absehenden Verallgemeinerung sind in der Ethnologie Grenzen gesetzt. Erst recht der Suche nach einem ‚Mittelwert der Kultur‘, ohnehin ein lebensfernes Konstrukt. Menschen entscheiden von Fall zu Fall, ob sie sich konform verhalten oder nicht, ob sie sich einem Trend anschließen oder einen eigenen Weg vorziehen. Überdies halten die jeweiligen Situationen und die handelnden Menschen so viele Imponderabilien bereit, dass ein Verhaltensmuster, ein Handlungsideal, ja selbst eine normative Konvention in einer Gesellschaft oft nur von einer – mitunter verschwindenden – Minderheit gelebt wird.
Der narrative Stil bietet dagegen die Möglichkeiten, Gefühle, Stimmungen, das Ambiente und die Atmosphäre zu schildern, die Impressionen wiederzugeben, die sich bei der Arbeit vor Ort aufgedrängt haben, die optischen, akustischen und olfaktorischen Eindrücke zu vermitteln. Er bietet auch die Chance, Abweichungen von der Norm zu zeigen sowie einen interkulturellen Dialog zu führen und so die kulturellen Besonderheiten beider Seiten kontrastiv herauszuarbeiten.
Der seit Generationen erhobenen Forderung, über die Umstände, Bedingungen, Konflikte während der Arbeit vor Ort zu berichten, wird nicht zuletzt wegen der Persönlichkeitsrechte und wegen des Arbeitsaufwandes sehr selten entsprochen, und wer es dennoch getan hat oder tut, gibt unvermeidlich viel Persönliches preis. Diese Offenheit macht sichtbar, wie sehr die Daten in der Ethnologie – und wohlgemerkt in den meisten kulturwissenschaftlichen, um nicht zu sagen wissenschaftlichen Disziplinen schlechthin – einen momentanen Kenntnisstand wiedergeben und sich eher auf der Ebene von augenblicklichen Impressionen als auf der von dauerhaften, festen Fakten bewegen. Mit dem doppelsinnigen Titel „Indisches Drama“ kommt Hilde Link hier der Forderung nach, offenzulegen, wie sie an die Daten gekommen ist.
Eine Besonderheit einer ethnologischen Feldforschung liegt darin, dass diese meist in einer kulturell fremden und in vielen Teilen überhaupt nicht vertrauten Welt durchgeführt wird. Die forschende Person muss erst einmal die fremden kulturellen Selbstverständlichkeiten und Besonderheiten lernen und hat ständig mit Situationen zu tun, die für sie Premieren sind. Wer sich heraus begibt aus der eigenen Kultur, befindet sich als erwachsener Mensch in einer Rolle, die innerhalb der Gesellschaft in der Regel nur Kinder durchlaufen, an die selbstverständlich andere Erwartungen gestellt werden als an einen Erwachsenen, auch wenn er ein Fremder ist.
Aufschlussreich, mitunter dramatisch, wird es dort, wo diese indische Welt mit dem Wertekanon einer Mitteleuropäerin zusammenstößt: konfliktträchtige Diskrepanzen bei zentralen Fragen des Lebens, bei dem, was als Recht und als Unrecht gilt, bei der unterschiedlichen Wertung von Symptomen, etwa als Anzeichen von Krankheit auf der einen Seite, als religiösvirtuoser Zustand auf der anderen. Oder herausfordernde Aufgaben beziehungsweise Gegebenheiten, etwa wenn jemand zum Spielball zwischen Kasten wird, wenn man sich fragen muss, wie jemand vor Gesichtsverlust bewahrt werden kann, wie man sich in einem ethischen Dilemma verhält oder wie man unversehens zu einer indischen Tochter kommt. Das zwingt zu Auseinandersetzungen, welche Divergenzen zwischen der eigenen und der fremden Einstellung zum Leben offenlegen und die unlösbare Verflechtung der ethischen Normen mit der jeweiligen kulturellen Tradition vor Augen führen.
Dieses Lernen der Eigenheiten und Techniken der anderen Kultur ist gleichzeitig eine hocheffiziente Diagnosehilfe. So ist es Fremden möglich, Fragen zu stellen, Präzisierungen zu erbitten, die ein Angehöriger der eigenen Kultur üblicherweise übergeht aus der Befürchtung, sich zu kompromittieren oder weil ihm die Mehrdeutigkeit einer Aussage nicht so bewusst vor Augen geführt wird, wie wenn man sie in eine andere Sprache bzw. Kultur übertragen will.
Hilde Link eröffnet Einblicke und zeichnet Impressionen, die das Leben in Tamilnadu und Züge aus der Tamilkultur ganz unmittelbar vermitteln und erklären. Man müsste sich durch umfangreiche wissenschaftliche Ethnographien, Abhandlungen und Diskussionen arbeiten und würde dennoch manches nicht erfahren. Darin liegt der besondere Wert eines solchen erzählenden Berichtes.
Wer das dörfliche Tamilnadu im Jahr 2020 vor Augen hat, stellt fest, wie aktuell das ist, was Hilde Link beschreibt, wie wenig sich geändert hat in den mehr als dreißig Jahren seit ihrer Feldforschung. Freilich ist der Zustand der großen Verbindungsstraßen unvergleichlich besser geworden, doch kaum biegt man von diesen ab, führen Schlaglochpisten und Staubwege zu den Dörfern und Slums. Der Straßenverkehr ist wesentlich dichter geworden und strapaziert die Nerven wie eh und je. Allerdings ist der ‚König der indischen Straße‘, der Ambassador, 2014 von Hindustan Motors aus der Produktion genommen, heute weitgehend von modernen Autos verdrängt, und wer früher per Fahrrad oder Moped vom Typ TVS 50 unterwegs war, fährt heute ein Auto, beliebter Anteil der Mitgift, einen Roller oder ein Motorrad.
In den Großstädten herrscht nach wie vor ein Wettbewerb im Zur-Schau- Stellen von Wohlstand oder Reichtum. Und da jeder besser dastehen möchte, als er es sich leisten kann, blüht das Hypothekar- und Kredit-Geschäft. Eine Verlockung, die viele Menschen in die fatale Schuldenfalle treibt. Zur optischen Modernisierung der Großstädte tragen die riesigen Investitionen von internationalen und indischen Großkonzernen bei, aber die Infrastruktur hinkt erheblich hinterher.
Heute bleibt man im Indian Coffee House vor Wanzenstichen verschont. Man findet Bioprodukte, Aufrufe zur Schonung der Umwelt; die Grünflächen in den Siedlungen und die umliegenden Felder sind mit weniger Plastikmüll übersät als zuvor, nachdem die indische Regierung im Jahr 2020 Plastiktüten verboten hat. Dafür wachsen an versteckten Stellen gigantische Berge von kompakt gepresstem Müll empor, seit Indien ein Großabnehmer vorwiegend toxischer europäischer Abfallstoffe geworden ist.
Rinnsale von Modernisierungsströmen erreichen auch die Dörfer. Doch obwohl Fernsehen und Internet auch dorthin vorgedrungen sind, hat sich wenig grundlegend geändert. Nach wie vor herrschen weitgehend die gleichen hygienischen Bedingungen. Der Alkoholmissbrauch lässt viele Familien zerbrechen, die Gewalt von Männern gegenüber Frauen und Kindern und das Gefälle zwischen den Geschlechtern sind geblieben, und das Kastensystem, offiziell seit der indischen Unabhängigkeit abgeschafft, besteht ungebrochen fort.
Der Einfluss von Fernsehen und Presse schürt gegenwärtig zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits gelangen sozialkritische und die Liberalisierung der Gesellschaft anmahnende Stimmen bis in die Dörfer, andererseits nehmen nationalistisch-hinduistische Strömungen in den letzten Jahren deutlich zu. Das fördert konservative Einstellungen auch und gerade auf dem Land. So kann man gegenwärtig eine Verschärfung der Abgrenzungen der einzelnen religiösen Gruppierungen voneinander sehen, die häufig eine Stigmatisierung der andersgläubigen Minderheiten zur Folge haben. Im Zuge dieser Rückbesinnung werden traditionelles Brauchtum und religiöse Riten beflissen beachtet, mitunter sogar ausgeschmückt und neu inszeniert. ‚Tradition‘ wird neu erfunden und als uralt oder wieder aufgefunden ausgegeben.
Die Kommerzialisierung alter Traditionen hat neben dem traditionellen indischen Tanz auch das Terukkuttu-Drama erfasst. Es wird in zunehmendem Maße zur Folklore zurechtgestutzt und für Touristen in Hotels oder auf großen indischen und internationalen Folklorefestivals aufgeführt, u.a. auch in Europa. Die Darsteller, oft junge Männer, die mit der Tradition keinerlei Verbindung haben, stecken in überladenen, bunten und karnevalesken Kostümen. Von entsprechendem Wert sind auch die Aufführungen. Auf den Dörfern abseits von Touristenströmen lebt jedoch die Terukkuttu-Tradition weiter wie ehedem.
Gerade unter dem Gesichtspunkt des Wandels wäre eine erneute Untersuchung der kultischen Dramen in höchstem Maße lohnend.
„Indisches Drama“ folgt chronologisch dem Weg der Forschung in Indien. Hilde Link führt die einzelnen Schritte, die Situationen und Personen plastisch vor Augen und zeigt eine indische Welt von damals und heute abseits der Metropolen, die sich dem Touristen oder dem Indian-Traveller zumeist verschließt, die in keinem Reiseführer zu finden ist, in wissenschaftlichen Publikationen ausgespart wird, selbst Städtern in Indien verborgen bleibt und die doch für weit mehr als die Hälfte der indischen Bevölkerung Lebenswirklichkeit ist.
Matthias Samuel Laubscher*
*Matthias Samuel Laubscher hatte 1986 als Vorstand des Instituts für Völkerkunde und Afrikanistik der Ludwig-Maximilians-Universität München das Projekt „Terukkuttu“ bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt.
Zur Schreibweise der Tamil- und Sanskrit-Begriffe
Wie schon bei „Mannfrau“ (Heidelberg: Draupadi Verlag, 2015) habe ich mich auch in diesem Buch entschieden, für die Tamil- und Sanskrit-Begriffe, die Namen der Götter eingeschlossen, die gebräuchlichste Schreibweise zu verwenden und ohne Diakritika zu arbeiten. Die Begriffe sind in etwa so geschrieben, wie man sie spricht. Zwar mögen Indologen, speziell Tamilisten, jetzt aufschreien. Aber irgendwer schreit bei Umschriften immer auf. Ich halte es so wie der große Historiker Eduard Meyer. In seiner „Geschichte des Altertums“ sieht er den Ausweg darin, „ganz prinzipienlos zu verfahren“.
Indische Bürokratie
„Einfach dann innerhalb von 48 Stunden in Indien ins Immigration Office gehen und diese Aufenthaltsgenehmigung abstempeln lassen.“ Ein hochgewachsener, höflicher Mann im Indischen Generalkonsulat München schob mit unbeteiligter Miene meinen Pass und ein paar Dokumente durch die schmale Durchreiche unter der kugelsicheren Glasscheibe. Im Nachhinein frage ich mich, ob der Schalterbeamte bösartig war, hinterlistig oder schadenfroh. Er muss doch gewusst haben, dass er mich mit „einfach in Indien abstempeln“ in einen Zweikampf ohne jede Gewinnaussicht mit Macht-verliebten Beamten schickt, deren Alltag nicht nur im gnädigen Entgegennehmen von Umschlägen mit pekuniärem Inhalt besteht, sondern vor allem im tagtäglichen Vergnügen, sich Schikanen aller Art für winselnde Antragsteller auszudenken. Vielleicht tue ich dem armen Konsulatsangestellten auch Unrecht. Er kam möglicherweise aus Delhi, wo andere Gesetze herrschen als im Süden Indiens. Das ist ja überall auf der Welt so, dass es im Süden eines Landes anders zugeht als im Norden. Woher kommt die Mafia? Eben.
„Danke.“ Ich nahm meine Dokumente entgegen und setzte mich auf einen der gepolsterten grauen Stühle, senkte den Blick, um vor den Wartenden mein Glück zu verbergen und mein seliges Lächeln dem Visaeintrag und meiner Aufenthaltsgenehmigung zu schenken. Ich war am Ziel aller Wünsche.
Ich hatte mir das alles ganz einfach vorgestellt: Fährst nach dem Ausschlafen, so am Vormittag, raus aufs Land, redest gemütlich mit dem einen oder anderen Alten darüber, was man sich in seinem Dorf so für Geschichten erzählt und wie sie szenisch umgesetzt werden, filmst ein wenig, nimmst alles auf Tonband auf, schreibst ein Buch darüber, und schon ist ein Kulturdenkmal der indischen Erzähltradition für immer der Vergessenheit entrissen. Meine Kinder, Johanna, zehn, Lena, sieben, nehme ich mit auf meine Ausflüge, sie würden mal was anderes kennen lernen als immer nur ihren eigenen Namen tanzen im Eurythmieunterricht der Münchener Rudolf-Steiner-Schule. Zurück in Deutschland werden sie dann einen Super-Aufsatz zum Thema „Mein schönstes Ferienerlebnis“ schreiben. Nur blöd, dass es in Waldorfschulen keine Noten gibt. Mit meinem Mann Manuel würde ich mich austauschen und das Leben in Indien in vollen Zügen genießen. Sein Antrag beim Deutschen Akademischen Austauschdienst als Meisterschüler an der Akademie der Bildenden Künste in München war ebenfalls genehmigt worden.
Im Gegensatz zu dem Sessel im Indischen Generalkonsulat in München war der Stuhl im Immigration Office in Pondicherry weder gepolstert noch grau. Ein paar der in einen Eisenrahmen gefassten Fäden des Plastikgeflechts, Naturmaterial zum Verwechseln ähnlich, versuchten den Sitzenden nicht auf den Boden stürzen zu lassen. In Indien sind eben nicht alle Stühle dafür gemacht, dass man bequem darauf sitzen kann. Nach einiger Zeit fühlte ich mich auf meinem Stuhl wie der Fakir auf seinem Nagelbrett. Obwohl der ja angeblich nichts spürt. Ich machte es mir bequem, nahm die Toilettenhaltung ein und stützte die Ellbogen auf die Knie. So drückte mir wenigstens nur noch der Eisenrahmen in die Oberschenkel. Meine Papiere hielt ich bereit wie Klopapier, um mal im Bild zu bleiben. Der kleine, stickige Raum war schon bei Büroöffnung um zehn Uhr morgens voll von Wartenden. Einer nach dem anderen verschwand durch eine dunkelbraun angestrichene Sperrholztür, auf der in frisch polierten Messingbuchstaben „S. Patil“ stand. In dem Raum saß offensichtlich jemand, der gehässig war. Das schloss ich daraus, dass einer nach dem anderen mit seiner Dokumentenmappe unter dem Arm freudestrahlend und mit federndem Schritt in den Raum ging, als wäre er auf eine Geburtstagsparty eingeladen, jedoch mit finsterer oder gar wütender Miene in den Warteraum zurückkam und eiligst dem Ausgang zustrebte. Frauen hatten Tränen in den Augen. Wer weiß, was die wollten, die Armen. Ich brauchte ja lediglich einen Stempel, weiter nichts. Nach drei Stunden war nur noch ein entmutigt dreinblickender Mann im Warteraum, der sich wacker auf seinem Stuhl hielt. Ich spazierte derweil zwischen den sogenannten Stühlen herum, betrachtete das Muster der verrosteten Gitter am Fenster und machte mir Gedanken darüber, wie schön das Leben im Allgemeinen sein kann und wie schön speziell das meine war und in den nächsten zwei Jahren sein würde. Jedenfalls anders als damals, als Manuel und ich mit unserem 9-PS-Auto, einem Citroën 2CV, dem „Döschöwo“, nach Indien gefahren waren und auch wieder zurück.
Endlich war ich dran.
„So, so“, sagte der überaus gepflegte, auffallend hellhäutige und nach Haarpomade duftende Herr S. Patil hinter seinem grün angestrichenen Eisenschreibtisch. Ein Blechbecher mit Tee stand in einer braunen Pfütze. Die Eselsohren der schmuddeligen Blätter, ordentlich auf die linke Seite des Schreibtisches geschoben und mit einer bunten Glaskugel beschwert, winkten lustig im Luftzug des Ventilators. Meine Aufenthaltsgenehmigung hatte ich Herrn Patil in vorauseilendem Gehorsam so auf den Schreibtisch gelegt, dass er nur noch seinen Stempel nehmen und diesen auf die erste Seite zu drücken brauchte.
„Sie sind also Ethnologin.“
„Ja“, antwortete ich sachlich mit einem angedeuteten Lächeln. Nur nicht gleich plump vertraulich werden, nicht dass er noch denkt, ich hätte was zu verbergen. Komisch, dieser Mann gab mir das Gefühl, irgendetwas ausgefressen zu haben. Während der Beamte bedächtig in meinen Papieren blätterte, erforschte ich sorgfältig mein Gewissen in der Rubrik „Visum“. Zwar wurde ich nicht fündig, das Gefühl, ich hätte große Schuld auf mich geladen, verließ mich dennoch nicht.
„Was wollen Sie denn hier erforschen?“
Ich legte eine zweiminütige Elevator Speech hin, ohne ein einziges Mal ins Stocken zu geraten, so überzeugt war ich von meiner Mission.
Seine Miene verfinsterte sich und der schwarze Oberlippenbart zog sich synchron mit seinen Mundwinkeln nach unten.
„Sie sind doch Indologin, und da gibt man sich nicht mit dem Quatsch ab, den irgendwelche ungebildeten Dörfler von sich geben. Da arbeitet man mit Pandits, mit Gelehrten, in den Bibliotheken und mit vedischen Texten auf Palmblättern.“
Mein Gegenüber outete sich als Brahmane, als Gelehrter der obersten Schicht im Kastensystem, während ich vorhatte, Dalit, die Unterdrückten in ihren Slums, und Shudra, die untersten in der Hierarchie innerhalb des Kastensystems, zu Wort kommen zu lassen und das, was sie sagten, ernst zu nehmen und zu dokumentieren.
Vorsichtig versuchte ich eine Richtigstellung meines Berufes.
„Ich bin keine Indologin, sondern Ethnologin, und als solche...“
„Papperlapapp!“, unterbrach er mich. „Sie arbeiten in Indien, also sind Sie Indologin.“
„Ja.“ Ich nickte zustimmend. Jetzt bloß keine Beckmesserei. Gut, dann bin ich eben Indologin. Von mir aus. Hauptsache Stempel.
Mr. Patil schob seinen Stuhl zurück, zog seinen Bauch ein und holte aus der Schublade ein Buch hervor.
„Das ist die Bhagavad Gita“, rief er hocherfreut, als hätte er einen Schatz zutage gefördert. Was in gewisser Weise ja auch so war. Seine Miene hellte sich auf, die Sonne schien ihm ins Gesicht und ließ die Schweißtropfen auf seiner Nase in Regenbogenfarben glänzen.
„Bhagavad Gita!“, rief er wieder. Argwöhnisch blickte er zu mir herab, dem weißen, kastenlosen Dummchen.
„Sagt Ihnen das was?“
„Ja.“ Antwortete ich demütig. „Das ist eine der wichtigsten Schriften des Hinduismus.“
„Und wissen Sie auch, was da drinsteht?“
Bevor ich untertänigst mit „Ja“ antworten konnte, tippte er schon auf der Stelle herum, die er mir zeigen wollte. Unter dem Sanskrit-Text stand die englische Übersetzung.
„Lesen Sie!“, befahl er in einem Ton, der gut zu seiner braunen Uniform passte. „Englisch! Ihr Sanskrit tue ich mir nicht an.“ Eine weise Entscheidung.
Artig wie eine eingeschüchterte Schülerin im Englischunterricht las ich, dass man seine Pflicht erfüllen solle und nicht nach den Früchten trachten darf. Ich blickte ihn erwartungsvoll an, um meine nächste Aufgabe klassenprimushaft zu seiner Zufriedenheit erfüllen zu können.
„Was wollen Sie denn mit ihren Erkenntnissen machen?“
„Ein Buch schreiben“, antwortete ich der Einfachheit halber.
„Sie trachten also nach Früchten.“
Meine wissenschaftliche Arbeit im Lichte der Bhagavad Gita kam mir plötzlich unanständig vor, und ich schämte mich. Bestürzt blickte ich zu Boden.
„Geben Sie mir Ihre Affiliation“, befahl er so laut, als müsste er ein ganzes Regiment zu Kampfhandlungen ermutigen.
Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, benötigt man unter anderem das Schreiben einer indischen wissenschaftlichen Institution. Mit der Fingerfertigkeit eines Klaviervirtuosen hatte ich blitzschnell das entsprechende Dokument aus den bestimmt fünfzig Seiten umfassenden Papieren hervorgezaubert.
Mit einem „Alles dabei“ legte ich nicht ohne Stolz das Schreiben vor den verbeamteten Philosophen.
„Das ist eine Kopie. Wo ist das Original?“
„Das ist in München. Aber schauen Sie, hier ist der Original-Stempel vom Konsulat. Die Kopie ist beglaubigt.“ Ich deutete auf die drei etwas verwischten Löwen und die Unterschrift, die wie die Peitsche eines Dompteurs unter den Pfoten der Tiere schwebte.
„Wessen Unterschrift ist das?“, wollte er als nächstes wissen.
„Na, die vom zuständigen Beamten, schätze ich mal. Und das hier, das ist die Unterschrift von Herrn Dr. Murugan, vom Leiter des PICA, des Pondicherry Institute of Cultural Anthropology.“ Beflissen beugte ich mich vor, um auf die Unterschrift tippen zu können.
Herr Patil schlürfte genüsslich seinen Tee. Er schien nachzudenken.
„Ich brauche eine Beglaubigung dieses Dokuments...“ Seine flache Hand klatschte auf die Affiliation. „...von einem deutschen“, er hob den rechten Zeigefinger, „von einem deutschen! Notar.“
Wie bitte? Ich soll die Affiliation bei einem deutschen Notar beglaubigen lassen? Obwohl das Indische Generalkonsulat in München dies bereits getan hatte?
„Lassen Sie die Affiliation vom Direktor des PICA unterschreiben, seine Unterschrift hier ist ja eine Kopie, und legen Sie das Ganze zusammen mit dem Original dem deutschen Notar vor. Er wird das Dokument bestätigen“, wiederholte Herr Patil. Er wollte sichergehen, dass ich auch alles verstanden hatte, nachdem von mir keinerlei Reaktion kam. Sehr wahrscheinlich stand mir der Mund offen.
„Wo ist Ihre Geburtsurkunde? Geben Sie her!“
Geburtsurkunde?
In keinem Informationsblatt zur Antragstellung einer Aufenthaltsgenehmigung stand etwas von Geburtsurkunde. Ich war sprachlos. Normalerweise bin ich nicht auf den Mund gefallen und hätte angefangen zu argumentieren. Aber ich hatte erkannt, dass Herr Patil seinen eigenen Gesetzen folgt, völlig unabhängig von allen Visabestimmungen dieser Welt.
„Gehen Sie und kommen Sie wieder.“ Sagte er unvermittelt in meine Verwirrung hinein.
„Ich gehe und komme wieder“, antwortete ich automatisch, packte meinen Kram zusammen und verschwand.
Wie alle anderen vor mir verließ ich den Raum in gebückter Haltung und mit sorgenvoll-wütendem Gesicht.
Jetzt brauchte ich erst mal ein anständiges Mittagessen. Mit einem „Ato“, einer Scooter-Riksha mit gelbem Aufbau für die Passagiere, ließ ich mich in eine Ess-Bude fahren, die mir der Fahrer empfohlen hatte. Sie lag gegenüber dem Arbeitsamt, wo gerade Sprechchöre ihre Forderungen nach mehr Rechten in Fabriken in die Gegend schrien. Der Ato-Fahrer kam mit rein und wurde für das Abliefern der Touristin mit einem Tee belohnt. In Pondicherry sind die Fahrer in der Regel nicht unverschämt, weil es da so viele Europäer gibt, die seit Jahren in der Stadt und Umgebung leben und sich mit den Preisen gut auskennen. Man einigt sich ohne große Diskussionen auf einen bestimmten Betrag, und los geht die Fahrt.
In dem kleinen Lokal mit seinen drei nicht ganz sauberen Tischen verdrückte ich ein Masala Dossai, das ist eine Art Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl mit Kartoffelfüllung, vom Bananenblatt. Mein Hirn befand sich in Schockstarre, und ich war nicht in der Lage, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Daran änderten selbst drei Gläser Tee nichts. Alles, was ich wusste, war, dass ich nicht wusste, was zu tun war. Trotz Mittagshitze ging ich zu Fuß den kurzen Weg die Uferpromenade am Meer entlang zum Ashram-Gästehaus. Am selben Morgen hatte ich mich, frisch aus Deutschland angekommen, dort einquartiert. Mein Zimmer war spartanisch möbliert, die beiden Betten waren durch ein fest in die Wand einzementiertes Nachtkästchen getrennt. Dadurch wird konsequent verhindert, dass es bei einem Paar zum Letzten kommt. Sri Aurobindos Vision, dass Kinder durch reine Lichtenergie gezeugt werden, würde erst in naher Zukunft Wirklichkeit werden. Bis dahin musste man das Zusammenschieben von Betten verhindern.
Ich trat auf den Balkon und schaute kurz aufs Meer, das mich so grell blendete, dass ich für einen Moment nur silber-gleißende Sternchen sah. Das dunkle Grün des Rasens im Park vor dem Gästehaus gab mir die Sicht zurück, so dass ich die Mäuerchen, die Bänkchen, die künstlich aufgeschütteten Hügelchen, die weißen Figürchen, die Blümchen, die Brünnchen und Kanälchen mehr und mehr ausmachen konnte. Mir hat mal eine Ashramitin erzählt, dass man bei der Aufnahme in den Ashram von einem Komitee gefragt wird, wie man sich vorstellt, für die spirituelle Gemeinschaft tätig werden zu wollen. Man darf seine Interessen, Fähigkeiten und Neigungen darlegen und sagen, was man am liebsten tun würde, jetzt, wo einem alle Möglichkeiten offenstehen. Was einem auch immer vorschwebt in seiner großen Zukunftsvision für das neue Leben, genau das darf man dann nicht machen. So lernt man Demut und Gehorsam. Derjenige, der dazu verdonnert worden war, den Gästehaus-Park zu gestalten, wäre vielleicht lieber Bäcker geworden oder Schneider. Der Park jedenfalls ist Ausdruck der Demut eines zutiefst gekränkten Menschen, dem seine nicht ganz unterdrückte Rachsucht all die Geschmacklosigkeiten eingegeben hat, die den Betrachter ästhetische Qualen erleiden lassen. Ich stellte mir einen verzweifelt „Alles, nur nicht den Park gestalten!!!“ rufenden Aspiranten vor und wohlwollend blickende Ashramitinnen und Ashramiten, die maskenhaft lächelnd mit leiser und freundlicher Stimme säuseln: „Du bist der Richtige für den Park, Du musst noch viel Demut in dein Herz einkehren lassen, mein Bruder.“ Und der Demut-gelernt- Habende macht sich an die Arbeit. Tag und Nacht gibt er sich die allergrößte Mühe mit der Gestaltung des Parks, indem er einen Entwurf nach dem anderen ersinnt und schließlich sich für den erbärmlichsten entscheidet. Aus lauter frustriert-boshafter Demut.
Der Jetlag überkam mich, und ich legte mich auf eines der Betten. Der verklärt-alkoholselig dreinblickende Sri Aurobindo und die uralte Mira Alfassa, die Insider „die Mutter“ nennen, blickten über allem wachend auf mich herab. Diese Übergriffigkeit beendete ich, indem ich das Leintuch vom Nachbarbett über die fenstergroßen Fotorahmen der Portraits hängte. Die Mutter kam dabei zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Ich legte das Bild mit dem Gesicht nach unten auf den Schreibtisch und wünschte mir inständig, der Himmel oder mein Schöpfer oder wer das alles hier lenkt, möge verhüten, dass ich je so alt werde wie die Mutter und dann auch so aussehen muss. Bevor ich einschlief, dachte ich an Manuel und die Kinder. Es war geplant, dass sie in einer Woche nachkommen. In der Zwischenzeit sollte ich, das Organisationsgenie, ein wohliges und heimeliges Nestchen für meine Familie bauen, alle bürokratischen Hindernisse aus dem Weg räumen und ansonsten dafür sorgen, dass Indien unser aller Traumland bleibt.
Die kurze Rast im Gästehaus brachte meine Lebensgeister wieder in Schwung, und ich wusste, was ich als nächstes tun musste: um vier Uhr zum PICA fahren und Dr. Murugan bitten, die beglaubigte Kopie der Affiliation zu unterschreiben, die er ja sowieso schon auf dem Original, das in München war, unterschrieben hatte. Eine Angelegenheit von einer, meinen Dank mitgerechnet, maximal zehn Sekunden. Ich rechnete mir beim Immigration Office doch noch eine Chance aus, wenn ich mit einem Dokument antanzte, auf dem jetzt also die Original(!)-Bestätigung des Generalkonsulats in München und obendrein die Original(!)-Unterschrift des PICA-Leiters standen. Vielleicht ließe Herr Patil ja morgen bei besserer Laune mit sich reden, so dass ich die Geburtsurkunde nachreichen und das Ganze von einem indischen Notar bestätigen lassen könnte. Kurz zog ich sogar in Erwägung, Mr. Patil einen gut gefüllten Umschlag zu überreichen. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass ich mich dumm anstellen würde, war hoch. Schließlich war ich in diesen Dingen gänzlich unerfahren. Wenn die Sache schiefgehen sollte, käme ich ins Gefängnis, und dieses Risiko war mir dann doch zu groß. Und außerdem und vor allem: Korruption ist was Böses, und sowas darf man nicht machen. Blöderweise kann so eine Aufenthaltsgenehmigung ausschließlich vom Immigration Office des künftigen Wohnortes ausgestellt werden, sonst hätte ich in irgendeiner anderen Stadt mein Glück versuchen können. Allerdings gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beamten dort anders drauf waren.
Punkt vier Uhr war ich im PICA. Ich hoffte, Dr. Konrad Maier zu treffen, dem ich die Affiliation zu verdanken hatte. Im Südasien-Institut in Heidelberg hatte man mir gesagt, dass in Pondicherry seit vielen Jahren ein deutscher Indologe arbeite. Ein echter, einer, der es mit Texten und nicht mit Menschen zu tun hat. Schriftlich hatte ich Kontakt zu Dr. Maier aufgenommen, und er hatte mir freundlicherweise die Affiliation besorgt.
Gleich im Eingangsbereich saß ein weißer, blasser junger Mann hinter Bergen von Büchern und tippte eifrig in eine vorsintflutliche Schreibmaschine.
„Guten Tag“, sagte ich auf Deutsch. „Herr Maier?“
Die schlacksige Gestalt erhob sich, kam mit einem Lächeln auf mich zu und begrüßte mich mit einem kräftigen und angenehmen Händedruck. Als allererstes bedankte ich mich von ganzem, wirklich von ganzem Herzen für die Affiliation, ohne die mein Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht genehmigt worden wäre. Dann erzählte ich ihm in aller Ausführlichkeit von meiner Pleite mit dem verweigerten Stempel. Ich bräuchte dringend die Unterschrift von seinem Chef, Herrn Dr. Murugan. Ja, der sei da. Dr. Maier verschwand in einem Büro drei Treppenstufen höher. Irgendwie erinnerte mich das alles an das Immigration Office. Auch Messingbuchstaben an der Türe, diesmal „Dr. Murugan“. Ich solle kurz warten, der Chef hätte gleich Zeit für mich und würde das Dokument selbstverständlich unterschreiben, richtete mir Dr. Maier aus.
Gegen Abend waren Konrad und ich schon Freunde geworden. Wir erzählten einander aus unserem Leben, und was uns nach Indien getrieben hatte. Kurz vor Feierabend flog die Tür des Chefzimmers auf, und ein kleiner und stark pigmentierter Mann in Militäruniform schwirrte, so tuend, als hätte er mich nicht gesehen, an uns vorbei.
„Ist er das?“, fragte ich schnell Konrad. Der nickte.
Ich sprang auf und lief Dr. Murugan bis auf die Straße nach.
„Kommen Sie morgen wieder. Um zehn“, rief er, als würde er einen lästigen Straßenköter verscheuchen.
„In Indien musst du eines lernen“, tröstete mich Konrad und blickte mich mit seinen sanften, braunen Augen an: „Immer schön die Nerven bewahren. Gleichmut, verstehst du?“ Erst im Nachhinein kann ich einschätzen, welchen Aufwand an Zeit und Nerven es Konrad gekostet haben muss, mir eine Affiliation zu besorgen. Und das für eine Kollegin, die er gar nicht kannte.
Am folgenden Vormittag hatte ich viel Zeit, um erstens Konrad von der Arbeit abzuhalten und ihn zweitens nach einer Wohnung für eine vierköpfige Familie zu fragen. Ja, er wisse was. Er würde mich morgen um elf im Ashram- Gästehaus abholen, die Wohnung sei gleich in der Nähe.
Endlich! Kurz vor zwölf erschien ein Gehilfe. Ich machte mich mit meinen Papieren bereit. Der Chef lasse mir ausrichten, ich solle heute Nachmittag zu ihm nach Hause kommen, da habe er Zeit. Um vier Uhr.
Konrad gegenüber äußerte ich den Verdacht, dass sein Chef ein schikanöser Vollidiot sei. Konrad murmelte was von wissenschaftlicher und persönlicher Null und meinte lapidar, ich solle doch einfach die Hoffnung auf diese Unterschrift aufgeben. Überhaupt die Hoffnung, dass das mit der Aufenthaltsgenehmigung jemals was werden würde. Konrad war nicht erst seit zwei Tagen in Indien.
„Na, du bist ja gut. Und was dann? Soll ich wieder nach Hause fahren und sagen, ich war leider nicht in der Lage meine Aufenthaltsgenehmigung abstempeln zu lassen, und das ist der Grund, warum ich mein gesamtes Forschungsvorhaben, so leid es mir tut, aufgeben muss?“
Pünktlich fand ich mich bei der angegebenen Adresse ein. Eine freundliche junge Frau öffnete mir die Türe und bat mich, im Innenhof des Hauses Platz zu nehmen. Nach einer halben Stunde brachte man mir einen Tee.
Ob Dr. Murugan da sei?
„Yes, yes. Coming.“
Irgendwann nach geraumer Zeit schlurfte ein Mann im Lunghi, im Beinkleid, heran, fläzte sich auf einen bequemen Stuhl und gähnte so ausgiebig, dass ich in Ruhe seinen verfaulten Backenzahn unten rechts betrachten konnte. Mundgeruch wehte zu mir herüber, und ich ignorierte die leichte Übelkeit, die in mir aufstieg. Ich hatte Dr. Murugan ja nur kurz im Institut zu Gesicht bekommen, und so wollte ich kaum glauben, dass ich mich hier mit ihm persönlich ganz offensichtlich in einer dienstlichen Besprechung befand. Eine freundliche ältere Dame im einfachen dunkelblauen Sari mit feiner Goldborte reichte dem Herrn mit unterwürfigem Gesichtsausdruck Kaffee. Dr. Murugan musste nach dem ersten Schluck rülpsen, es roch nach angedautem, nicht-vegetarischem Reisgericht. Er begann zu erzählen, dass er gerade dabei sei, seinen Sohn zu verheiraten, dass dieser aber die Braut, die er, der Vater, ausgesucht habe, undankbarerweise nicht haben wolle und dass seine Tochter, die mich hereingelassen hatte, Business Administration studiere. Und wie es mir denn so in Indien gefalle. Mit einem „Gut“ brachte ich die Antwort rasch hinter mich und, endlich zu Wort gekommen, trug ich mein Anliegen vor. Ich reichte ihm meine Affiliation zum Unterschreiben und einen Kugelschreiber. Er nahm beides, erkannte seine Unterschrift und gab mir das Papier zurück.
„Waren Sie bei diesem brahmanischen Bhagavad-Gita-Herumfuchtler, bei Mr. Patil? Hat er gesagt, ich solle hier noch einmal unterschreiben, obwohl ich schon unterschrieben habe?“
„Also, ja, Mr. Patil meinte, das hier sei ja nur eine Kopie, und vielleicht könnten Sie...“
„Sagen Sie Herrn Patil, wenn er eine Unterschrift von mir will, dann soll er gefälligst selber kommen. Good bye.“
Unversehens war ich in einen allgegenwärtigen Konflikt zwischen Brahmanen und Nicht-Brahmanen geraten, der bei jeder Gelegenheit hochkocht. Dr. Murugan war kein Brahmane, Mr. Patil hingegen schon. Wer stand zwischen den Fronten? Ich, das Opfer.
Schnurstracks fuhr ich zu Konrad ins Institut und suchte bei ihm Trost. Er riet mir zu Gelassenheit. Ich war aber erst seit ein paar Stunden in Indien, und das Schicksal hatte mir nicht wie ihm das Glück zuteilwerden lassen, mir neun lange Jahre lang diese beneidenswerte Gemütsverfassung aneignen zu können.
Mir war klar, dass Konrad Recht hatte und ich diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Ich musste das Risiko eingehen, mich zwei Jahre lang ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung im Land aufzuhalten. Dieser Gedanke fühlte sich ausgesprochen ungemütlich an. Und was würde dann bei der Ausreise passieren? Gott sei Dank würde es mit Manuels Visum keine Probleme geben. Beim DAAD kümmert sich das Auswärtige Amt um alles.
Der Dämon der Unwissenheit lässt mich hoffentlich nicht los
Gegen Abend, es war noch nicht dunkel, ging ich ins „Seagull“, allgemein bekannt als „Sigl“. Das Sigl ist ein Lokal direkt am Meer neben dem Ashram- Gästehaus, von wo aus man schön auf die Möwen und den Sonnenuntergang schauen kann. Im Sigl verkehrt der hochkastige und gepflegte Alkoholiker, wie ich später erfuhr: Ärzte aus den umliegenden Krankenhäusern, Universitätsprofessoren, unter Garantie auch mein Peiniger, Herr Patil. Ich setzte mich draußen an einen der Sperrholztische und versuchte, mich beim Auflehnen nicht zu verletzen. Die Meeresluft hatte das einst schön aufgeklebte braune Plastik-Holzimitat der Tischoberfläche in kleine Splitterpfeile verwandelt, die hartnäckig versuchen, Hände und Unterarme des Hungrigen aufzuspießen.
Kaum hatte ich mich hingesetzt, kamen fünf junge Männer in roter Uniform an meinen Tisch gestürmt. Die Kellner. Als ginge es um eine Hinrichtung, zeigten alle gleichzeitig, die rechten Hände zur Pistole geformt, auf meinen Oberkörper und riefen im Chor: „Comefrom!!!“ Auf meine Antwort „Germany“ hin wurde mir die Speisekarte ausgehändigt. Der Einband mag einmal, so vermutete ich, aus rotem Samt gewesen sein. Ich nahm das speckig- dunkelbraune Büchlein mit den roten Rändern, schlug die drei ersten Seiten auf und tippte auf einen dunklen Fleck, wie viele, viele andere schon vor mir. Den Namen des Gerichtes konnte man nicht mehr lesen, aber ich dachte mir, bestimmt ist das was Gutes, sonst hätten das ja nicht so viele Leute bestellt. Es kam ein Teller mit „chicken 65“, gebratene rote Geflügelstückchen. Ich dachte, die Hühnchen sind aber klein hier in Indien, was für winzige Knöchelchen. Konrad klärte mich später auf, dass das keine Hühner, sondern Krähen sind, die sich von Aas und den Stoffwechsel-Endprodukten ernähren, die Fischer am Strand in ihrer Open-Air-Toilette hinterlassen. Indischen Gästen ist das egal, ob Krähe oder Huhn, Hauptsache gut gewürzt. Gerade als ich das erste Stück des köstlichen Gerichtes gegessen hatte, trat ein athletischer junger Mann an meinen Tisch und fragte, ob er sich zu mir gesellen dürfte.
„Bitte, gern.“
„Ich bin Ray“, sagte der blond gelockte Schöne.
„Ray, wie X-ray?“, fragte ich und fühlte mich originell.
„Ray wie – sunray.“
Der Sonnenstrahl bestellte auch kurz entschlossen das abgetippte Gericht, also „chicken 65“, nachdem ich ihm versichert hatte, wie lecker das schmeckt. Ray war Banker aus dem United Kingdom und hatte gerade einen überaus erfolgreichen Geschäftsabschluss in Bombay mit einer indischen Bank hinter sich. Die Geschäfte habe er unerwartet zügig abgewickelt, jetzt wolle er in Pondicherry Urlaub machen. Mir gegenüber saß der personifizierte Erfolg, ein Held der Londoner Lombard Street. Und was hatte ich Versagerin vorzuweisen? Meine Pleite mit der Aufenthaltsgenehmigung und ein Forschungsprojekt, das ich noch gar nicht kannte. Ich mochte gar nicht dran denken, machte einen auf coole Ethnologin und gab wenigstens mit meiner Doktorarbeit an: eine Studie über Mikronesien. Wo Mikronesien ist, wusste Ray nicht und überspielte seine Unkenntnis mit:
„Ich kenne nur Millionesien. Von Dagobert Duck.“
Gott, wie einfallsreich und witzig dieser Mann doch war. Ich lachte amüsiert und erklärte ihm, wo die Inselgruppe ist, nämlich im Pazifik.
„Dann bist du also Pazifistin“, bemerkte Ray, wieder so einfallsreich und witzig wie vorhin.
Ich bejahte, ja, ich bin Pazifistin, genau.
Während des Essens sahen wir ein Kind am Strand, wie es von den Wellen hin und her geschubst wurde und wie der Sand anfing, es zu bedecken. Ray sprang auf und sprintete quer durchs Lokal ans Meer. Schade, dass er nicht noch ein paar Tische umgerissen hat, das hätte mir gefallen. Ich hechtete hinterher, so schnell ich konnte, und kam an, da war das Kind schon gerettet. Allerdings nicht von Ray. Der Junge hatte nur „Ich bin ertrunken“ gespielt. Seine Freunde lachten, als Ray es hochriss, mit dem Kopf nach unten über sein linkes Knie legte und ihm auf den Rücken klopfte. Dieser Mann war ein Held, nicht nur in London, sondern auch in Pondicherry: entschlossen und selbstlos, jederzeit bereit, Menschenleben zu retten. Zurück bei unseren inzwischen kalt gewordenen vermeintlichen Hühnchen, erwähnte der Verehrenswerte, wo wir schon mal beim Thema waren, dass er eine Woche zuvor in Bombay eine ganze Schulklasse samt Lehrerin aus den Fluten gerettet habe. Er sei nämlich Rettungsschwimmer. Donnerwetter! Held auch noch in Bombay.
Auch Ray wohnte im Ashram-Gästehaus. Nebeneinander gingen wir die Treppen zum ersten Stock hoch. Sein Zimmer war links von der Treppe, meines rechts. Obwohl ich ihm erzählt hatte, dass ich verheiratet bin, nahm er bei der vorletzten Stufe meine Hand und zog mich nach links. Oben angelangt ging ich ohne jeden Kommentar nach rechts. So ein einsames Herz war ich nun auch wieder nicht.
Gegen neun Uhr – in Deutschland war es jetzt halb fünf Uhr morgens – betrat ich den Frühstücksraum des Gästehauses. Auf jedem Tisch stand ein Plastikschildchen mit weisen Zitaten der Mutter oder Sri Aurobindos. Sowas wie: „Die Ewigkeit ist unendlich“ oder „Gnade.“ Ray hatte sich für „Alles Leben ist Yoga“ entschieden und wartete seit sieben Uhr morgens auf mich. Er habe nicht schlafen können, denn Abgewiesen-Werden sei für ihn ganz was Schlimmes, das sei er ja so gar nicht gewöhnt. Das Porridge in seiner Schale war angetrocknet, und auf dem Tisch standen fünf leere Tassen, auf deren Grund sich Reste von Kaffee, Zucker und Milch zu bizarren Landschaften formiert hatten. Ideal zum Kaffeesatzlesen. Konnten wir aber zum Glück nicht, sonst hätte ich da schon gewusst, dass die nächsten eineinhalb Jahre kein Ethno-Ringelrein auf dem Abenteuerspielplatz Indien werden würden, sondern das blanke Martyrium. Ich holte mir einen Knoblauchtoast und drei Tassen Tee. Knoblauch ist nämlich gesund und macht fit. Bei der Wahl meines Sitzplatzes achtete ich darauf, nicht den Park im Blickfeld haben zu müssen. Schon nach den ersten Bissen lehnte Ray sich in seinem Stuhl zurück. Ich erzählte ihm, dass ich gleich von einem Kollegen abgeholt werde, um eine Wohnung zu besichtigen, in der ich mit meiner Familie zwei Jahre lang zu leben gedachte. Ray wünschte mir von ganzem Herzen viel Glück und beteuerte mir, dass er für mich da sei, und fragte, ob wir uns zum Mittagessen wieder hier bei „Alles Leben ist Yoga“ treffen wollten. Ich sagte: „Warum nicht“. Da hatte Ray schon beschlossen, seinen Urlaub mit mir zu verbringen.
Punkt, wirklich punkt elf stand Konrad am Eingang des Frühstücksraums und winkte. Ich verabschiedete mich von Ray und freute mich aufrichtig, dass Konrad gekommen war.
Wir gingen die Uferpromenade entlang, ohne viel zu reden. Konrad ist nicht gesprächig. Wenn er was sagt, dann Essentielles. Und Essentielles gab es gerade nicht zu besprechen. Wir bogen von der Avenue Goubert in die Rue du Bazar Saint Laurent ab und gelangten schließlich zur Rue La Bourdonnais. La Bourdonnais war im 18. Jahrhundert der Gouverneur von Mauritius. Auf dieser Insel sollte ich später einmal arbeiten. Es ging um indische Tempel als politische und wirtschaftliche Machtzentren. Diese Forschung hatte ich beantragt, weil meine Kinder, inzwischen in der Pubertät, gesagt hatten: „Mama, in diese Zumutung von Indien kannst du künftig alleine fahren. Andere Mütter sind auch Ethnologinnen, und die arbeiten in der Karibik oder irgendwo sonst auf der Welt, wo es schön ist. Wir bleiben zu Hause, schließen uns kriminellen Banden an und werden drogenabhängig, während du in Indien bist.“ Also hatte ich mir überlegt, wo es schön ist auf der Welt und wo sonst noch Inder sind, und kam auf Mauritius. Die Kinder waren einverstanden. Ich stellte einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und als dieser bewilligt worden war, flogen wir alle miteinander nach Mauritius. Meine Töchter belegten Tauchkurse und flirteten mit den örtlichen Beach Boys, während ich im Landesinneren, da wo sonst niemand hinkommt, eifrig nach indischen Tempeln Ausschau hielt und die Priester befragte, was sie außer religiösen Zeremonien noch so alles treiben. Wirtschaftlich und politisch gesehen. Abends ließen wir uns dann gemeinsam mit den anderen Urlaubern den weißen Rum schmecken, feierten Grillpartys und schauten aufs Meer. Dieses Projekt bescherte uns sogar noch eine Kongressreise nach Japan. In Kyoto und Osaka hat es uns auch gut gefallen. Wären wir sonst ja nie hingekommen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eine wunderbare Einrichtung. Kleiner Tipp: Drohungen von pubertierenden Kindern unbedingt ernst nehmen.
Die Rue La Bourdonnais Nummer zwei war keine Wohnung, sondern ein französischer Kolonialbau mit verschnörkelten Gittern an den hohen Fenstern. Das Haus war von zwei Parteien bewohnt: von Rebecca Gottlieb und von Mr. Shubash, beide Ashramiten. Nach mehrmaligem Klopfen mit dem Vorhängeschloss an das hohe, weiß gestrichene Gittertor vernahm ich ein langgezogenes „Muuuuhh“. Die violetten Bougainvilleen wucherten über die Mauer und bildeten über Konrad und mir eine Laube.
Eine Kuh im Garten dieser Villa?
„Rebecca, mach auf!“ Konrad war ungeduldig.
Eine ältere Frau im abgewetzten Sari kam mit einem Schlüssel in der Hand herbeigeeilt und öffnete das Tor.
„Vanakkamaaya“, (Tamil: Willkommen, Großmutter) sagte Konrad höflich.
„Vanakkamaya“, (Tamil: Willkommen, gnädiger Herr) antwortete die Großmutter. Mir schenkte sie ein freundliches Lächeln.
Auch ich sagte „vanakkamaaya“, schließlich hatte ich nicht umsonst Tamil gelernt.
Die Aaya ging langsam mit wiegendem Schritt voraus und führte uns einen kleinen Weg entlang durch den Garten zu einer von Fächerpalmen gesäumten Terrasse, deren Decke von zwei dorisch nachempfundenen Säulen getragen wurde.
Wir sollten doch auf den Rattansesseln einstweilen Platz nehmen, ob wir einen Tee wollten. Nein, danke.
Wieder ein tiefes „Muuuuh“, das aus dem Haus zu kommen schien.
Die ratlos dreinblickende Aaya führte uns durch ein hohes Holztor, hinein in einen fast doppelt so hohen Raum. In einer Ecke dieser Halle lag eine füllige Gestalt, die kurz muhte, als sie uns erblickte. Das musste Rebecca sein. Die langen braunen, etwas verstrubbelten Haare und die Kaffeeflecken auf dem weißen Gewand ließen mir den Gedanken an eine Kuh nicht abwegig erscheinen. Konrad und ich knieten uns vor das Heilige Tier.
„Rebeccaaaa!“
Ein Blick aus sanften braunen Augen war die Antwort auf Konrads Versuch, die Kuh-Frau zu erreichen.
„Das ist Hilde. Sie will das Haus mieten. Du hast doch gesagt, du ziehst aus.“
„Haaaallooooo!“ Konrad winkte vor Rebeccas Augen mit der flachen Hand hin und her, als würde er am Bahnhof stehen und seine Familie im ausfahrenden Zug verabschieden und als wäre es völlig normal, deutsche Frauen, mich mal noch nicht mitgerechnet, zurück in die Realität zu holen.
Rebecca kam zurück ins Hier und Jetzt, rappelte sich umständlich vom Fußboden hoch und ließ sich in einen weiß lackierten Rattanstuhl fallen, der unter der Last alle vier Beine von sich spreizte. Konrad und ich standen ebenfalls auf und setzten uns auf ein weißes Holzsofa mit weißen Kissen. Rebecca erblickte mich und schaute verwundert. Sie fragte sich wohl, wie wir hereingekommen waren.
„Das ist Hilde“, versuchte Konrad noch einmal sein Glück. „Sie will hier einziehen. Du hast doch gesagt, du willst weg von hier.“
„Weißt du, Hilde“, begann Rebecca, „hier in Indien kannst du einen Yoga machen, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Ich mache hier spirituelle Erfahrungen“ – sie hielt einen Moment inne, um ihren Worten die rechte Bedeutung zu verleihen, und fixierte Konrads obersten Hemdknopf – „die ich mir in Deutschland nicht einmal vorstellen konnte.“
Ich nickte wenigstens andächtig, wenn ich schon nicht wusste, wovon Rebecca sprach.
„Manchmal bin ich Kuh. Du musst das richtig verstehen: Ich versetze mich nicht hinein in das Wesen einer Kuh oder tue so, als wäre ich eine. – Ich bin Kuh. Ich – bin – ganz – Kuh.“
Pause.
Rebecca wartete auf mein Nicken. Ich tat ihr den Gefallen.
„Der Dämon der Unwissenheit, weißt Du, Hilde, der Dämon der Unwissenheit, der hält uns alle gefangen. Mich hat er losgelassen.“
Mit einem Male war mir das alles hier unheimlich. Was, wenn auch mich der Dämon der Unwissenheit loslässt? Als hätte sie meine Gedanken erraten – wahrscheinlich hatte ihre innere Stimme ihr mein sorgenvolles Abwägen offenbart – fuhr sie fort: