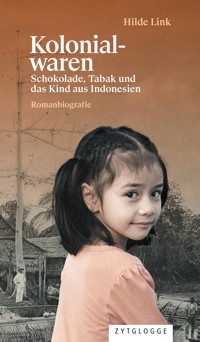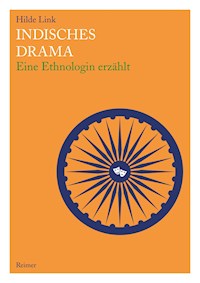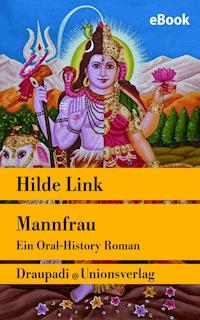
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gita und Niveda leben gemeinsam in einem Slum im Süden Indiens mit anderen Außenseitern der Gesellschaft. Gita ist intergeschlechtlich, Niveda zu diesem Zeitpunkt noch ein Junge, der wegen seiner Andersartigkeit verstoßen wurde. Auf der Reise nach Bombay, wo Niveda bei einer Operation die Geschlechtsteile abgetrennt werden, verlieren sich Gita und Niveda aus den Augen. Gita wird adoptiert und zur Tänzerin ausgebildet. Niveda arbeitet als Prostituierte. Als Erwachsene begegnen sich Gita und Niveda wieder. Sie verbringen ihr Leben am Rande eines Dorfes und bleiben Außenseiter. Heute ist Gita eine berühmte Tänzerin mit Auftritten in aller Welt und lebt in Mumbai. Mit Gita und Niveda führt die Ethnologin Dr. Hilde Link in die Anmut, in die Spiritualität, in den Horror von Indien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Gita und Niveda leben gemeinsam in einem Slum im Süden Indiens mit anderen Außenseitern der Gesellschaft. Gita ist intergeschlechtlich, Niveda noch ein Junge, der wegen seiner Andersartigkeit verstoßen wurde. Gita wird Tänzerin und Niveda nach einer Operation zur Prostituierten. Als Erwachsene begegnen sie sich wieder.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Hilde Link ist Ethnologin und sprach über viele Jahre hinweg mit zahlreichen Mannfrauen, feierte gemeinsam mit ihnen religiöse Feste und besuchte sie in entlegenen Dörfern Südindiens. Die Autorin lebt im Tessin oder in München. Sie hat vier Kinder, von denen eines ein indisches Pflegekind ist.
Zur Webseite von Hilde Link.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Hilde Link
Mannfrau
Ein Oral-History Roman
Mit Fotografien
E-Book-Ausgabe
Draupadi @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Der Gott Ardhanarishvara, Mann und Frau zugleich
Umschlaggestaltung: Reinhard Sick, Heidelberg, und Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30936-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 02:37h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
MANNFRAU
VorwortEinleitungDer Fluch der NachbarinDie WendeFahrt ins VerderbenDer GeheimtippNivedas Traum entgegen»Geht und kommt wieder«AngekommenIch bin kein Monster?Bei Mama und PapaGeburtstagsfeierSchuleKalakshetraReise zu NivedaHochzeit mit der GottheitEndlichNiveda erzähltHeimreiseZurück in KalakshetraTreffen mit NivedaIm KrankenhausAufrechterhaltung der WeltenordnungSchock für Mama und PapaAbschiedSchwestern und TantenUnser neues ZuhauseAnfangsschwierigkeitenBesuchKleinkrediteDorfidylleReise mit MamaDie VisionWieder in BombayEpilogDankBildteilZur Schreibweise der Tamil- und Sanskrit-BegriffeWeiterführende LiteraturWissenschaftliche FilmeAbbildungsverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Über Hilde Link
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Indien
Zum Thema Frau
Für meine Tochter Tamara Indra
Vorwort
in memoriam GANGU,
großherzig, gerecht und selbstlos,
eine wahre Freundin
Als ich Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts begann, über die tamilischen »Ali« zu forschen, war das Thema Transsexualität (ich benutze der Einfachheit halber diesen Begriff, obwohl er – wie die Autorin dieses Buches in ihrer Einleitung deutlich macht – nicht alle Aspekte des hier Angesprochenen abdeckt) in Indien noch relativ unbekannt und unbearbeitet. Neben wenigen ersten (Auto-)Biographien, welche zudem zumeist von Hijras stammten, deren Kultursphäre sich von der der Alis stark unterscheidet, gab es zu der Zeit hauptsächlich Erwähnungen und kurze Ausführungen dieses Themas am Rande, in Werken, die sich primär mit übergreifenden Thematiken befassten. So war ich zu fast einhundert Prozent auf eigene Feldforschung und Interviews angewiesen. Im Jahre 2001 war ich dann soweit, einen längeren Artikel über die Ali zu veröffentlichen, in dem damals von mir herausgegebenen Online-Journal KOLAM. Im Folgenden werde ich zuweilen ohne weitere Angaben aus diesem Artikel zitieren. Inzwischen sind die Ali – oder, wie sie sich heute nennen, Tirunankai – intensiv auf der politischen Bühne Südindiens aktiv und haben sich, zusammen mit ihren nordindischen Schwestern, zahlreiche Rechte und politische Anerkennungen erkämpft, darunter zum Beispiel die Regelung, dass auf offiziellen indischen Formularen, in denen man sein Geschlecht angeben muss, neben »männlich« und »weiblich« nun auch regelmäßig der Eintrag »anders« erscheint, was dieser Gruppe in der indischen Bevölkerung eine offizielle Stellung bescheinigt. Gerade dadurch wird zum Beispiel auch der Weg in »normale« Berufe heutzutage bei Weitem leichter als noch in den 90er Jahren: Ich kenne persönlich mehrere Ali, welche Lehrerinnen, Händlerinnen, Inhaberinnen von Beamten-Posten sind, und solche, die in ihren Wohngebieten inzwischen angesehene Persönlichkeiten sind, die sogar zu politischen Sprecherinnen auf lokaler Ebene gewählt wurden. Ohne die allgemeine Situation beschönigen zu wollen, habe ich den Eindruck, dass sich die Situation der Ali in den letzten zwei Jahrzehnten bedeutend verbessert hat.
Bereits in den späten 90er Jahren antwortete mir GANGU – eine meiner Haupt-Informantinnen aus der Gruppe der Ali – in einem inzwischen von mir veröffentlichten Video-Interview auf die Frage, warum Alis häufig verlacht, vertrieben und ausgegrenzt werden, dass dies auch oft an ihrem eigenen Verhalten liege. Wörtlich: »So, wie wir uns benehmen, werden wir auch von anderen behandelt. Stell dir ein Dorf vor, in dem jemand sich auffällig benimmt. Dieser wird von der Dorfgemeinschaft zurechtgewiesen. So ist es auch mit uns …« Gangu selbst legte größten Wert auf korrektes Verhalten und erntete im Gegenzug den Respekt ihrer Umgebung. Sie war eine einflussreiche Person – nicht nur unter Ihresgleichen: Sie war eine »Mutter« (Gangu selbst benutzte den Ausdruck »Guru« – also »Lehrer«), die zahlreiche »Töchter« anleitete –, sondern auch in der sie umgebenden allgemeinen Gesellschaft, in welcher sie zeitweilig sogar die Rolle einer regionalen politischen Führerin innehatte.
In zahlreichen Autobiographien von Angehörigen gesellschaftlicher Minoritäten (in Indien, neben den Ali/Hijra, etwa auch Dalits und Angehörige von Stammesgesellschaften) findet man oft einen übertriebenen Negativismus, in dessen Rahmen alles, was dem Protagonisten/der Protagonistin im Leben zustößt, allein durch die Zugehörigkeit zu der entsprechenden Minorität erklärt und begründet und so als Unterdrückungsmaßnahme dargestellt wird. Das Fehlen von Selbstkritik und die in diesem Sinne übertriebene Schuldzuweisung nach außen haben dabei oft eine kontraproduktive Konsequenz, da der Leser nicht mehr zwischen den vorgeschobenen und den durchaus existierenden tatsächlichen Minoritäten-Problemen unterscheiden kann und somit auch die letzteren nicht mehr ernst zu nehmen bereit ist. Daher sind selbstkritische und positive Äußerungen wie die von Gangu (oder, im Bereich der Tamil-Dalits, etwa die außergewöhnliche Autobiographie von Viramma) von großer Bedeutung, da sie das reale Bild zurechtrücken und den Leser im Endeffekt viel tiefer beeindrucken als die übertrieben negativistischen Darstellungen. In diesem Zusammenhang begrüße ich auch die im vorliegenden Buch gegebene Darstellung des Ali-Lebens in Form einer auf »oral history« basierenden romanhaften Erzählung sehr. Hier erscheinen Negatives und Positives als relativ ausgewogen, wir haben Teil an Alltagssituationen und an Gedanken der Protagonistinnen, wodurch wir die dargestellten Personen als Teile der sie umgebenden Gesellschaft wahrnehmen und auch ihre Probleme im jeweiligen Kontext verstehen können.
Meinem weiter oben erwähnten Artikel über die Ali hatte ich den Titel »The Mystery of the Threshold« (»Das Mysterium der Schwelle«) gegeben, womit ich anspielen wollte auf eine alte Legende über Gott Vishnu in seiner Form als Narasimha oder »Mann-Löwe«. Diese Legende erzählt, dass der dämonische König Hiranyakashipu sich strengster Askese unterzog und den Göttern zahlreiche Opfer darbrachte, um sie so letztendlich zu zwingen, ihm einen Wunsch zu gewähren. Als die Götter sich diesem Druck schließlich beugen mussten und Hiranyakashipu fragten, was denn sein Wunsch sei, verlangte er, nicht getötet zu werden
weder von einem Menschen, noch von einem Tier,
weder bei Tag, noch bei Nacht,
weder im Innern, noch außerhalb seines Palastes.
Die Götter gewährten diesen Wunsch gezwungenermaßen, und so fühlte Hiran-yakashipu sich vollkommen sicher und unsterblich. Er begann, die Erde und das gesamte Universum zu tyrannisieren, bis die Götter die Situation unerträglich fanden und beschlossen, etwas zu unternehmen. In der hinduistischen Mythologie nimmt jedes Mal, wenn das Universum in Gefahr ist, Vishnu eine geeignete Gestalt an, um die Ordnung wieder herzustellen. So inkarnierte er sich in dieser Situation als Narasimha – Mann-Löwe –, also weder Mensch, noch Tier, und er tötete Hiranyakashipu in der Dämmerung, als es weder Tag, noch Nacht war, auf der Schwelle des Palastes, also weder im Innern, noch außerhalb desselben.
Warum erzähle ich diese Geschichte hier?
Weil es eine Geschichte über die »Schwelle« und ihr Mysterium ist – das Weder-so-noch-so-sein, das Beides-zugleich-sein, ohne exklusiv einer der beiden Komponenten anzugehören. Und dieses Charakteristikum trifft auf die Ali zu, die »Mann-Frauen«, die weder Mann noch Frau und doch beides zugleich sind.
Unter die Tamil-Bezeichnung »Ali« gruppieren sich Individuen verschiedenster Ausprägung, die nur das eine gemeinsam haben, nämlich nicht deutlich als »maskulin« oder »feminin« identifizierbar zu sein. Eine Ali kann ein Transvestit sein, ein Eunuch, eine transsexuelle Person oder ein Hermaphrodit.
Während die nordindischen Hijra höchstwahrscheinlich auf das Eunuchen-tum in der Haremskultur der jahrhundertelangen Herrschaft der großen islamischen Dynastien Nordindiens zurückgehen, führen sich die tamilischen Ali auf eine ausschließlich in der südindischen Version des Epos Mahabharata vorkommende Episode zurück:
Das Mahabharata erzählt von dem großen, 18 Tage währenden Krieg zwischen den beiden Clans der Pandavas und Kauravas. Beide stehen sich von Tag zu Tag gleich stark gegenüber, und der Krieg führt zu keiner Entscheidung. So greifen schließlich die Götter ein und verkünden, dass der Clan, aus dessen Reihen ein Krieger bereit sei, am folgenden Tag auf dem Schlachtfeld sein Leben zu opfern, den Sieg erringen werde. Aravan, der junge, 16-jährige Sohn des Pandava-Helden Arjuna erklärt sich bereit. Doch ist Aravan noch unverheiratet, was bedeutet, dass die Totenriten, welche allein eine positive Existenz nach dem Tod garantieren, nicht vollständig an ihm vollzogen werden können. So stellt er die Bedingung, noch am gleichen Tag verheiratet zu werden, um sodann am folgenden Tage als verheirateter Mann auf dem Schlachtfeld sein Leben zu lassen. Doch welcher Vater wäre bereit, seine Tochter einem jungen Mann, dessen baldiger Tod gewiss ist, zur Braut zu geben und sie so zu einem Witwendasein zu verdammen? Es fand sich also keine Braut für den jungen Helden. So ergriff Vishnu Partei, inkarnierte sich als die schöne, verführerische Mohini und heiratete Aravan. Die Hochzeit fand am Abend statt, und Aravan starb am folgenden Tag auf dem Schlachtfeld – woraufhin die Pandavas den Sieg im großen Mahabharata-Krieg errangen.
Diese Episode, in welcher der männliche Gott Vishnu sich als schöne Mohini inkarniert, veranlasst die Tamil-Ali, sich mit Mohini zu identifizieren. Sie sagen, dass Vishnu in dieser Inkarnation »eine von ihnen« sei, sie also alle mit Mohini identifizierbar sind. Und somit wird auch das jährlich in zwei Dörfern in der Gegend von Pondicherry und Villupuram gefeierte Aravan-Fest zum wichtigsten religiösen Ereignis im Jahreslauf der Ali. Jedes Jahr versammeln sie sich in diesen zwei Dörfern, um dort die Geschichte um Aravans Hochzeit erneut rituell zu zelebrieren. Das Fest ist von solcher Bedeutung, dass sogar in Bombay und in Delhi ansässige tamilische Ali dafür nach Südindien angereist kommen: Gibt doch erst diese Episode und das daraus abgeleitete Ritual ihnen ihre Identität, ihre Daseinsberechtigung und auch, in gewissem Maße, ihre Position in der tamilischen Gesellschaft. Als Personen, die den Gott Vishnu-Mohini darstellen, bringt man ihnen einen gewissen Respekt entgegen – wenn auch eher aus einer Art »bhaya-bhakti« (Verehrung aus Furcht) hervorgehend, wobei diese Furcht mit dem »Schwellen-Charakteristikum« der Ali zu tun hat – man weiß sie nicht wirklich einzuordnen, kann sie nicht fassen und nimmt daher an, dass sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Natur magische Kräfte besitzen. Man kann wohl behaupten, dass die Ali in der tamilischen Gesellschaft zwar eine Randstellung einnehmen, jedoch nicht aus derselben ausgeschlossen sind.
Es gibt literarische Hinweise, welche beweisen, dass bereits vor mehr als 2000 Jahren Ali in der tamilischen Gesellschaft existierten. Die alte Tamil-Grammatik Tolkappiyam, die etwa im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstand, enthält zwei Lehrsätze, in welchen auf die Ali (wenn auch in anderer, archaischer Terminologie) eingegangen wird, indem die Frage aufgeworfen wird, welches grammatische Geschlecht »Personen, bei denen die Männlichkeit ›schlummernd‹ ist« bei der Formulierung von Wörtern und Sätzen zuzuordnen sei. Die späteren Kommentare zu diesem Text nehmen die Frage auf und diskutieren sie im Detail. Sie sind sich einig, dass hier Hermaphroditen gemeint sind und männliche Personen mit deutlich femininen Charakteristika. Tolkappiyam selbst lehnt hier den Gebrauch maskuliner grammatischer Endungen ab und plädiert für feminine Endungen. Im Falle von Personen, in denen das Geschlecht nicht eindeutig feststellbar ist (hier sind wohl Hermaphroditen gemeint), solle man sich der Neutrum-Form bedienen. Wenn diese alte und nicht allzu umfangreiche Grammatik gleich in zwei Lehrsätzen diese Frage diskutiert, so können wir mit Sicherheit daraus ableiten, dass Ali in der alten Tamilgesellschaft nicht nur vorkamen, sondern auch durchaus sichtbar waren.
Der moderne Terminus »Ali« ist abzuleiten von einer Wortwurzel »al-«, welche in etwa bedeutet »ohne etwas sein«. Dahinter steht die Idee, dass nach populärer, panindischer Anschauung, jeder vollkommene Mensch 10 Charakteristika habe, von welchen den Ali eines, nämlich die eindeutige sexuelle Bestimmung, abgeht. Daher werden sie im tamilischen Volksmund auch oft »ompadu« – das Zahlwort für »9« – genannt, eine Bezeichnung, die freilich eine abschätzige Konnotation innehat und die so Bezeichneten lächerlich macht.
Ich habe in diesem Vorwort versucht, die wichtigsten der mir bekannten Fakten über die tamilischen Ali kurz darzustellen, um deutlich zu machen, dass es sich hier um eine seit mehreren tausend Jahren in Südindien gesellschaftlich verankerte Minoritätengruppe handelt. Wenn sogar die Götter eine der vielfältigen Formen solcher Existenz annehmen können (Shiva als Ardhanarishvara – einer, dessen Hälfte eine Frau ist [vergleichbar mit einem Hermaphroditen] –, Vishnu als Mohini [vergleichbar mit einer transsexuellen Person], der vergöttlichte Mahabharata-Held Arjuna jahrelang als Tänzerin verkleidet an einem fremden Königshof [vergleichbar mit einem Transvestiten] – um nur einige Beispiele zu nennen), so können wir davon ausgehen, dass auch menschliche Existenzen dieser Art ihren Platz in der Gesellschaft, und sei es heute am Rande derselben, haben und dass die tamilische Gesellschaft mit diesem Phänomen umzugehen weiß. Vieles deutet darauf hin, dass die Ali in früheren Zeiten definierte gesellschaftliche Funktionen und somit auch größeren Respekt inne hatten als heute. Doch bedarf die Beantwortung dieser Frage einer ausgedehnten Erforschung der alten Tamilliteratur und Ritualkunde, welche mit Blick auf diese Thematik bisher noch nicht vorgenommen worden ist.
Gesellschaften verändern sich ständig. Und in der mehr und mehr von einer verwestlichten Mittelklasse charakterisierten modernen indischen Gesellschaft haben es Randgrupen wie die Ali schwer sich zu behaupten. Traditionelle Vorstellungen und Rituale, aus denen sie früher ihre Daseinsberechtigung und ihre gesellschaftlichen Funktionen und Stellungen ableiten konnten, haben zum größten Teil ihre Bedeutung verloren. Mögen die Ali die Kraft, die Motivation und die nötige Unterstützung finden, um sich auch in der modernen Welt einen Platz zu sichern. Dieses Buch wird mit Sicherheit dazu beitragen, uns die Welt der Ali ein wenig verständlicher zu machen und mögliche Vorurteile abzubauen.
Ulrike Niklas (Universität zu Köln)
Der Fluch der Nachbarin
Mein Auftritt im Goethe-Institut in New York war ein gigantischer Erfolg. Die Leute da mögen Bharatanatya, den klassischen indischen Tanz. Ich hatte mein Bestes gegeben. Das Publikum klatschte und klatschte. Schließlich standen sogar alle auf. Ich lächelte und verbeugte mich. Das war mir unangenehm. Das Verbeugen und der Applaus. Weil das so aussah, als hätte ich für das Publikum getanzt, das da unten im Zuschauerraum war. Ich kam mir vor wie eine Betrügerin. Denn in Wahrheit tanzte ich nur für die Götter und für Niveda, die Liebe meines Lebens.
Der Applaus war verebbt, ich eilte in meine Garderobe. Die Glöckchen an meinen Fußgelenken kamen mir heute besonders laut vor. Auf dem Schminktisch hatte ich bereits vor meinem Auftritt eine kleine Bronzefigur aufgestellt von Shiva-Nataraj, dem Zerstörer und Erneuerer, in seinen kosmischen Tanz versunken. Shiva-Nataraj steht inmitten eines Feuerkranzes und tanzt. So wie ich in meiner Fantasie bei jedem meiner Auftritte. Da bin ich Shiva-Nataraj. Ich entzündete Räucherstäbchen und holte das Foto von Niveda hervor. Immer trage ich es bei mir. Direkt an meinem Herzen. In meinen BH habe ich mir ex-tra ein kleines Fach genäht. Das Bild passt genau hinein. Jedes Mal, wenn ich es anblicke, muss ich ein wenig lachen. Auch jetzt dachte ich an die Situation vor dem Tempel in Thanjavur. Drei Jahre ist das jetzt her. Niveda hatte die rechte Hüfte zur Seite geschoben, die Arme über den Kopf gestreckt und eine lustige Grimasse geschnitten. Ihr Blümchensari war ganz verrutscht. »Gita tanzt«, hatte sie mich veräppelt. Wir haben uns sehr amüsiert damals. Jetzt kniete ich mich vor die Gottheit und vor Niveda und ließ meine Gebete mit dem Rauch der Räucherstäbchen gen Himmel ziehen.
Der Wahrsager hat es schon vor meiner Geburt gewusst. »Dieses Kind wird einmal berühmt«, sagte er, »es wird eine wichtige Aufgabe im Leben übernehmen.« Aber meiner Mutter war das egal. Nachdem ich auf der Welt war, heulte sie nur und beleidigte ihre Nachbarin mit den übelsten Schimpfwörtern. Die ist nämlich schuld, dass ich mit so einem Körper geboren worden bin. Sogar »Ich hau dir den Schuh auf den Kopf« hat meine Mutter geschrien. Das ist so ziemlich die schlimmste Demütigung, die man jemandem antun kann. Ein Schuh, mit dem man durch den Dreck geht, mit dem man vielleicht in einen Scheißhaufen getreten ist, solch ein Gegenstand auf dem Haupt, dem Tor zur Oberwelt – widerlich.
Meine Mutter hatte eine Kuh und verkaufte die Milch. Auch an unsere Nachbarin. Klar war immer ein kräftiger Schuss Wasser dabei. Unsere Nachbarin schmeckte das natürlich, aber meine Mutter behauptete, dass die Milch absolut überhaupt rein gar nicht gepanscht sei. Irgendwann war der Nachbarin dann die Sache zu blöd und sie knallte den Topf mitsamt der Milch vor die Füße meiner Mutter und schrie: »Du sollst eine Ali gebären!« Meine Mutter erstarrte. Kurz nach diesem Ereignis war sie mit mir schwanger geworden. Wegen des Fluchs bin ich eine Ali. Aus der Sicht der Leute in unserem Dorf war ich ein Monster, ein Tier, einfach kein Mensch.
Die Hebamme war ganz ruhig, als sie meiner Mutter kurz nach Mitternacht bestätigte, dass der Fluch unserer Nachbarin sich erfüllt habe. Sie legte mich auf eine Matte auf dem Boden und ging Paddy holen. Paddy, das ist Saat-Reis, den man einpflanzt. Paddy hat einen Spliss, der so scharf ist wie eine Rasierklinge. Wenn man ein Kind nicht haben will, dann stopft man dem Neugeborenen ein kleines Paddy-Korn in den Mund. Wenn das Kind dieses schluckt, wird ihm Speise- und Luftröhre aufgeschlitzt. Die Hebamme verkündet dann, dass das Kind kurz nach der Geburt gestorben sei. Einfach so.
Am Paddy-Sack wartete mein Vater. Er wusste, dass ich eine Ali sein würde. Alle wussten das. Aber mein Vater wusste auch, was der Wahrsager verkündet hatte.
Die Hebamme wollte den Sack öffnen, aber mein Vater sagte: »Verschwinde! Dieses Kind wird einmal eine wichtige Aufgabe im Leben erfüllen. Es wird berühmt werden. Es bleibt am Leben.«
Der Fluch der Nachbarin hatte sofort gewirkt. Die Prophezeiung des Wahrsagers sollte sich erst im Laufe der Zeit erfüllen. So nach und nach.
Die Wende
Mich haben in meiner Kindheit die Bewohner meines Dorfes von vornherein wie ein Tier behandelt und nicht wie einen Menschen. Den Fluch der Nachbarin kannte inzwischen jeder.
Es gibt auch männliche Kinder, die irgendwie seltsam sind, obwohl sie aussehen wie richtige Jungs. So war das bei Niveda. Da war bis zu ihrer Operation alles dran. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass sie, die einmal Mutthu hieß, in der Seele kein richtiger Junge sein konnte. Kinder wie Mutthu werden wenigstens wie Menschen behandelt, auch wenn die Eltern sie von einem gewissen Zeitpunkt an nicht mehr haben wollen. Irgendwann wurde Mutthu einfach weggeschickt. Die Eltern bekamen mit, dass Mutthu gern tanzte, dass er oft in den Tempel ging und sich dort mit dem Priester darüber unterhielt, warum alles so ist wie es ist. Warum er, Mutthu, so ist wie er ist. Der Priester wusste auf alles eine Antwort. Irgendeine Gottheit ist immer für irgendwas zuständig. Auch für Jungs, die anfangen komisch zu werden. Oder für Ali-Kinder wie mich, die weder-noch/sowohl-als-auch von Geburt an sind.
Der Gott, der für uns zuständig ist, ist Ardhanarishvara. Er ist Mann und Frau zugleich: Shiva und Parvati in einer Person. Diese ist ausgestattet mit der Gabe, Menschen glücklich zu machen, und dem Auftrag, sich um jeden zu kümmern, der Hilfe benötigt. Shiva ist der Zerstörer und Erneuerer, Parvati ist seine liebende, sanfte Gattin. Zusammen sind sie das Weltelternpaar, aus dem alles hervorgegangen ist, was existiert. Ardhanarishvara ist der vollkommene Mensch. Mann und Frau zugleich. Er ist beides. Nicht nur körperlich, sondern auch spirituell, streben wir an, ein vollkommener Mensch zu sein, so zu sein wie Ardhanarishvara. Die Spiritualität unseres Hindu-Glaubens und das richtige Leben sind zweierlei.
Das Schicksal, das unsere Kultur für intergeschlechtliche Kinder vorsieht, ist immer gleich. So wie es mir ergangen ist, ergeht es allen anderen mehr oder weniger auch: Ich musste mich anziehen wie ein Junge. So dass wenigstens nach außen hin der Schein gewahrt wird, obwohl doch jeder im Dorf wusste, was mit mir los war. Und mit etwa acht Jahren gehen wir dann weg von zu Hause oder wir werden weggeschickt. Problem beseitigt, Schein gewahrt. Das ist ganz wichtig bei uns in Indien, dass der Schein gewahrt wird. Das ist das Allerwichtigste sogar. Völlig egal, wie etwas eigentlich ist. Das, was nach außen getragen wird, das ist die Wirklichkeit, auch wenn es mit der Wahrheit nicht das Geringste zu tun hat.
Meine Familie und ich wohnten in einem kleinen gemauerten Häuschen mitten im Dorf an dem breiten Weg, der zur nächsten Ortschaft führte. Links und rechts von unserem Haus gab es nur mit Palmwedeln gedeckte Hütten ohne Fenster. Die Lehmwände von solch einer Hütte sind nicht mehr als hüfthoch. Dann beginnt schon das Dach. Unsere Nachbarin, die meine Mutter verflucht hatte, wohnte auch in so einer Hütte direkt neben uns. Unser Haus war eines von dreien im Ort, das richtige Ziegelmauern hatte. Auch bei unserem Haus war das Dach ganz weit herunter gezogen, so dass man sich tief bücken musste, wenn man hinein wollte. Wer auch immer in das Innere des Hauses ging, musste an Großmutter, an Aaya, vorbei. Sie saß den ganzen Tag über rechts vor der Eingangstüre auf einem Plateau aus Lehm und unterhielt sich mit Besuchern, die auf der linken Lehmfläche herum saßen oder lagen und die Kühle des Untergrundes unter sich und den Schatten des Daches über sich genossen. Die Besucherfläche erstreckte sich über die gesamte Längsseite des Hauses und war so breit wie ein Bett. Gäste blieben oft abends gleich liegen, wenn es spät geworden war, und brachen dann am nächsten Morgen gemütlich auf.
Leute, die nicht zur Familie gehören, außer den Bediensteten, haben im Inneren des Hauses nichts zu suchen. Mein Vater wahrte besonders die Privatsphäre, schließlich waren wir in seinen Augen was Besseres.
Die linke Hälfte der Teakholz-Eingangstüre, wenn man also zwischen Aaya und Besuchern durch war, war immer zu, die rechte stand, außer in der Nacht, offen. Zwei fein geschnitzte Pfauen beäugten neugierig jeden, der ein und aus ging. Der eine der Pfauen, der rechte, der an der offenen Türe, hatte im Laufe der Zeit ganz dünne Beinchen bekommen und sah so aus, als könne er sein Gewicht nicht mehr lange halten, weil ihm jeder, der durch die Türe trat, mit der rechten Hand automatisch quer über die Beine strich. So als wolle der Besucher im Zwischenraum von Außen und Innen die Mühen der äußeren Welt dem Pfau überantworten. Die dadurch entstandene schwarz glänzende Speckschicht hatte dem armen Tier eine Fessel angelegt, die seine Beine kaum noch erahnen ließ. Warum das so ist, warum das jeder landauf landab in Tamilnadu, und wohl in ganz Indien macht, also den Dreck seiner rechten Hand an der offen stehenden Türe abwischt, oder am Türrahmen oder an der Wand neben der Türe, weiß ich nicht. Ist einfach so. Nicht alles in Indien ist tiefsinnig und von großer sozio-kultureller Hintergrundsphilosophie getragen.
Aaya saß immer auf ihrem Platz vor den Pfauen. Ihren dunkelgrünen Sari trug sie, wie das früher üblich war, ohne Bluse. Wenn sie ihren Kopf auf die Hand stützte, sah man ihre von 16 Kindern ausgesaugten Brüste. Wer auch immer kam, meine Großmutter war dabei, sagte zu jedem Thema ihre Meinung oder schlichtete auch mal Streitereien. Als sie dann richtig alt war, saß sie praktisch nie mehr alleine da. Jemand aus der Familie oder von den Nachbarn war immer bei ihr und massierte ihre Schultern oder hielt ihre knochigen Hände. Nachts holte mein Vater sie ins Haus und legte sie auf eine Reisstrohmatte zu den anderen Familienmitgliedern dazu. Heutzutage gibt es Altersheime. Einrichtungen, in denen der alte Mensch jeglicher Würde beraubt wird. Schlafsäle mit zwanzig, dreißig Betten, in denen sich die Alten wundliegen, bis sie qualvoll sterben. Hauptsache, die Jungen können arbeiten gehen, damit ein Fernseher oder ein Auto angeschafft werden kann. Obwohl ein Altersheim nicht viel kostet, gibt es die ganz Sparsamen. Bei denen wird die Oma in einen Lastwagen gesetzt, der in ein anderes Bundesland fährt. Der Lastwagenfahrer bekommt ein paar Rupien und setzt die Alte dann irgendwo aus. Verständlich machen kann sie sich nicht, denn sie spricht ja nicht die entsprechende Landessprache.
Für unsere Familie war es selbstverständlich, dass Aaya zu uns gehörte. Ich war froh, dass sie da war, denn so konnte ich mich immer zu ihr setzen und Trost finden. Wir haben nie miteinander so richtig gesprochen. Ich meine, dass ich ihr meine Sorgen und Nöte als Ali hätte anvertrauen können. Auch sie bewahrte den Schein und tat so, als sei alles in Ordnung bei uns. Aber sie war da, ich konnte meinen Kopf an ihre Schulter lehnen und ihren wunderbaren Atem riechen, der immer so schön nach den Betelpriemchen duftete, die sie unentwegt kaute. Als ihr auch noch der letzte ihrer pechschwarzen, vom Betel zerfressenen Zähne ausgefallen war, stampfte ihr meine Mutter alles klein mit unserem Granitmörser.
Ein Priemchen ist nicht irgendein Betelblatt mit Betelnüssen drin. Jeder stellt es anders und ganz individuell zusammen. Meine Großmutter zum Beispiel wollte immer zwei Betelblätter haben, die sie sorgfältig übereinander legte und dann mit Kalk aus ihrem kleinen Metalldöschen bestrich. Darauf kamen dann Krümel einer zerkleinerten Betelnuss (bot. areca catechu) und irgendwas Süßes, zum Beispiel ein Stückchen getrocknete Mango. Und ganz oben drauf ein oder zwei große getrocknete Tabakblätter. Wenn sie dann ihr zusammengerolltes Werk in den Mund schob, schaute sie immer vollkommen zufrieden aus, und ich konnte an ihrem Gesicht sehen, wie sehr sie den Moment genoss, in dem sie den bitter-süßen Geschmack in ihrem Mund spürte. Der Boden vor ihrem Sitzplatz sah immer aus, als hätten wir gerade mehrere Hühner geschlachtet. Von dem Priemchen bekommt man im Nu den ganzen Mund voll roter Spucke. Das ist, als würde man ganz viele Wasserhähne auf einmal aufdrehen. Aaya war Meisterin darin, die rote Brühe ganz lange zurück zu halten. Aber irgendwann gab es auch für sie kein Halten mehr, und sie spuckte eine immense Menge von blutroter Flüssigkeit, die sich in ihrem Mund gebildet hatte, in den Sand vor unserem Haus.
Wenn mein Vater von der Arbeit kam, schimpfte er immer mit Aaya und sagte, sie solle doch nicht genau dahin spucken, wo jeder drüberlaufen muss, um ins Haus zu kommen. Aber meiner Großmutter war das egal. Sie lächelte freundlich und nickte, weil sie an den Lippenbewegungen sah, dass mein Vater zu ihr sprach. Gehört hat sie sowieso schon lange nichts mehr. Ich denke mir manchmal, dass sie irgendwann genug gehört hatte von dem ganzen Tratsch und den ganzen Tragödien in unserem Dorf. Genug für dieses Leben. Keine Speicherkapazität mehr. Als sie wirklich alt wurde, als sie schon so um die 50 war, hörte sie auch auf zu sprechen.
Mein Vater war gebildet, er arbeitete im Büro einer Reismühle und genoss hohes Ansehen im Dorf, weil er lesen und schreiben konnte. Wenn mein Vater auf der Arbeit war, gab mir meine Mutter nichts zu essen, und meine drei älteren Brüder droschen unkontrolliert auf mich ein. Manchmal brachten sie Freunde mit, von denen sie Geld bekamen, damit sie mich auch mal in der Gruppe verhauen konnten. Das machte ihnen großen Spaß, und sie haben viel gelacht. Richtig lustig war das, wenn ich am Boden lag und mich nicht wehren konnte und wimmerte. »Monster, Monster« schrien sie dann und lachten. Der Vormittag war für mich immer die Ruhe vor dem Sturm. Am frühen Nachmittag kamen meine Brüder von der Schule nach Hause und meistens brachten sie Freunde mit zum Monster-Verdreschen. Wenn mein Vater von der Arbeit kam, fragte er mich immer, wie es mir geht, und immer sagte ich gut. Und immer war mein Vater zufrieden, weil es mir gut ging. Manchmal fragte er, wie es in der Schule war. Ich sagte gut, und mein Vater war zufrieden. Die Wahrheit war, dass ich tagelang gar nicht in die Schule ging, weil mich dort die Kinder mit Steinen beworfen haben. Meine Durga-Lehrerin hielt zu mir, und manchmal kam sie in der Pause sogar zu uns nach Hause und fragte meine Mutter, warum ich nicht zur Schule käme. »Shiva«, so hieß ich früher, »ist krank«, sagte meine Mutter dann immer. Mrs. Durga ging ins Haus, Wahrung der Privatsphäre hin oder her, und sah, wie ich auf meiner Reisstrohmatte auf dem Boden lag und vor mich hin döste mit meinen wehen Knochen und meinen aufgeplatzten Lippen. Wenn meine Lehrerin dann neben meiner Matte kniete und mir übers Haar strich, dann war ich glücklich. Sie lächelte wie die Göttin Durga auf dem kleinen Pappbildchen, das auf unserem Hausaltar stand. Ganz genau so.
»Komm«, sagte Mrs. Durga zu mir und verscheuchte die Fliegen von meinen Wunden. »Komm doch in die Schule.« Dann stand ich auf und ging mit ihr mit. Unter ihrem Schutz wagte niemand mich anzufassen oder eine dumme Bemerkung zu machen. Ich liebte Mrs. Durga, denn sie hat mich beschützt wie eine echte Göttin. Und außerdem war sie wunderwunderschön. Aber dann wurde Mrs. Durga versetzt. Da hatte ich niemanden mehr, der mich beschützte, der mich verstand, der mit mir sprach und dem ich mich anvertrauen konnte. Ich saß dann oft bei meiner Großmutter und lehnte mich an sie, aber sprechen konnte ich mit ihr nicht oder gar sagen, was mit mir los war.
Meinem Vater habe ich nie gesagt, wie es in Wahrheit um mich stand. Er hätte es sowieso nicht wissen wollen. Er musste doch meine Verletzungen gesehen haben. Er musste doch wahrgenommen haben, wie mager ich war, und er musste doch daraus geschlossen haben, dass ich zu wenig zu essen bekam. Das Verhältnis zu meinem Vater war wie eine Abmachung, wie eine Vereinbarung. Er fragte zum Schein, und ich antwortete zum Schein. Ich habe ihn letztlich nicht interessiert. Nie hat er sich für mich eingesetzt, wenn er zufällig Zeuge einer Auseinandersetzung mit meinen Brüdern geworden war, nie hat er sich ein Zeugnis zeigen lassen, nie war er in der Schule und hat nachgefragt. Alles musste ihm aufgefallen sein, alles musste er gewusst haben, und nichts hat er getan. Die Tatsache, dass ich wegen ihm nach der Geburt nicht umgebracht worden war, war für ihn wohl genug dessen, was er für mich zu tun bereit war.
Einmal im Monat, immer bei Neumond, fuhren wir alle von unserer Familie gemeinsam in den übernächsten Ort zum Tempel. Der war der Göttin Durga gewidmet. Durga besitzt eine zerstörerische Energie. Diese Zerstörung aber gilt nicht dem, was gut ist im Menschen oder in der Welt. Vielmehr richtet sie sich gegen die Unwissenheit, die ein Teil des Bösen ist und zum Dämon werden kann. Wenn man den Dämon in sich selbst oder in der Welt besiegt, dann ist der Weg geebnet für Moksha, für die Befreiung.
Meine Mutter, meine Brüder und mein Vater legten im Tempel immer ein gewaltiges Tempo an den Tag, denn sie wollten schnell wieder nach Hause, nachdem sie ihre religiösen Pflichten erfüllt hatten. Von der besonderen Kraft des Platzes haben sie unter Garantie nichts mitbekommen, obwohl sie im wahrsten Sinne des Wortes offensichtlich war. Denn wie kraftvoll ein Platz ist, erkennt man an der Anzahl der Arme, die eine Gottheit hat. Wenn sie vier Arme hat, dann ist sie zwar sehr mächtig, aber acht – das ist schon was Besonderes. Und die Durga in unserem Tempel hatte acht Arme.
Mit etwa acht Jahren habe ich damit angefangen, heimlich zum Tempel mit dem Bus zu fahren. Der Busfahrer kannte mich schon und sagte dem Schaffner, dass er ein Auge zudrücken soll wegen des Fahrscheins, den ich nicht bezahlen konnte.
Schon wenn ich mich dem Tempel näherte, wurde ich ganz andächtig. Ich roch den betörenden Duft von Räucherstäbchen, und Durga segnete alle, die zu ihr kamen. Zwar hatte ein Bildhauer sie aus schwarzem Granitstein gefertigt, aber immer wenn ich sie sah, war sie für mich die wirkliche Durga, die Göttin selbst. Sie lächelte ganz genauso wie meine Lehrerin. Der Priester war besonders nett zu mir. Immer kam er gleich auf mich zu mit seinem Messing-Opfertablett, auf dem eine Kampferflamme brannte und auf dem heilige Asche, viputi, und rotes Pflanzenpulver, kunkunam, waren. Ich legte, wie die anderen Gläubigen auch, kurz meine beiden Handflächen über die Flamme, drehte dann meine Hände um und führte symbolisch die Flamme an meine Stirn. Herrlich fühlte ich mich dann immer. Alles, was in meinem Leben nicht gut war, hatten die Flammen mitgenommen. Das gab mir Kraft, all die Ungerechtigkeiten, die mir in meinem Dorf widerfuhren, auszuhalten. Jedes Mal, wenn ich in den Tempel kam, stand ich lange vor Durga und schaute sie einfach nur an. Wie sie da im Allerheiligsten saß, kaum zu erkennen vom Rauch der Räucherstäbchen und der Öllämpchen, gekleidet in einen prachtvollen Seidensari, behängt mit duftenden Rosen- und Jasmingirlanden.
Eigentlich war es ein Besuch im Tempel wie jeder andere auch. Plötzlich, das war wie eine Eingebung, hatte ich das Gefühl, dass für mich heute ein besonderer Tag war, dass meinem Leben eine Wende bevor stand. Ich fürchtete mich, als ich auf das Sträßchen vor dem Tempel trat. Mit gesenktem Blick blieb ich stehen. Ich fühlte mich, als würde ich auf etwas warten. Auf was, das wusste ich selbst nicht. Da hörte ich das feine Klingen von Fußkettchen, das gehende Frauen ankündigt. Das Geräusch verstummte. Direkt vor meinen Augen sah ich die goldene Borte eines roten Saris, darunter kräftige Füße. Die Zehennägel schmutzig, tiefe Risse in der Hornhaut an den Fersen vom vielen Herumlaufen. Langsam blickte ich nach oben. Sie war sorgfältig geschminkt mit schwarzem Kajal, kein Lippenstift, die Haare zu einem Nackenknoten gebunden. Unverkennbar eine Ali. Nicht so eine wie ich, eine von Natur aus, sondern eine Operierte, eine, die mal ein Mann gewesen war. Mit ihrer tiefen Stimme sagte sie nur: »Komm.« Begleitet wurde sie von zwei jungen Ali. Eine davon war Niveda. Mit einem unsäglichen Glücksgefühl ging ich mit den dreien mit. Direkt hinein in mein Verderben.
Fahrt ins Verderben
Mein Herz hüpfte vor Freude, das Klingen der Fußkettchen der Ali, die vor mir her gingen, war wie eine Verheißung. Nun wird mein Leid ein Ende haben, niemand wird mich mehr schlagen, niemand mich mehr mit Steinen bewerfen, niemand mich demütigen.
Im Gehen sagte die, die mich aufgefordert hatte, mitzukommen:
»Ich bin Rasiga, die Mutter von denen da. Das sind Kaviya und Niveda.«
Sie deutete auf eine Halbwüchsige und eine junge Erwachsene.
Eine der beiden, die jüngere, trug einen grün-geblümten Punjabi-dress. Sie kam gleich neben mich und schaute mich neugierig an.
»Niveda?«, sagte ich auf gut Glück, denn Rasiga hatte nicht dazu gesagt, wer wer war.
»Ja, ich bin Niveda. Und du?«
»Shiva.«
Niveda nahm meine Hand, und ich spürte ihre weiche und sanfte Energie. In dem Moment wusste ich: Ich gehöre zu ihr und sie zu mir. Wir gehören zusammen.
Rasiga wandte sich an mich: »Ich bin jetzt deine Mutter, Niveda und Kaviya sind deine Schwestern.«
Meine neue Mutter schaute mich nicht an, sie lächelte nicht. Sie übermittelte mir eine Information.
Bei uns Ali gibt es Familienverbände wie bei anderen Familien auch. Nur dass wir keine männlichen Linien haben. Es gibt also Mütter, Großmütter, sogar Ur-Großmütter, Töchter, Enkelinnen und Ur-Enkelinnen. Ein Junge oder ein Kind wie ich wird zur Tochter, wenn sie von einer erwachsenen Ali adoptiert, d.h. angenommen wird. Es kommt auch vor, dass ein erwachsener Mann sich einer Ali-Familie anschließt. Er trägt dann bis zum Zeitpunkt seiner Operation, also bis zum Abtrennen seiner Geschlechtsteile, einen Sari. Diese Übergangszeit kann ganz unterschiedlich lange dauern, je nachdem, wie der entsprechende Kandidat, eigentlich muss man sagen: die Kandidatin, sich macht. Ob sie z.B. für Freier attraktiv ist, ob sie gehorsam und unterwürfig gegenüber der Mutter ist, sich sozial engagiert etc. Erst nach der Operation ist eine Kandidatin eine echte Ali und kann ihrerseits eine eigene Familie gründen. Wie viele Töchter eine Mutter hat, ist ganz verschieden. Eine Mutter in Madurai hat z.B. fünfhundert Töchter.
Meine Ali-Familie und ich stiegen in einen bunt bemalten Bus, vorne drauf ein Tiger, der das Maul aufriss und seine Zähne zeigte. Er hatte die Aufgabe, entgegenkommende Fahrzeuge davon abzuhalten, mit uns zusammen zu stoßen. In der halben Ewigkeit, die die Fahrt dauerte, hatte ich Zeit, meine neue Mutter und meine Schwester Kaviya zu spüren, denn ich saß genau zwischen ihnen. Kaviya fühlte sich irgendwie kratzig an, sperrig. Sie war eine ganz Hagere mit vorstehenden Zähnen, so dass sie den Mund niemals schließen konnte. Zumindest habe ich sie nie mit geschlossenem Mund gesehen. Ihr brauner Sari war schon etwas ramponiert, und die goldenen Fäden der Stickerei standen auf dem dunklen Stoff ab wie widerspenstige Haare. Überhaupt hatte Kaviya etwas Düsteres. Immer glotzte sie abwesend vor sich hin und sagte auf der ganzen Fahrt kein Wort, obwohl wir fast vier Stunden nebeneinander saßen. Vielleicht mag sie ja keinen Familienzuwachs, dachte ich mir. Aber das war gar nicht so, wie sich später herausstelle. Kaviya war mit ihren 23 Jahren einfach so wie sie war. Freudlos und maskenhaft. Angeblich war sie erst nach ihrer Operation so geworden.
»Schon zweimal hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen«, berichtete Niveda.
»Ich verstehe sie nicht, denn ich freue mich schon so auf meine Operation. Dann bin ich endlich eine richtige, echte Ali. Aber meine Mutter hat gesagt, ich muss noch warten. Fünfzehnjährige werden noch nicht operiert. – Und du?«
Niveda schaute mich erwartungsvoll an. Ich wollte nicht sagen, dass es bei mir gar nichts zu Operieren gibt, und murmelte nur:
»Weiß nicht.«
Von meiner neuen Mutter ging etwas Gemütliches aus, obwohl sie sehr herrschsüchtig sein konnte. Die ganze Fahrt über schaute sie mich nicht ein einziges Mal an. Sie schien die langweilige ebene Landschaft und den glühend heißen Fahrtwind zu genießen, der ihren sorgfältig geschlungenen Dutt in Unordnung brachte. Zwischendrin öffnete sie den Beutel auf ihrem Schoß und bastelte sich ein Betelprimchen. Der Bus hatte keine Glasscheiben, stattdessen drei Eisen-Querstangen an jedem Fenster. Immer wenn Rasiga ausspucken musste, zog sie sich an der obersten Querstange hoch, hielt ihren Kopf etwas nach draußen und dann – gabs Gekreische von der Frau hinter ihr, die die ganze Bescherung auf ihrem Sari hatte, weil genau da ein kräftiger Windstoß durch einen entgegenkommenden Bus die rote Spucke wieder hinein wehte. Meine Mutter lachte frech, und die Frau hielt auch sogleich ihren Mund und fing an, mit dem einen Ende ihres Saris das Schlimmste zu beseitigen.