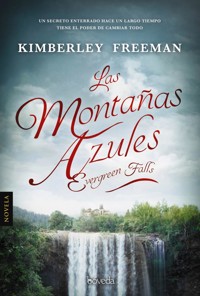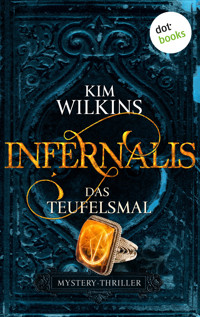
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vom Teufel gezeichnet – auf ewig verflucht? Der packende Mystery-Thriller »Infernalis – Das Teufelsmal« von Kim Wilkins jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn ein dunkles Erbe in dir erwacht … Lisa Sheehan ist Musikerin mit Leib und Seele – doch dann wird ihr unbeschwertes Rockstarleben zutiefst erschüttert: Ein Unbekannter lockt während ihrer Konzerte Fans an einsame Orte … und ermordet sie in grausamen Ritualen! Aber kann dies wirklich etwas mit den unheilvollen Träumen zu tun haben, die Lisa quälen? Zunächst will sie nicht glauben, dass sie schon einmal gelebt hat – und sich im elisabethanischen England auf einen Pakt mit dem Teufel selbst einließ. Doch schnell wird ihr klar: Sie wird heute jeden Tropfen dieser höllischen Kraft brauchen, um zu überleben! Der mehrfach preisgekrönte australische Horror-Roman endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: Kim Wilkins verbindet den dunklen Klang der Bestseller von Anne Rice mit der blutroten Action von Markus Heitz! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Infernalis – Das Teufelsmal« von Kim Wilkins. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn ein dunkles Erbe in dir erwacht … Lisa Sheehan ist Musikerin mit Leib und Seele – doch dann wird ihr unbeschwertes Rockstarleben zutiefst erschüttert: Ein Unbekannter lockt während ihrer Konzerte Fans an einsame Orte … und ermordet sie in grausamen Ritualen! Aber kann dies wirklich etwas mit den unheilvollen Träumen zu tun haben, die Lisa quälen? Zunächst will sie nicht glauben, dass sie schon einmal gelebt hat – und sich im elisabethanischen England auf einen Pakt mit dem Teufel selbst einließ. Doch schnell wird ihr klar: Sie wird heute jeden Tropfen dieser höllischen Kraft brauchen, um zu überleben!
Der mehrfach preisgekrönte australische Horror-Roman endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: Kim Wilkins verbindet den dunklen Klang der Bestseller von Anne Rice mit der blutroten Action von Markus Heitz!
Über die Autorin:
Kim Wilkins ist in London geboren und in Australien aufgewachsen. Sie ist Autorin und Dozentin für Kreatives Schreiben und Buchkultur an der University of Queensland. Wenn sie gerade nicht schreibt oder lehrt, liebt sie es, durch nebelverhangene Landschaften zu spazieren, Led Zeppelin zu hören und über das England der Wikingerzeit oder pagane Mythologie zu lesen. Sie lebt mit ihrem Partner und ihren Kindern in Brisbane.
Die Autorin auf Facebook: facebook.com/KimAuthorPage/
Bei dotbooks erscheint von Kim Wilkins auch:
»Grimoire – Das magische Buch«
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Infernal« bei Arrow Books, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Das Teufelsmal« bei Heyne.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Kim Wilkins
Published by Arrangement with Kim Wilkins
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Stefan Hilden, hildendesign.de unter Verwendung von © Shutterstock.com, Kanea, vseb
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-446-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Infernalis« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kim Wilkins
Infernalis – Das Teufelsmal
Mystery-Thriller
Aus dem Englischen von Thomas Hag
dotbooks.
Dem Andenken an Lyall Wilkins gewidmet, der sicher sehr stolz gewesen wäre.
Vipern und Schlangen, laßt mich atmen!
Grausige Hölle, verschlinge mich nicht!
Bleib fort, Luzifer!
Ich verbrenne meine Bücher …
CHRISTOPHER MARLOWE, Doctor Faustus
Prolog
Vielleicht ist man erst dann wirklich erwachsen, wenn man erkennt, daß man nicht der einzige Mensch ist, dessen Existenz zählt, wenn man sich bewußt wird, daß auch außerhalb der eigenen Wahrnehmung andere leben und atmen. Ich machte diese Erfahrung an dem Tag, als ich von dem ersten Mord hörte.
Während ich am Abend zuvor auf der Bühne gestanden hatte, war jemand in dem Kiefernwäldchen vor der Stadt getötet worden. Meine Phantasie arbeitet, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, und die Nachricht löste eine endlose Kette morbider Gedanken bei mir aus. Ich formte mir ein genaues Bild davon, wie es gewesen sein mußte, so zu sterben, und verband es mit dem, was ich zur gleichen Zeit getan hatte, als habe meine Band den Soundtrack zu dem realen Alptraum des Opfers gespielt.
Mehr noch; mein Job war mir so wichtig und bedeutsam vorgekommen, aber angesichts dessen, was er durchlitten hatte, waren wir nichts weiter als Möchtegern-Rockstars, die ihre nichtigen bürgerlichen Ängste als echten Weltschmerz verkauften. Ich trat meinen Mikrofonständer um; er wußte, daß er sterben würde: den Kopf hin und her werfend, bettelnd, flehend, entsetzt, nach Furcht stinkend. Ich ließ mich von der Menge tragen, schreiend, ließ mir von den Leuten unter mir an den Haaren und den Kleidern ziehen. Er war an einen Baum gefesselt, und vielleicht schrie er auch. Ich artikulierte jedoch einen vermarktbaren Schmerz, während seiner echt und rein war und aus der Quelle der Seele stammte, aus der wir nur in unseren schwärzesten Träumen trinken. Während sich die Menge in Bierlachen und unsterblichem Teenager-Frust suhlte, wurde ihm die Brust aufgeschlitzt … Überall Blut und Knochensplitter, und bevor seine Augen sich für immer verdunkelten, schaute er in sein Innerstes – und das meine ich nicht im spirituellen Sinn. Wann gab er die Hoffnung auf, vielleicht doch noch davonzukommen – daß jemand helfen und einen Krankenwagen rufen und daß alles wieder gut würde? Daß alles so bleiben würde wie bisher – obwohl dieser Irre ihm eine Handvoll lebenswichtiger Organe aus dem Körper gerissen hatte?
Während ich meinen Job machte, erlebte er den Alptraum einer ganzen Welt.
Es ist seltsam, wenn ich heute an diesen Tag denke. Es war der Tag, an dem sich alles änderte. Damals wußte ich es noch nicht.
Kapitel 1
Ich haßte den Freitag. An diesem Tag absolvierte ich eine Doppelschicht und fühlte mich deshalb bereits, wenn ich Freitagmorgen aufwachte, so erschöpft, daß ich fast wieder einnickte, noch bevor ich die Augen ganz offen hatte.
In einer Underground-Band zu spielen war cool, aber man verdiente nicht viel. In einer Kellerbar im Treasury Casino im Abendkleid und mit Perücke billige Celin-Dijon-Songs zu trällern, war nicht cool, aber man kann sich leicht vorstellen, warum ich es tat. Ich wohnte gerne in der Stadt, ich aß gerne gut, und ich kaufte mir gerne dann und wann eine CD. Ich beugte mich den wirtschaftlichen Notwendigkeiten wie jeder in unserer materialistischen Gesellschaft, und deshalb verkaufte ich mich Freitagabend, wenn ich mit Brad als Duo auftrat. Damals hoffte ich, bald reich und berühmt zu sein und glaubte daran, daß die kommenden BMW- und Kaviartage die Jahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Bohnensuppe irgendwie aufwiegen würden.
An diesem Morgen jedoch fand ich, daß es wieder nur ein beschissener Freitag war, den ich wie üblich erdulden mußte. Er sollte jedoch weitaus schlimmer werden als sonst. Ich drehte mich auf die andere Seite, schaltete das Radio ein und bekam gerade noch das Ende eines Regurgitator-Songs mit, bevor die Nachrichten kamen. Was ich hörte, war folgendes:
Heute morgen entdeckten Jogger in einem Kiefernwäldchen bei Brisbane die verstümmelte Leiche eines Mannes, der an einen Baum gefesselt war. Die Polizei geht davon aus, daß der Tod gegen ein Uhr morgens eingetreten ist und sucht nach eventuellen Tatzeugen. Bis jetzt gab es noch keine offizielle Bestätigung dafür, daß dem Opfer Herz und Augen fehlten. Der Name des Toten wurde noch nicht bekanntgegeben.
Das war alles, gefolgt von einer Geschichte über einen Hund in Deutschland, der seinem Frauchen das Leben gerettet hatte, und den Ausflugstips fürs Wochenende.
Um ein Uhr hatte ich auf der Bühne des Fire Fire gestanden, wo meine Band, 747, jeden Donnerstagabend spielte, weil der Veranstalter und unser Drummer eine Vorliebe für die gleichen Drogen teilten. Wir waren für eine Lokalband ziemlich bekannt und standen davor, in die Oberliga aufzusteigen. Mit siebenundzwanzig war Brad der älteste von uns. Er und ich spielten schon seit neun Jahren in verschiedenen Bands zusammen; eben seit damals, als ich von zu Hause weggelaufen war, um Rockstar zu werden und wir mit einer zweitklassigen Coverband eine Tour durch den Norden gemacht hatten. Aber wir haben nie miteinander geschlafen, obwohl er nur zu gerne gewollt hätte. (Okay, einmal haben wir’s gemacht, aber ich war erst sechzehn und hatte keine Ahnung. Seither wartete Brad auf eine Wiederholung – mit einer Engelsgeduld.) Wir beide spielten Gitarre und sangen. Ailsa war unsere extrem fette, neurotische, lesbische Bassistin, und Jeff, ein Wesen der Nacht mit strähnigen Haaren, gab unseren durchgeknallten Drummer. Wir kamen ganz gut miteinander aus, aber eigentlich war es eine Geschäftsbeziehung.
Wir vier hatten also gespielt, während dieser Typ ermordet wurde, und ich begann darüber nachzugrübeln, wie diese Welt eigentlich funktioniert, etwas, über das ich mir sowieso mehr Gedanken mache, als gut für mich ist. Ich hatte immer die Vorstellung, daß das Universum so was ähnliches wie ein großes Spinnennetz ist, in dem wir alle hängen. Jedesmal, wenn ein Unglück naht, spüren wir vorher das Zittern in den glitzernden Fäden, eine Warnung, aus dem Weg zu gehen. Aber so funktioniert es nicht. Das Problem bei einem Spinnennetz ist seine Zartheit. Manchmal reißt es ohne Vorwarnung. Manchmal begegnet dir ein Perverser, der dir die Augen aus dem Kopf schneidet.
Ich stellte mir vor, wie das Verbrechen geschehen sein mochte … als das Telefon klingelte. Natürlich konnte das nur Karin sein, weil sonst niemand wagte, mich vor zwölf Uhr mittags anzurufen. Sie wußte, daß ich endlose Geduld mit ihr hatte, besonders jetzt: Schließlich wollte sie am nächsten Tag heiraten und schwankte zwischen Aufregung und Angst hin und her.
»Lisa? Ich bin’s.«
»Hi Karin. Ich wußte, daß du es bist. Das Klingeln klang nach dir.«
»Hmmh.« Das war eines der Dinge, die ich an Karin liebte, wie sie ›hmmh‹ sagte, wenn sie der Meinung war, daß ich etwas sehr Unwitziges geäußert oder einen völlig blöden Vorschlag gemacht hatte, was recht oft vorkam. Ich hatte viele Bekannte, aber nur eine gute Freundin, und diese Freundin war Karin. Was darauf hindeutet, daß ich nicht immer die Rebellin gespielt hatte. Karin und ich waren zusammen aufgewachsen und hatten mit Puppen gespielt. Brad mochte Karin zwar, aber er hatte nie verstanden, warum wir uns so eng verbunden fühlten. Jeder Fremde merkte sofort, daß wir vollkommen verschieden waren. Vielleicht ergänzten wir, was der anderen jeweils fehlte – Karin blühte auf, wenn sie von meinen Eskapaden hörte, während ich mich an ihrer Verläßlichkeit aufrichten konnte. Sie war ein echtes Goldstück, man mußte sie einfach liebhaben. Und deshalb war ich höllisch eifersüchtig, weil sie heiratete. Ich wollte sie für den Rest meines Lebens ganz für mich allein, aber wenn eine vierundzwanzigjährige Jungfrau sich Hals über Kopf in einen zweiundvierzigjährigen Buchhalter verliebt, ist auch die besitzergreifendste beste Freundin machtlos.
»Was ist los?« fragte ich, denn irgend etwas mußte los sein – sie würde mich nicht anrufen, nur um ein bißchen zu plaudern. Schon deswegen nicht, weil sie sich vollkommen unwohl fühlte, wenn sie durch ein Gespräch ohne festes Thema steuern mußte.
»Dreimal darfst du raten. Jemand macht mir die Hölle heiß.«
»Wer könnte das denn sein?«
Sie bemerkte meinen sarkastischen Ton nicht einmal. »Lisa, du weißt, wen ich meine.«
Natürlich wußte ich das – Karins Mutter war berüchtigt für so etwas –, aber ich schwieg, weil ich nicht schon wieder diejenige sein wollte, die Dana Anders ein Biest nannte.
»Na schön«, sagte Karin schließlich. »Es ist meine Mutter. Dieses Mal hat sie sich selbst übertroffen.«
Kurz – nur ganz kurz und mit schlechtem Gewissen – dachte ich: ›Also gut, jetzt geht es los, Karin jammert über ihre psychotische Mutter, und letzte Nacht ist so ein armer Kerl im Wald aufgeschlitzt worden‹, aber dann verdrängte ich den Gedanken. Karin konnte nichts dafür, daß sie bis zu ihrer Begegnung mit David ein Leben wie in einer Puppenstube geführt hatte, und diese Liebesgeschichte würde sicherlich das Aufregendste bleiben, was ihr je zustoßen konnte. Ihre Mutter, Dana, war eine Tyrannin der übelsten Sorte, die ihre Tochter während der Teenagerjahre buchstäblich zu Hause eingesperrt hatte, damit sie nicht wegen eines Jungen ›in Schwierigkeiten‹ kam. Man muß wohl kaum erwähnen, daß ich nicht gerade Danas Liebling war, aber ich hatte mich nie abschrecken lassen, weil ich wußte, daß Karin eines Tages erwachsen werden und von zu Hause fortgehen würde. Nur hatte ich nicht damit gerechnet, daß sie es zusammen mit einem langweiligen alten Kerl tun würde.
»Was hat sie denn jetzt gemacht?«
Kaum hatte ich gefragt, als Karin schluchzend und stammelnd einige Worte hervorbrachte. Ich verstand ›Deutschland‹, ›Flugkosten‹, ›Verwandte‹, und ich nahm an, daß Dana ihr altes Blatt ausgespielt hatte, mit der Trumpfkarte ›Ich habe dich von Deutschland hierher gebracht, damit du es besser haben sollst. All meine Freunde und Verwandten habe ich zurückgelassen‹; und weiter dann mit ›David hat genug Geld, um ihnen die Flugreise zu bezahlen, aber er hat es nicht einmal angeboten‹. Wahrscheinlich hatte sie noch ein paarmal ›selbstsüchtig‹ und ›undankbar‹ untergemischt. Ich an Karins Stelle hätte die alte Fregatte ignoriert, aber ich war nicht an ihrer Stelle, und vierundzwanzig Jahre Gehirnwäsche lassen sich nicht durch eine sechswöchige Verlobung auslöschen.
Also sagte ich ein paar tröstende Worte, und Karin entschuldigte sich ungefähr ein dutzendmal. Ich ließ sie gewähren, weil ich sie zu sehr mochte, um mich über ihre Hypersensibilität zu ärgern. Was ich betonen möchte. Manchmal denke ich, daß ich sie inzwischen gar nicht mehr richtig kenne, und wir stehen uns auch sicherlich nicht mehr so nah. Zu viel ist geschehen.
Aber ich greife vor.
Als ich eine Viertelstunde später den Hörer auflegte, hatte sich ihre Stimmung deutlich gebessert. Ich hatte ihr nichts von der Leiche im Wald erzählt – und ärgerte mich fast, daß ich selbst nicht mehr daran gedacht hatte. Vielleicht beschäftigen wir uns mit trivialen Problemen, damit wir nicht schreiend vor dem Horror in der Welt davonlaufen.
Am Abend fragte ich Brad, was er über den Mord dachte. Er hatte stets interessante, wenn auch etwas oberflächliche Ansichten zu diesen Dingen. Wir stiegen an der Laderampe des Treasury in den Wagen, um zu unserem Auftritt im Universal Theatre zu fahren, einem alten Kino aus den Zwanzigern, das in eine halbseidene Neunziger-Bar umgebaut worden war. Es schien mir absurd, daß ein Mord, der in der Nähe geschieht, so bedeutsam wird, während überall auf der Welt Mord und Totschlag herrschen, und ich haßte mich dafür, daß ich es so aufregend fand, über den Tod zu sprechen. Trotzdem fing ich davon an. Alte Gewohnheiten kann man nicht einfach abschütteln.
»Hast du von diesem Typen gehört, der im Wald getötet wurde?«
»Ja, grauenhaft.«
»Macht es dich nicht auch ganz nervös?«
»Wieso – weil es ganz in der Nähe passiert ist?« Wir fuhren los.
»Ja, deswegen und … weil es jedem von uns passieren könnte, ohne Vorwarnung.«
Brad zuckte mit den Schultern. »Wir wissen ja gar nichts darüber. Vielleicht hatte dieser Typ mit einer dieser verrückten Sekten zu tun; vielleicht war er ein Drogendealer; vielleicht hätte er das gleiche mit einem zwölfjährigen Mädchen gemacht, wenn es nicht vorher jemand mit ihm gemacht hätte.«
Aus diesem Blickwinkel hatte ich es noch nicht betrachtet. Ich beobachtete die Leute, die vor uns die Straße überquerten. Eine große Frau in einem eleganten Abendkleid ging an uns vorbei, begleitet von einem offensichtlich betrunkenen Mann. Als sie auf der anderen Seite standen, beugte sich der Mann plötzlich vor und kotzte ihr vor die Füße. Brad lachte.
»Und?« fragte ich, das Thema wechselnd. »Haben Numb Records schon zurückgerufen?«
»Wenn, dann hätte ich es dir doch erzählt«, sagte er ungehalten. Mit dieser Frage eröffnete ich seit zwei Monaten fast jedes Gespräch.
»Es wird nicht klappen, ich weiß es«, sagte ich und ließ mich in den Sitz fallen.
»Mach keinen Aufstand, Lisa. Wir sind so nahe dran wie noch nie.«
Nun, ich war es langsam leid. Numb Records hatten uns angeschrieben und um ein paar Demos gebeten, nachdem sie mitbekommen hatten, daß es uns gelungen war, tausend CDs in Eigeninitiative zu verkaufen. Das war vor sieben Wochen gewesen, und wir warteten noch immer auf eine Antwort.
Wir parkten auf einem Schotterplatz einen Block vom Universal entfernt und gingen den Rest zu Fuß. Es war Februar, der dahinscheidende subtropische Sommer gab sich warm und nah, und die kühlen Wolkenkratzer ragten um uns herum in den Himmel. Brad zog seine Jacke aus und band sie sich um die Hüften. Zwei Typen kamen uns entgegen und riefen »He, 747!« bevor sie rauchend und lachend weitergingen.
Der Schwall der Klimaanlage im Universal traf mich mitten ins Gesicht, kurz bevor der dichte Zigarettenrauch in meine Lungen, mein Haar, meine Augen und Kleider kroch. Für einen Augenblick blieb mir die Luft weg. Ein paar Mädchen, die an der Bar standen, winkten mir zu, und ich winkte zurück, obwohl ich sie nicht kannte. Brad schlenderte zu ihnen und sagte einer etwas ins Ohr. Ich ging zur Bühne, wo mir Angie, unser Tontechniker, die Hand reichte und hinaufhalf.
»Wo ist Brad?« fragte er.
»Flirtet mit einer charmanten jungen Dame an der Bar. Warum?«
»Es gibt ein Problem mit seinem Lautsprecher. Was hat er gestern abend damit gemacht?«
»Nichts besonderes. Hat ihn nur beim letzten Song umgetreten, aber bei der Zugabe hat er noch funktioniert.«
»Ich rede lieber mal mit ihm.« Angie sprang von der Bühne und humpelte durch die Menge. Eines seiner Beine war kürzer als das andere, so daß er stets leicht schief ging.
Ich sah ihm nach, als mir eine Gruppe auffiel, die neben der Bühne stand. Sie trugen alle Schwarz und hielten Kerzen in den Händen. Wenn wir eine Goth-Band gewesen wären, hätte ich mich nicht weiter darüber gewundert, aber das waren wir nicht. Außerdem kannte ich sie, sie kamen oft, sozusagen als Stammkunden.
»Lisa, komm schnell nach hinten.«
»Was ist los? Warum sehen die da vorne alle aus wie Goths?« fragte ich, aber Ailsa zog mich sanft hinter die schweren, verrauchten Vorhänge in den Backstage-Raum, wo grelles gelbes Licht jede schmierige Ecke erleuchtete. Überall lagen Zigarettenkippen, und es stank nach schalem Bier und Pisse.
Jeff hüpfte von einem Fuß auf den anderen. »O Scheiße, Lisa, das errätst du nie, niemals.«
Ich hatte mich an Jeffs Anfälle von Euphorie gewöhnt, aber heute abend war er besonders aufgedreht. Seine Augen glänzten wie Knöpfe, und er lächelte glücklich, wenn auch auf eine leicht perverse Art.
Ailsa stieß ihn in die Rippen. »Das ist nichts, was einen freuen sollte, du Schwachkopf.«
»Was denn? Kann mich mal jemand aufklären?« fragte ich ungeduldig. Brad betrat den Raum.
»Dieser Typ – der Typ, der im Wald aufgeschlitzt worden ist«, sagte Jeff und deutete in Richtung Bühne. Seine Hände waren extrem groß, und seine Finger sahen aus wie dünne Würstchen. »Er war einer von ihnen. Er war ihr Freund, von denen in Schwarz. Er war einer unserer Fans.«
Ich wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton hervor.
»Ist das dein Ernst?« fragte Brad.
»Ja, es stimmt«, bestätigte Ailsa. »Er hieß Simon. Wißt ihr, so ein rothaariger Typ, der immer dieses Sonic Youth T-Shirt trug.«
»Der mit den Dreadlocks?« fragte Brad.
»Ja, genau der.«
Mit einem Mal schien sich die Wirklichkeit zu verändern, zusammen mit meinem Körper. Mein Magen hing irgendwo zwischen den Knien. Ich glaube, ich sagte ein paarmal ›Scheiße‹. Dann versuchte ich mich zu erinnern, wie er ausgesehen hatte, aber über Ailsas Beschreibung kam ich nicht hinaus; ich kümmerte mich nicht mehr so viel um die Leute, die uns zuhörten. Damals, als die Band angefangen hatte, war es mir noch gelungen, mir die Namen der Fans zu merken, die jedesmal kamen, aber bald wurden es zu viele.
»Ich rede mit ihnen«, sagte Brad. Ich sah ihn an, und mir fielen die Falten um seinen Mund auf. In dem grausam hellen Licht wurde mir klar, daß er mittlerweile neun Jahre älter war als jenes Bild von ihm, das ich in mir herumtrug, seit ich mich bei seiner Band beworben hatte. Jetzt sah er aus wie ein Erwachsener. Besonders jetzt.
»Ich komme mit«, bot ich an. Wir gingen zusammen hinaus, aber dann wurde Brad von Angie abgelenkt, der noch immer seinen Lautsprecher reparierte. Ich näherte mich der Gruppe in Schwarz allein, setzte mich auf den Bühnenrand und versuchte ein Lächeln; aber dann fand ich, daß es nicht angebracht sei und sagte einfach nur »Hi«.
Eine von ihnen, ein etwa neunzehnjähriges Mädchen, war offenbar völlig fertig. Sie legte ihre Hand auf mein Knie und schluchzte, einmal nur, aber sehr laut. Das Geräusch kam so unerwartet, daß ich das Echo bis heute höre.
»Es tut mir leid wegen Simon«, sagte ich.
»Wir wollten uns im Fire Fire treffen«, warf ein Typ ein, der Robert oder Rodney hieß.
»Ja«, sagte das Mädchen, »er rief mich um halb zehn an und sagte, ›wir sehen uns bei 747‹, und das war das letzte, was ich von ihm gehört habe. Er muß unterwegs … erwischt worden sein.«
O Gott, er war auf dem Weg zu uns gewesen.
»Weiß die Polizei, wer es getan hat?« fragte ich.
»Nein«, sagte Robert oder Rodney. »Wir waren gestern alle auf der Wache und haben unsere Aussagen gemacht. Jemand hat ihm die Augen herausgeschnitten, Lisa, und das Herz. Aber sie lagen nicht bei der Leiche. Wer immer es getan hat, hat sie mitgenommen.«
Ich hätte schreien können oder weinen. Mir wurde flau. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll … Es tut mir so furchtbar leid.« Dabei dachte ich: ›Warum sind sie heute abend hierhergekommen? Warum sitzen sie nicht trauernd zu Hause?‹ Wahrscheinlich gibt es nichts Schickeres als einen ermordeten Freund.
»Sein Lieblingsstück war ›Treehouse‹. Könntet ihr das heute abend ihm widmen?« fragte das Mädchen.
Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich nicht, daß ich überhaupt auf die Bühne gehen und singen und spielen könnte, aber ich sagte, ich würde es machen, und ging wieder nach hinten, um die anderen zu informieren. Er war auf dem Weg zu uns.
Ich wollte die Band überreden, unseren Auftritt abzusagen, aber sie sahen mich nur an, als sei ich verrückt geworden; wahrscheinlich hatten sie recht. Es gelang mir während des ganzen Auftritts nicht, mich zu konzentrieren. Jedesmal, wenn ich mich vergaß und in meinem Spiel aufging, fiel mein Blick auf die Trauergruppe, und ich landete wieder in der Realität. Sie standen den ganzen Abend reglos da, bedrängt von der schwitzenden, rauchenden Menge, und schauten zu uns herauf, während die helle Schminke ihre Gesichter herablief. Ich widmete Simon sein Lieblingsstück, ohne zu wissen, wer Simon eigentlich gewesen war.
In jener Nacht hatte ich Den Traum. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauerte, bis er so dominant wurde. Wahrscheinlich nachdem er sich drei- oder viermal wiederholt hatte.
Ich konnte lange Zeit nicht einschlafen, weil sich mein Hirn einfach nicht abschalten ließ. Seltsamerweise dachte ich nicht an Simon. Ich dachte an alles mögliche andere, wahrscheinlich bewußt. Immer wieder sah ich Brads Gesicht vor mir. Die tiefen Falten um seine Mundwinkel, die Erkenntnis, daß er alt wurde, daß wir alle älter wurden. Meine beste Freundin war erwachsen geworden und heiratete, und ich spielte noch immer den Rockstar wie ein kleines Mädchen. Ein Teil von mir gab sich wie früher rebellisch, während ein anderer mir sagte, daß mich der Rest der Welt auslachte und daß ich mir schleunigst einen Beruf und einen Ehemann suchen sollte. Schließlich nickte ich in den frühen Morgenstunden ein, zu jenem Zeitpunkt, an dem die Welt am dunkelsten und kältesten ist.
Irgendwie im dunklen Frieden meines Schlafes begann sich ein Bild zu formen. Ich war ein Teil dieses Bildes, aber als eine andere Person. Ich war größer und dünner, mit dunklem Haar, das über meine Schultern und das Vorderteil meines Kleides fiel. Ein solches Kleid hatte ich weder jemals besessen noch getragen. Es war steif, schnürte mich in der Taille ein und fiel bis ganz nach unten, wo es der Tau befeuchtete. Plötzlich wurde mir klar, daß es voller Blut war. Es war kein purpurrotes Kleid, wie ich zuerst gedacht hatte, sondern blau und blutgetränkt. Je näher ich hinsah, desto mehr Details fielen mir auf. Das Kleid war so naß, daß es an meinen Brüsten klebte. Ich betrachtete meine Hände. Sie waren mit Streifen eines blutigen Breis bedeckt. Dann spürte ich einen metallischen Geruch, sogar im Mund, denn er ging von meinen Haaren aus, die mir der Wind ins Gesicht schlug. Um mich herum roch es feucht und faulig, wie ein Komposthaufen nach dem Regen. Ich stand irgendwo in einem Wald oder einem verwilderten Garten. Neben mir weinte eine Frau, so laut, daß es fast wie ein Schreien klang. Meine Arme schmerzten, weil ich eine Art Karren schob, dessen Rad knarrte. Immer wieder knarrte. Mein Atem ging keuchend und mühsam.
Ich wünschte, sie würde aufhören zu weinen, ich wünschte, sie würde einfach damit aufhören, denn es war zu spät, viel zu spät. Er war bereits tot. Er lag in der Karre, ein roter Fleck breitete sich auf seiner Brust aus. Ich hatte das schreckliche Gefühl nahender Verdammnis und versuchte mir vorzustellen, wie der Tod roch und wie er klang. Ich wußte, daß ich ihn nur ein einziges Mal riechen und hören würde. Das Rad hörte nicht auf zu knarren, und ich paßte meinen Schritt dem Geräusch an. Mein Atem, ihr Schluchzen, ihr Weinen. In mir wuchs ein ungeheurer Druck, als wolle jede Sekunde etwas in mir explodieren. Ich wollte meinen Mund zu einem Schrei öffnen, aber meine Kiefer klebten zusammen und meine Zähne knirschten. Mühsam formte ich ein Wort, das mit einem gutturalen Laut begann.
Der Traum wiederholte sich, doch an dieser Stelle wachte ich jedesmal auf, noch mit dem Knarren des Rades im Ohr.
Ein sich wiederholender Traum ist immer beängstigend, um so mehr, als er aufgetreten war, nachdem ich erfahren hatte, daß einer unserer Fans auf dem Weg zu unserem Auftritt von einem Perversen ermordet worden war. Ich wurde mir meiner eigenen Sterblichkeit schmerzhaft bewußt. Zitternd knipste ich das Licht an. Ich mußte mich vergewissern, daß die reale Welt existierte, mit mir darin, zumindest jetzt noch.
Ich stand auf und sah mich in meiner Wohnung um, auf der Suche nach etwas, das mir Halt geben würde. Welche Unordnung. Auf dem verstaubten Schreibtisch türmten sich neben dem Computer Bücher und Magazine. Das Sofa ächzte unter der Last der schmutzigen Wäsche von zwei Wochen. Ich ging in die winzige Küche und schaltete fast automatisch den Wasserkocher ein. Verdammt, der Traum sollte aufhören.
Ich machte mir eine Tasse Kamillentee, schob die Tür zu meinem kleinen Balkon auf und setzte mich in den Liegestuhl. Ober den Dächern der Nachbarhäuser sah ich die Lichter der Stadt. Der Fluß strömte dahin, und die Welt atmete. Ich versuchte, mit ihr zu atmen.
Kapitel 2
Es war zwei Monate später, und ich stieg vor einem zweistöckigen Haus aus dem Taxi. Rosa Kletterpflanzen wanden sich die Mauern hinauf, hinter dem prächtigen Garten bot sich eine atemberaubende Sicht auf den Fluß, und in der Doppelgarage stand ein brandneuer japanischer Sportwagen. Und alles dafür, daß man fremden Leuten die Bücher führte. Offensichtlich hatte ich den falschen Beruf gewählt.
Es war Viertel nach zwei. Ich stand vor Davids Haus. Irgendwo da oben legte Karin ein pompöses weißes Kleid an und bereitete sich darauf vor, sich an einen langweiligen Buchhalter zu binden – bis sie sich irgendwann scheiden lassen würde. Sicher, sie hatte das Haus, das Auto und Geld, aber für mich war Langeweile schlimmer als der Tod. Für David und Karin vielleicht nicht.
Meine Stiefel knirschten auf der Kiesauffahrt, als ich auf die Haustür zuging. Ich trug Doc Martens und ein langes, geblümtes Kleid. Bestimmt würde es Karin nichts ausmachen, daß ich nicht entsprechend gekleidet war; aber ihrer Mutter schon. Es war eine meiner Hauptfreuden im Leben, Dana Anders zu verärgern. Ich hatte es sogar fertiggebracht, demonstrativ die Tätowierung auf meinem linken Arm zu präsentieren, obgleich ich das verdammte Ding fast genauso sehr haßte wie Dana. Genau deswegen sollten Mädchen nicht mit fünfzehn von zu Hause weglaufen, um in einer Rockgruppe zu spielen. Sie enden gezeichnet, ihr Leben lang. Buchstäblich.
Ich drückte auf die Klingel und wartete. David öffnete die Tür und bat mich herein.
»Lisa, wie geht es dir?« Er machte einen Schritt nach vorne, als wolle er mich umarmen, aber dann hielt er im letzten Moment inne und schuf eine unbehagliche Distanz zwischen uns.
»Gut. Alles bereit für den großen Augenblick?« Ich spürte, wie mir die banale Frage von den Lippen glitt, aber in Gegenwart dieses Mannes hätte ich nichts Originelles hervorbringen können, und wenn mein Leben daran gehangen hätte. Es war, als sei seine Langweiligkeit ansteckend.
»Ja, ja. Wir sind alle bereit. Karin ist ganz aufgeregt.« Er hatte eine sehr deutliche Aussprache, die ihn insgesamt etwas arrogant rüberkommen ließ.
»Ich weiß, sie war schon aufgeregt, als ich gestern mit ihr gesprochen habe.« Dann herrschte erst einmal Schweigen. Die Distanz zwischen uns war nicht zu überwinden.
»Also«, sagte er schließlich. »Dann geh mal rauf. Es ist die erste Tür links neben der Treppe. Ich komme nicht mit. Du weißt schon – bringt Unglück, die Braut vorher zu sehen und so.«
»Sicher. Danke. Bis nachher …«
»Ja, draußen. Bei der ähm … Zeremonie. Bis nachher.«
Ich ließ ihn stehen und ging nach oben. Der Boden war mit cremefarbener Auslegeware bedeckt. Es roch nach Farbe, und mir fiel ein, daß Karin erzählt hatte, David habe vor seinem Einzug das ganze Haus renovieren lassen, was ganze sechs Wochen her war, kurz nachdem sie sich kennengelernt, ineinander verliebt und in Windeseile beschlossen hatten, zu heiraten.
Ich klopfte sachte an die Tür ihres Zimmers. »Wer ist da?« rief sie.
»Ich bin’s.«
»Lisa?«
»Nein. Hermann Göring.«
»Gar nicht witzig. Komm rein.«
Sie sah so blaß aus. Sie war immer blaß, aber die Kombination von weißem Kleid und einer starken Dosis Angst verliehen ihr ein aschfahles Aussehen.
»Geht es dir gut?« fragte ich, ging zu ihr und ergriff ihre Hand.
»Ja, ich bin einfach nur nervös. Wie ich sehe, hast du den alten Blacky zur Schau gestellt.«
So nannte sie meine Tätowierung. Zu meinem ewigen Bedauern hatte ich mich damals nicht für einen zarten, mädchenhaften Schmetterling entschieden, sondern für ein schwarzes, keltisches Ringmuster um meinen Oberarm. Brad trug das Gegenstück an seinem rechten Arm. Ich war immer noch sauer auf ihn, weil er mich dazu überredet hatte, denn er war älter und hätte es besser wissen müssen.
»Ja, ich dachte, ich versetze Dana noch einen letzten Schock, bevor ich sie nie mehr wiedersehe.«
»Ich werde sie weiterhin sehen müssen«, sagte Karin, trat ans Fenster und schaute auf den Garten hinaus. »Sie ist noch nicht hier, Gott sei Dank.«
»War es wirklich so schlimm?«
»Du machst dir keine Vorstellung. Sie hat mich die ganze Woche gequält. Ich wollte schon früher bei David einziehen, aber er ist sehr traditionell in diesen Dingen. Außerdem wäre das der letzte Schlag für meine Mutter gewesen, wenn ich an meiner Hochzeit ein weißes Kleid getragen hätte, ohne das Recht dazu zu haben. Sie findet es schon schlimm genug, daß wir uns nicht kirchlich trauen lassen.«
»Sie geht doch gar nicht in die Kirche«, sagte ich und stellte mich neben sie.
»Frag mich nicht. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgeht.« Sie sah mich an. »Danke, daß du gekommen bist.«
»War doch klar. Bist du sicher, daß du all dies willst?«
»Hör auf.«
»Ich wollte es nur wissen.«
»Natürlich bin ich mir sicher. Mein Gott, was habe ich je sonst gehabt oder gemacht?« Sie ließ sich auf das Bett fallen, und das Kleid bauschte sich um sie herum auf.
»Tut mir leid, war nur eine Frage. Ich wollte damit nichts andeuten.«
»Du hast Glück gehabt, Lisa. Du hast immer ein interessantes Leben geführt. Du bist von zu Hause weggelaufen, du spielst in einer Band, du kommst herum, und eines Tages wirst du sicher berühmt sein. Ich habe die Schule beendet und poliere den Leuten seitdem die Fingernägel. Ich poliere den Leuten jetzt seit sieben Jahren die Fingernägel. Bevor mir David über den Weg gelaufen ist, habe ich nie etwas Spontanes oder Romantisches getan.«
»Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Ich hoffe, du tust es nicht nur aus Trotz.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nimm meine Gefühle ruhig ernst, Lisa, ich habe mich wirklich verliebt.«
»Nun, dann hast du mir eines voraus.« Ich schämte mich, daß sie das zu mir gesagt hatte, denn vielleicht hatte ich ihre Gefühle wirklich nicht ernst genommen.
»Ich bin so nervös«, sagte sie und griff mit kalten Fingern nach meiner Hand.
»Keine Panik, ich bin bei dir.«
»Du wirst nicht dabei sein, wenn das geschieht, wovor ich am meisten Angst habe.«
»Ich hab dir gesagt, du sollst die Katze nicht im Sack kaufen.«
»Mein Gott, ich bin so lange Jungfrau, da kam es auf die sechs Wochen auch nicht an.« Sie blickte nach unten, und ihr blasses Gesicht überzog sich mit einer leichten Röte. »Kannst du mir irgendwelche Tips geben?«
»Sicher. Männer mögen es, wenn man sich nicht wäscht.«
»Komm, ernsthaft.«
Ich fuhr mir mit der Hand durchs Haar. Mir war bei der Sache so unwohl wie ihr. »Ich weiß nicht … Er ist älter und wahrscheinlich viel konservativer als die Typen, mit denen ich geschlafen habe.«
»So alt ist er gar nicht.«
»Für mich ist er uralt, Karin.«
»Er hat eine tolle Figur.«
»Wann hast du denn das gesehen?«
»Ich hab ihn mal ohne Hemd gesehen. Kein Gramm zuviel. Nicht so wie dein Brad mit seinem Bierbauch.«
»Brad hat keinen Bierbauch.«
»Dann sieh mal genauer hin. Als wir am Dienstag beide bei dir waren, ist mir aufgefallen, daß er ein bißchen füllig um die Hüften wird.«
Großartig. Brad hatte also nicht nur Falten, sondern auch einen Bierbauch. Vielleicht war David wirklich nicht zu alt, und vielleicht sollte ich nicht mehr zu lange warten, wenn ich doch noch mit Brad zusammenkommen wollte.
»Na schön«, sagte ich. »Sei nur nicht schüchtern und habe keine Angst zu sagen, was du magst.«
Sie kicherte. »Ich weiß nicht recht.«
»Du brauchst ja nicht ins Detail zu gehen. Schneller, fester oder langsamer reicht ja schon.«
»Schneller, fester, langsamer«, wiederholte sie und prustete vor Lachen.
Ein scharfes Klopfen ertönte an der Tür, begleitet von einer schneidenden Stimme mit den Resten eines Akzents.
»Kommst du jetzt raus und heiratest oder was?« fragte Dana.
Karin verzog das Gesicht. »O Gott, ich wünschte, sie würde mich in Ruhe lassen.«
»Ich kümmere mich um sie. Du nimmst dir noch fünf Minuten, atmest tief durch und denkst an etwas Schönes. Ich bringe sie in den Garten. Denk daran – wenn du das nächstemal mit mir sprichst, bist du verheiratet.«
»Ich glaube, mir wird schlecht.«
Ich drückte sie kurz an mich. »Keine Bange. Morgen wachst du in einem Haus ohne Dana auf. Nach vierundzwanzig Jahren endlich frei. Jubiliere!«
Ich ließ sie mit nachdenklichem Gesicht auf dem Bett sitzen und ging zu Dana hinaus.
»Guten Tag, Mrs. Anders. Wie geht es Ihnen?«
»Gut. Kommt sie jetzt oder was?«
»Oh, sie besinnt sich nur noch mal kurz. Gehen wir schon in den Garten.« Ich ging mit Dana die Treppe hinunter.
»Ich nehme an, du freust dich«, sagte sie. »Jetzt brauchst du mich nicht mehr zu sehen, wenn du Karin besuchst. Ich werde sie wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Nach allem, was ich für sie getan habe, läßt sie mich im Stich.«
»Mrs. Anders, ich bitte Sie, heute ist Karins Hochzeit. Freuen Sie sich nicht für Ihre Tochter?«
Sie wandte sich mir zu und hielt mir den Zeigefinger vors Gesicht. »Mich für sie freuen? Ich habe sie aus Deutschland hierhergebracht, als sie vier Jahre alt war, weil sie es einmal besser haben sollte. Ihr Vater war ein Säufer und Spieler, und ich wollte sie seinem Einfluß entziehen. Dafür habe ich meine Familie und meine Freunde zurückgelassen. Aber ich habe es für sie getan. Und das ist der Dank. Eine sechswöchige Kündigungsfrist, und dann verläßt sie mich, ohne sich um meine Gefühle zu kümmern oder daran zu denken, was jetzt aus mir wird.«
An dieser Stelle hätte ich sagen sollen: »Bei allem Respekt, Mrs. Anders …«, aber ich würde den alten Drachen mit seiner spitzen Zunge schließlich nie mehr wiedersehen und brauchte keine Rücksicht zu nehmen. »Sie sind ja verrückt. Haben Sie mal daran gedacht, daß Sie es sind, vor der Karin davonläuft, und zwar nicht weil sie egoistisch ist, sondern weil Sie es sind? Wahrscheinlich haben Sie Karins armen Vater in den Suff getrieben. Wahrscheinlich war er ein verdammter Jesuitenpater, bevor Sie ihn in die Finger kriegten.«
»Du kleine Schlampe«, zischte sie. »Du und deine ekelhafte Tätowierung, wie ein Hure, und deine schmutzigen Musiker, mit denen du deinen Körper auf der Bühne zeigst. Ich weiß, was du treibst!« Sie stürmte davon, und ich lief ihr nicht hinterher, denn ich hatte meinen Spaß gehabt, auch wenn ich gerne noch gehört hätte, was ich auf der Bühne so alles trieb.
Dana und ich waren nicht immer Erzfeinde gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie Karin und mir Saft und Kekse brachte, wenn wir spielten, und es gab eine Zeit, in der ich sie lieber mochte als meine eigene Mutter, weil sie so blond und hübsch war wie die Frauen im Fernsehen. Aber als Karin auf die High School kam und eine eigene Persönlichkeit entwickelte, gab es einen Knacks. Dana verwandelte sich in einen besitzergreifenden Vampir. Vielleicht hatte sie Angst vor dem Alleinsein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es komplexer, aber ich haßte sie viel zu sehr, um mich mit dem psychologischen Aspekt zu befassen.
Ich folgte Dana in den Garten und beobachtete, wie sie in der ersten Reihe Platz nahm und ein Taschentuch aus ihrer Handtasche holte, um sich die Augen trocken zu tupfen. Offensichtlich hatte ich ziemlich genau getroffen. Vielleicht war Karins Vater tatsächlich ein Jesuitenpater. Nicht daß Karin etwas davon gewußt hätte; Dana hatte sich stets geweigert, ihr etwas von ihm zu erzählen.
Ich setzte mich nach hinten, allein schon, um eine Distanz zwischen mir und Dana zu schaffen. Vor mir sah ich ihren Hinterkopf, und das Sonnenlicht verwandelte ihr helles Haar in einen Heiligenschein. Welche Ironie.
Kurz darauf drückte jemand die Play-Taste eines Kassettenrecorders, der auf einem Tisch unter dem Zeltdach stand, und eine Art kirchliche Hochzeitsmusik erklang. Karin kam aus dem Haus hinter mir und ging nach vorne, wo David sie erwartete. Niemand führte sie. Ihre Mutter hatte Karin nicht fragen wollen, und wenn sie jemand anderen gebeten hätte, wäre Dana wahrscheinlich ins Wasser gesprungen, um sich als Märtyrerin darzustellen.
Die Zeremonie begann, unter der Leitung einer dicken Frau in einem glänzenden, grünen Kleid. Ich schaute ins Leere, während mir die Idee für einen neuen Song kam. Er war ziemlich gut, und ich probierte im Geiste aus, welche Instrumente und welche Tonarten sich am besten eigneten. Eine Fliege summte um mich herum. Die Hochzeit schien sehr weit entfernt, so als schaute ich durch das falsche Ende eines Fernglases. Der Himmel war an diesem Tag wolkenlos blau, wie geschaffen für eine Hochzeit, wenn man auf so was steht.
Ich glaube, es war kurz vor dem Jawort, als sich in den ersten Reihen etwas regte. Jemand gab würgende, heisere Laute von sich, und als ich aufblickte, konnte ich Danas blondes Haupt nicht mehr entdecken. Die Leute standen auf und gingen nach vorne, und Karin und David hatten sich umgedreht. Karin schrie »Mum!«, und mir wurde klar, was geschehen war. Dana hatte doch noch ihren großen Auftritt als Mutter der Braut. Ich sprang auf und schob mich durch die Menge nach vorne. Sie lag zuckend auf dem Boden, griff sich an die Brust und stieß diese besorgniserregenden, würgenden Laute aus.
Karins Chef aus Becky’s Beauty Bar kniete über Dana. »Einen Krankenwagen, einen Krankenwagen!« rief er, aber ich wußte, daß hier keiner nötig war. Sie schauspielerte ganz offensichtlich.
»Ich brauche keinen Krankenwagen!« kreischte Dana nun, richtete sich auf und trommelte mit den Fäusten auf ihren Schoß. »Ich brauche ein neues Herz, weil sie mir das alte aus der Brust gerissen hat.« Ihr Gesicht war rot und geschwollen, sie weinte und weinte und preßte die Fäuste gegen die Augen wie ein Kind, das einen Wutanfall hat.
Nun brach auch Karin in Tränen aus. »Mutter, wie kannst du nur?« schluchzte sie. »Wie kannst du nur?« David legte seinen Arm um sie und versuchte, sie zu trösten.
Becky half Dana auf und führte sie ins Haus, eine traurige, schwankende Gestalt. Karin hatte sich zu David gewandt und sagte immer wieder zu ihm: »Wie konnte sie nur?« Sie tat mir leid. Es sollte ihr Tag werden, und ihre Mutter hatte ihn ihr ruiniert. Ich dachte einen Augenblick mit schlechtem Gewissen darüber nach, ob mein Streit mit Dana der Auslöser für den Anfall gewesen war, kam aber zu dem Schluß, daß sie wahrscheinlich alles schon seit sechs Wochen geplant hatte.
Die Leute setzten sich wieder. Ich wollte Karin noch einen beruhigenden Blick zuwerfen, aber David hatte sich mit ihr bereits wieder zu der Frau in Grün umgedreht und wies sie an, weiterzumachen. Ich setzte mich. Der Song in meinem Kopf hatte sich in Luft aufgelöst.
Es war mir peinlich, vor der eigentlichen Feier zu verschwinden, aber ich mußte zum Soundcheck. Nachdem der Fotograf seine Arbeit getan hatte, ging ich zu Karin, umarmte sie und drückte sie an mich. Sie legte das Gesicht an meine Schulter, zart wie ein kleiner Vogel.
»Wo ist deine Mutter?«
»Becky hat sie nach Hause gebracht. Sie hat alles kaputtgemacht, Lisa.«
»Du bist verheiratet, oder? Das konnte sie nicht verhindern.«
»Ich bin an sie gekettet, bis sie stirbt. Falls sie stirbt. Sie würde wahrscheinlich aus reinem Trotz damit warten, bis ich tot bin.«
»Unsinn. Du bist zu nichts verpflichtet. Du kannst sie vergessen, wenn du willst.«
»Lisa, sie hat sonst niemanden.«
Offenbar hatten vierundzwanzig Jahre Gehirnwäsche Wirkung gezeigt. Ich klopfte ihr auf die Schulter. »Tut mir leid, daß ich nicht bleiben kann.«
»Ach, schon gut. Ich weiß, es ist nicht deine Szene, aber mir macht’s Spaß, mal im Mittelpunkt zu stehen.«
»Du kannst ja nach dem Dinner mit deinen Gästen ins Black Flag kommen, die Band anhören.«
»Hmm. Eher nicht.«
Ich küßte sie zum Abschied, suchte David und gab ihm die Hand. Eigentlich wollte ich mehr zu ihm sagen als nur ›Alles Gute‹, wollte ihm sagen, wie wichtig es war, daß er Karin die Chance gab, das nachzuholen, was ihre Mutter ihr genommen hatte, aber ich konnte es nicht. Er war zu normal; es wäre uns beiden peinlich gewesen.
Den Montagmorgen verbrachte ich damit, die Wiederwahltaste meines Telefons zu drücken – achtunddreißig Mal. An jedem Wochentag gab es eine Radiosendung mit einer Traumdeuterin, und ich wollte unbedingt zu ihr durchkommen. Endlich antwortete jemand, fragte mich nach meinem Namen und bat mich, in der Leitung zu bleiben. Übers Telefon konnte ich die Sendung verfolgen. Ein Typ erging sich in detaillierten Schilderungen seines Traums, die nicht enden wollten. Alles wurde durch Sätze wie »und dann war ich plötzlich in …« zusammengehalten; die Szenen jagten einander wie bei einer australischen Seifenoper. Ich wünschte nur, er würde bald aufhören, damit ich drankam. Mein Herz pochte heftig.
Ich hatte bestimmt eine halbe Stunde gewartet, als ich schließlich an der Reihe war. »Lisa, sind Sie da?« fragte der Moderator.
»Ja, hi.«
»Erzählen Sie uns Ihren Traum, Lisa«, sagte die Traumdeuterin.
»Okay. Also, ich trage ein altmodisches Kleid, und ich weiß, daß ich es bin, auch wenn ich anders aussehe. Ich bin ganz mit Blut bedeckt, und ich schiebe dieses Ding, eine Art Schubkarre, in der ein toter Mann liegt. Ich gehe durch einen Wald, und neben mir geht ein anderes Mädchen, das dauernd weint und gar nicht damit aufhört. Ich bin total angespannt, als würde mir gleich der Kopf platzen, und das Rad der Schubkarre knarrt und knarrt. Es macht mir wirklich Angst, denn ich hatte diesen Traum schon neunmal, und er ist so realistisch, daß ich nie das Gefühl habe, zu träumen.« Der leise Ton der Verzweiflung, den ich aus meiner Stimme heraushörte, beunruhigte mich. Vielleicht hatte ich diesen dummen Traum zu lange verdrängt.
»Mein Gott, Lisa, das ist wirklich ein starker Traum. Neunmal, sagten Sie?«
»Ja, seit Anfang des Jahres.«
»Neunmal in acht Wochen? Ich glaube, das Universum will Ihnen wirklich etwas sagen.«
»Und was?«
»Ich würde sagen, daß es eine Erinnerung aus einem früheren Leben ist. Ich glaube, daß Ihnen in einem früheren Leben etwas zugestoßen ist und daß dies jetzt aus irgendeinem Grund wichtig für Sie wird.«
»Sie meinen damit, daß ich diese Dinge in einem früheren Leben wirklich getan habe?«
»Vielleicht, es muß aber nicht so sein. Es könnte auch ein Symbol für etwas anderes sein. Das ganze Blut – es könnte die Lebensenergie des toten Mannes symbolisieren, wissen Sie. Ich denke, Sie sollten sich in Ihrem Leben umschauen, ob Sie vielleicht jemanden die Energie rauben, ihn aussaugen. Wahrscheinlich ist es jemand aus diesem früheren Leben.«
Das schien mir wenig Sinn zu ergeben, aber ich wollte nicht vor Tausenden von Hörern mit ihr streiten. »Okay«, sagte ich. »Danke.«
»Keine Ursache, Lisa. Wie ich schon sagte, es hat definitiv etwas mit einem früheren Leben zu tun. Vielleicht sollten Sie dieser Idee nachgehen. Es gibt eine Menge Angebote an Therapien.«
Sie schalteten mich ab und gingen zum nächsten Anrufer über. Als ich auflegte, fiel mir ein, daß ich vergessen hatte, die Band zu erwähnen. Brad würde mich umbringen, wenn er das erfuhr.
Die Idee mit der Reinkarnationstherapie war mir auch schon gekommen. Im allgemeinen glaubte ich an nichts – das kalte, harte Licht des Zynismus kam mir wesentlich wünschenswerter vor als das Risiko, mich durch einen peinlichen Anfall von Glauben lächerlich zu machen. Andererseits schien Reinkarnation eine sehr attraktive Lösung für ein ansonsten unlösbares Problem zu sein. Was geschieht, wenn wir uns von dieser Existenz verabschieden? Bleibt etwas von uns übrig? Ist der Tod das Ende oder nur ein Haltepunkt in einem Kontinuum? Ich erinnerte mich daran, wie oft mir in meiner Kindheit kurz vor dem Einschlafen ein Gedanke gekommen war, der furchtbar wichtig erschien; aber kaum hatte ich mich darauf konzentriert, trieb er auch schon davon, hinein in den dunklen Flur, aus dem die Gedanken nie mehr wiederkommen. Alles, woran ich mich erinnern konnte, war, daß ich in dieser Gedankenvorstellung irgendwie nicht ich selbst gewesen war, sondern jemand anderer, in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Vielleicht sollte ich diese Idee von der Wiedergeburt akzeptieren, vielleicht. Aber ich fragte mich immer noch, was am besten als nächstes zu tun wäre.
Mir fiel ein Café in der Stadt ein, an dessen Außenfront ich ein Schild gesehen hatte, das für Tarot und Rückführungen warb, und da der 485er Bus stadteinwärts in knapp zehn Minuten fuhr, schnappte ich mir meinen Rucksack und verließ die Wohnung. Ich wußte, wenn ich noch lange darüber nachdachte, würde ich zu dem Ergebnis kommen, daß es vollkommen blödsinnig war, und ich würde nicht gehen.
Das Café lag an einer großen Kreuzung; nicht gerade förderlich für das Geschäft. Das Geräusch der vorbeibrausenden Busse und die Abgase, die jedesmal hereinströmten, wenn die Tür aufging, schreckten die schicken, kosmopolitischen Kaffeehausbesucher garantiert ab. Als ich ankam, saßen nur zwei Leute in einer Ecke, tranken Kaffee und unterhielten sich, zweifellos über einen französischen Film, den sie beide nicht ganz verstanden hatten. Ich ging zur Theke, wo sich ein gutaussehender junger Mann, wahrscheinlich ein Student oder ein Schauspieler, der etwas dazuverdienen mußte, die Hände an der Schürze abwischte und mich mit einem sexy Lächeln begrüßte.
»Hi, was möchtest du?« fragte er beinahe suggestiv. Vielleicht bildete ich mir das Suggestive nur ein.
»Hi. Ich komme wegen einer Rückführung.«
»Oh. Sekunde, ich sage Laura Bescheid.« Er drehte sich um und griff zum Telefon. Ich wartete und sah zu, wie draußen der Verkehr vorbeifloß.
»Sie kommt gleich«, sagte der junge Mann und wandte sich wieder mir zu. »Möchtest du in der Zwischenzeit einen Kaffee?«
Ich trinke lieber Rattengift als Kaffee, daher lehnte ich ab und setzte mich. Bald darauf rauschte Laura durch eine mit Perlenschnüren verhangene Hintertür, und als erstes fiel mir auf, wie normal sie aussah. Ich hatte angenommen, daß sich eine psychische Wegbereiterin so stylen würde, daß es meinen sechsten Sinn ansprach. Sie war hausbakken, mittelalt, füllig, ihr Haar wurde langsam grau, und sie trug ein wirklich häßliches blaues Kostüm und einen lila Schal. Wenn ich an diesem Punkt davongelaufen wäre, hätte ich fünfzehn Dollar gespart.
Die Frau führte mich durch die Perlentür und durch die Küche in einen winzigen, weiß gestrichenen Raum, an dessen Wänden Dutzende Bilder von Delphinen oder Pyramiden hingen. Auf manchen waren sogar Delphine und Pyramiden. Ich beschloß sofort, ihr nichts von meinem Traum zu erzählen, um ihr keinen Einstieg zu ermöglichen. Wenn sie keine Hochstaplerin war, würde sie es auch so wissen.
»Also«, sagte sie, »ich bin Laura.«
»Ich bin Lisa«, entgegnete ich, während sie mich an einen Kartentisch bat. »Ich möchte eine Rückführung.«
»Das sagte mir Adrian bereits. Irgendein bestimmter Grund?«
Ha. Sie versuchte, mir Informationen zu entlocken. »Nein.«
Sie wartete ein paar Sekunden, als könne mich die Stille bewegen, mehr preiszugeben, als ich beabsichtigte. Im Hintergrund dudelte irgendeine beschissene New-Age-Musik, die ein Ignorant mit zu vielen technischen Apparaten und zu wenig Talent zusammengeschustert hatte. Ich machte schon jetzt eine schlechte Erfahrung durch.
»Nun, ich sehe dich in einem langen Kleid, Lisa,« begann die Frau unvermittelt.
Ich fuhr zusammen. Konnte sie mir wirklich etwas sagen?
»Umgeben von Büchern. Es ist das neunzehnte Jahrhundert, und du lebst in einem alten Pfarrhaus in England.«
Es wurde interessant, auch wenn ich mir sicher war, daß ich in meinem Traum kein viktorianisches Kleid trug. Ich war nicht besonders bewandert in Geschichte, aber sie lag bestimmt zwei Jahrhunderte daneben.
»Ich sehe dich schreiben. Du bist sehr geduldig …«
Sie malte das Bild immer weiter aus, und ich hörte ihr zu, spürte aber keinen Kontakt zu ihr oder dem, was sie sagte. Schließlich kniff sie die Augen zusammen. »Ein Name, ich spüre, wie sich ein Name formt …«
Die Spannung brachte mich fast um. Nein, doch nicht.
»Jane Eyre«, stieß sie triumphierend hervor und sah mir in die Augen.
»Sind Sie sicher, daß Sie nicht Charlotte Bronte meinen?« fragte ich.
Sie lächelte mich an, als sei ich ein verwöhntes Kind. »Lisa, wir können uns nicht aussuchen, wer wir sind. Ich bin sicher, daß sich viele Leute sehr freuen würden, wenn sie herausfänden, daß sie eine so berühmte Schriftstellerin wie Jane Eyre waren.«
Sollte ich es ihr sagen?
»Ich wette, daß du Bücher liebst, hab ich recht?«
Vielleicht sah ich aus wie eine Studentin, und sie hatte es deshalb gesagt. Ich war ungewaschen, schlecht angezogen, und mein zerzaustes langes Haar hatte diese kupferfarbene Tönung, die man nur hinkriegt, wenn man mehrere Sorten billiger Färbung nacheinander benutzt.
»Ja, stimmt, ich liebe Bücher. Ich habe alle ihre Bücher gelesen«, sagte ich und fügte hinzu. »Wir lesen sie an der Uni.«
Sie schnippte mit den Fingern. »Ich wußte, daß du Studentin bist.« Offenbar war sie jetzt hoch zufrieden mit sich selbst, weil sie ein solch gutes Urteilsvermögen besaß. »Vielleicht solltest du wieder mit dem Schreiben anfangen.«
»Danke für den Ratschlag. Wieviel macht das?«
»Fünfzehn Dollar.«
In Gedanken wand ich mich, als ich zahlte. Das Geld hätte ich auch aus dem Fenster werfen können, aber es geschah mir recht, denn ich hatte etwas völlig Sinnloses getan – mir Rat bei jemand gesucht, der keine Ahnung hatte.
»Bye, Jane«, sagte sie, als ich ging. Sie schien auf einem anderen Stern.
»Wie ist es gelaufen?« fragte mich Adrian, der süße Schauspieler/Student/Kellner.
»Sie hat keinen Schimmer«, sagte ich. Er lachte. Wahrscheinlich wußte er das schon.
Am nächsten Morgen machte ich mir gegen drei Uhr eine Tasse Zitronentee, setzte mich an den Schreibtisch und startete den Computer. Es war die beste Zeit, um im Net zu surfen; keine Freaks, die meinen Server blockierten, weil sie Dungeons and Dragons spielten. Ich durchsuchte das Net nach New Age oder Naturtherapie-Seiten. Schließlich fand ich einen Psycho-Chat Room, in dem endlos über Todeserfahrungen berichtet wurde. Ich schickte eine Bitte nach Hilfe bei der Erforschung eines früheren Lebens ab, das in meinen Träumen auftauchte, hinterließ meine E-mail-Adresse und unterschrieb ›mit verzweifelten Grüßen, Lisa‹.
Brad hatte einen Schlüssel zu meiner Wohnung und ich einen zu seiner. Es war bequemer so – wir gingen dauernd bei dem anderen ein und aus, holten CDs oder Instrumente ab. Deshalb war ich nicht überrascht, daß er mich am nächsten Morgen mit einem Sprung in mein Bett aufweckte.
»Wie spät ist es?« murmelte ich und versuchte, die Augen zu öffnen.
»Zehn.«
»Laß mich weiterschlafen. Ich bin erst um vier ins Bett gegangen.«
»Aber ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen.«
»Dann mach mir eine Tasse Tee. Pfefferminze. In der grünen Schachtel auf dem Regal neben der Mikrowelle.«
Er ging in die Küche. »Ich weiß echt nicht, warum du dieses Zeug trinkst.«
»Es ist gut für meine Nerven«, entgegnete ich, gähnte und quälte mich aus dem Bett. Ich zog ein T-Shirt und Shorts über, ging in die Küche und setzte mich. Brad hatte die Zeitung mitgebracht und auf den Tisch geworfen. Ich schob sie beiseite und legte den Kopf auf die Arme.
Brad stellte eine Tasse mit Tee vor mir ab. »Möchtest du die Nachricht hören?«
Ich schaute auf und betrachtete seine Hüften. »Komm her«, sagte ich, zog ihn zu mir und schob sein T-Shirt hoch; Karin hatte nicht unrecht gehabt. Er entwickelte langsam richtige Rettungsringe. »Machst du eigentlich jemals Sport, Brad?« fragte ich und stieß ihm den Finger in seinen weichen Bauch.
»In der Zeit trinke ich lieber was«, sagte er, machte sich los und setzte sich mir gegenüber an den Tisch.
»Du könntest mit mir ins Fitneß-Studio kommen.«
»Numb Records haben heute morgen angerufen.«
»Was?« Jetzt war ich wach.
»Selena Soundso, ich hab’ den Namen vergessen. Nicht der Typ, der uns ursprünglich um unser Band gebeten hatte. Der ist vor zwei Wochen gegangen.«
»Und? Und?«
»Sie sagte, daß sie uns nicht vergessen haben. Es hängt aber noch von ihrem Budget ab, ob sie eine EP finanzieren. Im Augenblick ist es nur im Gespräch, aber wenn sie es machen, übernehmen sie den Vertrieb und alles. Die Scheibe wird dann überall zu haben sein.«
»Mann, das ist ja fantastisch. Glaubst du, es klappt?«
»Sie klang wirklich positiv. Aber bleiben wir ruhig, ich meine, sonst wird es ein echter Absturz, wenn sie doch nein sagen.«
Einmal, dieses eine Mal, erlaubte ich mir trotzdem zu hoffen.
»Es gibt aber noch mehr Neuigkeiten«, sagte er. »Wir sind berühmt geworden.«
»Wie das?«
Er schob mir die Zeitung hin. »Seite sieben.«
Mein schlaftrunkenes Ich wußte nicht genau, was hier ablief, aber gehorsam schlug ich die Seite auf. Ich sah ein großes Foto, auf dem ein junger Mann abgebildet war, der mir irgendwie bekannt vorkam, aber noch bevor ich ihn einordnen konnte, entdeckte ich ein einmontiertes Bild von uns, 747, eine schlechte Live-Aufnahme von einem Amateur.
»O Gott, was soll das?« murmelte ich. Dann las ich die Überschrift. TOTER LIEBTE MUSIK, SAGT SEINE MUTTER. Die Zeile unter dem Foto lautete: Das Opfer Simon Trussworth auf der Party zu seinem neunzehnten Geburtstag, eine Woche vor dem grausamen Mord.
»O nein«, stöhnte ich. Unter unserem Bild stand: 747 – die Lieblingsband des Opfers. »Großartig, wirklich großartig, ›Lieblingsband des Opfers‹. Warum können wir nicht die Lieblingsband des Dalai Lama oder so sein?«
»Es ist Publicity, umsonst.«
»Es ist grauenvoll.« Ich überflog den Artikel, sentimentales Gewäsch über Simons verzweifelte alleinerziehende Mutter. Zwischen Zeilen wie ›Simon war ein wilder Junge, aber ein guter‹ und ›Ich glaube, daß er mit Drogen experimentiert hat, aber er war klug und wußte, wann es Zeit war aufzuhören‹ spürte man die Absicht des Autors, subtil anzudeuten, daß Simons Lebensstil den Mord herausgefordert hatte. Jeder Normalo, der die Story las, konnte sich sicher fühlen, daß ihm so etwas nicht passieren würde. Das Leben ging weiter.
»Komm, wir gehen zu McDonald’s, frühstücken«, schlug Brad vor. »Als kleine Feier.«
»Feier?« Ich war entsetzt.
»Also wirklich«, sagte er. »Wegen der Plattenfirma.«
»Oh … Nein«, entgegnete ich. »Ich schleich mich wieder ins Bett, glaube ich. Kann ich die behalten?«
»Sicher. Ich klau bei McDonald’s eine neue. Geht’s dir gut?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Komm heute nachmittag wieder und frag mich noch mal.«
Nachdem Brad gegangen war, schnitt ich den Artikel aus und befestigte ihn an meiner Pinnwand, neben den anderen Presseartikeln über die Band. Ich betrachtete Simons Gesicht genauer und meinte, mich vage an ihn erinnern zu können, was einen gewissen Trost darstellte. Ich schwor mir, daß ich ihn nie vergessen würde, aber kaum war ich wieder im Bett und schloß die Augen, hatte ich es schon.
Kapitel 3
Mittwoch spürte ich weit weniger Verlangen, meinen Traum zu deuten. Ich blätterte die Gelben Seiten unter dem Stichwort ›Hypnose‹ eher halbherzig durch. Immerhin hatte ich bereits fünfzehn Dollar verschwendet, jetzt noch mal neunzig, und ich war pleite. Mir war klar, wenn ich so etwas machen würde, hieß es bestimmt, daß ich mindestens zwei Sitzungen bräuchte, um annähernd erfolgreich zu sein. Außerdem war ich so sehr damit beschäftigt, mich selbst als Rockstar vorzustellen, daß der Traum in den Hintergrund trat. Jede Sekunde konnte das Telefon klingeln, und Brad würde mir mitteilen, daß Numb Records uns unter Vertrag genommen hatten. Natürlich bedeutete ein Vertrag noch nicht, daß man Rockstar wurde, aber ohne wurde man es schon gar nicht. Und schließlich konnte mir niemand meine Tagträume verbieten.
747 hatten eine Seite im Internet, auf der die Leute uns mailen konnten, daß sie uns liebten oder Scheiße fanden oder wo sie nur ihre Adresse hinterließen, um unseren billig aufgemachten Newsletter oder Freikarten zu bekommen. Ich legte das Telefonbuch beiseite und sichtete die E-Mails, die während der Woche eingegangen waren.
747, gebt auf.
Ihr versucht verzweifelt, wie die Pixies zu klingen, aber ihr schafft es nicht. Verzieht euch, solange ihr noch könnt.
Die supergeile Sängerin kann mich auch mal.
Könntet ihr eine signierte CD an meine Freundin in Amerika schicken? Sie kennt jemanden, der …
Ich ging die Liste durch, kaum einen Blick auf die vorhersagbar öden Botschaften werfend. Dann stieß ich auf eine lange Nachricht von jemandem, der sich Whitewitch nannte. Sie antwortete auf meine Bitte um Hilfe bei der Erforschung eines früheren Lebens. Es gäbe Meditationen und Zauberformeln, schrieb sie, und wenn ich wollte, könnte sie mit mir daran arbeiten. Das Ganze klang ziemlich abgedreht, aber zumindest schien sie kein Geld zu erwarten. Ich antwortete ihr, daß ich alles ausprobieren würde, was keine bewußtseinsverändernden Drogen oder einen Pakt mit Satan verlangte.
Es klopfte leise an der Tür, sie wurde aufgeschlossen, und Brad kam herein. Ich schickte die Botschaft ab und löschte den Bildschirm. Brad brauchte nicht zu wissen, was ich hier tat; er würde sich nur kaputtlachen.
»Hier«, sagte er und gab mir eine Postkarte. »Sie lag im Briefkasten. Ist von Karin.«
»Du sollst meine Post nicht lesen«, sagte ich. »Hol dir was zu trinken.« Mit einer Handbewegung schickte ich ihn in die Küche.
Ich las die Karte:
Es ist prima hier, aber ich freue mich auch schon auf zu Hause. Ich bin am Achtzehnten wieder da, also halte dir den Termin frei, damit wir zusammen Kaffee trinken können oder von mir aus auch einen deiner ekelhaften gesunden Säfte. Ich hab’ dir soviel zu erzählen. Neuseeland ist toll, Skifahren war ich allerdings nicht. Hab’ Schiß gekriegt. Kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Karin.
Brad war zurückgekommen und stand mit einem Glas Orangensaft neben mir. »Amüsiert sie sich?« fragte er.
Ich reichte ihm die Postkarte. »Was meinst du? Klingt es nicht so, als zähle sie die Tage, bis ihre Flitterwochen vorbei sind?«
Brad überflog Karins Karte. »Das bildest du dir vielleicht nur ein, Lisa.«
»Ich mache mir Sorgen, daß sie einen Fehler gemacht hat.«
»Was hast du damit zu tun?«
Ich wandte mich ihm zu. »Immerhin ist sie meine beste Freundin.«
»He, du warst diejenige, die zu mir gesagt hat, daß es dich nichts angeht«, entgegnete er. »In der Woche vor der Hochzeit hast du gebeten, ich solle dich immer daran erinnern.«
»O ja«, sagte ich. »Tut mir leid. Aber du bist sicher nicht gekommen, um mir die Post zu bringen.«
»Nein, ich will dich abholen. Die Agentur will Fotos von uns machen.«
»Ich hasse Foto-Sessions.«
»Es ist für Numb Records. Ich nehme an, sie wollen sich davon überzeugen, daß wir nicht drei Köpfe haben oder so was.«
»Du meinst, sie wollen sichergehen, daß wir vermarktbar sind?«
Brad rieb sich das stoppelige Kinn. »Na ja, Ailsa müssen wir nach hinten stellen. Sonst fragen sie uns, ob wir The Mamas and Papas imitieren.«
»Das ist gemein.«