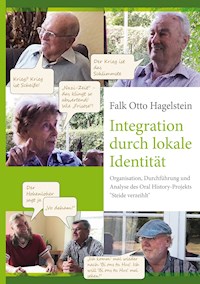
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Oral History ist eine Methode der Geschichtswissenschaft. Man kann mit ihr jedoch auch Regionalförderung betreiben! Dieser kleine wissenschaftliche Ratgeber kann Ihnen zeigen, wie! Neben der Oral History als Methode der Geschichtswissenschaft werden in "Integration durch lokale Identität" auch die Begriffe "Identität" und"Heimat" wissenschaftlich besprochen. Ferner wird LEADER als ein Instrument zur Regionalförderung in einem separaten Kapitel besprochen. Das Oral History-Projekt "Steide verzeihlt" wird in dem im Titel erwähnten Dreiklang "Organisation, Durchführung und Analyse" ausführlich besprochen. Das letzte Kapitel widmet sich der Frage, wer oder was denn ein "Zeitzeuge" ist bzw. sein kann. Das Fazit spricht im Titel bereits für sich: "Der Krieg ist das Schlimmste..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort von Helmut Flachenecker
„Guckt ner ôan Mensch zwââmol dôa nôu“ – Widmung und Danksagung
Vorbemerkungen und Terminologie
(
Film-)Projekte des Oral History-Projekts „Steide verzeihlt“
1. Einleitung: „Grood âsôu had mei Grooßvadder aa als nôch gsôchd“
2. Theorie I: Oral History – Geschichte einer Methode
2.1 Die Anfänge der Oral History
2.2 Oral History kommt nach (West-)Deutschland
2.3 Das narrative Interview als ein Ansatz von vielen in der Oral History
2.4 Schwierigkeiten der Methode Oral History – Repräsentativität und Subjektivität als Beispiele
3. Praxis I: LEADER als Instrument zur Regionalentwicklung
3.1 Kurzer Einblick in die Geschichte der Raumordnung und dazu aktuelle Probleme der Raumordnung
3.2 Die Geschichte und Philosophie von LEADER
3.3 LEADER in der Anwendung am Beispiel des Projekts „Steide verzeihlt“
3.4 Der Bottom-up Ansatz – gelebte Basisdemokratie und/oder bürokratischer Hemmschuh?
4. Theorie II: Die Begriffe „Identität“ und „Heimat“ und ihre Probleme
4.1 Identität
4.1.1 Der Begriff „Identität“
4.1.2 Ausgesuchte Probleme mit dem Begriff „Identität“
4.1.3 „Raumbezogene Identität(en)“ und „Regionalbewusstsein“ bzw. „regionale Identität“
4.1.4 „Identität“ – ein Plastikwort?
4.2 Heimat
4.2.1 Der Begriff „Heimat“
4.2.2 Ausgesuchte Probleme mit dem Begriff „Heimat“
4.2.3 „Heimat“ – ein Plastikwort?
5. Praxis II: Das Oral History-Projekt „Steide verzeihlt“
5.1 Organisation: „Steide verzeihlt“ umfasst Hohenlohe!
5.1.1 Hohenlohe als eine Region des Dialekts
5.1.2 „Steide verzeihlt“ als ein „kulturgeographischer Staubsauger“
5.2 Durchführung: Von der biographischen Einarbeitung über das eigentliche Interview zur Evaluation und Nacharbeit (kurz: „Zeitzeugenarbeit“)
5.2.1 Das „Zeitzeugengespräch“ in „Steide verzeihlt“
5.2.2 Der „thematisch-biographische Ansatz“
5.2.3 Die wichtigsten Probleme bei der Durchführung von „Steide verzeihlt“
5.3 Analyse: Vorschläge zur Arbeit mit dem „Material“ von „Steide verzeihlt“
5.3.1 „Des wââsch das selwêr“ – Der Dialog als unterschätztes Element der Oral History
5.3.2 Vergleich mit dem Interview-Dokumentarfilm „Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen – Amintiri şi dezvoltări din Transilvania“
5.3.3 Anregungen zur historisch-kritischen „Zeitzeugenarbeit“ anhand ausgewählter Probleme
5.3.4 „Ich war auch mal n‘ Kerl so wie du“ – Oral History motiviert Schüler!
6. Fazit: „Der Krieg ist das Schlimmste“
7. Epilog: „Hâ, du mâggsch dês schô…!“ – Zum Verhältnis der Begriffe „Autor“, „Interviewpartner“ und „Zeitzeuge(n)“ sowie: Was „Karl M.“ lehren kann
8. Literaturverzeichnis
8.1 Quellen
8.2 Sekundärliteratur
8.3 Filme und Videoclips
8.4 Index zu „Steide verzeihlt“ – Hier hat der „(Zeit-)Zeuge“ das Wort!
8.5 Abbildungsverzeichnis
9. Nachwort – Was ist „anständig“? Oder: Eine Szene aus Hohenlohe
Vorwort von Helmut Flachenecker
Die vorliegende Arbeit ist anregend, nicht nur wegen der Thematik, sondern auch wegen der Methodik. Die Darstellung von Geschichte und Region eröffnet eine Möglichkeit für eine Veränderung der bisherigen Bewusstseinshaltung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Ortes. Zugleich verändert sie durch die Anwendung der Oral History zugleich die „Zeitzeugen“ als auch den Interviewer. Letzterer steht in der letztlich unlösbaren Zwickmühle zwischen, wie der Verfasser es selbst beschreibt, „faktischer Subjektivität bei angestrebter Objektivität“.
Bei der Umsetzung der gängigen methodischen Theorie stößt der Autor schnell auf Schwierigkeiten, als er sein Projekt in einer praktikablen Weise in der realen Welt einer ländlich-kleinstädtisch geprägten Umgebung mit ihren spezifischen Moral- und Persönlichkeitsvorstellungen, die in der bisherigen Forschungsliteratur häufig ausgeblendet werden, umzusetzen versuchte. Um einer Spirale gegenseitiger Missverständnisse zu entgehen, fertigt der Verfasser seine sehr eigenständig entwickelte Theorie des thematisch-biographischen Ansatzes an. In diesem muss der Interviewer sehr gut vorbereitet sein. Er muss Distanzen abbauen, um Vertrauen zu gewinnen, und Empathie für die Interviewten entwickeln. Da er aber aus derselben Region kommt und damit den Dialekt der „Zeitzeugen“ spricht – also trotz des Altersunterschiedes einer der Ihrigen ist –, gelingt es ihm, die Menschen zum Reden und damit zum Erinnern zu bringen.
Der Verfasser betritt Neuland, weil er sein Projekt nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch durchgeführt hat. Er musste Werbung für seine Interviews machen, Bürgermeister und Verwaltungsbeamte überzeugen und auch unangenehme Erfahrungen machen. Aber er hat das Projekt durchbekommen, was für seine Hartnäckigkeit spricht.
Zwei interessante Fragen stellt der Verfasser zu Ende: Welche Geschichte wird eigentlich von „Zeitzeugen“ weitergegeben und was sind eigentlich „Zeitzeugen“? Zurecht deutet er mündlich tradierte Geschichte als etwas Bedeutsames, denn so werden persönliche wie allgemeine Geschichten, etwa innerhalb einer Familie oder einer Ortsgemeinschaft, weitergegeben – und zwar jenseits der offiziellen Geschichtswissenschaft. Es handelt sich also um eine sehr subjektiv erfahrene Geschichte, deren Akzentuierungen sich auch im Laufe eines Lebens verändern können.
Damit geht die Arbeit über die rein lokale bzw. regionale Vergangenheitserinnerung hinaus, und stellt auch grundsätzliche Fragen nach Identität und Geschichtserinnerung.
Helmut Flachenecker
„Guckt ner ôan Mensch zwââmol dôa nôu“ – Widmung und Danksagung
[…]
„Guckt ner ôan Mensch zwââmol dôa nôu,
wie drei Weiber ihr‘ vier Kinder mit fünf Pfennich
in sechs Lädâ neischiggâ.
Bringâ net die siewâ Dâggl,
achtKôuzle,
neiGigglâ!
Dôa kôusch –
zähmôl
verzweiflâ!“1
Wir leben in einer historischen Zeit – unabhängig von „Corona“. Lassen Sie, lieber Leser, diesen Satz auf sich wirken! Merken Sie, wie der Satz historisch geworden ist? In dem Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, in diesem Moment erfüllt Schrift eine ihrer wichtigsten Funktionen: Die Information wurde für einen Leser festgehalten und der Schreibende kann sich anderen Gedanken widmen.
Blicke ich auf meinen bisherigen Werdegang, so stellt er eigentlich eine fortwährende Ernüchterung dar. Zunächst wurde ich durch den lieben Stephan Dombrowski und seine „Global Studies“ während meiner Zeit am Wirtschaftsgymnasium mit diesem faustischen Antrieb ausgestattet, „die Welt, was sie im Innersten zusammenhält“ verstehen zu wollen. Während meines Studiums an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg dachte ich lange, es müsse doch einmal dieser Moment kommen – der Moment, „wo ‘s endgültig schnaggêlt“.
Aber der kam nicht – und der kann auch nie kommen. Ich wunderte mich zu Beginn noch aufrichtigst: Wie kann es sein, dass man in „Endo“ (Endogene Dynamik) so viel über plattentektonische Prozesse lernen kann – nur um sich zwei Stunden später von den Kulturwissenschaftlern sagen zu lassen, dass „Kontinente, Nationen alles ein Konstrukt“ seien. Ein Hoch der Hochschuldidaktik an dieser Stelle! Denn es war dieser ständige Zwiespalt, welcher sehr produktiv „ratterte“!
„Steide verzeihlt“ war ein Projekt, welches zum einen natürlich auf der Geschichtswissenschaft basierte, also ein Oral History-Projekt darstellte. Ich hatte von Anfang an vor, daraus eine kleine „Zeitkapsel“, einen Ausschnitt aus unserer Jetztzeit, zu produzieren. Mit der Anregung von Frau Kreisarchivarin Claudia Wieland zu diesem Buch und der Aufnahme des kompletten Projekts ins Kreisarchiv wurde dem Projekt damit auch ein krönender und erfolgreicher Abschluss gegeben.
Zum anderen wollte ich jedoch auch unbedingt die Geographie mit einbeziehen. So entwickelte ich die These, dass man mit einem Oral History-Projekt Regionalförderung betreiben könnte. Die ganze Entwicklung des Projekts mit seinen auf den folgenden knapp 200 Seiten beschriebenen Folgen validierte diese These. Folgenden „Akteuren“2 sei zu danken, denn ohne deren wohlwollende Begleitung wäre das Projekt in dieser genuin einzigartigen Weise nie möglich gewesen:
Meine „Opas“ und „den Dino“. Euer Tod war jeweils einschneidend in meinem Leben. Rückblickend habe ich mit der Auseinandersetzung damit gelernt, wie man auf das „Konzept Schicksal“ und „Schicksalsschläge“ kommen kann. Aber euer Tod lehrte mich die Wichtigkeit von Erzählungen und den Narrativen von und über Menschen. Der Grundgedanke von „Steide verzeihlt“ war im Nachhinein stark durch „Erinnerungen – Interview mit Opa“ geprägt. Wenn also im Folgenden das (in dieser engen Weise falsche) Verständnis von Oral History als ein „Opa erzählt aus dem Krieg“ die Rede ist, dann muss Ihnen, lieber Leser, klar sein, dass es „den Opa“ schon eine ganze Weile nicht mehr gibt. Er kann aber immer noch „sprechen“!
Wen es aber noch „gibt“ (und die hoffentlich noch lange „Zeitzeuge“ sein dürfen), das sind die Folgenden „Akteure“: Die ehemaligen Bürgermeister Kurt Finkenberger und Rüdiger Zibold sowie Bürgermeisterin Heike Naber. Bürgermeister Zibold erkannte nach dem ersten Gespräch die Chancen für die Stadt Niederstetten, welche das Projekt „Steide verzeihlt“ in der Außendarstellung der Stadt haben könnte. Dem Regionalmanagement von LEADER Hohenlohe-Tauber, vor allem Herrn Thomas Schultes, sei gedankt für die „freundliche Lenkung“. Wie Kapitel 3 zeigen wird hat LEADER als Instrument zur Regionalförderung zwar einige Haken, doch wenn Sie in diesem Buch schmökern werden Sie merken: „‘s funktionierd“3. Frau Claudia Wieland sei hier gedankt für die Unterstützung durch den Main-Tauber-Kreis für dieses doch genuin eigenen, von „Steide verzeihlt“ und meiner damaligen Masterthesis zu unterscheidenden Buches. Weshalb „zu unterscheidend“?
Der Text wurde in drei Hinsichten erweitert, auch wenn die grundsätzlich viergliedrige Struktur beibehalten wurde (und ja, auch die Masterthesis wies einen ähnlichen textlichen, thematischen und inhaltlichen Umfang auf):
a) Grundlegende Literatur und Verweise auf die jeweiligen Teildisziplinen, in welchen sich gerade bewegt wird. Dieses Buch versteht sich (wie auch „Steide verzeihlt“) in doppeltem Sinne als inklusiv: Es will Wissenschaft und Gesellschaft näher zusammenbringen, und dafür muss es auch ein Laie lesen können! Es will aber auch einzelne Teildisziplinen enger verknüpfen, denn wie gezeigt werden wird: Sie verwenden manchmal unterschiedliche Begriffe für ähnliche oder gleiche Sachverhalte und Befunde4.
b) Aktuellere Sekundärliteratur aus dem deutschsprachigen Raum. Die Sichtung dieser zeigte auch, dass die im November 2018 eingereichte Arbeit in vielerlei Hinsicht auf den richtigen Spuren war, eben auch wenn man „zwââmol dôa nôu guckte“ ergab sich maximal eine Ergänzung, aber kein inhaltlicher Widerspruch.
c) Aktuellere Quellen, welche sich vor allem aus dem (unvermeidlichen) breiten Quellenverständnis der Arbeit ergeben haben und die nicht außen vor gelassen werden wollten. Letztlich wurde so die Problematik, was denn im Rahmen eines „Zeitzeugenprojekts“ ein „Zeitzeuge“ eigentlich sei, zufriedenstellend gelöst.
So entstanden die letzten drei Seiten der „Einleitung“ komplett neu, um das mentale Verständnis von „Regionen“, welches den Autor umtrieb, einem Laien anhand von Beispielen der Darstellung „Hohenlohes“ bzw. des „Hohenloher Dialekts“ verständlicher zu machen. Die „mentalen Regionen“ sind für „gutes“ Regionalmarketing ohnehin ein wichtiger Baustein zum Erfolg. Auch der „Epilog“ ist komplett neu entstanden. In einem logischen Dreischritt enthält dieser:
1. Die Erfahrungen, welche nach Abgabe der Thesis mit „Steide verzeihlt“ und den beteiligten Akteuren gemacht wurden. Vor allem das Problem der Autorisierung durch die Interviewpartner wird besprochen.
2. Die einzige Kritik, die Prof. Dr. Helmut Flachenecker an der Arbeit hatte, wird aufgegriffen, und versucht, eine zufriedenstellende Lösungsmöglichkeit zu erarbeiten: Die Auffassung von „Zeitzeugen“ als „contemporary witnesses“.
3. Ereignisse und Entwicklungen, welche seither aufgetreten bzw. passiert sind, werden aufgegriffen und interdisziplinär diskutiert. Was macht es aus einem „Zeitzeugenprojekt“, wenn etwa ein renitenter Altnazi „Zeitzeuge“ sein will? Und dieser dann Massaker, an denen er beteiligt war, und sogar den Holocaust leugnet? Und wer ist „der eigentliche Autor“ dieses Buches, einem Buch (auch) über Oral History? Und was macht das Verhältnis eines Historikers zu „Zeitzeugen“ aus?
„Viele Leute behaupten ja, sie leben in der besten Ecke der Welt.
Aber bei mir stimmt’s!“5
In diesem Buch werden viele „zu Wort kommen“. Mündliche Formen der Kommunikation sind auch in vielen Bereichen der Wissenschaft wichtig. Die Wissenschaft ist in diesem Sinne auch eine „Szene“. Es gilt hier also zum Abschluss einfach „DANKE“ zu sagen, und zwar nicht nur den „Entscheidern“, sondern auch allen weiteren, die das Projekt „Steide verzeihlt“ direkt oder indirekt unterstützten!
In erster Linie natürlich jenen, die sich bereiterklärten, sich gemeinsam mit und von mir als „Zeitzeugen“ abfilmen zu lassen. Vor allem die in den autorisierten Filmprojekten abgebildeten Personen, da diese auf personalen narrativen Interviews basieren und die „Zeitzeugen“ damit ihre „Identität“ preisgeben mussten. Aber auch den vielen, wo es zeitlich nicht mehr möglich war und von denen manche mittlerweile auch schon verstorben sind. Andere waren wiederum hilfreiche „Tippgeber“ und „Hebelpersonen“, vor allem „d‘r Krüger‘s Walter“, seinerseits für „Steide“ der „Lokalmatador“ in puncto Geschichte. Auch andere waren bzw. sind immer noch wichtig: Manuel Stübecke, M.A., und Prof. Steve Voguit (Flagler College, St. Augustine/Florida), bei denen ich die für mich absolut anregungsreichsten Seminare zur Oral History als Methode der Geschichtswissenschaft besuchen durfte. Mit tollen Erklärungen half auch Hermann Limbacher aus. Der Vorsitzende des Vereins „Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.“ half oft „durch das Papierdickicht“ und war mit seiner ruhigen und besonnenen Art ein guter Ratgeber.
Dank auch an die vielen Dozenten und Professoren, von denen ich in meinem Studium so viel lernen und verstehen konnte. Namentlich natürlich Prof. Dr. Helmut Flachenecker (Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte) und Prof. Dr. Andreas Klee (Institut für Geographie und Geologie). Auch Dr. Markus Naser, dem in seiner neuen Position als Rothenburger Oberbürgermeister alles Gute gewünscht wird (und ab und an eine Erinnerung an seine tollen Veranstaltungen zur Landesgeschichte). Für die „Rückendeckung(en)“ durch die „alma mater“ ebenso aufrichtigst: DANKE!
Da ein Mensch eben aber ein Mensch ist, hat er immer ein „soziokulturelles Umfeld“, welches ihn prägt und beeinflusst. Für das Buchprojekt muss ich also in erster Linie ganz deutlich meinem lieben „gräänâ Kêênich“ Michael Hau danken. Dieser erklärte sich von Anfang an bereit, mir als Lektor zur Verfügung zu stehen.
Lieber „Haui“, ich glaube, „wir“ befinden uns auf einem ganz tollen Weg! Ich habe, das arbeite ich in Kapitel 3 und 4 aus, mich schon länger damit befasst, was an Aussagen wie „Ê rêêchder Steidemer mûas mindeschdens ôa Môôl beim Winzerdanz dabei gwê sei“ denn so dran ist. Ich denke, ich konnte zeigen, dass man den „Winzertanz Niederstetten“ durchaus als „starke schwache Kraft“ nach Peter Weichhart interpretieren kann. „Rôadê“ und „Gräänê“ (Winzertänzer!) sollten öfter zusammenarbeiten. Da kann sehr viel Gutes dabei herauskommen! „Deiner“ lieben Steffi (Frau Stefanie Kern) sei für das Korrektorat gedankt! Eure Anmerkungen („Falk, das geht besser!“) waren immer sehr kritisch, aber auch immer hilfreich. Dem lieben Frank „Hölle“ Hollenbach sei für die juristische Fachberatung gedankt.
Ich musste viel zusätzliche Zeit und Energie investieren in den letzten Monaten und Jahren. Ich denke, ein Grundproblem mit dem Schul- und Hochschulwesen, welches ich oft hatte, war immer dieser ständige Zwiespalt zwischen „Spezialisierung“ und „(Aus-)Bildung“. Ich habe viel von euch gelernt, vor allem, dass es im Zweifel besser ist, ein „Generalist“ denn ein „Spezialist“ zu sein6.
Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Krise, in der wir aktuell leben, u.a. als „kulturellen Schaden“7. Dieses Buch kann Antworten auf einige Herausforderungen anbieten, „dazu ein guter Wein, […] etwas Kultur muss sein“8.
Abschließend sei hier erwähnt, dass ich mit „Integration durch lokale Identität“ keine „große“ oder „fertige“ Theorie präsentieren möchte. Wohl aber möchte ich für die Themengebiete rund um „regionale“ bzw. „lokale Identität(en)“ und „die“ Oral History Anregungen anbieten – für „Laien“ wie für „Fachleute“.
Bleiben Sie fasziniert! „Â Lâs Êr“ und „T’eê Trôngc Si“! Adê ûnd gsûnd,
Niederstetten, im Mai 2022 Ihr, Falk Otto Hagelstein
1 Alte Redensart, „auf Hohenlohisch“. Von Otto Hagelstein jun. mündlich tradiert. Die genaue Bedeutung soll hier nicht diskutiert werden – es ist wohl volkstümlicher Absurdismus.
2 Vgl. für diesen doch etwas speziellen Terminus der Geographie das Lexikon der Geographie. „Akteur“. Link: https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/akteur/221(zuletzt abgerufen am 24.03.2020).
3 „Steide verzeihlt“ war explizit „modellhaft“. Wollen Sie auch ein LEADER-Projekt anregen? DANN MÜSSEN SIE IHR REGIONALMANAGEMENT KONTAKTIEREN, DENN DIESES DARF PROJEKTE NICHT SELBST ANSTRENGEN! Vgl. die Webseite von LEADER Hohenlohe-Tauber. „NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!“. Link: https://leader-hohenlohe-tauber.eu/kontakt/ (zuletzt abgerufen am 24.03.2020).
4 Siehe für das Verständnis der „Landscape Studies“ nach J.B. Jackson u.a. Jackson, John Brinckerhoff. Discovering the Vernacular Landscape. New Haven und London, 1984.
5 Diese Feststellung ist eine abgewandelte Form von „Ê Jeder behauptet von seinerâ Oma, sie duâd des beschdâ Essâ kochâ. Aber bei meinerâ stimmt’s!“. Man beachte den logischen Dreh in der inhaltlichen Ausage zwischen Verallgemeinerung und subjektivem Ich-Bezug. Vgl. den Sketch „Brädere Braade Nudel“ des Mundartkünstlers Markus Martin, Minute 1:562:01. Martin, Markus. „Brädere Braade Nudel“. Link: https://www.youtube.com/watch?v=EL1IHor-3Qc (zuletzt abgerufen am 24.03.2020).
6 Nicht umsonst steht „Spezialist“ im heutigen süddeutschen Dialekt (leicht abwertend) für einen eher unpraktisch denkenden Menschen, oder eben auch einen „Theoretiker“.
7 Vgl. Webseite „Die Bundesregierung“. „Ansprache der Kanzlerin“. „Es ist ernst“. Minute 1:22-1:58. Link: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ansprache-der-kanzlerin- 1732108 (zuletzt abgerufen am 25.03.2020). Unter dem Video als PDF verfügbar. Beachte hier die Titulatur mit dem Zusatz: „– es gilt das gesprochene Wort –“.
8 Vgl. Rammstein. „Reise, Reise“. Track Nr. 2. „Mein Teil“. Label: Universal Music. 27.09.2004. Full-length Musikalbum. Als Singleauskopplung verfügbar mit Musikvideo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=PBvwcH4XX6U (zuletzt abgerufen am 25.03.2020). Zitat ab Minute 2:03-2:25. Beachte v.a. das Spiel mit der deutschen Bedeutung von „Kultur“.
Vorbemerkungen und Terminologie
Der M.A. Cultural Landscapes wird zurecht als hochgradig interdisziplinär beschrieben9, denn beim Nachdenken über Regionen10 und Regionalmarketing fallen einem auch im Alltag immer wieder die Mächtigkeit von Repräsentation und Darstellung auf. Etwa in Bezug auf Fragen des Images11, welches deutlich erkennbar positiv12 oder negativ13 sein kann, dabei aber ständig durch die Geschichte ge- und manchmal sogar durch diese soweit überformt ist, dass eine Region sprichwörtlich an ihr „erstickt“ und sich nicht weiterentwickelt14. Der für diese Arbeit diskutierte Begriff „Heimat“ z. B. wurde und wird dabei vom Autor auch jetzt in seiner Vielschichtigkeit, und der damit einhergehende Problematik immer wieder bemerkt15.
Die Möglichkeiten eines Oral History-Projekts zur Regionalentwicklung war dem Autor damit recht früh klar. Auch die vielschichtigen, in diesem Falle journalistischen Verwendungsmöglichkeiten demonstriert ein regelmäßiger Blick in die Zeitung: als einzelne Erfahrungsberichte16 oder mehr oder weniger regelmäßigen, projektbasierten Serien17. Die Pluralität der Oral History erlaubt dabei ein breites Anwendungsgebiet, denn wie noch gezeigt werden wird, sind „Zeitzeugen“ wahrlich nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg oder generell mit Krieg, Leid und Tod zu verbinden. Vielmehr kann „Zeitzeugenarbeit“ auch (thematische) Biographiearbeit im besten Sinne an und mit den Personen selbst sein! Erst dann „sprechen“ sie nicht nur für sich, sondern für eine bestimmte „Zeit“!
Als kurze Bemerkung zur Terminologie dieser Arbeit sei an dieser Stelle vermerkt, dass das generische Maskulinum Anwendung findet, und zwar schlicht aus ganz textpraktischen Gründen. Der Autor bemerkte nämlich, dass, wenn er gefragt wurde, wohin er gerade gehe, und für Erklärungen keine lange Zeit war, er sagte: „Ich geh' zum Zeitzeugen!“, ähnlich eines Servicemitarbeiters, welcher „zum Kunden muss“. Wenn also im folgenden von „Zeitzeugen“ und „Interviewpartnern“ die Rede ist, sind natürlich die „Zeitzeuginnen“ bzw. „Interviewpartnerinnen“ mitgemeint. Ohne die erste Charge, als alles noch arges „Neuland“ war, hätte das ganze Projekt nicht den Verlauf genommen, welchen es genommen hat. Dafür mussten gerade die „Zeitzeuginnen“ dieser ersten Charge, Lydia Hagelstein, Ursula Riehle und Ilse Barthelmeh, mit dem damals noch in puncto Oral History als Methode völlig unerfahrenem Autor einiges aushalten. Hierfür sei ihnen an dieser Stelle nochmals gesondert gedankt18.
Dass Oral History eine Methode der Geschichtswissenschaft ist, soll nach der Auflistung der insgesamt 15 einzelnen Filmprojekte von „Steide verzeihlt“ im darauf folgenden ersten inhaltlichen Kapitel aufgezeigt werden. Denn eines ist anhand dieser „Vorbemerkungen“ klar geworden: Wissenschaft generell, aber gerade die Geschichtswissenschaften und die Geographie, ragen weit in das Leben einer Gesellschaft hinein, sind in vielerlei Hinsicht ihre Basis. Dies anzuerkennen fordert jedoch heraus und macht es auch nötig, über künstliche Trennungen in Fachbereiche und Teildisziplinen zu diskutieren19.
9 Für weitergehende Informationen zum Masterstudiengang „Cultural Landscapes“ an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vgl. die Webseite des Instituts für Geschichte, Reiter „Fränkische Landesgeschichte“, „Personal“, Tab „Flachenecker“, Link „Cultural Landscapes – Landesgeschichten im transatlantischen Vergleich“. Link: http://www.geschichte.uni-wuerzburg.de/institut/fraenkische-landesgeschichte/personal/flachenecker/masterstudiengang-cultural-landscapes/ (zuletzt abgerufen am 17.02.2020).
10 Der vielschichtige Begriff „Region“ wird in dieser Arbeit vor allem für eine „Region aus dem menschlichen Geist“ heraus verwendet. Grundlegend ist Haggett, Peter. Geographie – eine globale Synthese. Hrsg. v. Robert Geipel. Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Kinder und mit deutschen Beispielen ergänzt von denselben. 3. Auflage. Stuttgart, 2004. „Das Netz der Regionen“, S. 373-403, v.a. „Regionales Bewusstsein“, S. 387-397, und „Konstruktion von Regionen“, S. 398-401.
11 Vgl. z.B. Mende, Klaus T. „Das Image einer ganzen Branche aufpolieren“. Artikel der Fränkischen Nachrichten (FN) vom 24.05.2018, S. 23.
12 Vgl. z.B. Volk, Hartmut. „Derb, lebendig und unüberhörbar“. Artikel der FN vom 22.05.2018, S. 21.
13 Vgl. z.B. Wagner, Hartmut. „BamS im Tal der Anschlusslosen“. Artikel der Bild am Sonntag vom 13. Mai 2018, S. 16.
14 Das heutige Wolgograd ist ein gutes Beispiel hierfür, vgl. für eine Darstellung und durchaus auch schlüssige Erläuterung dieses Effekts durch gezielte Geschichtspolitik Feldhaus, Kai. „In dieser WM-Stadt hat der Weltkrieg nie ganz aufgehört“. In: Bild am Sonntag, 24.06.2018. „Sport“, S. 16f.
15 Vgl. für die aktuelle Verwendung des Heimatbegriffs auf Tiere, hier Wölfe, z.B. den didaktisierten Artikel „Alte neue Heimat“. In: Fränky'sche Nachrichten – Mit Fränky, der Leseratte. FN vom 30.06.2018, S. 48. Für den Heimatbegriff in Anwendung auf Personen vgl. z.B. Rüdenauer, Ulrich. „Lebenswerk mit der Heimatmedaille gewürdigt“, FN vom 03.08.2018, S. 16.
16 Vgl. hier z.B. den Einseiter Heck, Meinrad. „Die Gluthitze und den Kugelhagel überlebt“, FN vom 12.05.2018, S. 18. Inhaltlich handelt dieser Artikel über den israelischen Journalisten Shimshon Ofer, welcher als Soldat im Palästinakrieg kämpfte und aus Zufall auf einer berühmten Fotografie von Robert Capa zu sehen ist. Die kleinteilige Recherche von Meinrad Heck und die anschließende „Zeitzeugenarbeit“ mit Shimshon Ofer (Rekonstruktion der Situation etc.) und der ausführliche mündliche Bericht des „Zeitzeugen“ wird dabei ebenso festgehalten.
17 Vgl. hier z.B. die Serie „Erinnerungen an die Bombennacht vor 75 Jahren“ des Mannheimer Morgen mit Koch, Sebastian. „Zu Wort melden!“ und „‚Man kann das alles nicht schlimm genug schildern‘“. In: FN, 01.09.2018, S. 2, Groß, Konstantin. „Zuerst leiden Warschau und Rotterdam“. In: FN, 01.09.2018, S. 3, Backes, Klaus. „Zwei Städte versinken im Flammenmeer“. In: FN, 01.09.2018, S. 3 und „Zwei Fotografen, eine Perspektive – Mannheim nach der Bombennacht 1943 und heute“ als „Grafik der Woche“, S. 44f in derselben Ausgabe, Texte von Eileen Blädel und Konstantin Groß.
18 Für eine kritische Besprechung des Begriffs „Zeitzeuge(n)“ vgl. den „Epilog“ dieses Buches.
19 Vgl. Groß, Thomas. „‚Wir sind keine Solisten‘“. Das Zitat stammt von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. In: FN, 20.04.2018, S. 5.
(Film-)Projekte des Oral History-Projekts „Steide verzeihlt“
Nummer bei „Steide verzeihlt“ (Charge)
(Arbeits-)Titel
Aufnahme- datum
Genre(s) und Methode(n)
„Zeitzeuge(n)“ bzw. Interviewpartner (bzw. Themen)
I. (0)
„Erinnerungen – Interview mit Opa“
April 2008
VHS-Film, narratives Interview
Otto Hagelstein sen. („Opa“)
II. (0)
„Wie ich mein Auge verlor“
26.03.2016
Schriftliches Interview
Elfriede Menikheim (geb. Hahn)
1. (1)
„‘S vergess I mei Lewwâ Dôôch net“
20.03.2018
HD-Film, narratives Interview
Lydia Hagelstein (geb. Ehrmann)
2. (1)
„Ê‘ rêêchder Steidemer treichd sei Wissê net iwwer d‘ Stadtgrenz‘ naus“
05.04.2018
HD-Film, narratives Interview
Eugen Dod
3. (1)
„Da wurde sehr wohl was draus…“
11.04.2018
HD-Film, narratives Interview
Ursula Riehle (geb. Leist)
4. (1)
„Gartengeschichte(n) – Oma Ilse verzeihlt“
25.04.2018
HD-Film, narratives Interview
Ilse Barthelmeh (geb. Blumenstock)
5. (2)
„Meet & Eat – Hadley trifft Falk“
29.05.2018
HD-Film, freies Interview
„DJ Hadley B. Jones“ / Gerd Höller
6. (2)
„Das Wars – Daniel und Elena heiraten“
30.06.2018
HD-Film, Pfad des Fremden
Brautpaar & andere anonymisierte Gäste
7. (2)
„Mittel- vs. Unterzentrum – Odyssee nach Merchâdôôl“
04.07.2018
HD-Film, Pfad des Fremden (Vorbild: Dokumentarfilm „Bayern, Boden und Beton“)
„Raumordnung“, „Konzept der Zentralen Orte“ und „Kulturlandschaft“ (Sprecher: „Autor“)
Nummer bei „Steide verzeihlt“ (Charge)
(Arbeits-)Titel
Aufnahme- datum
Genre(s) und Methode(n)
„Zeitzeuge(n)“ bzw. Interviewpartner (bzw. Themen)
8. (2)
„Steide hat kôa Internet mehr!“
05. und 06.07.2018
HD-Film, Dokumentarfilm
Infrastruktur und Breitbandausbau (Sprecher: „Autor“)
9. (2)
„Happy BOARSDAY! – Das Boarstream Open AiR 2018“, Nachtrag: „Erlebnis Mittleres Jagsttal“
18.- 25.07.2018, Nachtrag am 06.09.2018
HD-Film, Dokumentarfilm, Pfad des Fremden, narratives Interview, freies Interview
Arbiträr ausgewählte Besucher des Festivals sowie Mitglieder des Aufbau- und Organisationsteams; für den Nachtrag Sabine Wieland („Erlebnis Mittleres Jagsttal“)
10. (2)
„RANT – Warum is(s)t man Mensch zweiter Klasse?“
05.08.2018
HD-Film, „Aufeating“
„Autor“
11. (3)
„Hausschlachtung und Hausmetzger in Hohenlohe“
09.08.2018, Nachtrag 10.08.2018
HD-Film, narratives Interview, Kommunikationsanalyse
Hermann Döhler („Herres“)
12. (3)
„Der Krieg ist das Schlimmste…“
10.08.2018
HD-Film, narratives Interview
Wilhelm und Marianne Ludwig (Doppelinterview)
13. (3)
„Bi ons tu Hus“, „Drei Heimaten“, „Was Flucht aus einem Menschen macht“
11. und 20.08.2018
HD-Film, narratives Interview
Reinhard Stoschus (Zweigeteiltes Interview)
14(3. )
„Für Dino“
31.08.2018
HD-„Realtalk“ Film,
„Autor“
15. (3)
„Fertig!“
14.09.2018
HD-Film, mündliche Evaluation
„Autor“; wegen der Intersubjektivität ist dies jedoch unmöglich; möge der Leser sich ein Bild machen!
Nummer
Vorgeschlagene Sinneinheiten der einzelnen Clips
Behandelte Teildisziplinen
Personalisiert und autorisiert?
Veröffentlichungsstatus und Cliplänge (ca.)
I.
„Jüdisches Leben in Niederstetten aus Sicht eines jungen Christen“, „Einzug zur Wehrmacht“, „Rommels Krieg in Afrika aus Sicht eines Soldaten“, „Gefangenschaft in Amerika“, „Rückkehr nach dem Krieg“, „Wiederaufbau eines Bauernhofes“, „Krieg ist Scheiße!“
Alltagsgeschichte, Zeitgeschichte, Erinnerungskultur, (Neue) Kulturgeschichte
Ja (Interviewpartner verstorben, Autorisierung durch Witwe)
Nicht veröffentlicht, 20 Minuten
II.
„Zum 9. April 1945 – 72 Jahre danach“
Erzähltheorie (Narratologie)
Ja
Veröffentlicht (Zweiteilige Serie im
Amtsblatt
)
1.
„‘S vergess i mei Lewwâ Dôôch net“, „Mein Leben als Bauersfrau“
Alltagsgeschichte, Erinnerungskultur, Zeitgeschichte, (Neue) Kulturgeschichte
Ja
Nicht veröffentlicht, 15 Minuten
2.
„Die Familie Dod während und nach dem Krieg“, „Geschichte der Firma H. Dod GmbH“, „Vereine und Vereinsentwicklung“, „Ê‘ rêêchder Steidemer trägt sei Wissê net iwwer d‘ Stadtgrenz‘ naus!“
Alltagsgeschichte Erzähltheorie (Narratologie), (Neue) Kulturgeschichte, Geschlechtergeschichte
Ja
Nicht veröffentlicht, 15 Minuten
3.
„Da wurde sehr wohl was draus… Ursula Riehle über ihre Kindheit und das Aufwachsen im Mangel“, „Aufwachsen mit Behinderung in den 1950ern“, „Das Leben als Frau im Nachkriegsdeutschland“
Alltagsgeschichte, Geschlechtergeschichte, (Neue) Kulturgeschichte
Ja
Auf Youtube veröffentlicht, 50 Minuten, Veröffentlichung wegen LEADER-Vorgaben zurückgenommen
Nummer
Vorgeschlagene Sinneinheiten der einzelnen Clips
Behandelte Teildisziplinen
Personalisiert und autorisiert?
Veröffentlichungsstatus und Cliplänge (ca.)
4.
„Das Bombardement auf Niederstetten aus Sicht einer Augenzeugin“, „Das Leben als Künstlerin“, „Der Niederstettener Winzertanz in den 1950ern“, „Vernakuläre Landschaft vs. Romantisierung“
Erinnerungskultur, Alltagsgeschichte, Zeitgeschichte, Geschlechtergeschichte, Landschaftstheorie, Ästhetik, Landschaftsmalerei
Ja
Nicht veröffentlicht, 30 Minuten
5.
„Wer ist Gerd und wer ist DJ Hadley?“, „Wie funktioniert Youtube?“, „Das Aufwachsen als Heimkind“, „Performanz auf oder für Youtube?“
Performance Studies, (Neue) Kulturgeschichte, Mediengeschichte, Alltagsgeschichte, Erinnerungskultur
Ja
Von DJ Hadley B. Jones als vierteilige Serie „Meet & Eat – Hadley trifft Falk“ veröffentlicht, 15 Minuten
6.
„Die zentrale Frage der Performanz“, „‚Brinck‘ – Ein professioneller Tourist“, „Flunkyball als Kulturtechnik“, „Die Straßen werden schlechter – mir kôummâ hâmm!“
Landscape Studies (nach J. B. Jackson)
Nicht personalisiert (aber vom Brautpaar autorisiert)
5 Minuten, nicht veröffentlicht
7.
„Wie groß ist die EMR Stuttgart?“, „Flächenversiegelung als unser Grundproblem“, „Wie geht Landleben 4.0 wirklich?“, „Höfe=Sterben“
Landscape Studies (nach J. B. Jackson), Raumordnung, Regionalentwicklung
Nicht personalisiert
5 Minuten bis max. 15 Minuten, nicht veröffentlicht
Nummer
Vorgeschlagene Sinneinheiten der einzelnen Clips
Behandelte Teildisziplinen
Personalisiert und autorisiert?
Veröffentlichungsstatus und Cliplänge (ca.)
8.
„Die Telekom als Quasi-Monopolist“, „Der Breitbandausbau“, „Das Kreuz mit der Infrastruktur“, „(K)Ein Anschluss unter dieser Nummer!“
Regionalentwicklung, Regionalforschung, Raumordnung
Nicht personalisiert
5 bis 10 Minuten, nicht veröffentlicht
9.
„Was macht Raum mit Menschen?“, „Metal ist Identität!“„Soziale Strukturen sichtbar machen!“, „Eberbach – sieht aus wie Sachsen oder Rumänien oder so…!“, „Erkundung des Regionalmarketings“, „Kreative Köpfe auf‘m Dorf“, „Periphere Räume und Nationalismus – Thesen und Ideen“, „Kulturförderung ist Regionalförderung!“
Landscape Studies (nach J. B. Jackson), Regionalentwicklung
Nicht personalisiert (aber autorisiert durch Hüttenfreunde Eberbach e.V. und Sabine Wieland)
3 bis max. 5 Minuten, nicht veröffentlicht
10.
„Struktureller Konservativismus, Postmoderne und Poststrukturalismus – alles doof!“, „Ein Aufeating nach DJ Hadley B. Jones“, „Der Gernot-Hassknecht-Effekt“
Philosophiegeschichte, Mediengeschichte, Performance Studies
Nicht personalisiert
3 Minuten, nicht veröffentlicht
Nummer
Sinneinheiten Vorgeschlagene der einzelnen Clips
Behandelte Teildisziplinen
Personalisiert und autorisiert?
Veröffentlichungsstatus und Cliplänge (ca.)
11.
„Integration ist, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt!“, „Â êchder Hohâloher Hausmetzger verzeihlt“, „Saubauer mit Leib und Seele“, „Was ist die Kunst des Warmwurstens?“, „Identität(en) als eine Praxis der Differenz“, „Landwirtschaft – ist die Vergangenheit die Zukunft?“
Alltagsgeschichte, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Agrargeschichte, Regionalforschung, Regionalförderung, Regionalentwicklung, Landscape Studies (nach J. B. Jackson)
Ja
5 bis 15 Minuten, nicht veröffentlicht
12.
„Hâmmkummâ ist inklusiv“, „Dahâm san d‘ Lêit – Heimat(en) sind Menschen!“, „Die letzten Kriegstage in Niederstetten aus Sicht eines damals Dreizehnjährigen“, „Ein Kreuz und seine Geschichte“, „Ein ‚Mann der ersten Stunde‘ der Bundeswehr“, „Der Krieg ist das Schlimmste…“
Alltagsgeschichte, Zeitgeschichte, Soziologie, Erinnerungskultur, Dialektologie
Ja
5 bis 15 Minuten, nicht veröffentlicht
Nummer
Sinneinheiten Vorgeschlagene der einzelnen Clips
Behandelte Teildisziplinen
Personalisiert und autorisiert?
Veröffentlichungsstatus und Cliplänge (ca.)
15.
„Medien und Macht“, „Was ist ‚der Krieg‘?“, „Manchmal muss man Freunde aufhängen…“, „Das Menschenmögliche“, „Es ist vollbracht!“, „Regionalforschung muss rein in die Regionen!“
Kulturgeographie bzw. Cultural Geography, Geschichtsphilosophie, Erinnerungskultur, Raumforschung, Mediengeschichte, Regionalforschung, Landscape Studies (nach J. B. Jackson)
Nicht personalisiert
3 bis 5 Minuten, nicht veröffentlicht
1. Einleitung: „Grood âsôu had mei Grooßvadder aa als nôch gsôchd“
„[…] Wenn man auch zweifellos von einer Hohenloher Mundart sprechen kann, die sich deutlich von anderen Mundarten abhebt, so kann doch von einer Einheitlichkeit innerhalb des Hohenloher Sprachgebiets keine Rede sein. […] Es wäre mir eine besondere Genugtuung, wenn Sie, lieber Leser, beim Durchstöbern der Wortsammlung auf Ausdrücke und Wörter stießen, die Sie nur noch dunkel in Erinnerung haben und von denen Sie sagen können: „Grood âsôu had mei Grooßvadder aa als nôch gsôchd“.“20
In der Tat ist dies das erste, was man, wenn man sich mit Hohenlohe als Region befasst, bemerkt: Ausnahmslos jeder spricht sein eigenes Hohenlohisch, es ist nicht einmal sinnvoll, es ortschaftsweise zu gliedern. Es ist kein Dialekt im klassischen Sinne der angrenzenden großräumigen Dialektalregionen, auch wenn unter sprachwissenschaftlicher Hinsicht natürlich die fränkische Wurzel hervorgehoben werden muss. Vielmehr ist es ein Soziolekt, welcher immer situativ Anwendung findet und auf den jeweiligen Gesprächspartner abgestimmt wird. Ein Soziolekt selbst erzählt viel über eine Gesprächssituation: soziale Nähe, aber auch Distanz und Hierarchie – er zeigt sogar Macht und Machtverhältnisse auf.
„Steide verzeihlt“ bedeutet daher nicht „Niederstetten kommt jetzt zu Wort“ oder „Hier spricht Niederstetten“. Wie in dieser Arbeit noch gezeigt werden wird, gibt es so etwas wie eine Definition, einen klar umrissenen Raum von Hohenlohe nicht. Was jedoch den Raum der Hohenloher Mundart auszeichnet, ist die starke lokale Identifikation seiner Einwohner. Man ist in erster Linie „Buchâbächer“, „Eberbächer“, „Schrôôzbercher“ oder eben „Steidemer“. Diese Tatsache und der Fakt, dass das Oral History-Projekt „Steide verzeihlt“ von der Stadt Niederstetten finanziert wurde, gaben dem Kind seinen Namen.
Die These des Autors ist, dass diese lokale Identifikation für die Bewohner des Hohenloher Raumes das zentrale Kriterium ist und zu einer sozialen Integration beiträgt. Wer z.B. „Steidemer“ oder „Wermutshäuser“ ist (und wer nicht) bemisst sich objektiv nicht daran, wo er geboren wurde, oder wie lange er schon „in Steide“ lebt. Vielmehr zeigt sich hier anhand der Interdependenz diverser sozialer Faktoren „wie's Dorf funktioniert“21.
Obwohl sich dieses Buch als vollumfänglich interdisziplinär versteht, sollen diese sozialwissenschaftlichen Faktoren im Einzelnen nicht diskutiert werden. Viel wichtiger wird sein, dass diese soziale Nähe über den Hohenloher Dialekt als Medium funktioniert. Die narrativen Interviews von „Steide verzeihlt“ sind daher mit immer wieder wechselnden Variationen des Hohenlohischen durchzogen– je nach Gesprächspartner. Wie die einzelnen Kommentare des Autors allerdings auch beweisen, hat das Hohenlohische nach wie vor eine gewisse Mächtigkeit. Sogar im analytischen Selbstgespräch vor der Kamera liegt es „leicht maulfaul“ auf der Zunge und kommt „aus jeder Ecke“ des (angestrebten) Hochdeutschen.
Was „Steide verzeihlt“ daher nicht will und auch nicht leisten kann, ist eine flächendeckende Aufnahme oder Darstellung des „Hohenlohischen“ bzw. des „hohenloher Dialekts“. Dies ist hier nicht möglich, nicht einmal ein entsprechendes „Steidemerisch“ könnte man systematisch analysieren und anschließend eine knapp einhundert Seiten lange Abhandlung darüber schreiben. In diesem Sinne ist es nicht möglich zu sagen: „Sôu hewês minândêr gred“22.
Ein weiterer Grund, warum bei „Steide verzeihlt“ nicht einfach „sôu minândêr gred“ wurde, war die Vorgehensweise. Narrative Interviews, in welchen die für (deutsche) „oral historians“ als ein Ideal angesehenen Stegreiferzählungen vorkommen, erwiesen sich als nicht durchführbar (wenngleich viele Interviews Momente mit Stegreiferzählungen aufweisen). Die einzelnen Interviews sind alle Individualprodukte, entstanden in mühevoller gemeinsamer Arbeit mit den Interviewpartnern (respektive „Zeitzeugen“). „Zeitzeugenarbeit“ wird daher als Arbeit mit und an als solchen definierten „Zeitzeugen“ verstanden. In der Regel wäre es nicht möglich gewesen, den jeweiligen Interviewpartner ohne jede Vorbereitung zu filmen23. Dennoch wurde sich bemüht, den jeweiligen Duktus der Person und der Situation in der Transkription zu treffen. Dies kann neben dem („hohenlohischen“ bzw. „lokalen“) Dialekt auch einfach Umgangssprache mit ausgelassenen, also „verschluckten“ Buchstaben sein. Der Autor vertraut hier auf sein Sprachgefühl und sein Einschätzungsvermögen; es wird auf eine sprachwissenschaftliche Herangehensweise verzichtet (genaue Lautschrift o.ä.).
Was hat also diese Erklärung mit dem Ansatz dieses Buches zu tun? Hierfür soll kurz zusammengefasst werden, was den Leser auf den nächsten knapp zweihundert Seiten erwartet:
Der erste Teil „Theorie I: Oral History – Geschichte einer Methode“ umreißt kurz die Herkunft der Oral History aus den USA und ihr Überschwappen auf die damalige BRD. Es soll aufgezeigt werden, weshalb der Ansatz des autobiographisch-narrativen Interviews nach Schütze und Welzer, welcher in der deutschen Diskussion um Oral History viel zu häufig als „die“ Vorgehensweise dargestellt wird, so nicht haltbar ist. Es zeigt sich: Nimmt man nach den deutschen Standardwerken die „Originale“, also amerikanische Autoren, zur Hand, erfährt man erst um den eigentlichen Charakter der Oral History als Methode. Auch realistische und aktuelle Handreichungen rund um das narrative Interview als zentralem Dreh- und Angelpunkt der Oral History kommen aus den Staaten. Dies hat jedoch weniger mit dem Stereotyp der amerikanischen Hemdsärmeligkeit zu tun, wie man zunächst vermuten könnte. Denn: Auch die theoretische Debatte ist „bei d' Amis“ differenzierter. Anhand der Beispiele zu den Problembereichen der Repräsentativität und der Subjektivität wird dies aufgezeigt.
Anschließend geht die Arbeit zunächst weg von der Oral History als einem (mittlerweile!) „klassischen Handwerk“ der Historiker und betrachtet das geographische Themenfeld der Raumordnung. In „Praxis I: LEADER als Instrument zur Regionalentwicklung“ wird zunächst ein geschichtlicher Überblick über die Raumordnung dargestellt. Außerdem soll wie in dem vorigen Kapitel dem Leser ein kurzer Überblick über den Sachverhalt geboten werden. Da dieses Buch interdisziplinär verstanden werden will, kann nicht „nur“ von einem Historiker oder einem Geographen als Leser ausgegangen werden. Ziel wird nach diesem ersten Abschnitt von „Praxis I“ sein, dass der Leser über Raumordnung als solche im Bilde ist, v.a. den Begriff und ihre historische Entwicklung in der BRD und auf der Ebene der EU.
Von dieser Basis aus wird der Ansatz LEADER als Philosophie zur Regionalförderung und Regionalentwicklung betrachtet. Dabei wird zunächst LEADER in seiner geschichtlichen Herkunft aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union dargestellt. Folgend soll die Anwendung von LEADER anhand von „Steide verzeihlt“ diskutiert werden. Denn eines wird am Ende des zweiten inhaltlichen Teils festzuhalten sein: Bei LEADER gibt es eine enorme Diskrepanz zwischen Philosophie und Praxis. Vor allem das Versprechen des „Bottom-Up-Prinzips“ kann LEADER unter aktuellen Umständen nicht halten, da den regionalen Vereinen (die „Lokalen Arbeitsgruppen“) die Entscheidungsgewalt fehlt.
In diesem Sinne wird sich das dritte inhaltliche Kapitel dieser Arbeit mit den Begriffen „Identität“ und „Heimat“ beschäftigen. Hierbei handelt es sich um eine kurze Begriffserörterung. Darüber hinaus werden auch ein paar wichtige Probleme der Begriffe angesprochen.
Da diese Begriffe (aktuell wieder) eine enorme politische Aufladung beinhalten, wurde darauf geachtet, sie ausgewogen in ihrer Herkunft und Bedeutung darzustellen24. Ein spezieller Fokus gilt dabei der geographischen Debatte um „Raumbezogene Identität(en)“. Die beiden Stichwörter „Regionalbewusstsein“ und „regionale Identität“ sind in dieser Diskussion untrennbar miteinander verbunden und werden auch kurz erläutert. Das Kapitel „Heimat“ schließt mit der Feststellung, dass der Begriff nicht nur spezifisch „deutsch“ ist – in seiner Bedeutung im Sinne der Unübersetzbarkeit in andere Sprachen, sondern dazu auch noch einen spezifisch deutschen Topos darstellt. Der Heimatbegriff ist daher spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit eigenen Problemfeldern versehen; diese sind z.B. verklärende Romantisierung und damit völkisch-nationale bzw. nationalistische Aufladung.
Diese Probleme der beiden Begriffe sind jedoch kein Grund, auf sie zu verzichten. Vielmehr wird auch im vierten und letzten Abschnitt „Praxis II: Das Oral History-Projekt ‚Steide verzeihlt‘“ gezeigt, dass eine nähere Betrachtung der Begriffe „Identität“ und „Heimat“ lohnenswert, eigentlich notwendig ist. Dieses vierte und längste Kapitel ist in den im Titel dieses Buches schon vorgemerkten Dreischritt „Organisation, Durchführung und Analyse“ aufgeteilt.
Das erste Unterkapitel „Organisation“ zeigt zunächst auf, welche theoretischen Überlegungen hinter „Steide verzeihlt“ zu Beginn standen, nämlich die Formen der Repräsentation von Hohenlohe als Region und die Erkenntnis, dass Hohenlohe eine „imagined community“ ist, welche sich realistisch betrachtet (und Stereotype außen vor lassend) vor allem über den Hohenloher Dialekt definiert. Ferner wird aufgezeigt, wie „Steide verzeihlt“ eine Entwicklung von einem „klassischen“ Oral History-Projekt (nach dem Motto: „Opa erzählt aus dem Krieg“) hin zu einem „kulturgeographischen Staubsauger“25 nahm. Dies meint den Versuch, neben den narrativen Interviews einen kulturgeographischen Rundumschlag mit verschiedenen Methoden, vor allem dem „Pfad des Fremden“ nach J. B. Jackson, zu wagen. Hierbei kamen z.B. Raumanalysen, Kommunikationsanalysen und – nach der Beschäftigung mit der Plattform „Youtube“ – abgeschaute Kunstgriffe zum Einsatz.
Das zweite Unterkapitel „Durchführung“ hat am ehesten den Charakter eines Erfahrungsberichts. Hier wird der „thematisch-biographische Ansatz“ von „Steide verzeihlt“ erläutert, also wie er zustande kam und was man dabei beachten sollte. Daraus ergab sich ein Verfahren, welches in einer zehn Schritte umfassenden Vorgehensweise dargestellt wird, und anhand des „biographischen Ansatzes“ von Hans Georg Ruhe vom Autor den Namen „thematisch-biographischer Ansatz“ erhielt. Dieses Kapitel spart jedoch auch nicht die Probleme aus, welche sich bis zur Herauskristallisation dieses Vorgehens ergaben und welche man als „oral historian“ dennoch immer wieder während des laufenden Oral History-Projekts hat. Denn wenn der Autor eines auch als Problem der deutschen Literatur zur Oral History bemerkte, dann dieses: Deutsche Autoren beschreiben ihre eigenen Projekte – außer bei wirklich offensichtlichen Fehlern, welche zu öffentlicher Empörung führten – fast durchgehend als reine Erfolgsgeschichten, welche nur noch der ausgiebigen Analyse bedürften. Dass auch sie eventuell massive Probleme während der Durchführung ihrer Oral History-Projekte hatten kam entweder so gut wie nie vor oder wurde im Nachhinein gekonnt von ihnen ausgeblendet.
Die „Analyse“ versucht, als letztes Unterkapitel, aus „Steide verzeihlt“ einen Mehrwert für die Betrachtung der Oral History als Methode zu gewinnen. Zunächst wird – nach Harald Welzer – festgehalten, dass der Dialog mit den Zeitzeugen, generell die gesamte in der „Durchführung“ geschilderte „Zeitzeugenarbeit“, massiv unterschätzt wird. Hier wird gezeigt, dass die klassische Stegreiferzählung, welche immer als Idealziel eines narrativen Interviews dargestellt wird, in der Praxis nur selten vorkommt. Wenn sie vorkommt ist diese das Ergebnis von aufwendiger Vorarbeit und nur einer empathischen Gesprächsstrategie von Seiten des Interviewers zu verdanken. Generell wird der Anteil des Interviewers am Prozess der Interviewerstellung unterstrichen.
Ferner werden Vorschläge zur weiteren Verwendung der entstandenen Quellen, also den aufgezeichneten narrativen Interviews und den in „Steide verzeihlt“ gesammelten Egodokumenten, herausgearbeitet. Zunächst werden anhand eines Vergleichs mit dem Interview-Dokumentarfilm „Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen – Amintiri şi dezvoltări din Transilvania“ auch die Möglichkeiten, welche sich aus filmisch aufgezeichneten narrativen Interviews ergeben können, aufgezeigt. Manuel Stübecke führte im Rahmen des Oral History-Projekts „Sie sollen sich nicht lassen“ von 2013 bis 2016 insgesamt 15 narrative Interviews in Siebenbürgen durch. Diese arbeitete er zu zwei Filmen aus, wovon er den ersten noch vor der Veröffentlichung dem Autor zukommen ließ. Mittlerweile ist die DVD mit beiden Filmen veröffentlicht (Hauptfilm ist „Der Vogel träumt vom Maismehl – Vrabia mălai visează“, „Sie sollen sich nicht lassen“ ist also „Teil 2“, die „Interviewsammlung“). In besagtem Kapitel werden beide Filme besprochen. So viel vorab: Dieser Vergleich wird nicht künstlerisch wertend sein, sondern will aufzeigen, dass zwei Oral History-Projekte in jedem Fall „besser“ sind als „nur eines“!
Neben den Möglichkeiten, mit den narrativen Interviews filmdramaturgisch zu arbeiten (vor allem der Begriff der „Authentizität“ wird an dieser Stelle diskutiert), zeigte sich die hohe Kongruenz von „Sie sollen sich nicht lassen“ mit „Steide verzeihlt“. Vor allem in dem Anspruch, ältere und jüngere „Zeitzeugen“ zu beachten und dabei die Begriffe „Identität“ und „Heimat“ zu diskutieren, sind sich die Projekte sehr ähnlich. Im Übrigen gilt dieser Befund auch für ihre Schwerpunkte auf „Regionalität“ und „Sprache“. Dem Autor liegt zwar nicht vor, wie die Interviews vorbereitet wurden, jedoch ist an mehreren Stellen sichtbar, dass mit dem Verständnis vom narrativen Interview nach Schütze vorgegangen wurde. An dieser Stelle muss noch hinzugefügt werden, dass „Steide verzeihlt“ zu keinem Zeitpunkt als eine schlichte Kopie von „Sie sollen sich nicht lassen“ verstanden werden sollte.
Anschließend folgen weitere Überlegungen zur historisch-kritischen Arbeit mit und an „Steide verzeihlt“. Es wird kurz besprochen, was denn überhaupt ein „Zeitzeuge“ ist und wozu ein Oral History-Projekt sonst noch gut sein kann, etwa das Heraustreten des Historikers aus akademischen Diskursen oder der Funktion des Projekts als „Zeitkapsel“. Auch die Frage nach Performativität bzw. von performativen Prozessen („Wie will sich diese Person gerade dargestellt wissen?“) ist anhand des Filmmaterials möglich, und zwar sowohl in Richtung des Interviewpartners als auch in Richtung des Interviewers. In diesem Zusammenhang wird das Problem diskutiert, inwiefern man den Interviewer aus „Steide verzeihlt“ überhaupt wegdenken kann. Schließlich hat er ja mit dem ganzen Projekt und innerhalb des jeweiligen Gesprächs auch dezidierte Eigeninteressen, ist also immer auch selbst subjektiv (Lynn Abrams nennt diesen Effekt „intersubjectivity“). Nur kurz angerissen werden in diesem Zusammenhang die „klassischen“ musealen Verwendungen von „Zeitzeugengesprächen“ (Welzer nennt diese monologisierende Verwendungsweise auch zu Recht „Das Interview als Artefakt“).
Dass es in dieser Arbeit nicht um „historische Wahrheit“ gehen kann, zeigt der letzte Teil der „Analyse“. Hier trägt der Autor seinem (mittlerweile bestandenen) Staatsexamen für das Lehramt Rechnung und bringt geschichtsdidaktische Überlegungen zur Oral History mit ein. Hier werden die zwei grundsätzlichen Ansätze, mit welchen man Schüler mit Oral History konfrontieren kann, aufgezeigt. Erstens die Arbeit an bereits erstellten narrativen Interviews und bereits vom Lehrer ausfindig gemachten „Zeitzeugen“ (Ansatz I). Als noch motivierender erweist sich jedoch mit Ansatz II die lehrerunterstützte Durchführung eines eigenen Oral History-Projekts. Hierbei ist dem Autor der handlungsorientierte Ansatz von Michael Sauer wichtig: Schüler haben in allen Aspekten eines Oral History-Projekts Probleme. Als Lehrer zu helfen, mit diesen umzugehen, macht Oral History für die Schüler (inklusive den Lehrkräften und auch für die „Zeitzeugen“!) nicht zur Bürde, sondern zum Erlebnis!
Worum geht es also in diesem Buch? Es geht um Darstellungen von Geschichte und Regionen. Denn diese Darstellungen sind der zentrale Dreh- und Angelpunkt von Bewusstseinsbildung – also Geschichtsbewusstsein und Regionalbewusstsein. Hier trifft die Theorie auf die Praxis, hier wird „new regionalism“ praktiziert. Wie wichtig dieses Bewusstsein für die Macht einer Darstellung ist, dies kann man anhand der Vorkommnisse seit 2018 beobachten – der Faktor von Ironie und Satire ist hierbei schon beachtet.
Es gibt Darstellungen von Regionen, welche ironisch-distanziert26, sarkastisch-polemisch27 bis zu wissenschaftlich-analytisch28 sein können. Hierbei muss das Regionalmarketing immer „Mögliche Zukünfte“29 im Blick haben. In diesem Sinne hat Jan Böhmermann recht in seiner Liedzeile: „Sachsen Nazis nennen – Nein! Das dürfen Sie nüschd!“30. Der Nutzer „Pur OwO“ hat mit dem sarkastischen Kommentar dazu den Nagel auf den Kopf getroffen: „Immer auf die armen Sachsen! Das ist sächsistisch!“.
Inwiefern diese Repräsentationen „korrekt“ oder „nicht korrekt“ sind ist für das Regionalmarketing31 zweitrangig. Wie anhand der beiden Karten auf den folgenden Seiten ersichtlich ist, ist der hohenlohische Dialekt als Teil der ostfränkischen Dialektgruppe jedoch von sächsischen Dialekten nicht so weit entfernt wie man von der geographischen Lage her zunächst glaubt.
Abb. 1: Karte des deutschen Dialektraums. Zentral gelegen die ostfränkische Dialektgruppe umgeben von den rheinfränkischen, thüringischen, obersächsischen, baierischen und alemannischen Dialektgruppen. Unter anderem ragt die ostfränkische Dialektgruppe bis weit in den Freistaat Sachsen hinein.
Es ist daher mit ein erklärtes Ziel von „Steide verzeihlt“ aufzuzeigen, wie Polarisierung über Stereotype funktioniert und Möglichkeiten zu erarbeiten, wie diese über Bewusstseinsbildung abgebaut werden können. Der Autor vertritt hierbei durchaus auch die These, dass man soziale Integration auf lokaler Ebene nicht (nur) diskutieren, sondern im ethischen Sinne praktisch leben muss32.
Die ostfränkische Dialektgruppe weißt mit dem viel geschmähten „Sächsisch“ nicht nur eine direkte geographische Nachbarschaft auf, sondern – und dies ist eine linguistische Besonderheit – weißt in der Tat mit dem an die sächsische Dialektgruppe direkt angrenzenden Oberostfränkisch mehr Gemeinsamkeiten auf, als mit ihrem unmittelbaren geographischen Nachbar, dem Unterostfränkischen. Der hohenlohische Dialektraum wird dabei manchmal als Südostfränkisch definiert.
Abb. 2: Karte der Dialekträume in den bayerischen Regierungsbezirken Unter- Mittel- und Oberfranken. Die Karte definiert den hohenlohischen Dialektraum als „Südostfränkisch“. Sie ignoriert jedoch jenen Sprachraum, welcher sich außerhalb der bayerischen Staatsgrenzen befindet. Dass das ostfränkische Sprachgebiet, wie oben dargestellt, noch weiter nach Baden-Württemberg hineinragt, wird in Darstellungen also, wie gezeigt werden konnte, oft ausgelassen.
Quelle für beide Karten: Alfred Klepsch, Historisches Lexikon Bayerns.
Hohenlohisch ähnelt phonetisch eher den sächsischen als den unterfränkischen Dialekten. Klepsch schreibt:





























