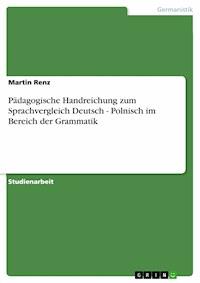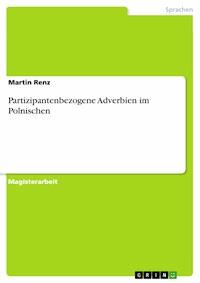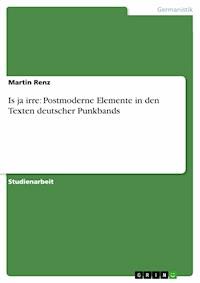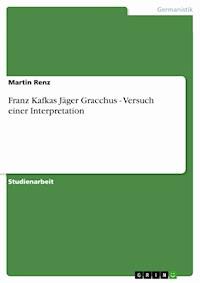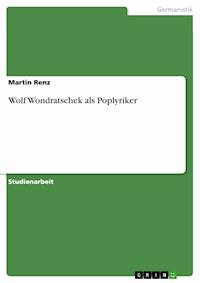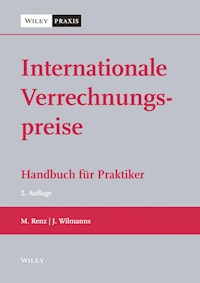
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die zunehmende Regulierungsdichte und die ausdrückliche Aufforderung an Betriebsprüfer, Verrechnungspreise bei jedem internationalen Unternehmen zu thematisieren, verlangt von Unternehmen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema der "Internationalen Verrechnungspreise".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 905
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
2. überarbeitete Auflage 2021
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2021 Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-50895-2E-Book ISBN: 978-3-527-83584-3
Vorwort
»Beim Lesen lässt sich vortrefflich denken«
Lew Nikolajewitsch Tolstoi
Im Jahr 2013 haben wir die erste Auflage des Werkes »Internationale Verrechnungspreise« veröffentlicht. Das Buch hatte eine außerordentlich starke Nachfrage, wofür wir uns bei den Lesern und Anwendern bedanken. Es wurden eine Vielzahl von Rückmeldungen und Hinweise gegeben, die uns motiviert haben, diese zweite Auflage zu erarbeiten.
Wir sind selber überrascht, wie schnell sich die Welt der Verrechnungspreise dreht. Über drei Jahre hinweg haben wir nun die politischen, fachlichen und praktischen Entwicklungen im Zeitraum von diesen zwei Auflagen erfasst und entsprechend für Sie als Anwender von Verrechnungspreissystemen aufbereitet und hieraus abgeleitet Handlungsempfehlungen erarbeitet. Das vorliegende Buch beschäftigt sich u. a. dezidiert mit der Umsetzung der OECD-Empfehlungen zum BEPS-Aktionsplan mit dem Fokus Verrechnungspreise, mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen sowie Fragestellungen zur Implementierung von Verrechnungspreissystemen. In diesem Kontext gehen wir in Ergänzung zur 1. Auflage auf die überarbeiteten OECD-Verrechnungspreisrichtlinien zu Intangibles, zu Finanztransaktionen, zu den Dokumentationsanforderungen, zu Betriebsstätten und den hiermit verbundenen Gewinnzuordnungs- und -aufteilungsmechanismen sowie zu Streitvermeidungs- und -beilegungsverfahren ein. Beim letztgenannten Aspekt wird insbesondere das Instrument des internationalen Joint Audits eingehend untersucht. Des Weiteren beschäftigt sich das Werk umfassend mit Fragen des Managements und der Umsetzung von Verrechnungspreissystemen sowie aktuellen Trends und Themen in Betriebsprüfungen.
Aus aktuellem Anlass haben wir die im Dezember veröffentlichten Verwaltungsgrundsätze 2020 als eigenen Gliederungspunkt aufgenommen. Im entsprechenden Abschnitt gehen wir dezidiert auf die Regelungen ein und beleuchten diese im Blickwinkel auf die Auswirkungen auf laufende Betriebsprüfungen und hiermit verbundene Folgewirkungen.
Hinzu kommt die COVID-19 Pandemie, die gleichermaßen einen massiven Einfluss auf Geschäftsmodelle von Konzernen hat. Diese gegenwärtige Pandemie zwingt viele multinationale Konzerne zu tiefgreifenden Maßnahmen hinsichtlich ihrer Lieferketten, Organisationsstrukturen und der Konsequenzen für die Geschäftsmodelle. Diese Pandemie kreierte Gewinner und Verlierer in Abhängigkeit der jeweiligen Industrien. Es stellen sich vielerlei Fragen, wie der Fremdvergleichsgrundsatz im Kontext dieser Pandemie auszulegen ist. Gleichermaßen werden Fragen aufkommen, wie der Übergang aus der genannten Krise in Zeiten der wirtschaftlichen Erholung sich auf bestehende Verrechnungspreissysteme auswirken wird. Im Rahmen dieser Entwicklungen reagieren weltweit auf der einen Seite die Gesetzgeber mit neuen Regelungen und auf der anderen Seite werden in Betriebsprüfungen zunehmend kontroverse Diskussionen hinsichtlich der Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Kontext der Krise erwartet. Es muss in der Konsequenz erwartet werden, dass viele Gerichte und/oder Finanzbehörden im Rahmen von internationalen Streitbeilegungsverfahren bei Nichteinigung in Betriebsprüfungen die Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes klären müssen. Wir gehen in diesem Werk explizit auf die genannten Aspekte der COVID-19-Krise ein und zeigen Lösungswege auf.
Eine weitere Herausforderung der heutigen Zeit ist die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Die OECD hat diese Entwicklung bereits in den OECD BEPS-Aktionspunkten aufgegriffen und plant nun die Einführung eines sog. Zwei-Säulenmodells (Pillar One und Pillar Two). Pillar One hat einen unmittelbaren Bezug zu Verrechnungspreisen und stellt die Vergütung von Marktstaaten in den Mittelpunkt, in denen die Konzerne keine physische Präsenz haben. Das Konzept wird voraussichtlich nur einige wenige Konzerne unmittelbar betreffen. Um dem Leser jedoch ein umfassendes Bild über aktuelle und zukünftige Entwicklungen zu geben, analysieren wir die möglichen Konsequenzen dieses Konzeptes der OECD für die multinationalen Konzerne.
Zuletzt sollte auch auf die zunehmende Bedeutung der Operationalisierung von Verrechnungspreisen in den Konzernen hingewiesen werden. Mit der »Operationalisierung« werden Fragestellungen zur Beziehung Price Setting und Outcome Testing, zur organisatorischen Verankerung von Verrechnungspreisabteilungen in den Konzernen, zur prozessualen Abbildung in bestehenden Prozessplattformen als auch zur Anbindung von Verrechnungspreissystemen an die Finanz-Reportingsysteme unter Einbeziehung von ERP-Systemen behandelt. Das vorliegende Werk versucht, soweit wie möglich Antworten auf diese Herausforderungen zu geben.
Das Handbuch »Internationale Verrechnungspreise« richtet sich an Praktiker und Studierende, die zu den verschiedenen Aspekten der Verrechnungspreise eine vertiefte Analyse suchen und gleichzeitig Lösungswege aufgezeigt bekommen wollen. Insofern ist die Gliederung des Buches sehr stark an den praxisrelevanten Fragestellungen ausgerichtet, gehen die Kapitel auf praxisbezogene Beispiele ein und fassen am Ende eines jeden Abschnitts in Form von Leitsätzen die Kernaussagen zusammen.
Ein derart umfangreiches Vorhaben ist nicht ohne die Hilfe vieler Kolleginnen und Kollegen zu bewältigen. In diesem Zusammenhang möchten sich die Herausgeber insbesondere bei Stefanie und Nicole Cernic bedanken. Schließlich gebührt unser Dank auch unseren Familien, die immer wieder das notwendige Verständnis und die Nachsicht bei der Erstellung des Werkes erbracht haben.
Wir hoffen, dass dieses Praktikerhandbuch den Leser im beruflichen Alltag nicht nur als Nachschlagewerk unterstützt, sondern getreu dem einleitenden Zitat zum Denken anregt und zum konfliktfreien Lösen von Problemstellungen beiträgt.
Frankfurt/Stuttgart, März 2021
Jobst Wilmanns, Martin Renz
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
A Grundlagen
I. Bedeutung von Verrechnungspreisen in der Konzernpolitik
II. Verrechnungspreise als Bestandteil der Konzernorganisation
Anmerkungen
B Steuerliche Rahmenbedingungen
I. OECD-Musterabkommen, -richtlinien, -empfehlungen
II. EU Joint Transfer Pricing Forum
III. Steuerliche Rechtsgrundlagen in Deutschland
Anmerkungen
C Arten von Geschäftsbeziehungen
I. Geschäftsbeziehungen als Bestandteil eines Geschäftsmodells
II. Verrechnungspreise bei Warenlieferungen
III. Konzerninterne Dienstleistungen
IV. Pool-Konzept
V. Übertragung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
VI. Finanzierungsleistungen
Anmerkungen
D Immaterielle Werte
I. Überblick
II. Definition von »Intangible«
III. Zuordnung von Intangibles
IV. Markenverrechnung als Sondertatbestand
Anmerkungen
E Funktionsverlagerungen
I. Einführung
II. Regelungen zur Funktionsverlagerung nach § 1 Abs. 3 AStG
III. Transferpaket als Verrechnungspreis
IV. Bewertung einer Funktionsverlagerung
V. Die OECD-Regelungen zu Business Restructuring im Überblick
Anmerkungen
F Digitale Entwicklung und Einfluss auf Verrechnungspreissysteme
I. Einleitung
II. Kernthesen zum Einfluss der Digitalisierung auf die Verrechnungspreiswelt
III. Digitalisierung verändert die Wirtschaft
IV. Verrechnungspreisregelungen im Blickwinkel veränderter Rahmenbedingungen
V. Ausblick
Anmerkungen
G Betriebsstätten und Betriebsstättengewinnermittlung
I. Betriebsstätten im Blickwinkel der Industrien und Finanzverwaltungen
II. Überblick über das Besteuerungsrecht
III. Betriebsstättenbegriff und -begründung
IV. Zuordnung des Betriebsstättengewinns
V. Verrechnungspreisdokumentation und Verfahrensgrundsätze in Betriebsstättenfällen
Anmerkungen
H Dokumentationsvorschriften
I. Inhalt und Auslegung der Dokumentationsvorschriften
II. Die Angemessenheitsdokumentation
III. Dokumentation von außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen
IV. Dokumentationsstrategien
Anmerkungen
I Verrechnungspreise in der Verwaltungspraxis
I. Handlungsempfehlungen vor und während einer Betriebsprüfung
II. Rechte und Pflichten von Steuerpflichtigem und Betriebsprüfer
III. Betriebsprüfungsklassiker
IV. (Vorab-)Verständigungs- und Schiedsverfahren
Anmerkungen
J Operationalisierung von Verrechnungspreisen in den Konzernen
I. Transfer Pricing Life Cycle
II. Implementierung als Erfolgsfaktor
III. Organisatorische Rahmenfaktoren
IV. Schritte der Operationalisierung
V. Ausblick
Anmerkungen
Anhang: Country-Matrix
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel A
Abb. A.1: Internationale Präsenz deutscher Konzerne
Abb. A.2: Gründe der Internationalisierung von Konzernen
Abb. A.3: Typische Wertschöpfungskette
Abb. A.4: Verrechnungspreisregelungen in Deutschland
Abb. A.5: Prioritäten von steuerlichen Themen auf der Agenda des Managements...
Abb. A.6: Internationales Steuerumfeld;
Abb. A.7: Einfluss von Verrechnungspreisen auf die Erfolgsrechnung
Abb. A.8: Disposition von Funktionen und Wirtschaftsgütern
Abb. A.9: Gewinnverteilung im Konzern in Abhängigkeit von der Funktions- und...
Abb. A.10: Ertragssituation in Abhängigkeit von der Unternehmenscharakterisi...
Abb. A.11: Hilfs- und Hauptkostenstelle
Abb. A.12: Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung (Beispiel);
Abb. A.13: Reportingsysteme im Spannungsfeld verschiedener Einflussfaktoren...
Abb. A.14: Bestimmungsfaktoren der Funktions- und Risikoanalyse
Abb. A.15: Charakteristika der strategischen, taktischen und operativen Plan...
Abb. A.16: Matrixorganisation;
Abb. A.17: Delegation taktischer und operativer Entscheidungen;
Abb. A.18: Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung von Einzahlungs-/Ausza...
Abb. A.19: Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss in Abhängigkeit der Wertschöpf...
Abb. A.20: Identifizierbarkeit von Geschäftsbeziehungen in Abhängigkeit vom ...
Abb. A.21: Wertschöpfungsbeitragsanalyse als Ausfluss von objektiven und sub...
Abb. A.22: Integration einer Verrechnungspreisorganisation in der Gesamtorga...
Abb. A.23: Anpassung der Verrechnungspreise anhand einer Plan/Ist-Analyse
Abb. A.24: Einfluss von Trends und Herausforderungen auf die Konzernstrategi...
Kapitel B
Abb. B.1: Ermittlung des Betrags A in zehn wesentlichen Schritten
Abb. B.2: Typische rechtliche Konzernstruktur
Abb. B.3: Typisches verrechnungsbezogenes Geschäftsmodell
Abb. B.4: Steuerliche Bewertungsmaßstäbe und ihre Anwendungsfelder
Abb. B.5: Bestimmungsfaktoren des Fremdvergleichs
Abb. B.6: Beispiel für einen beherrschenden Einfluss
Abb. B.7: Zusammenhang zwischen dem Funktions- und Risikoprofil, der Inhaber...
Abb. B.8: Zusammenhang zwischen Verrechnungspreismethode und Angemessenheits...
Abb. B.9: Verrechnungspreismethoden in Abhängigkeit der Ausprägung von Gesch...
Abb. B.10: Geschäftsmodell mit vielfachen Liefer- und Leistungsbeziehungen
Abb. B.11: Typisches Poolsystem
Abb. B.12: Zusammenhänge der Fremdvergleichsanalyse
Kapitel C
Abb. C.1: Einflussfaktoren einer Geschäftsmodellanalyse
Abb. C.2: Vorgehensweise bei einer Verrechnungspreisanalyse
Abb. C.3: Abgrenzung unterschiedlicher Formen von Fertigungsleistungen
Abb. C.4: Abgrenzung unterschiedlicher Vertriebsformen
Abb. C.5: Ausgangsfall – Typischer Konzernaufbau
Abb. C.6: Absauglizenzmechanismus
Abb. C.7: Beispiel »Wiederverkaufspreismethode auf Basis einer Zielnettorend...
Abb. C.8: Beispiel »Wiederverkaufspreismethode bei Verlusten des Herstellers...
Abb. C.9: Übersicht »Formen der Dienstleistungsverrechnung«
Abb. C.10: Übersicht verrechenbarer Dienstleistungen
Abb. C.11: Restriktionen verschiedener Dienstleistungsverrechnungsformen
Abb. C.12: Übersicht Bandbreiten Gewinnaufschläge im Bereich Dienstleistunge...
Abb. C.13: Abgrenzung »Low value-adding services« nach OECD
Abb. C.14: Physisches Cash-Pool System
Abb. C.15: Auswirkung der Konzernzugehörigkeit auf die Vergütung von Finanzi...
Abb. C.16: Creditratings entsprechend ausgewählter Ratingagenturen
Abb. C.17: Grundprinzipien zur Teilwertabschreibung auf Darlehensverhältniss...
Abb. C.18: Vernetzung Finanzierungsverhältnisse im Konzern
Kapitel D
Abb. D.1: Systematisierung des OECD-Begriffs Intangibles und die Implikation...
Abb. D.2: DEMPE-Funktionen gem. OECD-Leitlinien
Abb. D.3: Wege der Beeinflussung
Abb. D.4: Übersicht über die Bewertungsmethoden in Abhängigkeit von den Bewe...
Kapitel E
Abb. E.1: Gründe für Reorganisation in Konzernen
Abb. E.2: Entscheidungsorientierte Analyse der Funktionsverlagerung
Abb. E.3: Grundsystematik des hypothetischen Fremdvergleichs
Abb. E.4: Systematik der Transferpaketregelung
Abb. E.5: Preisbestimmung anhand der Ertragswertmethode
66
Abb. E.6: Direkte vs. indirekte Bewertung
Abb. E.7: Entwicklung der historischen Marktrisikoprämie
Abb. E.8: Entwicklung der Branchen-Betas
99
Abb. E.9: Rahmendaten des vorliegenden Beispiels
Abb. E.10: Berechnung der Kapitalkosten
Abb. E.11: Berechnung des Einigungsbereichs auf der Grundlage eines Prognose...
Abb. E.12: Berechnung des Einigungsbereichs auf der Grundlage eines unendlic...
Abb. E.13: Anwendung der Preisanpassungsklausel
Kapitel F
Abb. F.1: Systematisierung des OECD-Begriffs Intangibles und die Implikation...
Abb. F.2: Grundstruktur einer Netzwerkorganisation
47
Abb. F.3: Vorschläge der OECD zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft; Quel...
Kapitel G
Abb. G.1: Kriterien der Betriebsstättenbegründung
Abb. G.2: Der »two-step-approach« der OECD
Abb. G.3: Funktionale Zusammenhänge des »two-step approach«
Kapitel H
Abb. H.1: Steuerliche Rahmenbedingungen
Abb. H.2: Dreiteiliger Dokumentationsansatz der OECD
Abb. H.3: Überblick Wertschöpfungskette D-Gruppe
Abb. H.4: Darstellung Wertschöpfungskette
Abb. H.5: Berechnung Wertschöpfungsbeitrag
Abb. H.6: Beispiel Funktions- und Risiko-Chart mit Wertschöpfungsbeiträgen
Abb. H.7: Chancen- und Risikoallokation verschiedener Unternehmenscharaktere...
Abb. H.8: Country-by-Country Berichtstabellen nach OECD
Abb. H.9: Anwendungsformen von Vermögens- und Kapitalrenditen
Abb. H.10: Länderübersicht – Akzeptanz ausländischer Vergleichsunternehmen b...
Abb. H.11: Übersicht Management von Verrechnungspreisrisiken
Abb. H.12: Übersicht Dokumentationsstrategien
Abb. H.13: Beispiel einer Dokumentationsstrategie
Kapitel I
Abb. I.1: Typischer Ablauf einer Verrechnungspreis-Betriebsprüfung
Abb. I.2: Betriebsprüfungssachverhalte – Häufigkeit und Bedeutung
Abb. I.3: Fallbeispiel – Kostenbasis bei Kostenaufschlagsmethode
Abb. I.4: Fall – Standortvorteile
Abb. I.5: Fall – Nachträgliche Preisanpassungen
Kapitel J
Abb. J.1: TP Life Cycle
Abb. J.2: Zusammenfassung der möglichen Korrekturmechanismen
Abb. J.3: Management Account versus Legal Account
Abb. J.4: Technologiebasierter Ansatz
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
3
4
5
6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
590
591
592
593
594
595
596
597
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angegebenen Ort
Abs.
Absatz
AC
Arbitration Convention (Schiedsverfahren)
a. F.
alte Fassung
AG
Aktiengesellschaft
AK
Arbeitskreis
AmtshilfeRLUmsG
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
AO
Abgabenordnung
AOA
Authorized OECD Approach
APA
Advance Pricing Agreement
Art.
Artikel
AStG
Außensteuergesetz
Az
Aktenzeichen
B2B
Business to Business
B2C
Business to Consumer
BB
Betriebsberater (Zeitschrift)
BEPS
Base Erosion Profit Shifting
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BGBl
Bundesgesetzblatt
BilMoG
Bilanzmodernisierungsgesetz
BMF
Bundesministerium der Finanzen
bps
Basispunkte
BRIC-Staaten
Brasilien, Russland, Indien, China
BsGaV
Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung
Bsp.
Beispiel
BStBl
Bundesteuerblatt
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CAPM
Capital-Asset-Pricing-Model
CbC
Country by Country
CbCR
Country by Country Reporting
CCA
Cost Contribution Arrangements (Kostenumlagevereinbarungen)
CCCTB
Common Consolidated Corporate EU Tax Base
CTA
Covered Tax Agreement
CUP
Comparable Uncontrolled Price
CUT
Comparable Uncontrolled Transaction
D
Deutschland
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
DCF-Methode
Discounted Cash-Flow-Methode
DEMPE
Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation
d. h.
das heißt
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DStRE
Deutsches Steuerrecht Entscheidungsdienst (Zeitschrift)
DStZ
Deutsche Steuerzeitung (Zeitschrift)
€
Euro
EBIT
Earnings before interest and tax
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte (Fachzeitschrift)
ERP
Enterprice Ressource Planning
EStG
Einkommenssteuergesetz
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EU JTPF
EU Joint Transfer Pricing Forum
evtl.
eventuell
f.
folgende
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
F+E
Forschung und Entwicklung
ff.
fortfolgende
FG
Finanzgericht
FinVerw
Finanzverwaltung
FN-IDW
Fachnachrichten des IDW (Zeitschrift)
FR
Finanzrundschau (Zeitschrift)
FVerlV
Funktionsverlagerungsverordnung
GAAP
Generally Accepted Accounting Principles
GAufzV
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
GdPDU
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GE
Geldeinheit
gem.
gemäß
GewStG
Gewerbesteuergesetz
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHR
GmbH-Rundschau (Zeitschrift)
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
HB
Handelsbilanz
HGB
Handelsgesetzbuch
HR
Human Ressources
Hrsg.
Herausgeber
HTVI
Hard to value intangibles
IAS
International Accounting Standards
IDEA
Interactive Data Extraction and Analysis
i. d. F.
in der Fassung
i. d. R.
in der Regel
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer
IF
G20/OECD Inclusive Framework
IFRS
International Financial Reporting Standards
ifst
Institut Finanzen und Steuern
inkl.
inklusive
InsO
Insolvenzordnung
IP
Intellectual Property (Immaterielles Vermögen)
i. S. d.
im Sinne des/der
ISO
International Standards Organisation
ISR
Internationale SteuerRundschau (Zeitschrift)
IStR
Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)
IT
Informationstechnik
i. V. m.
in Verbindung mit
IWB
Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
JStG
Jahressteuergesetz
JTPF
Joint Transfer Pricing Forum (siehe auch EU JTPF)
KERT
Key Entrepreneurial Risk Taking
KPI
Key Performance Indicator
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStR
Körperschaftsteuerrichtlinien
KVD
Key Value Driver
KWG
Gesetz über das Kreditwesen
Lit.
Littera (lateinisch für Buchstabe)
LRD
Limited Risk Distributor
Ltd.
Limited
MAP
Mutual Agreement Procedure (Verständigungsverfahren)
max.
maximal
Mio.
Million(en)
MK
Musterkommentar
MLI
Multilaterales Instrument
MoTC
Mark-up on Total Costs (Vollkostengewinnaufschlag)
Mrd.
Milliarden
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
Nr.
Nummer
o. a.
oben angeführt
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OECD-MA
OECD-Musterabkommen
OECD-RL
OECD Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations
o. g.
oben genannt
ORA
»Options Realistically Available«
§
Paragraf
%
Prozent
PC
Personal Computer
PL
Polen
PLI
Profi Level Indikators
PMS
Performance Measurement System
PR
Public Relations
PwC
PricewaterhouseCoopers
R
Richtlinie
R&D
Research and Development (Forschung und Entwicklung)
Rn
Randnummer
ROA
Return on Assets
ROCE
Return on Capital Employed
RoS
Return on Sales
S.
Seite
SEC
sog.
sogenannte(n/r)
SP
Significant People
SPV
Special Purpose Vehicles (Zweckgesellschaften)
Sp.z.o.o.
Spólka z orgaaniczona odpwiedzialnoscia (polnische Rechtsform ähnlich GmbH)
StÄndG1992
Steueränderungsgesetz 1992 vom 25.2.1992,
BStBl
. I 1992, S. 297.
StuB
Steuern und Bilanzen (Zeitschrift)
StuW
Steuern und Wirtschaft (Zeitschrift)
StVergAbG
Steuervergünstigungsabbaugesetz
TAB
Tax Amortisation Benefits
TMTR
Tax Management Transfer Pricing Report
TNMM
Transactional Net Margin Methode, Transaktionsbezogene Nettomargenmethode
TR
Türkei
Tz.
Textziffer
u. a.
unter anderem
Ubg
Die Unternehmensbesteuerung (Zeitschrift)
u. E.
unseres Erachtens
UN
United Nations (Vereinte Nationen)
USA
United States of America
USP
Unique Selling Preposition (Alleinstellungsmerkmal)
usw.
und so weiter
u. U.
unter Umständen
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
VCT
Value Chain Transformation
Vgl.
Vergleiche
vs.
versus
VwG
Verwaltungsgrundsätze
VwG-Entsendung.
Verwaltungsgrundsätze-Arbeitnehmerentsendung
VwG-Verf.
Verwaltungsgrundsätze-Verfahren
z. B.
zum Beispiel
zzgl.
zuzüglich
AGrundlagen
(Jobst Wilmanns)
I. Bedeutung von Verrechnungspreisen in der Konzernpolitik
1. Einleitung
Der Erfolg international operierender Konzerne hängt zunehmend davon ab, wie diese auf internationale Entwicklungen reagieren und in welcher Form sie in der Lage sind, den Anforderungen der lokalen Märkte und den hiermit verbundenen Bedingungen gerecht zu werden. Beim Vergleich von Konzernabschlüssen international operierender Unternehmensgruppen vor zehn Jahren mit denen von heute können folgende Feststellungen getroffen werden:
Die Konzerne sind mittlerweile fast durchgehend auf allen Kontinenten präsent.
Die Wertschöpfungsketten sind zunehmend internationalisiert worden, d. h. neben den Vertriebstätigkeiten können zunehmend vernetzte Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten vorgefunden werden.
Der Sitz des Konzern-Headquarters bedeutet nicht uneingeschränkt, dass hier gleichermaßen der Strategieträger der Geschäftstätigkeiten sitzt. Es kann beobachtet werden, dass sich zunehmend auch die Geschäftsführung von Unternehmen virtualisiert und diese vielfach international verteilt an den Orten wiederzufinden sind, wo die Treiber des Wertschöpfungserfolgs sitzen. In der digitalen Welt ist dies vielfach Silicon Valley, bei der Bedeutung von Absatzmärkten ist dies z. B. China.
In Abbildung A.1 wird nochmals exemplarisch anhand der DAX-30 Werte dargestellt, wie deutsche Konzerne ihre Geschäftstätigkeit zunehmend auf ausländische Märkte ausdehnen.
Abb. A.1: Internationale Präsenz deutscher Konzerne
Im Zusammenhang mit der Internationalisierung von Konzernen sind zum einen die Märkte und die hiermit verbundenen Bedingungen zu analysieren, zum anderen die Einflussfaktoren, die die Konzerne mehr oder weniger dazu zwingen, den Weg ins Ausland zu gehen.
Die Märkte sind im Wesentlichen in vier Segmente zu unterscheiden:
Absatzmärkte
: Während die traditionellen Industrienationen wie u. a. die europäischen Länder, Nordamerika, Japan sich in einer Phase von eher niedrigen bis hin zu moderat steigenden Zuwächsen des Bruttosozialproduktes befinden, realisieren die sich entwickelnden Länder, wie insbesondere die sog. BRICTSA-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Türkei, Süd-Afrika) in einer Mehrperiodenbetrachtung höhere Wachstumsraten. Dies liegt zum einen an politischen Veränderungen, zum anderen aber auch an der Veränderung makroökonomischer Bedingungen. Vielfach sind die Konzerne nicht mehr in der Lage in den historisch angestammten Ländern die von den Anteilseignern erwarteten Renditen zu realisieren. Sowohl die kulturellen und sprachlichen Bedingungen, als auch die Ansprüche der Kunden erfordern ein starkes Vertriebsnetzwerk (extern, intern aber auch digital) der Konzerne in den Ländern. Mit ihrem Erfolg auf den Absatzmärkten sind die Konzerne in der Lage, durch hieraus resultierende mengenbezogene Kostendegressionseffekte entsprechende Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Des Weiteren ist bereits heute erkennbar, dass der Kontinent Afrika zunehmend im Fokus von Marktstrategen sein wird.
Beschaffungsmärkte:
Diese sind gekennzeichnet durch eine zunehmende Knappheit an Gütern und Ressourcen sowie hiermit verbundenen Preisexplosionen. Der Konsument spürt diese insgesamt anhand der Inflation, aber insbesondere unmittelbar anhand gestiegener Öl- und Energiepreise. Die verschiedenen Branchen greifen auf sehr unterschiedliche Bezugsquellen zurück.
Beschaffungsmärkte bedeuten nicht nur Zugang zu Ressourcen im Sinne von Rohstoffen, sondern auch die Verfügbarkeit von qualitativem Personal, beispielsweise in Branchen wie der IT-Industrie oder auch in ingenieurlastigen Industrien. Konzerne richten zunehmend Wertschöpfungsketten nach dem Kriterium »Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal« aus. Beispiele hierfür sind das Silicon Valley sowie Indien, wo sich die IT-Branche angesiedelt hat, oder auch Biotech-Zentren, wie z.B. in Martinsried bei München.
In Konzernabschlüssen ist anhand der Kennzahl Materialeinsatz zu Umsatz erkennbar, dass eine zunehmende starke Abhängigkeit zu den Beschaffungsmärkten besteht und dies eine der maßgeblichen kritischen Erfolgsfaktoren für Konzerne ist. Strategisch haben bereits heute Staaten und Konzerne damit begonnen, sich Ressourcenquellen langfristig zu sichern oder entsprechende Substitutionsmöglichkeiten bspw. durch synthetische Herstellungsprozesse zu evaluieren.
Kapitalmärkte
: Bei den Kapitalmärkten ist zu differenzieren zwischen den unterschiedlichen Anteilseignermärkten und den Märkten von Fremdkapitalgebern. Durch die zunehmende Zentralisierung von Finanzierungsfunktionen in den Konzernen verlieren kleinere regionale Finanzgeber zunehmend an Bedeutung, während globale Finanzgeber für die Konzerne an Bedeutung gewinnen.
Innovationsmärkte
: Konzerne werden zunehmend von den rasant verändernden Anforderungen der Märkte, insbesondere der Kapitalmärkte beeinflusst. Die Produktlebenszyklen verkürzen sich zunehmend und nicht mehr die Frage, wer ist Weltmarktführer in seinem Marktsegment heute, sondern wer ist Innovationsführer in seinem Marktsegment morgen, bestimmt die Zukunft eines Konzerns. Viele Konzerne in der Telekommunikations- und Unterhaltungsbranche haben aufgrund der mangelnden Innovationsfähigkeit ihre Marktführerschaft verloren und sind entweder in die Insolvenz gegangen oder übernommen worden. Laut einer Umfrage einer bekannten Unternehmensberatung sind 34% der Ansicht, dass ihr heutiges Geschäftsmodell sich in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren fundamental ändern wird. Vor allem die Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen und von Energie gehen zu 60% bzw. zu 50% davon aus, dass sie innerhalb der nächsten sechs Jahre ein »fundamental anderes Geschäftsmodell« fahren werden als heute.
1
Für die Konzerne geht es zunehmend um weltweite Vernetzungen mit Innovationsträgern wie Universitäten und Start-up-Unternehmen, um sich frühzeitig den Zugang zu technischen und marktbezogenen Ideen und Wissen zu sichern.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass international operierende Konzerne auf der einen Seite evaluieren, wie sie neue Märkte erschließen und Marktanteile in bestehenden Märkten ausweiten können, und auf der anderen Seite den Zugang zu essentiellen Beschaffungs- sowie Innovationsmärkten strategisch sichern und zugleich Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung, der Herstellung der Produkte sowie der Logistik stabil halten bzw. senken können. In diesem Kontext analysiert das Management Standortfragen und Möglichkeiten der Optimierung der effektiven Konzernsteuerquote (vgl. Abbildung A.2).
Abb. A.2: Gründe der Internationalisierung von Konzernen
Leitsatz
Der unbeschränkte Zugang zu den verschiedenen Märkten ist für die Konzerne von maßgeblicher Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Geschäftserfolgs. Die Konzerne richten strategische Entscheidungen, Organisationsstrukturen und Wertschöpfungsketten unter Einbeziehung von Digitalisierungsstrategien hiernach aus. Der Lebenszyklus von Konzernen hängt maßgeblich von der globalen Vernetzung, der hiermit verbundenen marktbezogenen Präsenz sowie der Veränderungsfähigkeit dieser ab.
2. Verrechnungspreise als Schnittstelle zwischen Unternehmensführung und Steuerquote
2.1 Konzerninterne Wertschöpfungsketten und die Relevanz von Verrechnungspreisen
Konzerne internationalisieren ihre Wertschöpfungskette – wie bereits oben dargestellt – aus diversen Gründen. Hiermit verbunden ist entweder die Gründung eigenständiger rechtlicher Einheiten, die Begründung von Betriebsstätten, die Gründung von Repräsentanzen und/oder die Strukturierungen von digitalen Präsenzen in den jeweiligen Ländern. In all den Fällen, in denen es sich um konzerninterne Organisationseinheiten handelt und diese in die konzerninternen Wertschöpfungsketten direkt oder indirekt eingebettet sind, wird das Interesse der Finanzbehörden geweckt, sicherzustellen, dass der Ort, an dem steuerpflichtige Gewinne ausgewiesen werden, mit dem Ort, an dem die tatsächliche wirtschaftliche Wirtschaftstätigkeit und Wertschöpfung stattfindet, übereinstimmt. Die Finanzbehörden haben ein gesteigertes Interesse, zu verstehen, wie der »Gewinnkuchen« eines Konzerns sich zwischen den aktiv am Wertschöpfungsprozess beteiligten Ländern aufteilt. Es ist jedoch auch von Bedeutung, dass die Finanzbehörden gleichermaßen verstehen, dass die Geschäftsleiter von Konzernen und Unternehmen die Unternehmensstrategie am Konzerninteresse und zum Wohl des Konzerns auszurichten haben, um eine langfristige Rentabilität des Konzerns zu sichern.2
Sobald ein grenzüberschreitender Liefer- oder Leistungsaustausch zwischen Unternehmen oder Organisationseinheiten eines Konzerns vorliegt, stellt sich die Frage der Vergütung dieser Transaktion. In der steuerlichen Sprache wird für den Liefer- und Leistungsaustausch der Begriff »Geschäftsvorfall« und für die Vergütung dieser der Begriff »Verrechnungspreise« verwendet. Der Begriff »Geschäftsvorfall« bezieht sich nicht nur auf Beziehungen zwischen rechtlichen Konzerneinheiten, sondern auch auf quasi vorhandene Leistungsbeziehungen zwischen nicht rechtlich selbstständig agierenden Konzerneinheiten, bei denen streng genommen kein rechtlicher Leistungsaustausch zugrunde liegt, wie z. B.
Beziehungen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte, da diesen keine rechtliche Vereinbarung zugrunde liegt, oder
Umlagesysteme: Unternehmen eines Konzerns schließen sich zu einer Gemeinschaft (fiktive Art einer BGB-Gesellschaft) zusammen, um im gemeinsamen Interesse durch Zusammenwirken in einem Pool Leistungen zu erlangen bzw. zu erbringen.
3
Ein Beispiel hierfür ist ein Forschungs- und Entwicklungspool, in dem jeder Teilnehmer die Ergebnisse verwertet.
Typische Geschäftsvorfälle sind:
Lieferungen von Gütern;
Erbringung von Dienstleistungen;
Vereinbarung von Finanzierungsverhältnissen (auch Gewährung von Sicherheiten);
Entsendung von Mitarbeitern;
Lizenzierung von immateriellen Wirtschaftsgütern;
Leasing von materiellen unbeweglichen oder beweglichen Wirtschaftsgütern;
Verkauf von Forderungen (Factoring).
In Abbildung A.3 wird auf einer funktionellen Betrachtungsweise eine typische konzerninterne Wertschöpfungskette dargestellt.
Abb. A.3: Typische Wertschöpfungskette
Zu beachten ist, dass auch Restrukturierungen von Geschäftsmodellen bzw. Wertschöpfungsketten sich zu einer Geschäftsbeziehung verdichten können.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mit der Restrukturierung Wirtschaftsgüter oder konkrete Vorteile von einem verbundenen Unternehmen an ein anderes Konzernunternehmen übertragen werden, wie z. B.
Produktionsfunktionen und hiermit verbundenes Knowhow;
Vertriebsfunktionen und der hiermit verbundene Kundenstamm an eine andere Konzerneinheit.
Die Vergütung der Geschäftsvorfälle zwischen den Konzerneinheiten erfolgt anhand der sog. Verrechnungspreise. Da in der überwiegenden Anzahl der Fälle regelmäßig kein direkter Marktpreis ermittelbar ist, wird der Verrechnungspreis zweckorientiert festgelegt. Die Bestimmung erfolgt entweder
marktorientiert
: Zum Beispiel wird der Wiederverkaufspreis, d. h. der Verrechnungspreis abgeleitet vom Marktpreis abzüglich einer Marge;
kostenorientiert
: Auf der Grundlage der angefallenen Kosten wird der Verrechnungspreis ermittelt, oder
gewinnorientiert
: Die Vertragspartner teilen sich den realisierten Gewinn nach bestimmten Regeln auf.
Die Regelung der Verrechnung wird als Verrechnungspreismethode bezeichnet. Mit der Auswahl der Verrechnungspreismethode wird bestimmt, wer im Konzern die sog. Übergewinne realisiert und wer im Konzern als Dienstleister vergütet wird.
Leitsatz
Grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen im Konzern sind vollständig zu erfassen und zu vergüten. Finanzverwaltungen haben ein gesteigertes Interesse daran, konzerninterne Wertschöpfungsketten zu verstehen, und wollen die Systematik der Vergütung hinsichtlich der Bestimmung des zu versteuernden Einkommens nachvollziehen.
2.2 Der Parameter »Steuern« als Einflussfaktor
Steuerliche Vorschriften werden vielfach als eine »Last« angesehen, die aufgrund der gesetzlichen Anforderungen (»Compliance«) zu erfüllen ist. Erhöhte Aufmerksamkeit erfährt die Konzernsteuerquote dann, wenn Möglichkeiten bestehen, diese zu optimieren, und dies auch ohne weitergehende Risiken umgesetzt werden kann. Vorstände und Geschäftsführungen sind berichtspflichtig gegenüber den Anteilseignern der Gesellschaft, so dass die geschäftsführenden Organe unterjährig, aber insbesondere am Geschäftsjahresende, berichtspflichtig hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Kontrollorgane, wie der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung, hinterfragen insbesondere, inwieweit die Geschäftsführung den Unternehmenswert gesteigert und zugleich zusätzliche flüssige Mittel für kurzfristige Dividendenausschüttungen realisiert hat.
Steuerlich getriebene Projekte werden sehr stark danach beurteilt, welchen Nutzen diese für das Unternehmen bzw. für den Konzern bringen. Auf dem Gebiet der Verrechnungspreise sind grundsätzlich folgende Maßnahmen zu unterscheiden:
Strukturierung von Verrechnungspreisen mit dem Ziel der Steueroptimierung
: Verrechnungspreissysteme werden unter Berücksichtigung bestimmter rechtlicher und wirtschaftlicher Parameter derart bestimmt, dass die maßgeblichen Gewinne an einem Standort realisiert werden, der eine möglichst niedrige Steuerbelastung aufweist. Im Lichte des OECD-Aktionsplans zu BEPS und der hiermit verbundenen Umsetzung in den OECD Verrechnungspreisrichtlinien 2017 ist der Steuerpflichtige aktiv aufgefordert, die betriebliche Substanz (Entscheidungs- und Kontrollstrukturen) bezogen auf die implementierten Verrechnungspreissysteme nachzuweisen.
»Tax follows business«– Bestimmung der konzerninternen Verrechnungspreissystematik als Ausfluss der konzerninternen Steuerung des Geschäftsmodells:
Bestehende Verrechnungspreissysteme in den Konzernen werden auf den Prüfstand hinsichtlich der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben bzw. internationaler Standards gestellt, um potenzielle Gewinnkorrekturen bzw. Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Für identifizierte grenzüberschreitende Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen Konzerneinheiten wird die vollständige Erfassung und die fremdvergleichskonforme Vergütung sichergestellt, d. h. die Verrechnungspreissystematik folgt dem betriebswirtschaftlichen Verständnis des Geschäftsmodells (»Tax follows business«). Es findet somit kein steuerinduzierter Eingriff in das bestehende Geschäftsmodell, wie z. B. die Bestimmung steueroptimierter Abrechnungsströme, statt.
»Minimalistischer Ansatz« – Vermeidung etwaiger Strafzuschläge und eines strafrechtlichen Aufgriffs
: In diesem Ansatz folgt die Verrechnungspreissystematik der konzerninternen Steuerungssystematik, ohne eine weitergehende Untersuchung der Auswirkung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf konzerninterne Geschäftsbeziehungen durchzuführen. Dies kann insbesondere in den Konzernen festgestellt werden, in denen die Verrechnungspreissystematik der betrieblichen Controller-Logik folgt. Es wird zwar die vollständige Erfassung aller Geschäftsbeziehungen sichergestellt, eine ausreichende Funktions- und Risikoanalyse und die hiermit verbundene Herleitung einer Verrechnungspreismethodik für steuerliche Zwecke wird aber vielfach nur für Dokumentationszwecke durchgeführt. Mit anderen Worten, die Verrechnungspreisdokumentation soll Diskrepanzen zwischen der Steuerung von Geschäftsmodellen und der steuerlichen Beurteilung dieser heilen. Das Gewinnberichtigungsrisiko ist jedoch bei einer derartigen Verfahrensweise erheblich. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern sowohl die Erhebung von Strafzuschlägen als auch die strafrechtliche Verfolgung unmittelbar an die steuerstrafrechtlichen Vorschriften gekoppelt ist.
Leitsatz
Steueroptimierung ohne Steuersicherheit sollte vermieden werden. Die Strukturierung von Verrechnungspreissystemen ist nicht nur nach Cashflow- und Compliance-Aspekten auszurichten, sondern vielmehr nach dem Gesichtspunkt der steuerlichen Anerkennung und somit der Vermeidung von materiellen Gewinnberichtigungen in den jeweiligen Vertragsstaaten.
2.3 Steueroptimierung versus Steuersicherheit
Es ist zu beobachten, dass im Rahmen von Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Investoren-Telefonkonferenzen das Management mit der Frage konfrontiert wird, welche Maßnahmen dieses ergreift, um die effektive Steuerbelastung zu reduzieren. Hierzu werden vielfach sog. Benchmarks aus der gleichen Branche herangezogen. Die G20-Länder und in der Folge die OECD haben mit dem sog. BEPS-Aktionsplan auf die aggressive Steuerpolitik einzelner Konzerne reagiert. So sieht der Aktionspunkt 13 »Verrechnungspreisdokumentation« sowie in der Folge Kapitel V der OECD-Richtlinien in Zukunft die Vorlage des sog. »Country-by-Country Reports« (kurz CbCR) für Konzerne mit einem konsolidierten Konzernumsatz von mehr als 750 Mio. € vor. Dieser umfasst die Höhe der Einkünfte, die Vorsteuergewinne, die gezahlten und noch zu zahlenden Ertragsteuern für jede Steuerjurisdiktion, in der eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird (Table 1) sowie eine »high-level«-Funktionsanalyse für jede rechtliche selbstständige und unselbstständige Einheit (Table 2).4 Mit dieser Maßnahme möchte die OECD zum einen eine weitergehende Transparenz hinsichtlich der steuerlichen Einkünfte erreichen, aber auch zum anderen die Finanzverwaltung in die Lage versetzen, eine Vorab-Verrechnungspreis-Risikoanalyse durchzuführen. Die Finanzverwaltungen sind seitens der OECD angehalten, keine vertraulichen Informationen, die dem Steuergeheimnis unterliegen, an die Öffentlichkeit zu geben. Der Aspekt der Geheimhaltung ist für die Steuerpflichtigen nicht nur im Hinblick auf steuerlich relevante Daten bedeutend, sondern insbesondere im Hinblick auf Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Finanzdaten.5 Hiergegen hat die Europäische Kommission in einem Kommissionsvorschlag vom 12.4.2016 einen Vorschlag zur Veröffentlichung von bestimmten Ertragsinformationen aus dem CbCR im Internet unterbreitet.6 Unabhängig hiervon veröffentlichen bereits mehrere namhafte international operierende Konzerne Teile des CbCR im Internet. Auch Aktionärsvertreter fragen zunehmend im Rahmen von Hauptversammlungen nach diesen Informationen. Eine weitergehende Offenlegung dieser Daten gegenüber der Öffentlichkeit ist jedoch aufgrund des übergeordneten Schutzes von Geschäftsgeheimnissen abzulehnen.
In Abschnitt 2.5 wird später auf die Einflussfaktoren der effektiven Steuerquote eingegangen. Insofern ist zu prüfen, welche Parameter die Konzernsteuerquote beeinflussen und bei den in Frage kommenden Optionen ist die Beziehung zwischen operativen Veränderungen und dem Steuereffekt zu analysieren.
In Konzernen werden vielfach Prinzipalmodelle diskutiert, in denen in einer Konzerneinheit, die typischerweise in einem Niedrigsteuergebiet wie der Schweiz liegt, strategische Funktionen und die wesentlichen für die Ausübung der Geschäftstätigkeit notwendigen immateriellen Wirtschaftsgüter gebündelt werden. Die Konzerne fungieren somit als Entrepreneur.7 Die Produktions- und Vertriebseinheiten des Konzerns werden vielfach als Routineeinheiten qualifiziert und über die Verrechnungspreise mit einem bestimmten, aber eher niedrigeren Gewinnniveau ausgesteuert. Somit realisiert die Prinzipalgesellschaft die Übergewinne aus der Geschäftstätigkeit, die wiederum einer niedrigeren Steuerbelastung unterliegen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Konzerne vielfach ein derartig für steuerliche Zwecke geeignetes Geschäftsmodell anstreben.
Es sind jedoch folgende operative Aspekte zu betrachten:
Wie viel Substanz benötigt der Prinzipal, damit das Geschäftsmodell dem Grunde nach anerkannt wird? Die OECD spricht in diesem Kontext von dem sog. »Control-Over-Risk-Approach«, wonach die Charakterisierung einer Funktion auf Grundlage von (Personal-) Funktionen zur Kontrolle der Risiken sowie den finanziellen Mitteln zur Übernahme von Risiken abhängt. Die Kontrollfunktion setzt voraus, dass die Entscheidungsträger die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen zur Risikokontrolle haben. In der Regel reicht es nicht aus, dass nur das Topmanagement in der Prinzipalgesellschaft angesiedelt ist.
Welche Folgen hat eine Prinzipalstruktur für das Supply-Chain-Management? In bestimmten Fallgestaltungen fallen mit den neuen Strukturen zusätzliche operative Aufwendungen an.
Wie ist das generelle Kostenniveau im Prinzipalland? Umso mehr Mitarbeiter für die Steuerung und Kontrolle der Geschäftstätigkeit von Notwendigkeit sind, umso mehr Lohn- und Gehaltskosten fallen an.
Ist der Ort der Prinzipalgesellschaft ausreichend attraktiv für das Management? Fluktuation im Management kann zusätzliche Aufwendungen erzeugen.
Ist der Ort der Prinzipalgesellschaft logistisch ausreichend angeschlossen? Ohne die Nähe zu internationalen Flughäfen ist die Anbindung des Managements an die operative Tätigkeit des Konzerns nicht möglich.
Welche Implementierungsaufwendungen fallen mit der Umstellung des Geschäftsmodells an? Konzerninterne Systeme und Prozesse müssen auf das neue Modell hin angepasst werden.
Des Weiteren sind steuerlich folgende Kriterien zu prüfen:
Verursacht der Wechsel eines Geschäftsmodells zusätzliche Ausgleichszahlungen?
8
Bei der Übertragung von werthaltigen Funktionen und Wirtschaftsgütern sind diese vielfach marktkonform zu vergüten.
Fallen ggf. Quellensteuern aufgrund von Zahlungsabflüssen in anderen Ländern an, die steuerlich nicht genutzt werden können?
Des Weiteren sind die umsatzsteuerlichen Bedingungen und zollrechtlichen Aspekte zu prüfen.
Es ist feststellbar, dass Finanzbehörden zunehmend aggressiv derartig steuerlich optimierte Geschäftsmodelle aufgreifen. Hier ist zu prüfen, ob es sinnvoll ist, neue Geschäftsmodelle vorab mit den jeweiligen Finanzverwaltungen abzustimmen.
9
In bestimmten gesellschaftsrechtlichen Strukturen und in Abhängigkeit der Qualifizierung der Geschäftstätigkeit im Prinzipalland, können trotzdem Hinzurechnungsbesteuerungen im Land der Anteilseigner anfallen.
10
Im steuerlichen Umfeld ist zu beachten, dass die Finanzministerien zunehmend bestrebt sind, international steuerliche Aspekte, insbesondere auf dem Gebiet der Verrechnungspreise, detaillierter zu regeln (vgl. Abbildung A.4).
Abb. A.4: Verrechnungspreisregelungen in Deutschland
Des Weiteren ist festzustellen, dass – auch begründet durch die weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrisen und die hiermit verbundenen Haushaltsdefizite – Finanzverwaltungen zunehmend aggressiv im Rahmen von Betriebsprüfungen Verrechnungspreissysteme aufgreifen. Das Korrekturvolumen hat bereits in Einzelfällen die Milliardengrenze überschritten. Die Kunst des Handelns von heute ist es, das Verhalten der Finanzbehörden von morgen zu adaptieren. Mit anderen Worten: Die Betriebsprüfungen beginnen i. d. R. zeitversetzt von drei bis fünf Jahren nach Realisierung des Tatbestandes. Die Betriebsprüfer wenden jedoch ihren Kenntnisstand und vielfach die Rechtslage zum Zeitpunkt der Betriebsprüfungen an. Somit ist zum Zeitpunkt der Realisierung steueroptimierender Instrumente sicherzustellen, dass der angestrebte Steuervorteil sich nicht in späteren Jahren zu einem höheren Steuernachteil umdreht.
Konzerne haben die Bedeutung der Verrechnungspreise sowohl hinsichtlich des Einflusses auf die konzerninterne Steuerung von Geschäftsprozessen, als auch im Hinblick auf die Konzernsteuerquote erkannt und entsprechend die Prioritäten innerhalb der Managementagenda angepasst (vgl. Abbildung A.5). Im Bereich des Managements von Steuern sind die Konzerne nach einer Untersuchung weitestgehend bereit, für die Zukunft zu investieren.
Abb. A.5: Prioritäten von steuerlichen Themen auf der Agenda des Managements;
Quelle: In Anlehnung an Global Tax Monitor, Market research, Transfer pricing, year ending Q2 2012
Leitsatz
Maßnahmen der Steueroptimierung sind hinsichtlich der Steuersicherheit zu prüfen. Gegebenenfalls sind Vorababstimmungen mit den betroffenen Finanzbehörden zu empfehlen. Des Weiteren ist der ermittelte Steuervorteil mit ggf. anfallenden operativen Konsequenzen und zusätzlich anfallenden Aufwendungen abzuwägen.
Die Einführung des CbCR dient der Transparenz der Konzernsteuerquote sowie der Offenlegung, in welchen Staaten welche Aktivitäten in welcher Höhe zu einer Besteuerung führen. Mit dem CbCR sowie dem geregelten Informationsaustausch zwischen Vertragsstaaten sollen aggressiven Steuervermeidungsmodellen entgegengetreten werden.
2.4 Cashflow als Entscheidungsparameter
Anteilseigner beurteilen den Erfolg ihres Konzerns i. d. R. anhand von zwei maßgeblichen Faktoren:
Dividendenpotenzial: kurzfristiger Rückfluss von Liquidität an die Anteilseigner auf der Grundlage des realisierten Jahresüberschusses.
Wertsteigerung des Unternehmenswertes: Grundlage der Beurteilung ist der Marktwert des unternehmerischen Eigenkapitals (»Shareholder Value«), d. h. der langfristigen Gewinnmaximierung.
11
Werttreiber des Shareholder Value sind die langfristigen Zahlungsüberschüsse (Cashflow), die ein Konzern erzielt. Der Konzern-Cashflow wird i. d. R. ermittelt auf der Grundlage des Konzernjahresüberschusses und der Eliminierung von nicht-zahlungswirksamen Positionen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Bei der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung (kurz GuV) nach HGB12 handelt es sich um einen Werttreiber, der sowohl zahlungswirksame als auch nicht-zahlungswirksame Elemente enthält. Bei den nicht zahlungswirksamen Faktoren handelt es sich i. d. R. um latente Steuern, die i. d. R. in späteren Perioden zu zahlungswirksamen Effekten führen. Der Unterschied zu allen GuV-Positionen oberhalb der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag13 ist, dass es sich bei der genannten Position um eine zahlungswirksame Größe handelt, der keine direkte Gegenleistung gegenübersteht.14 Jedoch ist zu berücksichtigen, dass, wenn über die Optimierung von Konzernsteuerquoten gesprochen wird, vielfach eine unmittelbare oder mittelbare Beziehung zwischen den Einflussgrößen des operativen Ergebnisses (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) und den zu zahlenden Ertragsteuern besteht. In der Regel wird durch Beeinflussung bestimmter Aufwandspositionen einer einzelnen rechtlichen Einheit (Steuersubjekt) direkter Einfluss auf die steuerliche Bemessungsgrundlage genommen. Jedoch ist zu unterscheiden zwischen Steuern als Ausfluss der Gestaltung der operativen Geschäftstätigkeit und der Anwendung bestimmter steuerlicher Vorschriften. Beispiele hierfür sind die sog. Debt-Push-Down-Modelle, in denen durch Veränderung des Kapitalverhältnisses einer Gesellschaft das Finanzergebnis direkt verändert wird oder auch die Gestaltung von Verrechnungspreismodellen zur aktiven Steuerung des operativen Ergebnisses einer Konzerngesellschaft.
Leitsatz
Steuern sind eine Zahlungsgröße, der keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Die Gestaltung der Steuerlast kann vielfach über die Ausnutzung bestimmter steuerlicher Vorschriften sowie der Strukturierung von Verrechnungspreissystemen gestaltet werden.
2.5 Steuerpolitik im Kontext einer sich verändernden Steuerwelt
Die Konzernsteuerquote eines Konzerns und die hiermit verbundenen Zahlungsverpflichtungen werden durch verschiedene Parameter beeinflusst.
2.5.1 Steuersatz
»Digitalkonzern X zahlt kaum Steuern«. Der Konzern beschäftigt mit die besten Entwickler und Designer und vermarktet seine Produkte weltweit erfolgreich. Doch zahlte der Konzern X im abgelaufenen Geschäftsjahr einen effektiven Steuersatz von 1,9 %. 70 % des Umsatzes realisierte X dabei außerhalb von den USA. Viele vorwiegend angloamerikanische, aber auch europäische Konzerne standen und stehen im Blickwinkel öffentlich geführter Diskussionen zu Steuervermeidungsstrategien von global agierenden Konzernen. Die aktive Gestaltung der Konzernsteuerquote basiert in den überwiegenden Fällen auf der Strukturierung und Vergütung von immateriellen Werten und Finanzierungen.15 Die Politik und in der Folge die OECD kritisiert zunehmend die Steuerpolitik großer, vielfach digitaler Multikonzerne. »Diese Taktiken sind zwar streng genommen legal, beeinträchtigen aber die Steuergrundlage vieler Länder und gefährden die Stabilität des weltweiten Steuersystems«. Neben der steuerlichen Behandlung von immateriellen Wirtschaftsgütern stehen im Fokus der Kritik die steuerliche Strukturierung von Internethandel, digitale Geschäftsmodelle und Finanzinstrumente.16 Die G-20-Länder haben auf ihrer Sitzung in Lima am 8.10.2015 basierend auf detailliert ausgearbeiteten Empfehlungen der OECD dem sog. BEPS-Aktionsplan (Based Erosion Profit Shifting) zugestimmt. Laut OECD wird die Umsetzung des Maßnahmenpaketes dazu führen, dass zukünftig der Ort, an dem steuerpflichtige Gewinne ausgewiesen werden, besser mit dem Ort übereinstimmt, an dem die tatsächliche Wirtschaftstätigkeit und Wertschöpfung stattgefunden hat. Dieser Plan sieht in 15 Aktionspunkten detaillierte Maßnahmen vor, die sowohl auf völkerrechtlicher Ebene (DBA-Framework) als auch auf nationalstaatlicher Ebene kurzfristig umzusetzen sind.17 Die EU-Finanzminister haben die OECD-Maßnahmen bestätigt und sind dabei, eine Richtlinie zu verabschieden, die die Konzerne an einer sog. »hybriden Steuergestaltung« hindern soll. Diese Richtlinie soll wirksam werden für die Wirtschaftsjahre, die nach dem 1. Januar 2020 beginnen. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission eine sog. schwarze Liste an Steueroasen veröffentlicht. Die möglichen Maßnahmen gegen die endgültig als Steueroasen identifizierten Staaten sind noch nicht final festgelegt.18
Des Weiteren wird die Zuordnung der Besteuerungsrechte für die Gewinne einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft als weitere große Herausforderung des internationalen Steuerrechts angesehen. Die OECD arbeitet seit 2019 unter den Bezeichnungen Pillar One und Pillar Two an einer anteiligen Zuordnung von Besteuerungsrechten zu den Marktstaaten sowie der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. Aus Verrechnungspreissicht ist insbesondere Pillar One im Fokus der öffentlichen Auseinandersetzung. Dieser Ansatz sieht im Gegensatz zu der herkömmlichen Umsetzung des Fremdvergleichsgrundsatzes vor, dass jenen Staaten, in denen Umsätze unabhängig von einer physischen Präsenz realisiert werden, ein bestimmter Anteil an Gewinn in Abhängigkeit von Bedingungen vorab zugeordnet wird. Bei einem Treffen des Inclusive Framework on BEPS von OECD und G20 am 08.10./09.10.2020 wurde zwar der Wille bekräftigt, die steuerlichen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft zu bewältigen. Allerdings wurde die bislang für das Jahr 2020 noch geplante, politische Einigung auf Mitte 2021 verschoben.
Die Länder stehen im Steuerwettbewerb und in der öffentlichen Diskussion wird dieser meistens über den Nominalsteuersatz ausgetragen. Der Nominalsteuersatz wird jedoch wiederum beeinflusst durch die Staats- und Finanzsysteme der jeweiligen Länder.
Als Folge der Umsetzung des OECD-BEPS-Aktionsplanes, der zunehmenden Forderung nach Transparenz in Steuerfragen sowie dem zunehmenden Protektionismus in wichtigen Industrieländern, wie z. B. Großbritannien und den USA, wird eine neue Stufe des Steuerwettbewerbs eingeläutet. Wolfgang Schön, Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen warnt vor Illusionen. Man schaue nicht länger nur, wo Lizenzeinnahmen versteuert würden und wie sich Unternehmen grenzüberschreitend finanzieren.19 Es geht um umfassende Unternehmenssteuerreformen. In den USA wurde eine Steuerreform mit Wirkung vom 1. Januar 2018 implementiert, die zum einen eine erhebliche Senkung des Unternehmenssteuersatzes auf 21 % vorsieht, aber zum anderen Cash-Abflüsse ins Ausland mit einer zusätzlichen Besteuerung benachteiligt. Die Schweiz hat im Kontext dieses Steuerwettbewerbes für Erträge aus Patenten und ähnlichen Rechten eine Reduzierung des Steuersatzes von 90 % vorgenommen. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die im Inland entstehen, sind bis zu 150 % steuerlich abzugsfähig. Des Weiteren wird auf jenen Teil des Eigenkapitals, den ein Unternehmen längerfristig nicht für die Betriebsführung braucht, ein steuerlich abzugsfähiger, kalkulatorischer Zins berechnet.20 Mit diesen Maßnahmen will die Schweiz attraktiv werden als Standort für Forschungs- und Entwicklungsprojekte und für Holdingstrukturen. Polen hat im Gegensatz hierzu mit der Steuerreform, die ab dem 1.1.2018 wirksam geworden ist, eine Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von konzerninternen Dienstleistungsverrechnungen als Betriebsausgaben eingeführt.
In Deutschland wird hier maßgeblich unterschieden zwischen der Einkommensteuer/Körperschaftsteuer auf der einen Seite und der Gewerbesteuer auf der anderen Seite. In Abhängigkeit von der Gemeinde variiert der Gewerbesteuerhebesatz zwischen 200 % und ca. 500 %. Das heißt, bei Kapitalgesellschaften kann in Abhängigkeit vom Standort der Steuerpflicht bei einem Körperschaftsteuersatz von 15% und dem Solidaritätszuschlag von 5,5% der effektive Steuersatz zwischen 24,9% und 35,25% betragen. In der Schweiz wird ebenfalls zwischen einem staatlichen und einem kantonalen Steuersatz unterschieden. Im Gegensatz zu Deutschland hat hier der Steuerpflichtige die Möglichkeit, mit der jeweiligen Steuerbehörde den Steuersatz zu verhandeln. In anderen Ländern, wie z. B. in Großbritannien oder Italien, erheben die Steuerbehörden in Ergänzung zur Ertragsteuer auch bei Körperschaften spezifizierte Substanz- oder gewinnunabhängige Steuern. Des Weiteren kann beobachtet werden, dass der globale Steuerwettbewerb sich zunehmend auf die Gewährung von spezifischen Incentives konzentriert. Im Fokus stehen sog. IP- und Finanzierungsboxen, d. h. die spezifischen funktionsbezogenen Erträge werden entweder steuerfrei oder steuerermäßigt gestellt. Diese Incentive-Systeme stehen zunehmend in der öffentlichen Kritik und führen zu sog. Anti-Steuervermeidungsregelungen in den jeweiligen Partnerstaaten. In diesem Kontext hat Deutschland ein entsprechendes Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen eingeführt (§ 4j EStG), wonach Aufwendungen für Rechteüberlassungen an nahestehende Personen nicht mehr oder nur noch zum Teil abziehbar sind. Voraussetzung für das Abzugsverbot ist, dass die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger aufgrund eines als schädlich eingestuften Präferenzregimes (u. a. »Lizenzbox«) nicht oder nur niedrig besteuert werden.21 Die OECD stellt auf der eigenen Webseite eine Übersicht über die derzeit geltenden Nominal- und Effektiv-Steuersätze aller OECD-Staaten bereit.22
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in Ergänzung zur nationalstaatlichen Umsetzung des OECD-BEPS-Aktionsplanes die meisten Staaten neben der Steuersatzpolitik weitere steuerliche Maßnahmen ergreifen, um steuerliche Investitionen insbesondere im Forschungs- und Entwicklungsbereich zu fördern oder die Niedrigbesteuerung dieser zu verhindern.
2.5.2 Bemessungsgrundlage
Bei der Ermittlung des zu versteuernden Gewinns gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Nach deutschem Steuerrecht wird unterschieden zwischen steuerlich abzugsfähigen und nicht abzugsfähigen Aufwendungen. Des Weiteren sind für gewerbesteuerliche Zwecke die Vorschriften zu Hinzurechnungen bzw. Kürzungen bei der Ermittlung des Gewinns zu berücksichtigen. So werden beispielsweise nach § 8 GewStG Teile von Miet- und Pachtzinsen als auch von Lizenzausgaben der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage hinzugerechnet. Auch zu berücksichtigen sind steuerliche Vorschriften, die inländische Verlustvorträge, -rückträge oder auch -verrechnungen zulassen. In anderen Ländern wird häufig die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Steuerlast zur steuerlichen Förderung von bestimmten geschäftlichen Aktivitäten verwendet. So kann z. B. in Ungarn der Steuerpflichtige Forschungs- und Entwicklungsausgaben bei der Erfüllung bestimmter Bedingungen doppelt von der Bemessungsgrundlage abziehen. Innerhalb der EU gibt es hierzu spezifische Bestrebungen, die steuerliche Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (Common Consolidated Corporate EU Tax Base – kurz CCCTB) zu harmonisieren.23
2.5.3 Steuerliche Förderungen
In Abhängigkeit vom Land, der Geschäftstätigkeit an sich (z. B. Land- und Forstwirtschaft), der Größe des Betriebs (z. B. Erleichterungen für Kleinbetriebe) oder der Ausprägung der rechtlichen Einheit (z. B. Personengesellschaften, Betriebsstätten) werden steuerliche Förderungen oder Sonderregelungen gewährt, die entweder spezifisch darauf abstellen, die Steuerlast zu senken, oder eine Verschiebung der Besteuerung bewirken. Als Beispiel ist nach deutschem Steuerrecht die Möglichkeit der Bildung eines steuerlichen Ausgleichspostens bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens zwischen Stammhaus und Betriebsstätte innerhalb der EU zu nennen.24 Darüber hinaus war es in verschiedenen Ländern vielfach Praxis, als Investitionsanreiz unilaterale verbindliche Zusagen für steuerliche Gestaltungen zu geben. Diese Zusagen sind ebenfalls Gegenstand des OECD-Aktionsplans und in Zukunft im Rahmen der Verrechnungspreisdokumentation offenzulegen.25
2.5.4 Steuersystem
Steuersysteme sind häufig auf bestimmte Investitionsanlässe ausgerichtet. Hier sind insbesondere Länder wie Dänemark oder Luxemburg zu nennen, die spezielle Holding-Regimes anbieten, oder auch Österreich, wo unter bestimmten Bedingungen eine grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung möglich ist. Des Weiteren ist im Kontext von Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern zu analysieren, in welcher Form im Ausland erhobene Steuern, wie z. B. Quellensteuer nach nationalem Recht, verrechnet werden können (Freistellungs-, Anrechnungsmethode). Steuersysteme sind jedoch gleichermaßen, wie bereits erwähnt, zunehmend geprägt von der Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben bzw. der steuerlichen Vergünstigung von bestimmten Ertragsarten.
2.5.5 Steuerumfeld
Es ist zu beobachten, dass Finanzverwaltungen sehr unterschiedlich Verrechnungspreise prüfen. Eine Klassifizierung der Länder kann wie folgt vorgenommen werden:
»
Kundenorientiert«
: In Abhängigkeit der Materialität der grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen werden Verrechnungspreise auf einer Verplausibilisierungssystematik im Rahmen der Prüfung der Steuererklärung geprüft, wie z. B. die Schweiz oder Singapur.
»
Formalistisch«
: Die Prüfung von Verrechnungspreisen wird mehr formalistisch durchgeführt, d. h. die wörtliche Auslegung von gesetzlichen Regelungen sowie die den Verrechnungspreisen zugrunde gelegten Verträge stellen die Grundlage für die Betriebsprüfung dar; beispielhafte Länder sind Polen, Frankreich, Portugal, Japan, Kanada und Russland.
»
Wirtschaftlich, pragmatisch«
: Die Betriebsprüfer legen den Schwerpunkt ihrer Prüfung auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten und interpretieren Verrechnungspreise als Ausfluss der Konzernstrategie und der hiermit verbundenen Umsetzung. In dieser Rubrik zu nennen sind Großbritannien, die USA, die skandinavischen Länder, und partiell auch Deutschland und Österreich.
»Cashorientiert«
: Sowohl Entwicklungsländer als auch sich stark entwickelnde Länder wie die BRIC-Staaten
26
analysieren Verrechnungspreissysteme von dem Aspekt des Devisenabflusses aus. Vielfach bedürfen bestimmte Transaktionen vorab der Genehmigung der Zentralbank oder anderer staatlicher Behörden.
»Weniger entwickelt«
: Hierbei handelt es sich um Länder, in denen Verrechnungspreise nicht explizit gesetzlich verankert sind, bzw. in denen die Finanzverwaltungen noch keine detaillierten Richtlinien implementiert haben.
»Aggressiv«
: Insbesondere in Ländern mit hohen Haushaltsdefiziten kann beobachtet werden, dass die Gesetzgeber protektionistische Verrechnungspreisregelungen gesetzlich verankern und die Finanzverwaltungen das Prüfungsgebiet Verrechnungspreise aggressiv aufgreifen. Häufig werden in diesen Ländern Verrechnungspreise auch unter dem Gesichtspunkt der Begründung von Betriebsstätten geprüft. In Europa ist hier beispielhaft Italien zu nennen, in Asien insbesondere China, Korea und Indien.
Das Steuerumfeld bestimmt die Sicherheit der prognostizierten Steuerlast. Je aggressiver eine Steuerverwaltung an das Steuergebiet Verrechnungspreise herangeht, umso unsicherer ist die effektive Steuerquote.
In Abbildung A.6 wird die Steuerquote in Abhängigkeit vom Steuerumfeld anhand eines Beispiels dargestellt. In der Matrix wird ebenfalls die Gestaltbarkeit der Steuerquote anhand der »Portabilität« von steuerlichem Einkommen analysiert.
Leitsatz
Der Steuersatz alleine bestimmt nicht die effektive Steuerbelastung. Vielmehr beeinflussen sowohl nationale Sonderregelungen als auch das Steuerklima die tatsächliche Steuerbelastung der Konzerne.
2.6 Zusammenhang zwischen operativem Ergebnis und Steuerlast
Wie bereits dargestellt, ist die Geschäftstätigkeit der meisten Konzerne geprägt von grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten. In diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden, in welchem Land welche Funktion ausgeübt wird und welche Einheit im Konzern die ausgeübte Funktion steuert und die hiermit verbundenen Risiken trägt sowie der Digitalisierungsgrad der Wertschöpfungskette. So ist es denkbar, dass ein Produzent von Produkten als Veredler/Lohnfertiger auftritt, als verlängerte Werkbank mit einem eigenen Investitionsrisiko oder als Vollproduzent. Vergleichbar kann eine Vertriebseinheit als Agent (»im fremden Namen und auf fremde Rechnung«) oder als Eigenhändler (»im eigenen Namen und auf eigene Rechnung«) seine Geschäftstätigkeit durchführen (vgl. auch Abbildung A.7). Zunehmend von Relevanz werden jedoch auch realisierte Endkunden-Umsätze in den Marktstaaten ohne physische Präsenz.
Abb. A.6: Internationales Steuerumfeld;
Quelle: Valeria Cardillo Piccolino, https://www.linkedin.com/pulse/cross-cultural-conflict-use-anthropologists-map-cardillo-piccolino
Mit der Strukturierung der Geschäftstätigkeit ergeben sich unmittelbare Konsequenzen auf die Erfolgsrechnung der rechtlichen Einheit. Im Falle eines konzerneigenen Agenten hat dieser keine Außenumsätze, sondern nur konzerninterne Umsätze für die Vergütung seiner Leistung. Die Höhe und Stabilität des Gewinns der leistungserbringenden Einheit richtet sich somit an der Wertigkeit der Funktion, der übernommenen Risiken und der für die Durchführung der Geschäftstätigkeit notwendigen Wirtschaftsgüter aus. Des Weiteren ist aber auch von Bedeutung, in welcher Einheit Funktionen und Wirtschaftsgüter angesiedelt werden. Je abstrakter die Geschäftstätigkeit und umso mehr der Rückgriff weniger auf materielle, sondern vielmehr immaterielle Wirtschaftsgüter erfolgt, umso disponibler ist die Zuordnung (vgl. Abbildung A.8).
Ein namhafter Konsumgüterkonzern verkaufte beispielsweise seinen Markennamen von einer konzerninternen Einheit auf Cayman Island an eine konzerninterne Gesellschaft in den Niederlanden. Der Verkaufspreis belief sich auf 12 Mrd. €. Die Finanzierung erfolgte in Höhe von 8,4 Mrd. € mit konzerninternen Darlehen undin Höhe von 3,6 Mrd. € mit Eigenkapital. Grund für die Übertragung innerhalb des Konzerns war »die Unternehmensstruktur zu stärken und zu vereinfachen«. Des Weiteren wurde eine steuerlich induzierte Finanzierungsstruktur implementiert, die gleichermaßen unmittelbaren Einfluss auf die Konzernsteuerquote hat.
Vollproduzent
Verlängerte Werkbank
Eigenhändler
Vertriebsagent
Umsatzerlöse
gegenüber fremden Dritten
X
X
gegenüber verbundenen Unternehmen
X
X
Provisionserlöse
X
Bestandsveränderung
RHB-Stoffe
X
X
Unfertige Erzeugnisse
X
(X)
Fertigerzeugnisse
X
X
Wareneinsatz
von fremden Dritten
X
X
von verbundenen Unternehmen
X
X
X
Personalaufwand
X
X
X
X
Abschreibungen
auf immaterielle Wirtschaftsgüter
X
Wirtschaftsgüter des immateriellen Anlagevermögens
X
X
(X)
Vertriebsaufwendungen
(X)
X
X
Materialaufwendungen
(X)
X
(X)
Sonstige Aufwendungen
X
X
X
X
= Operatives Ergebnis
X
X
X
X
Abb. A.7: Einfluss von Verrechnungspreisen auf die Erfolgsrechnung
Abb. A.8: Disposition von Funktionen und Wirtschaftsgütern
Vielfach werden auch Finanzierungseinheiten genutzt, um Einfluss auf die Konzernsteuerquote zu nehmen. Dies kann erfolgen, indem Finanzierungsleistungen unter Anwendung von nationalem Steuerrecht und den bilateral abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen derart strukturiert werden, dass die Finanzierungsleistungen nicht besteuert werden (sog. double-dip-Effekte). Häufig werden in diesen Fällen im Land der ausleihenden Partei die Finanzierungseinnahmen als steuerfreie Dividenden klassifiziert und im Land der finanzierenden Einheit die Zinsausgaben als steuerfreie Ausgaben zugelassen oder ein doppelter Betriebsausgabenabzug in beiden Vertragsstaaten gewährt. Gleichermaßen bieten eine zunehmende Anzahl an Ländern spezielle steuerliche Sonderbehandlungen von immateriellen Wirtschaftsgütern und Finanzierungsleistungen an, die zur Reduzierung der Konzernsteuerquoten führen.
Diesen sog. aggressiven Steuerstrukturen ist die OECD mit dem BEPS Aktionsplan entgegengetreten. Hiernach soll, wie bereits dargelegt, das steuerliche Einkommen an dem Ort der Besteuerung unterliegen, an dem die wirtschaftlichen Aktivitäten stattfinden. Um dies sicherzustellen, sind die Vertragsstaaten verpflichtet, über den geregelten Informationsaustausch zwischen den Staaten alle notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Insofern sind die Konzerne angehalten, steuerliche Strukturen unmittelbar an die Substanz der wirtschaftlichen Aktivitäten zu binden.
Leitsatz
Über die Strukturierung von Wertschöpfungsketten kann unmittelbar Einfluss auf die Konzernsteuerquote genommen werden. Die steuerliche Akzeptanz der Strukturen ist jedoch unmittelbar an die Substanz der wirtschaftlichen Aktivität gebunden.
2.7 Einfluss von konzerninternen Geschäftsmodellen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens
Die Verrechnung von Lieferungen und Leistungen hat unmittelbaren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einzelnen Konzerngesellschaften und des Gesamtkonzerns. Bei den meisten konzerninternen Transaktionen werden konzerninterne Effekte im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. Es gibt jedoch auch Fallgestaltungen, die zu Auswirkungen auf das Konzernergebnis führen können. Ein Beispiel hierfür sind konzerninterne Umlagesysteme im Forschungs- und Entwicklungsbereich, deren Gegenstand für Zwecke des Konzernabschlusses vielfach als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden müssen. Gleichermaßen haben steuerliche Abzugsbeschränkungen, wie z. B. bei der Abschreibung auf Goodwill oder bei konzernintern übertragenem IP unmittelbar Auswirkungen auf das Konzernergebnis.
Weitergehende Auswirkungen haben konzerninterne Verrechnungssysteme von Lieferungen und Leistungen auf den Jahresabschluss der einzelnen rechtlichen Einheit.
2.7.1 Vermögenslage
Sowohl bei der Zuordnung von immateriellen Werten als auch bei Leasingvereinbarungen im Konzern kommt es vielfach zum Auseinanderfallen des rechtlichen Eigentums und der wirtschaftlichen Ertragsberechtigung. Dies kann zum einen zu der Fragestellung führen, welche Konzerngesellschaft die Aktivierung des Wirtschaftsgutes vorzunehmen hat. Der Buchwert von immateriellen Vermögensgegenständen als auch der Wert von Finanzanlagen ist im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Wertigkeit zu prüfen. Insbesondere in den Fällen, in denen der Ertragswert dieser Vermögensgegenstände maßgeblich von konzerninternen Geschäftsbeziehungen abhängt, können Veränderungen des Geschäftsmodells zu unmittelbaren Folgen auf den Wertansatz führen.
Zum anderen geht es auch um die Ertragsberechtigung aus der Verwertung des zu betrachtenden Wirtschaftsgutes. Die OECD hat hierzu im Rahmen des sog. BEPS-Aktionsplanes entsprechende Leitlinien hinsichtlich der Verrechnungspreisbestimmung für Transaktionen mit immateriellen Werten erarbeitet, die im Kapitel VI der OECD-Richtlinien 2017 zu Verrechnungspreisen übernommen worden sind. Hiernach verwendet die OECD eine sehr viel weitere Definition zu immateriellen Werten als es die handelsrechtlichen Vorschriften wiedergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den nahestehenden Personen sind entsprechend der zitierten Richtlinie lediglich der Ausgangspunkt der Verrechnungspreisanalyse und können seitens der Finanzbehörden bei Nichtübereinstimmung mit den wirtschaftlichen Tatbeständen ignoriert werden. Als Ausfluss dieser wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist die Ertragsberechtigung der beteiligten Konzerneinheiten aus der Verwertung der immateriellen Werte zu bestimmen, d. h. die Erträge sind entsprechend der Wertbeiträge und den übernommenen Risiken zwischen den beteiligten, nahestehenden Personen aufzuteilen. Als wertbeitragende Funktionen werden insbesondere die Entwicklung, die Verbesserung, der Erhalt, der Schutz und die Vermarktung der immateriellen Werte genannt.27 Somit implizieren die neuen OECD-Richtlinien, dass dem rechtlichen Eigentümer der immateriellen Werte nicht automatisch die Erträge aus der Verwertung dieser zustehen. In der Folge kann dies zu erheblichen Verzerrungen und Unterschieden zwischen der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Erfassung der Vermögenspositionen führen.
Beispiel 1
Unternehmen A ist zu 100 % beteiligt am Unternehmen B. Der Beteiligungswert hat sich aus einer Akquisition ergeben und basiert auf einer Planrechnung mit einem Planungshorizont von 15 Jahren. Das Unternehmen B ist eine Produktionseinheit, die innerhalb des Konzerns ihre Produkte auf der Grundlage eines vom Marktpreis abgeleiteten Verrechnungspreises gegenüber der Konzerneinheit C verrechnet. An dem Konzernunternehmen C ist A nicht direkt beteiligt. Auf der Grundlage der Verrechnungen für die Produktlieferungen weist das Unternehmen B einen operativen Gewinn von durchschnittlich 100 GE aus. Nun wird im Folgejahr die Produktionseinheit in eine verlängerte Werkbank umgewandelt, mit der Folge, dass die Produktlieferungen auf der Grundlage einer kostenorientierten Methode verrechnet werden. Unternehmen B realisiert nun ein operatives Ergebnis von 50 GE. Der gesunkene Ertragswert kann im Rahmen eines sog. »Impairment tests« ggf. dazu führen, dass der bilanzierte Beteiligungswert am Unternehmen B bei A außerordentlich wertberichtigt werden muss.