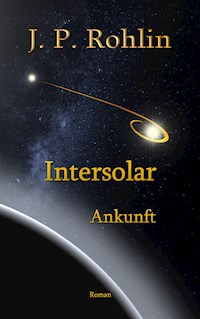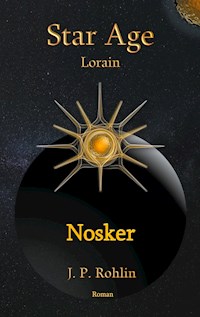5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Interstellare Reisen ist ein Sachbuch, das sich mit den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der interstellaren Raumfahrt beschäftigt, mit Schwerpunkt des Konzepts eines Generationenraumschiffs. Zusätzlich enthält es Kapitel zu den Themen: Was ist Zeit? Was ist Leben? Woraus und warum ist das Universum entstanden? Den Abschluss bilden 3 SF-Kurzgeschichten zum Thema "Künstliche Intelligenz".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Relative an der Zeit ist,
dass wir sie als relativ empfinden.
Wie lange ist ein Moment?
Wie lange ist er, wenn er schön ist,
Wie lange, wenn er Schmerzen bereitet?
Wie lange ist eine Stunde sinnlosen Wartens?
Wie lang ist der Tag eines Kindes?
Wie lang ist der Tag eines Menschen,
am Ende seines Lebens?
Wie lang ist für mich ein Tag, ein Monat, ein Jahr,
hundert Jahre, Millionen Jahre?
Ab wann sind Zeiträume nicht mehr vorstellbar?
Vorwort
Die Vorstellung, diese Welt, unsere Erde, zu verlassen, klingt fantastisch und scheint weit näher an Science Fiction, als an möglicher Realität.
Doch was uns heute als Science Fiction erscheint, ist allzu oft eine Frage der Epoche. Zu Zeiten von Jules Verne galt ein Unterseeboot, wie die Nautilus, oder eine Reise zum Mond als absolute Science Fiction.
Nun, die Reise zum Mond hatte 2019 ihr 50. Jubiläum. Sie ist schon so lange Geschichte, dass es Menschen gibt, die es als weit im Gestern liegend betrachten. Und nicht wenige wissen nicht einmal, dass Menschen schon einmal auf dem Trabanten der Erde standen.
Was in 50 Jahren alles möglich sein wird, wissen wir nicht. Werden wir in einer sozial aktiven und gerechten Welt leben? Oder werden wir uns nach neuen Ufern sehnen?
In der Hoffnung eines Neuanfangs?
In der Hoffnung, alles besser machen zu können?
Von der Konstruktion her ist der menschliche Körper dazu gemacht, weite Strecken zurückzulegen. Was wir reichlich getan haben. Keine andere Spezies hat sich derart weit und erfolgreich über den gesamten Planeten hinweg ausgebreitet. Kein Tier kann solange ununterbrochen laufen, wie ein Mensch, der das volle Potential seines Körpers pflegt und nutzt.
Wir Menschen sind zum Gehen gemacht. Sowohl im physischen Sinn, als auch im spirituellen. Stehenbleiben ist nicht unsere Art. Weitergehen ist unsere Bestimmung. Und wir werden ihr folgen, wohin sie uns auch bringen mag.
Wohin auch immer, ob ins Verderben oder zu den Sternen....
Kapitelübersicht
1.
Warum?
1.1 Exoplaneten
1.2 Ein lohnenswertes Ziel
1.3 Wer will, wer darf?
1.4 Der Weg zum Ziel (Out of Range)
2.
Das Raumschiff
2.1 Der Antrieb
2.2 Energieversorgung
2.3 Gravitation
2.4 Schute vor Strahlung
2.5 Versorgung
2.6 Reparaturen
2.7 Shuttles
2.8 Abwechslung
2.9 Nachwuchs
2.10 In vitro
3.
Endlich am Ziel
3.1 Die Ankunft
3.2 Landung
3.3 Anpassung
3.4 Immunisierung
3.5 Rohstoffe
3.6 Infrastruktur
3.7 Autonome Versorgung
3.8 Gesellschaftsstruktur
3.9 Religion
3.10 Kontakt
4.
Nachgedanken
4.1 Spekulationen
5.
Mysterium Zeit
5.1 Relativität der Zeit
5.2 Licht und Zeit
5.3 Zeitreisen
5.4 Zeitparadoxon
6.
Mysterium Lehen
6.1 Was ist Evolution?
6.2 Seelen
6.3 Jenseits
7.
Mysterium Universum
7.1 Big '
silent
' Bang
7.2 Energie und Materie
7.3 Dunkle Energie
7.4 Dunkle Materie
7.5 Schwarze Löcher
7.6 Am Anfang war Nichts
8.
Aliens
8.1 Invasion der Aliens
9.
Kurzgeschichten
9.1 Lyra
9.2
Ceres
9.3 Singu
10.
Das Ende des Universums
Nachwort
"Würde man sein Leben opfern, für ein Ziel,
das man sich sehnlich wünscht,
aber selbst nicht erreichen kann?
Kapitel 1: Warum
Warum es notwendig ist, die Erde zu verlassen.
Die Erde ist unsere Heimat. Die Welt, die uns geboren hat. Welchen Grund sollte es geben, die Heimat zu verlassen?
Ein einziger, nur ein einziger, Grund kann uns treiben, diese Welt zu verlassen. Es ist ein maximaler Grund. Unerbittlich und unwiderruflich wird er uns gebracht werden. Durch niemand anderen, als die Zeit selbst.
Die Erde ist in etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Leben gibt es seit etwa 3 Milliarden Jahren. Die Menschheit, jedenfalls das, was wir gerne als modernen Mensch bezeichnen, existiert seit wenig mehr als 200.000 Jahren.
Obwohl für uns 100 Jahre als eine kleine Ewigkeit erscheinen, so ist die Menschheit in Wahrheit eben erst auf diesem Planeten erschienen. Die Frage ist, wie lange dürfen wir bleiben? Diese Frage ist verbunden mit der Frage, wie alt die Erde wird, oder besser gesagt, wie lange sie uns eine lebensfähige Umwelt bieten kann.
Wenn wir nun glauben, dass wir diesen Planeten unbewohnbar machen können, so täuschen wir uns. Denn nichts, was der Mensch kann, wird dazu führen, dass die Natur der Erde vollständig vernichtet wird.
Allerdings kann die Umwelt einen Zustand annehmen, dass die Menschen, zumindest in ihrer derzeitigen Zahl von fast 8 Milliarden, nicht mehr versorgt werden können.
Aber anzunehmen, dass eine Menschheit, die ernsthaft darüber nachdenkt, dauerhaft überlebensfähige und sich autonom versorgende Stationen auf dem Mars einzurichten, aufgrund von irdischen Umweltbedingungen ausstirbt, ist abwegig.
Solange die Erde existiert, kann der Mensch, durch die Nutzung seiner technischen Fähigkeiten, überleben. Ob gut oder schlecht, und in welcher Zahl, ist hierbei nicht relevant. Allein die Frage nach der Fortführung der Existenz, der Erhaltung der Art, ist das, was letztlich zählt.
Aber wie lange wird die Erde noch existieren?
Einfach ausgedrückt, bis sie vernichtet wird.
Das ist jetzt der Moment, wo wir in Richtung der Sonne blicken dürfen. Der Heimatstern der Erde ist ein gelber Zwergstern von 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser und befindet sich etwas unterhalb der Hälfte seiner "Lebenserwartung".
Begrenzt wird die "Lebenserwartung" der Sonne durch den Vorrat an Wasserstoff. Dieses Element, das die Basis der Kernfusion aller Sterne ist, wird von der Sonne in ihrem Kern in Helium verwandelt. Das heißt, die Sonne erzeugt mittels Kernfusion neue Elemente. Ein Prozess, bei dem Energie entsteht, die als Licht und Wärme abgestrahlt wird. Die Sonne verliert also beständig an Masse. Man könnte nun glauben, dass sie schrumpfen müsste.
Dies wird aber leider nicht der Fall sein. Stattdessen wird sich die Dichte verändern und ebenso der Strahlungsdruck und letztlich wird die Sonne wachsen. Aus einem kleinen gelben Zwergstern wird ein roter Riesenstern werden. Statt 1,4 Millionen Kilometer werden es 250 Millionen oder mehr sein. Auch wenn diese Veränderung nur sehr langsam geschehen wird und überdies erst in einigen Milliarden Jahren beginnt, so wird sie letztlich die Erde auf die ein oder andere Weise vernichten.
Spätestens wenn unsere Sonne zur Nova wird, wenn ihr Kern implodiert und die äußere Gashülle explosionsartig abgestoßen wird, wird die Erde dies nicht überstehen.
Auch wenn die Sonne nicht zur Supernova wird, weil ihr hierzu die Masse fehlt, wird von den inneren Planeten nicht viel übrig bleiben. Und die Sonne selbst wird nur noch ein blass leuchtender Rest eines Sterns seins.
Falls zu dieser Zeit noch Menschen auf der Erde leben, werden sie mit ihr untergehen. Die Heimat der Menschen wird ihr Ende sein. Und wenn die Menschheit das Ende der Erde überstehen möchte, dann gibt es hierzu nur einen Weg.
Und der führt zu den Sternen!
Das ist keine Frage, ob wir es wollen. Keine Frage einer unbezähmbaren Neugier. Keine von Entdeckerlust. Kein Eroberungsdrang. Keine Sucht nach Profit. Sondern einzig eine Frage des Überlebens.
Aber wie viel Sinn macht es, sie jetzt zu stellen? Denn selbst wenn wir wüssten, dass in 20, 30 Jahren ein Asteroid, groß wie ein Zwergplanet, mit der Erde kollidieren würde, was mit Sicherheit alles Leben auslöschen und den Planeten für Millionen Jahre unbewohnbar machen würde, wäre es sinnlos, eine Auswanderung zu planen.
Unser physikalisches Wissen und unsere technischen Möglichkeiten sind bei weitem noch nicht ausreichend, um ein Projekt, wie eine interstellare Reise es ist, anzugehen.
Warum tun wir es dann eigentlich?
Warum träumen wir von interstellaren Raumschiffen?
Warum planen wir das Aussehen solcher Raumschiffe und beschäftigen uns mit der Frage, wie sie funktionieren müssten, für den Flug zwischen den Sternen?
Die Antwort ist einfach.
Wir träumen es, weil wir es träumen können. Weil es keinen Apfel gibt, der so hoch hängt, dass wir nicht mal darüber nachdenken, wie wir ihn pflücken könnten.
So sind wir. So ist unsere Mentalität. Und sie ist so, weil das Leben selbst uns so gemacht hat. Wir tun es, weil wir dazu bestimmt sind. Und daher ist es richtig, es zu tun.
Jede Treppe beginnt mit der ersten Stufe, jede Leiter mit der ersten Sprosse und jeder Traum, den wir träumen, mit dem allerersten Gedanken. Und je inniger der Traum ist, je mehr wir ihn denken, desto größer ist die Möglichkeit, dass er real wird. Ob wir, die ihn träumen, ihn jemals erleben werden?
Für die Evolution stellt sich diese Frage nicht. Die Evolution will nur, dass die Menschheit überlebt, dass sie erhalten bleibt. Der Wert des Einzelnen ist da nur ein Wert für die Geschichte. Und das Gefühl, etwas bewirkt zu haben, zu etwas Besonderem beigetragen zu haben, das muss genügen, wenn die Möglichkeit des realen Erlebens, eines wahr gewordenen Traums, nicht besteht.
Ein Gefühl als eine Art von Lohn?
Als eine Form von Trost spendender Zufriedenheit?
Wir wären keine Menschen, wenn wir anders wären.
Irgendwann wird die Menschheit zu anderen Welten aufbrechen. Oder sie wird mit ihrer Heimatwelt untergehen.
Aber wie wird es sein, wenn Menschen, unter dem Licht einer fremden Sonne, den Boden einer neuen Welt betreten?
Werden sie glücklich sein?
Werden sie ehrfürchtig sein?
Werden sie es zu würdigen wissen?
Und wie werden sie mit dieser neuen Welt umgehen?
Werden sie die Ressourcen dieser Welt mit Bedacht nutzen oder werden sie sie ausbeuten? Werden sie Raubbau treiben, voll Gier und Rücksichtslosigkeit, in dem Wissen, dass dort draußen noch weitere Welten sind?
Nur die Zukunft wird zeigen, wie die zukünftige Menschheit sein wird. Welchem Glauben, welchen Vorstellungen, welcher Art des Lebens man folgen wird. Und welche Moral und Ethik gelten wird. Die Zukunft weiß es. Es liegt an uns, die Zukunft zu erreichen.
1.1 Exoplaneten
Was sind Exoplaneten? Und wann lohnt sich der Blick auf sie?
Sie können so exotisch sein, wie der Beginn des Wortes es leicht glauben machen kann.
Doch mit Exoplaneten sind extrasolare Planeten gemeint. Also Welten, die nicht Bestandteil unseres heimatlichen Sonnensystems sind. Welten, die um fremde Sonnen kreisen.
Noch Mitte des 20. Jahrhunderts wurde von vielen Wissenschaftlern ernsthaft bestritten, dass es Exoplaneten überhaupt gibt. Sicher, man hat die Sterne untersucht und korrekt als Sonnen, ähnlich der unseren, erkannt.
Aber Planeten sind viel zu klein und werden zudem vom Licht ihrer Sonne fast vollständig überdeckt. Mit den im 20. Jahrhundert verfügbaren Teleskopen war es praktisch unmöglich, Exoplaneten visuell zu entdecken. Zudem gab es Astronomen, die Argumente dafür fanden, dass unser Sonnensystem in der Galaxis einzigartig ist.
Als schließlich die ersten Anzeichen für Exoplaneten entdeckt wurden, da war es zwar vorbei mit der Einzigartigkeit unseres Sonnensystems, dafür wurde nun aber propagiert, dass das Leben auf der Erde eine Einzigartigkeit darstellt. Wenn aber die Erde der einzige Planet sein soll, auf dem Leben möglich ist, dann brauchen wir nicht darüber nachzudenken, zu einem Exoplaneten auszuwandern, um dort eine Kolonie zu gründen.
Da wir aber im Fall vom Mars über dessen Kolonisierung, trotz seiner, mal gelinde ausgedrückt, schwierigen Lebensbedingungen, nachdenken, dürfen wir glauben, dass das auch im Fall von Planeten möglich ist, die nicht zu unserem Sonnensystem gehören. Und davon, so wissen wir mittlerweile, gibt es viele. Nahezu unendlich viele. Allein die Frage, sie zu erreichen, zählt noch.
Doch wie hat man die Exoplaneten überhaupt entdeckt?
Hierzu gibt es zwei Methoden.
Die eine wird als Transit-Methode bezeichnet. Die funktioniert jedoch nur, wenn ein Planet, von uns aus gesehen, vor seiner Sonne vorbeizieht. Also zwischen der Erde und seiner Sonne steht. Dabei wird das Licht seiner Sonne um eine Winzigkeit verdeckt. Und dies genügt, um zumindest zu "sehen", dass dort ein Planet sein muss.
Die zweite Methode funktioniert auf Basis der Gravitation. Zwar umkreisen Planeten ihre Sonne, weil diese eine weitaus stärkere Anziehungskraft hat, als der Planet, jedoch ist dies immer ein Spiel zweier Kräfte.
Sicher, die Gravitation eines Planeten ist im Vergleich zu seiner Sonne eher schwach, doch sie genügt, um zu bewirken, dass seine Sonne nicht präzise um ihren Mittelpunkt rotieren kann. Salopp ausgedrückt, sie eiert, und dies führt zu Abweichungen in ihrem Spektrum. Was bedeutet, dass das Licht mal bläulicher, mal rötlicher erscheint.
Und je stärker die Abweichung ist, desto stärker ist die Wirkung des umkreisenden Planeten. Daraus lässt sich dessen Masse und die Entfernung zu seiner Sonne berechnen. Wir haben also zwei Methoden, mit denen wir Exoplaneten nachweisen können.
Was wir aber noch nicht können, ist, deren Beschaffenheit im Detail zu ermitteln. Zwar können wir in vielen Fällen die Größe und die Entfernung recht genau ermitteln, aber wie der Planet tatsächlich aussieht, das können wir derzeit (Stand: 2019) noch nicht sehen. So sind wir auf die messbaren Daten beschränkt. Und die sagen uns, ob es ein Gasplanet ist oder ob er, so wie Erde und Mars, eine feste, felsige Oberfläche hat.
Bei der Frage nach flüssigem Wasser wird es schon weitaus schwieriger. Ein direkter Nachweis ist noch nicht möglich. Wir können es nur vermuten. Und zwar in allen Fällen, in denen der Planet seine Sonne in der sogenannten habitablen Zone umkreist.
Als habitable Zone wird der Abstand zu einer Sonne bezeichnet, in der ihre Strahlungsenergie ausreicht, um auf einem Planeten Temperaturen zu erzeugen, die flüssiges Wasser ermöglichen.
Und flüssiges Wasser gilt als die Voraussetzung für die Entstehung von Leben. Wobei hiermit höheres Leben gemeint ist. Was bedeutet, dass die Temperaturen regelmäßig über 0 Grad Celsius steigen müssen. Allerdings dürfen sie auch nicht über den Siedepunkt steigen. Es ist diese Temperaturspanne, die den minimalen und maximalen Abstand eines Planeten zu seiner Sonne als habitable Zone definiert.
Leider reicht eine Umlaufbahn in der habitablen Zone alleine nicht aus. Deutlich wird dies am Beispiel der Venus. Diese liegt im inneren Bereich der habitablen Zone unserer Sonne.
Allerdings hat die Venus eine derart dichte Atmosphäre, dass sie ähnlich wirkt wie ein Treibhaus. Nur leider ist dieses Treibhaus so wirksam, dass die Temperaturen auf der Venus auf über 400 Grad Celsius steigen.
Somit ist die Beschaffenheit der Atmosphäre eines Planeten ein wesentliches Merkmal bei der Frage nach einer lebensfähigen Umwelt. Nur macht ein Exoplanet alleine aber noch kein Sonnensystem. Ein Sonnensystem besteht aus mindestens einer Sonne und einem oder mehreren, diese umkreisenden, Himmelskörper. Und Sonne ist auch nicht gleich Sonne. Es gibt Sonnen verschiedener Größen und Spektralklassen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Menge an Licht und Wärme, die sie ausstrahlen, sondern auch auf ihre "Lebensdauer".
So liegt die Lebensdauer eines Roten Zwergsterns zwischen 20 und 100 Milliarden Jahren, während sie bei Blauen Überriesen wenige 100 Millionen Jahre beträgt.
Unsere eigene Sonne hat mit etwas über 10 Milliarden Jahren eine mittlere "Lebenserwartung", die, zumindest im Fall der Erde, ausgereicht hat, Leben zu ermöglichen.
Bei Sonnen, die eine Lebenserwartung von kaum mehr als 2 Milliarden Jahren haben, bleibt zu wenig Zeit für die Entwicklung von Leben. Insbesondere wenn wir von intelligentem Leben sprechen.
Bei Roten Zwergsternen, bei denen man bisher die meisten erdähnlichen Planeten entdeckt hat, liegt der Fall etwas anders. Zwar haben Rote Zwergsterne eine hohe Lebenserwartung, was für die Entwicklung von Leben mehr als genug Zeit bietet, jedoch finden wir hier ein besonderes Problem.
Um dies zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf den Mond. Dieser zeigt der Erde immer die gleiche Seite, was bedeutet, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Mondes identisch ist mit seiner Umlaufzeit. Astronomen sprechen hier von einer gebundenen Rotation. Eine gebundene Rotation ist immer dann gegeben, wenn ein kleinerer Himmelskörper einen größeren in relativer Nähe umkreist.
Und im Fall von Roten Zwergsternen liegt die habitable Zone so nah am Stern, dass alle dort kreisenden Planeten eine gebundene Rotation haben. Sie zeigen ihrer Sonne also immer die gleiche Seite. Ewiger Tag auf der einen, ewige Nacht auf der anderen Seite. Dies hat gravierende Temperaturunterschiede zur Folge, die in den Übergangsbereichen von der Tagseite zur Nachtseite für Turbulenzen sorgen dürften. Man kann hier mit sehr starken Konvektionsströmungen rechnen. Kurz gesagt, stürmisch und unwirtlich.
Ein weiteres Problem sind mögliche Strahlungsausbrüche, bis hin zu koronaren Massenauswürfen. Wenn also Magnetfelder des Sterns eine Konstellation und Stärke erreichen, die hoch genug ist, um Materie von der Oberfläche in den interplanetaren Raum zu schleudern. Je näher ein Planet seiner Sonne ist, desto größer ist auch die Gefahr, von derartigen Strahlungsausbrüchen getroffen zu werden.
So hoch die Zahl an Planeten im Universum auch sein mag, damit ein Planet eine lebenswerte Umwelt entwickelt, benötigt es mehr, als nur irgendeinen Planeten, der um irgendeine Sonne kreist.
Wenn wir also die wirklich erdähnlichen Planeten finden wollen, dann müssen wir bei den Sonnen nachsehen, die der unseren am ähnlichsten sind. Diese Sonnen dürfen nicht zu klein, zu groß, zu kalt oder zu heiß sein. Und sie müssen im richtigen Alter sein. Und sie sollten sich auch nicht in einem Doppelsternsystem befinden. Auch die galaktische Position ist von Bedeutung.
Zu nahe am Zentrum der Galaxis existiert zu viel Strahlung.
Zu weit am Rand der Galaxis gibt es hingegen nicht genug schwere Elemente. Fast könnte man sagen, dass auch eine Galaxis eine habitable Zone hat. Allerdings darf man hier Ausnahmen nicht ausschließen.
Doch kommen wir zurück zu Sternen in unserer näheren Nachbarschaft. Ein Blick auf Sirius zeigt uns einen hellen Stern, der, oberflächlich betrachtet, unserer Sonne gleicht.
Betrachten wir jedoch die Daten, stellen wir fest, dass Sirius ein recht heißer Stern der Spektralklasse A ist. Zwar ist er ähnlich groß, wie unsere Sonne, doch nur wenig mehr als 200 Millionen Jahre alt. Das bedeutet, dass sich etwaige dort befindliche Planeten noch in einer sehr frühen Entstehungsphase befinden. Also, dass sie gerade erst dabei sind, ihre endgültige Größe zu erreichen und eine feste Oberfläche zu bilden. Bei Sonnen, wie Sirius, nach erdähnlichen Planeten zu suchen, wäre also wenig erfolgversprechend. Wenn es also Siriusianer gibt, dann definitiv woanders.
Warum die meisten erdähnlichen Planeten bisher bei Roten Zwergsternen gefunden wurden, liegt daran, dass man bei dieser Sternklasse Planeten leichter entdecken kann, als bei sonnenähnlichen Sternen.
Zwar suchen wir bereits seit gut 30 Jahren nach Planeten, doch im Grunde genommen sind wir vergleichbar mit Galileo Galilei und dessen Blick durch sein erstes, selbstgebautes Teleskop. Er entdeckte damit die Monde des Jupiters, aber mehr als verschwommene Lichtpunkte, die nahe bei einem deutlich größeren verschwommenen Lichtpunkt standen, war mit dieser Technik nicht zu sehen. Und so gut unsere Technik im Jahr 2019 auch sein mag. Um fremde Planeten visuell wahrnehmen zu können, dafür reicht sie noch nicht. Was nicht heißt, dass sich dies in naher Zukunft nicht ändern wird. Mit Bildern von Wolken, Meeren und Kontinenten sollte man jedoch nicht rechnen.
Richtig kompliziert wird die Angelegenheit übrigens bei Mehrfachsternsystemen. Wenn also zwei oder mehr Sonnen so dicht zusammenstehen, dass sie sich umkreisen und somit ein gemeinsames Sonnensystem bilden. Planeten, die sich in einem solchen System befinden, bekommen nicht nur das Licht von mehreren Sonnen, sondern werden auch von deren Gravitation beeinflusst.
Das Wichtigste, für einen erdähnlichen Planeten, ist eine stabile Umlaufbahn um seine Sonne. Nur sie garantiert, dass es einigermaßen stabile Temperaturen gibt. In einem Mehrfachsternsystem besteht aber die Gefahr, dass die Gravitation der beiden Sonnen dauerhaft stabile Planetenbahnen nicht zulässt. Jedenfalls nicht über große Zeiträume hinweg.
Ob hier nicht trotzdem die Entwicklung von Leben möglich ist, ist eine Frage, die sich, zumindest von hier aus, nicht beantworten lässt. Nur sollte man auf keinen Fall damit rechnen, dass ein solcher Planet ein dauerhaftes Heim für die Menschheit sein könnte.
Leider begrenzt all dies die Anzahl der Sonnensysteme, in denen es erdähnliche Planeten geben könnte, erheblich. Und im Umkreis von 20 Lichtjahren lassen sich nur 2 Sonnensysteme finden, bei denen sich ein genauerer Blick lohnt.
Um das Thema Exoplaneten abzurunden, sei erwähnt, dass es sogar singuläre Planeten geben kann. Planeten, die, ohne zu einer Sonne zu gehören, für sich allein die Galaxis durchstreifen. Die gängigste Theorie besagt, dass es sich um Planeten handelt, die durch die Gravitation eines anderen Planeten oder durch die Einwirkung einer anderen Sonne, zum Beispiel der eines Mehrfachsternsystems, aus der stabilen Bahn um die eigene Sonne herauskatapultiert wurden.
Theoretisch könnten sich solche Planeten aber auch aus Gas- und Staubwolken bilden, deren Masse für das Entstehen einer Sonne nicht ausreicht.
Hinweis:
Bei Sonnensystemen, bei denen die Ekliptik nicht direkt zur Erde zeigt, ist die Entdeckung von Planeten, insbesondere mittels der Transitmethode, erschwert, bis gar nicht möglich.
1.2 Ein lohnenswertes Ziel
Gibt es das?
Gibt es einen Exoplaneten, der alle Bedingungen erfüllt?
Der so lebenswert ist, dass er jede Mühe lohnt?
Gibt es dort draußen einen Planeten, der es lohnt, dass sich ganze
Generationen nur dem einen Ziel verschreiben, ihn zu erreichen?
Immerhin sprechen wir hier von Reisezeiten, die mehrere Jahrhunderte umfassen. Was bedeutet, dass niemand, der an Bord eines solchen Raumschiffs geht, zu Lebzeiten auch nur in die Nähe des Ziels kommt.
Es ist gleichbedeutend mit einer Opferung. Das eigentliche Ziel, die Erforschung einer neuen Welt, wird durch diejenigen, die die Reise beginnen, niemals erlebt werden. Nur ihre Nachkommen, und damit sind sehr ferne Nachkommen gemeint, werden die Chance haben, die fremde Welt zu betreten.
Wie viele Generationen reicht die Geschichte der eigenen Familie zurück? Eltern, Großeltern, Urgroßeltern? Dies ist bei den meisten noch überschaubar. Aber was, wenn es um 10 Generationen geht, um 15, um 20? Wer weiß, welche, seiner eigenen Vorfahren im 15. Jahrhundert gelebt hat? Oder noch früher?
Und was interstellare Reisen betrifft, mit den heute vorstellbaren Mitteln, sprechen wir von Reisen, die leicht 20 oder mehr Generationen dauern können.
Also wer wird eine solche Reise beginnen? Welches Ziel mag so verlockend sein, dass jemand den Rest seines Lebens in der Enge eines Raumschiffs, verbringt? Ohne zu wissen, ob das Schiff überhaupt eine Chance hat, sein Ziel zu erreichen.
Blauweiß, im Dunkel des Alls. Hell angestrahlt vom warmen Licht seiner gelben Sonne. Zarte Wolkenbänder verschleiern den Blick auf braungrüne Kontinente. Und strahlend hell glänzendes Wassereis glitzert von den Polen.
Langsam dreht sich der Planet unter den Blicken neugieriger Menschen. Nur leicht, kaum mehr als 10 Grad ist die Neigung seiner Achse. Zwei kleine Monde, 1.000 und 200 Kilometer im Durchmesser, begleiten die Welt auf ihrer Bahn um die Sonne.
Falls wir eine solche Welt, einen Zwilling der Erde, in einer Entfernung von nicht mehr als 25 Lichtjahren zur Erde finden, dann können wir wahrhaftig davon sprechen, den Hauptgewinn im Lotto gezogen zu haben.
Dass es bewohnbare Planeten in unserer Galaxis gibt, das dürfen wir vorbehaltlos glauben. Denn angesichts von mindestens 10 Milliarden Sonnen, die unserer Sonne ähnlich genug sind, kann man einen solchen Glauben nicht widerlegen. Nicht, wenn man sich vorstellen kann, was 10 Milliarden bedeutet.
Nehmen wir als Beispiel nur mal ein paar Würfel. Und versuchen ein paar Sechsen zu würfeln. Und zwar 10 Mal hintereinander. Nehmen wir nun an, wir könnten 10 Mal pro Minute würfeln. Wie lange würden wir dann wohl würfeln, wenn wir 10 Milliarden Versuche hätten?
Wir würden 1.900 Jahre lang ununterbrochen würfeln.
10 Milliarden Sterne, 10 Milliarden Sonnensysteme, das ist weit mehr, als ein Mensch sich vorstellen kann. Und mit 10 Milliarden sind nicht alle Sterne dieser Galaxis gemeint, sondern nur solche, die unserer Sonne ähnlich genug sind und sich in einem mittleren "Lebensalter" (3 bis 6 Milliarden Jahre) befinden.
Die Frage, ob es noch weitere erdähnliche Planeten gibt, sollte man, unter diesem Aspekt, durch die Frage, wo sie zu finden sind, ersetzen. Aber dass ein solch wunderbarer Planet, wie die Erde einer ist, in unserer direkten Nachbarschaft zu finden ist, das wäre ein wenig zu viel der Hoffnung. Seien wir mal zufrieden, wenn sich, in unserer Nähe, einer finden lässt, auf dem Menschen leben könnten. Vielleicht sogar mit der Option, dass wir in der Lage sind, seine Umwelt zu unseren Gunsten zu verbessern. Eine Welt also, deren Atmosphäre genügend Sauerstoff enthält, die ausreichend Wasser hat und die genügend nährstoffreiches Land für die Entwicklung einer nutzbaren Flora bietet.
Wenn wir eine solche Welt in erreichbarer Nähe finden, wäre ihre Inbesitznahme ein Geschenk an den Fortbestand der Menschheit. Und jeder, der für dieses Ziel arbeitet, ist ein Idealist für die Zukunft unserer Spezies.
Doch was haben wir davon, wenn ein Teil der Menschheit auf einem Planeten siedelt, der so weit entfernt ist, dass er in einem Menschenleben nicht erreichbar ist?
Was hat die Menschheit davon?
Nichts! Außer einer emotional wirksamen Gewissheit, sich ins Universum ausgebreitet zu haben.
Erinnern wir uns doch mal an die Anfänge der menschlichen Geschichte. Daran, als die ersten Menschen, auf der Suche nach neuem Lebensraum, begannen, Afrika zu verlassen. Einen Kontinent, der ein recht angenehmes Leben bot. Insbesondere keine Winter.
Stattdessen drangen Menschen in Regionen vor, in denen die Jahreszeiten ihr Leben beeinflussten. Jahreszeiten, die nur zu überstehen sind, wenn man neues Wissen und neue Fähigkeiten erlangt. Wenn man es schafft, Lebensmittel zu konservieren, feste Behausungen zu bauen und auch Kleidung von besserer Qualität anzufertigen.
Die Menschen, die, vor mehr als hunderttausend Jahren, Afrika verließen, nahmen erhebliche Mühen auf sich. Auf ihrem Weg, diesen Planeten in Besitz zu nehmen, indem sie sich über seine gesamte Landmasse hinaus ausbreiteten. Können wir uns heute vorstellen, wie schwer es gewesen sein muss, Amerika zu erreichen oder Australien, Neuseeland, die Osterinseln?
Kein Land, keine Insel, die zu weit, zu abgelegen war, um von Menschen nicht erreicht zu werden. Und die ersten, die Afrika verließen, verließen sie nicht damit auch den Teil der Menschheit, der in Afrika zurückblieb? Und die, die Amerika erreichten, hatten sie nicht gewissermaßen eine neue Welt erreicht? Eine, die sie vom Kontakt zum Rest der Menschheit isolierte? Und das für Jahrtausende!
Heute ist die Erde vergleichbar mit einem kleinen Staat des Mittelalters. Nicht viel größer als ein Königreich. Denn praktisch jeder Ort dieses Planeten ist für alle, die über genügend finanzielle Mittel verfügen, innerhalb von maximal drei Tagen erreichbar.
Aus Sicht der Menschen des 15. Jahrhunderts unvorstellbar. Einem Wunder gleichkommend.
Wenn wir einmal zu einer anderen Welt aufbrechen und damit die Grenzen zu anderen Sonnensystemen überwinden, ist dies dann nicht vergleichbar mit dem Auszug aus Afrika?
Und wenn wir fragen, was es uns bringt, sind wir dann nicht zu persönlich? Sollten wir das nicht vielmehr aus Sicht der Evolution betrachten?
Schließlich geht es nicht um uns, nicht um den Einzelnen, nicht um das Wohl einer Gruppe, eines Volkes oder eines Kontinents. Es geht um nicht weniger, als um die Menschheit an sich. Es geht um den Fortbestand unserer Spezies, unserer Gene. Also, um etwas, wozu die Evolution der Erde 4,5 Milliarden Jahre gebraucht hat, es zu erschaffen! Es geht um die Sicherung des Fortbestands unserer Art.
Auch wenn unsere Generation noch nicht das Wissen und die Technik hat, um sozusagen „morgen loszufliegen", so dürfen wir doch unsere Gedanken ausrichten auf ein Ziel, das in der Zukunft unweigerlich auf die Menschheit wartet.
Die Menschheit wird einmal zu den Sternen reisen, weil sie dazu bestimmt ist. Allein, dass wir darüber nachdenken, dass wir davon träumen, dass wir uns Ziele setzen, die unerreichbar scheinen, zeigt uns, dass wir dazu bestimmt sind, immer neue Grenzen zu überwinden.
Welchen Sinn hätte es, dass die Evolution eine intelligente Spezies erschafft, deren unweigerliches Schicksal der Untergang ist?
Denn geht die Erde unter, ist dies auch das Ende der gesamten Menschheit. Jedenfalls von all denen, die sich dann noch auf der Erde befinden.
Der Drang, zur Sicherung der Erhaltung unserer Art, ist ein fundamentaler Bestandteil unseres Wesens, ist Teil unserer Gene. Es ist die Triebkraft hinter allem. Diese Kraft hat uns aus Afrika geführt und sie wird uns ins Universum führen.
Wir sind Menschen, jeder für sich ist ein Universum. Und gleichermaßen sind wir Teil eines Ganzen, Teil einer kollektiven Gemeinschaft. Ohne das Ganze wird es den Einzelnen nicht mehr geben.
So gesehen ist nicht eine andere Welt, wie sehr sie auch der Erde ähnelt, das lohnenswerte Ziel.
Das lohnenswerte Ziel ist die Menschheit selbst.
Sie gilt es zu erhalten.
Das ist jede Mühe wert.
Und selbst wenn uns derzeit interstellare Reisen nicht möglich sind, so kann jeder Gedanke, jeder Traum daran, dazu beitragen, dass sie eines Tages einmal möglich werden!
1.3 Wer will? Wer darf?
Wie klärt man die Frage, wer an Bord eines interstellaren Raumschiffs gehen darf? Wie wählt man diejenigen aus, die auf einer fremden Welt eine neue Menschheit begründen sollen? Und wie viele sind nötig, dies zu tun? Wie viele Menschen braucht es, damit eine ausreichende Vielfalt an genetischer Auswahl zur Verfügung steht?
Das sind Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, wie es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag.
Eins der größten Probleme früherer Adelsgeschlechter war die Frage der standesgemäßen Heirat. Eine Denkweise, die einerseits zu einer engen Verknüpfung verschiedener Adelsfamilien geführt hat, andererseits jedoch die potentielle genetische Vielfalt stark begrenzte. Es gab sprichwörtlich zu wenig frisches Blut.
Für eine gesunde Gesellschaft ist es wichtig, dass es eine ausreichende Auswahl an genetisch nicht eng verwandter Partner gibt. Inzucht ist also nicht nur aus moralischer Sicht abzulehnen, sondern insbesondere deshalb, weil die genetische Verwandtschaft zu hoch ist, was zu einer genetischen Degeneration beim Nachwuchs führen kann. Also ist es unbedingt notwendig, dass bei der Auswahl der Kolonisten auf genetische Vielfalt geachtet wird. Brüder unerwünscht?
Vielleicht ist das jetzt etwas hart formuliert, aber es wird bei der Frage, wer an Bord darf, ein Thema sein müssen.
Aber nicht nur die genetischen Aspekte werden ein Thema sein. Ebenso delikat ist die Frage nach kultureller Vielfalt. Denn will man die verschiedenen Kulturen bewahren, dann muss die Auswahl der Kolonisten dies berücksichtigen.
Wie viele Europäer, wie viele Asiaten, wie viele aus Lateinamerika, Afrika, Indonesien und nicht zu vergessen die Minderheiten, bis hin zu den Inuit?
Wer will entscheiden, welche Gruppe wie stark vertreten sein soll? Insbesondere unter der Wahrung der Erfordernisse der genetischen Vielfalt. Wird man hier nach einer einheitlichen Quote verfahren oder wird diese abhängig sein vom Anteil an der Population? In diesem Fall würden Asiaten die Mehrheit der Kolonisten bilden.
Obwohl sich die Frage stellt, ob ethnische Unterschiede in 100 Jahren überhaupt noch eine kulturelle, soziologische oder politische Rolle spielen. Genetisch tun sie es.
Ethisch lässt sich die Frage der ethnischen Vielfalt, die die Neue Welt erhalten soll, nicht in einem Satz beantworten.
Sicherlich würde man ein Gremium bilden, das entscheidet, wer von denen, die sich bewerben, einen Platz an Bord bekommt. Denn aufgrund der zu beachtenden genetischen und ethnischen Vielfalt wäre es nicht angemessen, es dem Zufall zu überlassen. Schließlich soll der Fortbestand der gesamten Menschheit, also auch ihrer ethnischen Vielfalt, gewährleistet werden. Aber zur Verwirklichung einer solchen Gewährleistung ist man schlecht beraten, den Zufall zu bemühen. Denn was, wenn die Anzahl der Bewerber für die geforderte Vielfalt nicht ausreicht?
Die Frage nach der Auswahl der Kolonisten wird nicht nur die Verantwortlichen bewegen, sondern gleichermaßen auch die Medien und auch die Bewerber selbst. Es wird zu Diskussionen kommen. Darüber, welche Methode die richtige ist. Und auch darüber, ob es sinnvoll ist, auf eine maximale Vielfalt zu bestehen.
Dann wäre da noch die Frage der Religion. Welche Religionen sollen an Bord präsent sein? Wird man deren Gleichberechtigung sicherstellen können? Und wenn man auch das berücksichtigen will, wie will man es verwirklichen? Wie soll man eine Religionszugehörigkeit zu einem Entscheidungsmerkmal machen, ohne den Betreffenden zu diskriminieren?
Wenn man all dies bedenkt, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass die Fragen nach den technischen Problemen einer solchen Reise möglicherweise weit einfacher zu lösen sind, als die sozialen, die moralischen, die ethischen und die politischen.
Und nicht zu vergessen, die psychologischen. Denn die sind von besonderem Gewicht. Was, wenn einige Kolonisten nach Beginn der Reise ihre Entscheidung bereuen? Wenn ihnen nach einem Jahr an Bord bewusst wird, dass sie nicht viel weiter, als bis hinter den Kuipergürtel gekommen sind? Wenn ihnen klar wird, dass sie niemals am Ziel ankommen werden. Und dass sie den Rest ihres Lebens an Bord eines Raumschiffs verbringen und dies auch der Ort sein wird, an dem sie sterben werden. Wenn ihnen bewusst werden wird, dass es keine Beerdigung geben wird. Dass ihr Körper recycelt oder verbrannt wird. Kein Grab, kein Grabstein, keine Erinnerung, außer der in einer digitalen Datei oder bestenfalls ein Namenszug an einer Wand des Raumschiffs.
Was, wenn die erste Euphorie vorbei ist und die Realität eines gleichförmigen Alltags ins Bewusstsein dringt? Das Potential an möglichen psychischen Erkrankungen wird mit der Dauer der Reise exponentiell steigen.
Und möglicherweise werden die wichtigsten pharmazeutischen Mittel an Bord Medikamente sein. Genauer gesagt Antidepressiva.
Und hier sprechen wir nur von der ersten Generation. Was mich dazu bringt, noch zu erwähnen, dass man bei der Auswahl der Kolonisten auch die demografischen Aspekte beachten muss.
Und ganz nebenbei, nur die Generation, die am Ziel ankommt, ließe sich als Kolonisten bezeichnen. Denn alle vorangegangenen Generationen, allen voran diejenige, die die Reise begonnen hat, werden niemals eine Welt kolonisieren. Sie werden nichts anderes sein, als Menschen, die an Bord eines Raumschiffs leben, das auf einer Reise ist, die zu Lebzeiten der Passagiere nicht enden wird. Gewissermaßen ist es eine Reise in den Tod. Denn dieser ist das einzige erreichbare Ziel, solange das Schiff nicht in den Orbit der fremden Welt einschwenkt.
Kommen wir zu einem ethischen Thema. Eins, das mit Verantwortung zu tun hat. Gemeint ist eine Verantwortung Menschen gegenüber, die noch nicht geboren sind, wenn die Raumschiffe das heimatliche Sonnensystem verlassen.
Gemeint sind die Kinder, die, an Bord der Schiffe, nicht das Licht der Welt, sondern das künstliche Licht geschlossener Räume erblicken werden.
Wie wird sich ein Kind fühlen, wenn es damit beginnt, die Welt, seine Welt, zu erforschen und feststellt, dass es keine Welt ist?
Wie wird es sich fühlen, wenn es erfährt, dass die 'wahre', die natürliche Welt, aus Planeten besteht. Planeten, die so weit entfernt sind, dass das Kind keine Chance hat, sie zu Lebzeiten zu erreichen?
Welche Mutter, welche Eltern, sind bereit, ihrem Kind zuzumuten, dass es sein ganzes Leben in einer winzigen Enklave, mitten im Nirgendwo eines interstellaren Leerraums, zu verbringen hat? Welche Auswirkungen wird das auf die Psyche, auf die Seele des Kindes haben?
Und welche Mutter wird keine Tränen vergießen, wenn ihr Kind fragt: „Mama, warum können wir nicht auf der Erde sein?"
Wie fühlt es sich an, wenn man der Sehnsucht seines Kindes hilflos gegenübersteht?
1.4 Der Weg zum Ziel
Out of Range
Was tun wir, wenn das, was wir haben wollen, außerhalb unserer Reichweite liegt?
Sind wir in einem solchen Fall wirklich dazu bereit, aufzugeben?
Oder werden wir danach streben, unsere Reichweite zu erhöhen?
Wie lange man für einen Weg braucht, liegt zum einen an der Länge der Strecke und zum anderen an der erreichbaren Geschwindigkeit.
Und bei interstellaren Reisen sprechen wir von wirklich langen Strecken.
1 Kilometer ist etwas, was man zu Fuß bewältigen kann.
10 Kilometer ist zu weit, für einen Fußmarsch?
100 Kilometer war früher eine Reise, die 2 – 3 Tage dauerte.
1.000 Kilometer lassen uns an Flugzeuge denken.
10.000 Kilometer sind eine Fernreise.
100.000 Kilometer wären zweieinhalb Mal um den Äquator.
1.000.000 Kilometer lang war die Reise von Apollo 11.
100.000.000 Kilometer reichen nicht aus, die Sonne zu erreichen.
1.000.000.000 sind zwei Drittel der Strecke zum Saturn.
10.000.000.000 ist irgendwo im Kuipergürtel.
100.000.000.000 ist zwischen Kuipergürtel und Oortscher Wolke.
1.000.000.000.000 ist mitten in der Oortschen Wolke.
10.000.000.000.000 ist 1 Lichtjahr von der Erde entfernt.
1 Lichtjahr, 10 Billionen Kilometer und wir befinden uns immer noch im Einflussbereich des heimatlichen Sonnensystems.
Die Distanzen, die uns im Weltall begegnen, sind jenseits unserer Vorstellungskraft. Was uns aber nicht davon abhält, darüber nachzudenken, wie wir sie überwinden können.
Die Evolution hat uns die Fähigkeit gegeben, vom schier Unmöglichen zu träumen. Sie hat uns auch die Kraft gegeben Unmögliches zu verwirklichen. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, dann dürfen wir uns bei ihr bedanken.
Was erwartet uns, auf dem Weg zu anderen Sonnensystemen?
Wie ist der Weg, der dorthin führt?
Ist es nichts als leerer Raum?
Bei Geschwindigkeiten von 15.000 Kilometer pro Sekunde, was 5% der Lichtgeschwindigkeit sind, kann man sich nur wünschen, dass man durch absolut leeren Raum fliegt.
Nur zur Veranschaulichung. Eine normale Gewehrkugel erreicht 700 Meter pro Sekunde. Spezialmunition schafft es auf über 1.000 Meter pro Sekunde. Keiner dieser Kugeln könnte ein Mensch ausweichen. Nicht einmal wahrnehmen können wir sie. Sie sind zu schnell für unsere Augen.
Und nun sprechen wir von einem Raumschiff, das 15.000 Mal schneller fliegt als eine Gewehrkugel. Mit was auch immer das Raumschiff kollidieren würde, die Menschen an Bord würden es nicht einmal merken. Sie wären tot. Nicht einmal ein Augenblick würde ihnen bleiben. Keine Explosion, keine umherfliegenden Trümmer, sie wären tot, bevor sie auch nur wahrnehmen könnten, dass es zu einer Kollision gekommen ist. Und leider ist der interstellare Raum keineswegs ein absolut leerer Raum. Denn es gibt das sogenannte interstellare Medium.
Durchschnittlich rechnet man mit 1.000 Wasserstoffatomen (Protonen) pro Kubikmeter. Das ist nun wirklich nicht viel. Und von keinem Menschen spürbar. Allerdings schafft das Raumschiff 15.000.000 dieser Kubikmeter pro Sekunde.
Und das bedeutet, dass 15.000.000.000 Protonen mit mindestens 15.000 Kilometer pro Sekunde auf jeden Quadratmeter Raumschiff einschlagen. Wirklich viel ist das nicht. Rechnet man aber über einen Zeitraum von 100 Jahren, dann wären das 15.000.000.000 Mal 3.153.600.000 Protonen. Welche Auswirkungen das auf die Technik des Raumschiffs hat, ist nicht vorhersehbar.
Aber Protonen sind nicht das einzige Problem. Ein Sonnensystem besteht nicht nur aus Sonne und Planeten. Es gibt unzählige kleinere Objekte. Von der Größe eines Staubkorns bis hin zu Zwergplaneten. Letztere sind noch relativ gut wahrnehmbar. Auch bei größeren Geschwindigkeiten wird man sie rechtzeitig entdecken können. Und dann hilft bereits eine geringe Änderung der Geschwindigkeit, um eine Kollision zu vermeiden.
Kleinere Objekte sind hingegen wesentlich schwieriger entdeckbar. Und bei 15.000 Kilometer pro Sekunde kann bereits ein Tennisball genügen, um schwerste Schäden, bis hin zur Zerstörung des Schiffes, zu verursachen. Das wichtigste Kriterium bei der Frage nach dem Weg ist daher die Frage, was man tun kann, um solche Kollisionen zu vermeiden.
Im Fall der Abreise ist dies noch recht einfach zu bewerkstelligen. Schon während das Raumschiff noch gebaut wird, kann die Reiseroute festgelegt werden und der Flugkorridor, der aus unserem Sonnensystem hinausführt, kann gründlich, auf Gefahren hin, untersucht werden.
Bis hin zum Kuipergürtel wäre dies in der verfügbaren Zeit möglich. Jedenfalls wenn Kosten keine Rolle spielen.
Die Oortsche Wolke zu vermessen, ist da schon ein ganz anderes Problem. Immerhin sprechen wir von einer Distanz, die bereits 1 Lichtjahr weit hinaus ins All führt. Vermessungsschiffe müssten dorthin gesendet werden. Und obwohl es automatisch arbeitende Sonden sein könnten, würden sie dennoch Jahrzehnte unterwegs sein.
Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wäre jedoch eine Option denkbar. Hierbei könnten Sonden dem Schiff vorausfliegen und die Route auf einer ausreichenden Breite vermessen.
Da die Sonden über einen Antrieb und entsprechende Brennstoffvorräte verfügen müssen, wären sie zwar relativ groß und teuer, aber strenggenommen unerlässlich.
Außerdem müssten es mehrere sein und das Mutterschiff muss in der Lage sein, neue zu produzieren. Denn speziell beim Einflug in ein fremdes Sonnensystem, wo jeder Gedanke an Hilfe von der Erde absolut illusorisch ist, ist nichts wichtiger als eine sichere Reiseroute. Aus diesem Grund kann das Schiff auch nicht mit 5 % der Lichtgeschwindigkeit ins System einfliegen. Zuvor muss das fremde Sonnensystem analysiert werden.
Wie sind die dortigen Gravitationsverhältnisse? Gibt es Regionen mit einer höheren Materiedichte? Gibt es Asteroidengürtel, Staubwolken, Kleinsttrümmer als Überreste von Kollisionen von Meteoren, Kometen? Wie ist der Strahlungsdruck der Sonne? Gibt es Planeten, die mit ihrer Gravitation den Einflug zum Zielplaneten stören? Kurz gesagt, welches ist die beste Einflugroute?
Daher kann, nachdem man in der Nähe des fremden Sonnensystems angekommen ist, also interstellare Distanzen überwunden hat, die restliche Reise im interplanetaren Bereich des Systems durchaus noch weitere Jahre benötigen.