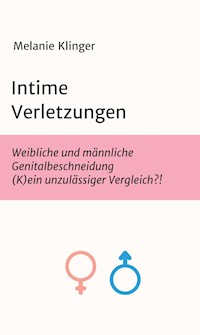
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Genitalverändernde Eingriffe werden seit Jahrtausenden praktiziert. Weltweit sind etwa 5% der weiblichen und ca. 37% der männlichen Gesamtbevölkerung von Genitalbeschneidungen betroffen. Während die weibliche Form in der westlichen Welt allerdings als schwere Körperverletzung geächtet wird, gilt die Vorhautentfernung bei Jungen und Männern als harmlos, wenn nicht sogar als medizinisch sinnvoll. Melanie Klinger setzt sich in "Intime Verletzungen" mit den vielfältigen Aspekten und Hintergründen genitalverändernder Praktiken auseinander. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Fragestellung, ob und inwieweit weibliche und männliche Genitalbeschneidung miteinander vergleichbar sind und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. Eine gebündelte Untersuchung aus medizinischer, psychologischer, soziokultureller und politischer Perspektive.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Allen bedanken, die mich bei der Arbeit an diesem Buch begleitet und unterstützt haben!
Melanie Klinger
Intime Verletzungen
Weibliche und männliche Genitalbeschneidung (K)ein unzulässiger Vergleich?!
© 2019 Melanie Klinger
Kontakt: [email protected]
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-3198-5
Hardcover:
978-3-7497-3199-2
e-Book:
978-3-7497-3200-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Anatomie und Physiologie der Genitalien
Embryonale Entwicklung
Die Klitoris - Eine Unbekannte
Die Verteilung der Nervenenden
Die Penisvorhaut - Eine weitere Unbekannte
Der Mythyos der 20.000 Nervenenden
Die physiologische Entwicklung der Vorhaut
Smegma
Fazit
2 Die Praxis der Genitalverstümmelung
Einführung
Female Genital Mutilation (FGM)
Terminologie
Verbreitung
Methodik und Durchführungsbedingungen
Klassifikation
Verbreitung der unterschiedlichen Formen
Infibulation
Einstellungen und Entwicklungstrends
Medikalisierung
Male Genital Mutilation (MGM)
Beschneidungstypen
Verbreitung
Methodik und Durchführungsbedingungen
Human Genital Alterations (HGA)
Klassifikation
3 Auswirkungen von Genitalbeschneidung
Einführung
Physische Folgen und Komplikationen
Schmerzen
Komplikationen
Auswirkungen auf die Sexualität
Psychische Auswirkungen
Kognitive Dissonanz
4 Historische Entwicklung und Motive
Kulturelle Riten
Religiöse Beschneidung
Judentum
Christentum
Islam
Medizinwissenschaftliche Begründungsmuster
Masturbationshysterie und Reflexneurose
Erste Anfänge der Genitalchirurgie
FGA in der westlichen Welt
MGA - Die Entstehung der Routineneugeborenenbeschneidung
Masturbationsprophylaxe
Die Theorie der Reflexneurose
Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
Krebsprophylaxe
Die Routinebeschneidung im Kreissaal
Kritik an der Beschneidungspraxis
Prävention von Harnwegsinfektionen
HIV-Prävention
Beschneidungsexperimente in Afrika
Beschneidungsprogramme in Südafrika
Beschneidungspraxis und Phimose
Die Vorhaut als Handelsware
Beschneidungsfetisch und Pädosexualität
5 Die Beschneidungsdebatte in Deutschland
Ursprung und Hintergründe
Das Kölner Urteil und seine öffentliche Wirkung
Diskussion in den Medien
Politische Debatte
Juristische Überlegungen
6 Sozialwissenschaftliche Aspekte der Genitalbeschneidung
Soziologische und sozialpsychologische Hintergründe
Beschneidung und Soziale Arbeit
Fazit
Anmerkungen
Quellenangaben
Vorwort
Wenn das Thema Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) in Politik und Medien bearbeitet oder in beliebiger Gesellschaft angesprochen wird, zieht sich durch alle Diskussionen der Tenor, dass es sich dabei um eine schreckliche Menschenrechtsverletzung handle, und deshalb alle alles tun müssen, um diese Praktiken global abzuschaffen. Die Lösung sei das Schaffen von Hilfsangeboten wie Informationsmaterial und Beratungsstellen, die Schulung von Ärzt*innen, Jugendämtern und Polizei und schließlich die strafrechtliche Verfolgung und die Drohung mit Gefängnisstrafen. Juristisch gesehen steht FGM in Deutschland unter Strafe seitdem Körperverletzung unter Strafe steht – vorausgesetzt es handelt sich nicht um eine von einer volljährigen Frau selbst gewünschte Operation. Jedoch wurde (bis heute) weder vor noch nach der Gesetzgebung des § 226a StGB ein Fall vor Gericht gebracht, geschweige denn jemand verurteilt. Info-Broschüren und Beratungsstellen werden fast nie von betroffenen Mädchen und Frauen aus den entsprechenden Communities konsultiert, sondern überwiegend von Lehrer*innen, Ärzt*innen oder dem Bekanntenkreis mutmaßlich betroffener oder gefährdeter Personen.
Eines der wenigen Beispiele effektiven Vorgehens gegen FGM-Praktiken ist das CHANGE-Projekt von TERRE DES FEMMES e.V.: Hier nehmen sog. Change Agents Kontakt mit Communities auf, in denen mutmaßlich FGM praktiziert wird.
Sie schaffen über viele Ebenen eine Vertrauensbasis und können dadurch irgendwann FGM ansprechen und bei einzelnen Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen, welche schädlichen Auswirkungen damit einhergehen. Dieses Vorgehen ist mühevoll und aufwendig und kann nur lokal an Einzelfällen wirken. Großflächiger reduziert sich FGM automatisch dadurch, dass die Frauen in der zweiten oder dritten Generation in einem Land leben, in dem FGM unüblich ist – dies zumindest ist das Ergebnis mehrerer Studien. Fest steht in jedem Fall, dass es noch immer und trotz aller Aufklärungsarbeit in der Vergangenheit einen langen Atem brauchen wird, FGM abzuschaffen.
Bei der Genitalverstümmelung von Jungen (MGM) stellt sich die Situation etwas anders dar. Jungen werden in Deutschland am helllichten Tag ganz offiziell und unter dem Schutzmantel der Legislative beschnitten. Bei Jungen gilt es nicht als Menschenrechtsverletzung; Politik und Medien fordern keine Hilfsangebote für Betroffene und Gefährdete. Aber noch etwas ist hier anders: Betroffene melden sich zu Wort. Einerseits ganz offen in Form von Protesten und öffentlichen Statements, andererseits im geschützten Raum von Betroffenengruppen und Internetforen, wo sie miteinander in Kontakt treten und wiederum andere beraten, die sich fragend an sie wenden. Dort tauchen Jugendliche auf, die unter dem Trauma ihrer Verstümmelung leiden und den Austausch mit anderen Betroffenen suchen, u.a. über Restaurationsmethoden, bei sexuellen und partnerschaftlichen Problemen, oder sie erkundigen sich, was sie konkret tun können, um von MGM bedrohten Jungen in ihrem Umfeld zu helfen.
Es melden sich dort auch Mütter und Väter, die mit dem jeweils anderen Elternteil in Streit darüber geraten sind, ob der Sohn einer Vorhautamputation unterzogen werden soll oder nicht.
Gäbe es zum Thema „Jungenbeschneidung“ Beratungsstellen – sie würden (im Gegensatz zu FGM) von direkt betroffen Jungen und deren Eltern in Anspruch genommen. Es darf sie aber nicht geben, da es in Deutschland ein Gesetz gibt, das Eltern ausdrücklich erlaubt, eine Genitalverstümmelung an ihren Söhnen zu verlangen - ohne Angabe von Gründen, ohne Altersbeschränkung, ohne Vorschrift, was und wie viel entfernt werden darf und ohne, dass dazu irgendeine strafrechtliche Konsequenz erfolgt. Einzige Auflage ist: Der Eingriff muss von ärztlichem Personal durchgeführt werden, außer das Kind ist jünger als sechs Monate, dann darf jeder von einer Religionsgemeinschaft dafür vorgesehene Mensch mit einem Kinderpenis tun was immer die Eltern wünschen oder er/sie für geboten hält. Solange diese Vorgaben eingehalten werden, kann der Betroffene nicht klagen, kann sich nicht wehren. Selbst wenn er alt genug ist zu sprechen, gibt es keine Beratungsstelle, an die er sich wenden könnte und es wird auch auf lange Sicht in diesem Land keine geben.
Das vorliegende Buch ist eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Genitalverstümmelung aus Perspektive der Sozialen Arbeit. Neu ist an diesem Ansatz, dass keine Selektion mehr nach Geschlechtern geschieht. Auf diese Weise findet eine umfassende und ehrliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Realitäten statt. Der Titel stellt zunächst die Frage in den Raum, ob männliche und weibliche Beschneidung verglichen werden kann und darf. Die umfassende Darstellung von Beschneidungsriten und -praktiken in Geschichte und Gegenwart kommt jedoch am Ende zu einer noch viel wichtigeren Erkenntnis: Nämlich, dass es eine Aufgabe auch und vor allem der Sozialen Arbeit ist, diejenigen anzuhören, die keiner hören will. Menschen, die sich an sozialpädagogische Institutionen wenden, haben in der Regel mit Problematiken zu tun, die auf einem üblichen und regelkonformen Weg durch die Ämter nicht (mehr) zu bewerkstelligen sind. Wer durch Krankheit aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, vor einer Abschiebung flieht, aus der Prostitution aussteigen möchte, eine Konfliktberatung benötigt oder wegen einer Sozialphobie das Haus nicht mehr verlassen kann, der landet, wenn er Glück hat, bei einer sozialpädagogischen Fachkraft, die ihm Möglichkeiten und Wege aufzeigt, aus seiner scheinbar aussichtslosen Situation herauszukommen bzw. ihn an weiterführende spezialisierte Fachkräfte oder Stellen vermittelt. Was wird ein Sozialarbeiter* jedoch tun, wenn sich Jungen und Männer aufgrund von Genitalverstümmelung entstandener Problemsituationen an ihn wenden? Er ist in erster Linie dem eigenen Gewissen unterstellt und mit der Aufgabe betraut, die Person, die zu ihm kommt, als rat- und hilfesuchendes Individuum zu erkennen.
In einer Realität, in welcher Politik und Medien das Phänomen der Traumatisierung von Jungen und Männern von der Bildfläche verschwinden lassen, kann dieses Buch eine erste Hilfestellung für die Soziale Arbeit sein und Mut machen, sich diesen Realitäten zu stellen.
Institutionen und Beratungsstellen, die von Kirchen getragen werden, wird hier sicherlich noch sehr lange im Wege stehen, dass sie sich bei Angriffen auf andere monotheistische Buchreligionen als kirchennahe Vereinigungen schützend vor deren Weltbild stellen werden. Dem einzelnen in der Sozialen Arbeit tätigen Menschen aber steht es frei, seiner Instuition zu folgen und eine betriebliche Übung daraus zu machen, auch männlichen Hilfesuchenden zur Seite zu stehen.
Spannend bleibt in jedem Fall, welche Rolle dabei das sich langsam ausbreitende Wissen um die zahlreichen intergeschlechtlich geborenen Kinder spielen wird. Denn klar ist: die Unterscheidung zwischen Opfern des einen und Nicht-Opfern des anderen Geschlechts bröckelt, je mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gerät, dass die radikalbinäre Einteilung der Menschheit in Mann und Frau mit der Realität so noch niemals übereingestimmt hat.
Gislinde Nauy, M.A.
Theater- und Religionswissenschaftlerin,
Vorsitzende bei Mogis e.V.
Einleitung
Genitalverändernde Praktiken bei Kindern und Jugendlichen werden seit Jahrtausenden weltweit praktiziert. Die Gründe dafür unterscheiden sich je nach Kultur, Ethnie und Religionszugehörigkeit. Ursprünglich sollte mit der Beschneidung der Genitalien in erster Linie die sexuelle Triebkraft beschnitten werden. Dieses zugrundeliegende Motiv ist im Laufe der Zeit in den Hintergrund getreten und wurde weitestgehend durch traditionelle, religiöse und medizinische Beweggründe abgelöst. Bemerkenswerterweise wird die Beurteilung solcher Operationen weniger am Schweregrad, sondern vorrangig an Geschlechterverhältnissen festgemacht. Während jegliche Form der Beschneidung bei Mädchen und Frauen im Allgemeinen als unnötiger, traumatischer und schmerzhafter Eingriff gewertet wird, werden Vorhautamputationen bei Jungen und Männern sowie „korrigierende“ genitalchirurgische Maßnahmen bei intersexuellen Kindern für gewöhnlich verharmlost und zum Teil sogar forciert. Begünstigt wird diese einseitige Vorstellung vor allem auch durch eine Überrepräsentation der besonders dramatischen Formen der weiblichen Genitalverstümmelung in den Medien. Der zunehmende (besorgniserregende) Trend der Labienplastik in der Schönheitschirurgie, bei der sich erwachsene Frauen freiwillig für eine Genitaloperation entscheiden, wird in diesem Kontext oftmals ignoriert.
Mit einem Urteil des Kölner Landgerichts im Mai 2012, welches die Beschneidung von Jungen erstmalig als Körperverletzung einstufte, kam es zum ersten Mal zu einem öffentlichen Diskurs der Thematik in Deutschland.
Dieser kam jedoch durch das überhastet geschaffene „Beschneidungsgesetz“ bereits im Dezember des gleichen Jahres zu einem schnellen Ende. Begründet wurde das Gesetz, welches die Knabenbeschneidung ausdrücklich erlaubt, damit, dass die „harmlose Beschneidung“ von Jungen nicht mit der „grausamen weiblichen Genitalverstümmelung“ gleichzusetzen sei. Nach Angela Merkels Worten würde sich Deutschland ja zur „Komiker-Nation“ machen, würde ein Beschneidungsverbot ernsthaft diskutiert. Im Gegenzug dazu wurde nur ein halbes Jahr später ein Gesetz eingeführt, welches sämtliche Formen der weiblichen Genitalverstümmelung unter Strafe stellt.
Das vorliegende Buch setzt sich mit den vielfältigen Aspekten und Hintergründen genitalverändernder Eingriffe auseinander. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Fragestellung, ob und inwieweit weibliche und männliche Genitalbeschneidung miteinander vergleichbar sind und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Praktiken bestehen.
1 Anatomie und Physiologie der Genitalien
Embryonale Entwicklung
Die männlichen und weiblichen Genitalien entwickeln sich aus ein und demselben embryonischen Gewebe. In den ersten sieben Schwangerschaftswochen, dem sogenannten sexuell indifferenten Stadium, verläuft die Entwicklung noch bei beiden Geschlechtern gleich. Erst am Ende der 7. Schwangerschaftswoche beginnen sich die Geschlechtsorgane zu differenzieren.1 Beim männlichen Embryo entwickelt sich die Keimdrüse (Gonade) zum Hoden (Testis). Dort wird das männliche Geschlechtshormon Testosteron gebildet. Unter dessen Einfluss entwickelt sich aus den Geschlechtswülsten der Hodensack (Skrotum) und der Genitalhöcker wird zum Penisschaft. Die Genitalfalten schließen sich und bilden die Eichel (Glans penis). Aus einer Gewebefalte der Eichelfurche entsteht die Vorhaut (Präputium penis), welche durch das Vorhautbändchen (Frenulum) mit der Eichel verbunden ist.2 Der Hoden behält während der Schwangerschaft seine intraperitoneale Lage und wandert erst kurz vor der Geburt von der Bauchhöhle in den Hodensack.3
Beim weiblichen Embryo entwickelt sich die Keimdrüse zum Eierstock (Ovar), in welchem das weibliche Geschlechtshormon Östrogen produziert wird. Die Geschlechtswülste bilden sich zu den großen Schamlippen (Labia majora) und die Genitalfalten zu den kleinen Schamlippen (Labia minora) aus. Der Genitalhöcker entwickelt sich zur Klitoris als weibliches Äquivalent zum Penis, mit dem Unterschied, dass sich diese im Inneren des Körpers befindet und nur die Eichel (Glans clitoridis) sowie die Vorhaut (Präputium clitoridis) von außen sichtbar sind. Anders als beim männlichen Embryo schließt sich der Urogenitalspalt nicht, wodurch die Vaginalöffnung zu Stande kommt.4
Diese Beschreibung stellt dabei – etwas vereinfacht – den normaltypischen Ablauf der Differenzierung beider Geschlechter dar. Durch die vielen komplexen Einzelschritte gibt es in der Realität jedoch eine Vielzahl an möglichen und von der Norm abweichenden Entwicklungen. Rund 2% der in Deutschland geborenen Kinder sind intersexuell, d.h. sie kommen mit nicht eindeutig zuweisbaren Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Die Erscheinungsformen sind dabei sehr vielfältig und es gibt ein breites Feld an Zwischenstufen.5
Die Klitoris – Eine Unbekannte
Obwohl die wissenschaftliche Erforschung der Genitalien weit in die Vergangenheit zurückreicht, wurden sowohl das klitorale System, als auch die spezialisierte Struktur der männlichen Vorhaut erst in den 1990er Jahren detailgenau beschrieben. Die ersten bedeutsamen Beschreibungen der Anatomie der Klitoris erschienen in der Renaissance Mitte des 16. Jhs. durch die Anatomen Charles Estienne, Realdo Colombo und Gabriele Falloppio.6 Seitdem wurde die Klitoris in verschiedenen wissenschaftlichen Schriften thematisiert. Als besonders einflussreich gelten diesbezüglich die Untersuchungen des Anatomen Georg L. Kobelt Mitte des 19. Jahrhunderts.
In seinem 1844 veröffentlichten Aufsatz „Die männlichen und weiblichen Wolllust-Organe des Menschen und einiger Säugetiere in anatomisch-physiologischer Beziehung“ präsentierte er eine umfassende Beschreibung der tieferliegenden Strukturen der Klitoris sowie ihrer sexuellen Funktion.7
In der nachfolgenden Zeit wurde die Erforschung der Klitoris jedoch weitestgehend vernachlässigt und ihre verborgenen Strukturen gerieten zunehmend in Vergessenheit. Bis heute wird die Klitoris häufig auf die sichtbare Eichel reduziert. So wird die Klitoris beispielsweise im Duden immer noch als ein „am oberen Ende der kleinen Schamlippen gelegenes weibliches Geschlechtsorgan“ definiert.8
In den 1990er Jahren begann sich die australische Urologin Helen O’Connell mit ihrem Forschungsteam eingehender mit der Anatomie der Klitoris und deren Beziehung zu den umliegenden Organen zu befassen. Dabei stellte sie fest, dass die klitoralen Strukturen weitreichender sind, als bislang angenommen wurde. Nach dem bisherigen Verständnis setzte sich die Gestalt der Klitoris aus einem Körper (Corpus clitoridis), zwei Schenkeln (Crura clitoridis) und der Eichel (Glans clitoridis) zusammen. In den gängigen Beschreibungen der Anatomielehrbücher erstreckte sie sich lediglich auf einer Ebene, ohne direkten Bezug zur Harnröhre (Urethra) und den beiden Schwellkörpern (Bulbi vestibuli) des Scheidenvorhofs (Vestibulum vaginae).9 Die Untersuchungen von O’Connell zeigen jedoch, dass die Schwellkörper in direktem Zusammenhang zur Klitoris und zur Harnröhre stehen und weniger dem Scheidenvorhof zuzuordnen sind.
Demnach ist die Bezeichnung Vorhofschwellkörper (Bulbi vestibuli) ihrer Ansicht nach nicht ganz zutreffend, weshalb sie eine Umbenennung in Klitorisschwellkörper (Bulbi clitoridis) vorschlägt.10
Durch diese zusätzlichen Elemente ergibt sich eine veränderte Gestalt der Klitoris. Mit den Schwellkörpern dehnt sie sich auf eine weitere Ebene aus und stellt somit einen bis zu 9 cm großen dreidimensionalen erektilen Komplex dar, welcher gemeinsam mit Harnröhre und Vagina eine funktionelle Einheit bildet.11 Das gesamte klitorale System weist zudem eine hohe neurovaskuläre Versorgung auf. Vor allem die Klitoriseichel ist besonders dicht innerviert, da die Stränge des Nervus dorsalis clitoridis dort fast vollständig, mit nur minimaler Verzweigung, ankommen.12
Ihr Vorschlag, die Schwellkörper umzubenennen, wurde zwar nicht umgesetzt, ihre Untersuchungsergebnisse wurden jedoch zum Teil aufgegriffen und entsprechende Veränderungen in Anatomielehrbüchern vorgenommen. So werden die Schwellkörper im „Lehrbuch Anatomie“ 2011 nicht mehr dem Scheidenvorhof zugeordnet, sondern der Klitoris.13
Auch in der Öffentlichkeit erzielte die Arbeit von Helen O’Connell große Wirkung. Die 2002 produzierte Arte Dokumentation „Klitoris, die schöne Unbekannte“ stieß auf große Resonanz und in der Folge entstanden verschiedene Kunstprojekte wie „Cliteracy“ von Sophia Wallace und „After Dinner Party“ von Lynn Schirmer.14,15 Im Jahr 2016 entwickelte die französische Sozialmedizinerin Odile Fillod das erste originalgetreue Klitorismodell in 3D, um es im Sexualkundeunterricht an Schulen einzusetzen.16
Abbildung 1: 3D-Modell einer Klitoris
(Foto: Vimeo/Marie Docher)
Die Verteilung der Nervenenden
Ziel dieser Aufklärungskampagnen war es in erster Linie, ein Bewusstsein für die tatsächliche Größe der Klitoris sowie deren sexuelle Funktion zu schaffen. So erklärt die Wissenschaftsjournalistin Natalie Angier sowohl in der Arte Dokumentation als auch in ihrem Buch „Frau – eine intime Geographie des weiblichen Körpers“, die Klitoriseichel sei die empfindlichste Stelle des menschlichen Körpers. Sie sei wesentlich sensibler als der Penis, da die Klitoriseichel etwa 8000 Nervenenden enthalte, während der Penis insgesamt mit nur etwa 4000-6000 Nervenenden ausgestattet sei.17,18
Diese Aussage wurde seither im Netz stetig wiederholt und findet sich auf zahlreichen Ratgeber- und Unterhaltungsseiten ohne jegliche Quellenangaben wieder.19,20,21 Wie Angier auf diese Zahlen kommt, geht nicht aus ihrem Buch hervor, da sie ihre Angabe dort nicht belegt. Vermutlich bezieht sie sich dabei auf eine Studie von 1955, in welcher diese Zahlen erstmalig veröffentlicht wurden. Allerdings wurden die dort beschriebenen Beobachtungen an Schafen und Kühen angestellt und wurden bisher nie an der menschlichen Spezies bestätigt.22
Bereits Kobelt hatte schon eine höhere Nervendichte der Klitoriseichel gegenüber der Peniseichel beschrieben.23 Die Konzentration der Nervenenden in der Klitoriseichel führte ihn zu der Annahme, „dass in denjenigen Fällen, wo man wegen Nymphomanie oder wegen, bis zum Blödsinne getriebener Onanie die clitoris exstirpierte, die weniger eingreifende Abtragung der kleinen Eichel der clitoris zu denselben Resultaten geführt haben würde“.24
Die Nervenendigungen der Haut können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden: Die freien Nervenendigungen, die für die protopathische Sensibilität, d.h. Schmerz- und Temperaturwahrnehmung verantwortlich sind, sowie die spezialisierten Nervenendigungen (korpuskuläre Rezeptoren) für die Übertragung feiner Berührungen.25 Wie die Studie von Halata & Munger zeigt, befinden sich in der Peniseichel überwiegend freie und weniger spezialisierte Nervenendigungen, ähnlich wie in der Hornhaut des Auges.26 In einer Vergleichsstudie untersuchten Cheryl Shih et al. das Vorkommen spezialisierter Nervenendigungen in Glans penis und Glans clitoridis.
Sie stellten fest, dass in der Klitoriseichel deutlich mehr korpuskuläre Rezeptoren vorhanden sind, als in der Peniseichel.27
Daraus lässt sich schließen, dass die Klitoriseichel hochempfindlich auf feine Berührungen reagiert, während die Peniseichel in erster Linie Schmerz- und Temperaturreize wahrnimmt und unempfindlicher gegenüber leichten Berührungen ist. Doch lässt sich daraus ableiten, dass die Klitoris insgesamt berührungsempflindlicher ist als der Penis? Bei dieser Betrachtung fehlt ein entscheidendes Detail – die männliche Vorhaut.
Die Penisvorhaut – Eine weitere Unbekannte
Helen O’Connell konstatiert, die Klitoris würde in medizinischen Lehrbüchern entweder kaum vorkommen oder ungenügend bzw. fehlerhaft beschrieben werden, während die Anatomie des Penis hingegen in aller Ausführlichkeit behandelt würde.28 Ihre Einschätzung trifft jedoch nur zum Teil zu, da die männliche Vorhaut ähnlich nachlässig behandelt wird wie die Klitoris. Bis heute fehlt in Anatomiebüchern eine detaillierte Beschreibung der anatomischen Struktur und Funktion der Vorhaut. Im Allgemeinen kommt es zu einer Überbetonung der Peniseichel, während die Vorhaut lediglich in einem knappen Satz erwähnt wird.29,30,31 In aktuellen amerikanischen Lehrbüchern wird der Penis zum Teil nach wie vor ausschließlich ohne Vorhaut abgebildet, so, als wäre dies der Normalzustand.32 Häufig ist das Einzige, was Medizinstudent/innen in den USA über die Vorhaut lernen, die Art und Weise, wie diese entfernt wird, wie Steve Scott es etwas zugespitzt formuliert.33
Während der Vorhaut einerseits zwar eine Schutzfunktion gegenüber der Eichel zugesprochen wird, gilt sie in vielen medizinischen Lehrbüchern als potentielle Gefahrenquelle für die Entstehung verschiedener Krankheiten wie Krebs oder HIV.34,35,36 Als häufiges Krankheitsbild gilt vor allen Dingen die Vorhautverengung (Phimose), welche dann bestünde, wenn sich die Vorhaut bei Jungen über drei Jahren nicht über die Eichel zurückziehen ließe.37,38,39 Im „Lehrbuch Anatomie“ wird die Beschneidung als minimaler krankheitsvorbeugender Eingriff beschrieben, während paradoxerweise wenige Seiten zuvor auf das Problem der weiblichen Genitalverstümmelung hingewiesen wird, mit welchem durch Migration auch die Ärzt/innen in Deutschland zunehmend konfrontiert wären.40
Die Vorhaut macht etwa 50% der gesamten Penishaut aus und besteht aus einem doppellagigen Hautsystem von äußerer Schafthaut und innerer Schleimhaut.41 In den 1990er Jahren untersuchten der Pathologe John Taylor und Kollegen die Vorhaut genauer. Sie stellten fest, dass die bisherige Unterscheidung der Vorhaut in äußere Schafthaut und innere Schleimhaut nicht ausreicht, um die komplexe Struktur der Vorhaut vollständig zu beschreiben. So lässt sich die innere Schleimhaut nochmals in einen glatten und einen gefurchten Bereich unterteilen. Der 10-15 mm breite gefurchte Teil der Schleimhaut, das sog. gefurchte Band, befindet sich an der Vorhautspitze in der Nähe der mukokutanen Grenze und geht fließend in das Frenulum über. Im Ruhezustand bedeckt das gefurchte Band die Eichel, während es bei zurückgezogener Vorhaut umgestülpt wird und dadurch auf der Schafthaut aufliegt.42
In der histologischen Untersuchung stellten Taylor et al. fest, dass vor allem die Bereiche der gefurchten Schleimhaut, des Frenulums und der Übergangsregion zur normalen Haut stark durchblutet sind und besonders viele spezialisierte Nervenendigungen enthalten.43 Damit verhält sich die Verteilung der spezialisierten Nervenendigungen der Eichel und Vorhaut des Penis bzw. der Klitoris genau entgegengesetzt, da die Klitorisvorhaut im Vergleich kaum korpuskuläre Rezeptoren enthält.44
Der Mythyos der 20.000 Nervenenden
Hinsichtlich der Anzahl der Nervenendigungen auf der Penisvorhaut entwickelte sich ein ähnlicher Mythos wie schon bei der Glans clitoridis / penis. So kursiert im Netz sowie in der (Fach-) Literatur die Aussage, die männliche Vorhaut würde etwa 20.000 Nervenendigungen enthalten.45,46 Diese Angabe geht vermutlich auf einen Artikel des Kinderarztes Paul Fleiss in der Zeitschrift „Mothering“ aus dem Jahr 1997 zurück.47 Dessen Berechnungen der Nervenendigungen ergeben sich aus einer Studie von 1932, in welcher Bazett et al. in 1 cm2 Vorhautgewebe 212 korpuskuläre Rezeptoren gezählt hatten.48 Ausgehend von einer gesamten Vorhautgröße (Innen- und Außenhaut) von ca. 100 cm2, rechnete Fleiss die Nervenendigungen entsprechend hoch.49,50 Wie die Studie von Taylor et al. zeigt, sind die korpuskulären Rezeptoren jedoch sehr unterschiedlich verteilt, weshalb die Nervendichte in 1 cm2 Gewebe nicht auf die gesamte Vorhaut übertragen werden kann.
Die physiologische Entwicklung der Vorhaut
Die Entwicklung der Vorhaut ist bei der Geburt noch nicht vollständig abgeschlossen.51 Zum einen besteht bei neugeborenen Jungen eine natürliche Enge der Vorhautspitze und zum anderen sind Vorhaut und Eichel zu diesem Zeitpunkt noch durch ein gemeinsames Schleimhautepithel, die sog. balanpräputiale Membran, fest miteinander verbunden, ähnlich wie Fingernägel mit dem Nagelbett oder die Augenlider von Katzenbabys.52 Durch diese Schutzmechanismen lässt sich die Vorhaut nicht über die Eichel zurückziehen, so dass das Eindringen von Krankheitserregern und Verschmutzungen wie Urin und Kot verhindert wird.53 Die Auflösung dieser natürlichen „Verklebung“ (Konglutination) und Enge der Vorhaut vollzieht sich in einem sehr individuellen Reifungsprozess, der bei einigen Jungen erst mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter abgeschlossen ist.54
Der Ablöseprozess der Vorhaut verläuft dabei in Schüben und geht teilweise mit verschiedenen Symptomen einher, die bei Eltern und Ärzt/innen oftmals zu Verunsicherungen führen. So kommt es beispielsweise in der Übergangsphase häufig zu Aufblähungen beim Urinieren, wenn sich die Vorhautoberfläche bereits von der Eichel gelöst hat, die Vorhautöffnung jedoch noch zu eng ist, so dass sich der Urin vorübergehend unter der Vorhaut staut.55 Solange dieses „Ballonieren“ schmerzfrei ist und der Urin von selbst abfließen kann, ist hier jedoch keinerlei Behandlung notwendig.56
Smegma
Der weibliche und männliche Präputialsack enthält flüssige Transsudate und abgeschilferte Epithelzellen, die sich als weißlicher Belag, dem sog. Smegma (griechisch für Seife) unter der Vorhaut des Penis (Smegma preputii) bzw. der Klitoris (Smegma clitoridis) und zwischen den großen und kleinen Schamlippen ansammeln können.57
Das Smegma ist Teil des natürlichen Selbstreinigungssystems des Körpers. Zudem hält es die Schleimhäute feucht und geschmeidig und fungiert damit als natürliches Gleitmittel beim Geschlechtsverkehr bzw. bei der Masturbation.58
Darüber hinaus spielt Smegma ebenfalls eine Rolle beim Ablösungsprozess der Vorhaut von der Eichel. So führt die Akkumulation von Smegma in Verbindung mit Peniswachstum und auftretenden Erektionen zu der graduellen Separation von Glans und innerem Vorhautblatt.59 Dabei können sich durch retiniertes Smegma gelb-weißliche linsengroße Zysten unter der Vorhaut ausbilden. Diese sog. „Smegmaretentionszysten“ entleeren sich spontan und erfordern keine Behandlung.60
Im Normalfall ist Smegma geruchlos. Bei langanhaltender mangelnder Intimhygiene kann es jedoch zu einem Ungleichgewicht der physiologischen Bakterienflora und infolgedessen zu Geruchsbildung und Infektionen kommen.61
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwischen Penis und Klitoris grundlegende Gemeinsamkeiten bestehen. Beide Organe sind mit einem Schwellkörpersystem ausgestattet und verfügen über ausgeprägte neuronale und vaskuläre Netzwerke. Sowohl die Klitoris als auch der Penis stellen komplexe Systeme dar, deren einzelne Komponenten auf unterschiedliche Art und Weise zusammenwirken. Sie sollten daher als zusammenhängende funktionelle Einheiten angesehen werden, deren einzelne Elemente jeweils eine spezifische Aufgabe erfüllen.
Die wesentlichen Unterschiede bestehen vor allem in der unterschiedlichen Anordnung der Nervenendigungen sowie der komplexen Struktur der männlichen Vorhaut. Die Tatsache, dass sich die Vorhaut im Lauf der Evolution derartig spezialisiert entwickelt hat, spricht deutlich gegen die Bewertung als überflüssiges Stück Haut. Tatsächlich ist das doppellagige Hautsystem des Penis in seiner Spezialisierung und der Fähigkeit, sich komplett umzustülpen, einzigartig. Das Wissen um Funktion und Physiologie der männlichen Vorhaut hat sich innerhalb der Ärzteschaft leider immer noch äußerst unzureichend durchgesetzt. Aus diesem Grund kommt es infolge von Missinterpretationen physiologischer Phänomene nach wie vor zu der Fehldiagnose der pathologischen Phimose und daraufhin zum vermeintlich medizinisch notwendigen Heileingriff der Beschneidung.
(Näheres hierzu auch im Kapitel „Beschneidungspraxis und Phimose“)
2 Die Praxis der Genitalverstümmelung
Einführung
Allgemein wird unter dem Begriff Verstümmelung eine funktionsbeeinträchtigende Veränderung der Gestalt durch irreversible Schädigung oder Entfernung wesentlicher Teile des Körpers verstanden.1 Gemäß dieser Definition lassen sich alle medizinisch nicht indizierten Eingriffe der Genitalien ohne Zustimmung der betroffenen Person unter den Begriff Genitalverstümmelung zusammenfassen. Üblicherweise wird in diesem Zusammenhang jedoch ausschließlich von weiblicher Genitalverstümmelung gesprochen, während die männliche Form einfach „wegdefiniert“ wird, wie es der Geschlechterforscher Willi Walter ausdrückt.2 So gibt es bei Wikipedia lediglich einen Eintrag zu weiblicher Genitalverstümmelung. Im Falle betroffener Jungen und Männer wird die Thematik dagegen unter dem euphemistischen Begriff Beschneidung (Zirkumzision) diskutiert. Nach vorherrschender Auffassung handelt es sich dabei um zwei komplett unterschiedliche Praktiken. So erklärt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Positionspapier, dass es sich bei Female Genital Mutilation (FGM) um einen schwerwiegenden Eingriff mit lebenslangen Folgen und zudem um ein extremes Beispiel an Geschlechterdiskriminierung handele, während die männliche Beschneidung demgegenüber einen vergleichsweise harmlosen Eingriff darstelle, welcher im Gegensatz zu FGM außerdem signifikante gesundheitliche Vorteile bieten würde.3
Besonders paradox erscheint diese unterschiedliche Beurteilung auch bei Waris Dirie, der es in den 1990er Jahren mit ihrem Buch „Wüstenblume“ gelungen war, internationale Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken. Die gebürtige Somalierin zählt seitdem zu den bekanntesten Gegnerinnen der weiblichen Genitalverstümmelung und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für ihr Engagement im Kampf gegen FGM erhalten. Konträr zu ihrer eigenen traumatisierenden Erfahrung bewertet sie die Beschneidung ihres Sohnes dagegen als besonders positiven Eingriff: „We had Aleeke circumcised in the hospital a day after he was born. This is very different from female genital mutilation; that should never even be called circumcision – it’s not. In males it’s done for medical reasons – to ensure cleanliness. … Despite my strong feelings about FGM, I knew it was the right thing to do. … His little penis was sticking up straight and clean. It was lovely to look at!“4
Female Genital Mutilation (FGM)
Terminologie
Der Begriff Female Genital Mutilation (FGM) entstand Mitte der 1970er Jahre vor dem Hintergrund der damals aufkommenden Menschenrechtsbewegungen. Bis zu dieser Zeit wurde die Thematik in der westlichen Welt hauptsächlich in der Medizin bzw. in der Anthropologie unter eher neutralen Begriffen wie Zirkumzision, Klitoridektomie oder Infibulation diskutiert.5
Um das öffentliche Interesse auf die Problematik zu lenken, entstanden 1974 auf Initiative einiger Frauen- und Menschenrechtsbewegungen diverse Kampagnen gegen die verschiedenen Praktiken der weiblichen Beschneidung. Dabei wurde die Thematik in erster Linie als geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen verstanden. Aus diesem Grund forderten viele Aktivist/innen, den bisherigen Begriff Beschneidung durch Verstümmelung zu ersetzen, um eine klare Abgrenzung zur männlichen Beschneidung zu erreichen und die besondere Schwere des Eingriffs bei Mädchen und Frauen zu betonen.6
Durch die Einführung dieser Terminologie entstand somit eine Entkoppelung der weiblichen und männlichen Beschneidung, infolgedessen sich zwei komplett unterschiedliche Diskurse entwickelt haben.
Der Begriff Female Genital Mutilation verbreitete sich im Lauf der Zeit zunehmend und wurde schließlich 1990 bei der Dritten Konferenz des Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children in Äthiopien offiziell aufgenommen, sowie im Folgejahr von der WHO.7 Des Weiteren wurde die Praxis als geschlechterspezifische Menschenrechtsverletzung bei der Menschenrechtsweltkonferenz in Wien 1993 anerkannt.8 In der Folge wurde die weibliche Genitalverstümmelung nach und nach in vielen Staaten weltweit gesetzlich verboten.9
Im weiteren Verlauf entwickelte sich allerdings eine kontroverse Debatte hinsichtlich der negativen Konnotation des Begriffs.
Viele Organisationen, die sich für eine Beendigung von FGM einsetzen, haben die Erfahrung gemacht, dass eine derartige sprachliche Abwertung dieser Praxis in den betreffenden ethnischen und kulturellen Gemeinschaften auf Ablehnung stößt. Zum einen empfinden betroffene Frauen die Zuschreibung, „verstümmelt“ zu sein, oftmals als stigmatisierend und beleidigend, zum anderen verhindert die implizite Anklage des Begriffs eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen sich Engagierenden und „Täter/innen“. Aus diesem Grund sprechen sich einige Organisationen für die ergänzende Verwendung des neutraleren Begriffs Female Genital Cutting (FGC) aus.1011
Verbreitung
Schätzungen zufolge sind weltweit mindestens 200 Mio. Mädchen und Frauen, d.h. ca. 5% der weiblichen Gesamtbevölkerung, von Genitalverstümmelung betroffen.12 Die Praxis ist hauptsächlich in einigen afrikanischen, arabischen und asiatischen Ländern verbreitet, sowie in einzelnen indigenen Bevölkerungsgruppen in Australien und Südamerika. Durch Migrationsbewegungen sind zunehmend auch Mädchen und Frauen in Europa und Nordamerika betroffen.13 Nicht für alle Verbreitungsgebiete sind detaillierte Daten verfügbar. Aus dem Grund ist eine umfassende und zuverlässige Darstellung der globalen Verteilung nur sehr eingeschränkt möglich. Die Häufigkeit von FGM ist unter den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. So weisen beispielsweise Staaten wie Somalia, Guinea, Djibouti, Ägypten, Eritrea, Sierra Leone, Mali, Sudan, Burkina Faso, Äthiopien, Malaysia und Indonesien mit 70-100% eine sehr hohe FGM-Rate auf, während die Praxis in Ländern wie Ghana, Togo, Niger, Kamerun und Uganda mit 1-4% vergleichsweise selten verbreitet ist.14,15,16 Aber auch innerhalb eines Staates gibt es teilweise gravierende Unterschiede je nach Region. In Tansania bspw. beträgt die Spannweite zwischen Gegenden mit niedriger und hoher Prävalenz bis zu 70%, im Senegal sogar bis zu 90%.17 Im Irak und Iran konzentriert sich die Praxis vor allem in kurdischen Gebieten, sowie in ländlichen Provinzen im Südiran, wo FGM zu etwa 70% praktiziert wird.18,19 Wie aus verschiedenen Studien hervorgeht, ist die Häufigkeit innerhalb muslimischer Bevölkerungsgruppen dabei am höchsten.20,21,22,23
Methodik und Durchführungsbedingungen
In den meisten Fällen erfolgt der Eingriff noch vor dem 15. Lebensjahr. In den asiatischen Ländern wird die Beschneidung üblicherweise bereits innerhalb des ersten Lebensjahres durchgeführt, während die Mädchen in arabischen und afrikanischen Ländern durchschnittlich im Alter von 4 bis 7 Jahren beschnitten werden.24,25,26,27,28
In der großen Mehrheit der Fälle findet der Eingriff zuhause statt und wird von traditionellen Beschneiderinnen vorgenommen. In der Regel wird dabei eine unsterile Klinge oder ein Rasierer verwendet.29,30 In einigen Ländern, wie beispielsweise in Ägypten und im Sudan, wird der Eingriff überwiegend von medizinischem Personal durchgeführt.31 Auch in den asiatischen Ländern findet die Praxis zunehmend im medizinischen Kontext statt.32,33
Klassifikation
Die WHO entwickelte 1995 eine Klassifikation der verschiedenen Formen der weiblichen Genitalverstümmelung, welche 2007 aktualisiert wurde.34 Danach lassen sich vier Haupttypen mit jeweiligen Unterformen unterscheiden:
WHO Typologie 1995
WHO Typologie 2007
Typ I: Entfernung der Vorhaut mit oder ohne teilweiser oder vollständiger Entfernung der Klitoris (Klitoridektomie)
Typ I: Teilweise / vollständige Entfernung der Klitoris und/oder der Vorhaut (Klitoridektomie)Typ Ia: Entfernung der VorhautTyp Ib: Entfernung der Klitoris mit der Vorhaut
Typ II: Entfernung der Klitoris mit teilweiser oder vollständiger Entfernung der Labia minora (Exzision)
Typ II: Teilweise / vollständige Entfernung der Klitoris und Labia minora und/ohne Labia majoraTyp IIa: Entfernung der Labia minoraTyp IIb: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und Labia minoraTyp IIc: Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und Labia minora und majora
Typ III: Teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren Genitalien und Verengen/Vernähen der Vaginalöffnung (Infibulation)
Typ III: Verengung der Vaginalöffnung durch Vernähen der Labia minora und/oder majora mit oder ohne Entfernung der Klitoris (Infibulation) Typ IIIa: Entfernung und Vernähen der Labia minora Typ IIIb: Entfernung und Vernähen der Labia majora
Typ IV: Sonstige Formen wie Stechen, Piercing, Dehnen, Verbrennen, Verätzen, Ausschaben, Einschneiden (Inzision) etc.
Typ IV:





























