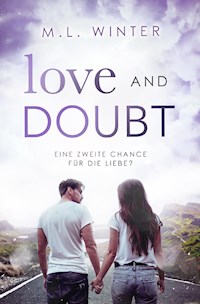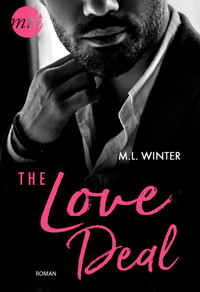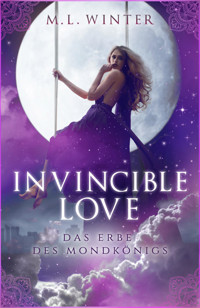
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau, auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und ein Bewohner des Mondes, der auf die Erde kommt, um seinen Spaß zu haben. Ziellos reist Piper durchs Land und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Doch nirgends hält sie es lange aus. Es ist wie ein innerer Zwang, gegen den sie nicht ankommt. Erst Austin (Texas) scheint ein Wendepunkt in ihrem Leben zu werden. Piper bekommt die Chance, in einem Planetarium über ihre größte Leidenschaft, das Sonnensystem, zu referieren. Bevor Duncan der neue Mondkönig werden kann, muss er eine Reise zur Erde antreten. So will es das Gesetz. Begleitet wird er dabei von seinem Kumpel Gideon. Während die beiden durch die Länder reisen, geschieht das Unfassbare: Gideon verliebt sich Hals über Kopf, will es aber nicht wahrhaben. Duncan beschließt seinem Freund auf die Sprünge zu helfen. Doch Gideon macht es ihm wirklich nicht einfach und auch Piper stellt sich ihm quer. Dabei ist es kaum zu leugnen, dass auch sie etwas für Gideon empfindet. Werden sich Piper und Gideon eine Chance geben? Und welches Geheimnis verbirgt Duncans Vater?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Invincible Love
Das Erbe des Mondkönigs
M. L. Winter
E-Mail: [email protected]
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen.
1. Auflage, August 2021
Copyright M. L. Winter
Umschlaggestaltung: Kristina Licht
Lektorat: Bettina Bergmann
Korrektorat: Elisa Garrett
ISBN: 9783754609064
Alle Rechte vorbehalten.
Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension darf kein Teil dieses Buches ohne Genehmigung in gedruckter oder elektronischer Form reproduziert, gescannt oder verteilt werden.
Die Figuren und Handlungen sind frei erfunden. Geschilderte Örtlichkeiten können von realen Schauplätzen inspiriert sein, beinhalten aber oftmals auch fiktive Angaben.
Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für meinen Papa ... Du bist der hellste Stern im Universum.
Prolog
Die unzähligen Monde in unserem Universum steuern auf eine Katastrophe zu. Das spürt auch Jeldrik, der Mondkönig der Menschenwelt. Die einzelnen Himmelskörper verblassen zusehends, und auch seinen Untertanen geht es immer schlechter. Die Hände hinter seinem Rücken verschränkt schreitet er durch den verwaisten Thronsaal. Nur das Geräusch seiner Schritte hallt wider. An den Wänden hängen die Gemälde seiner Vorfahren. Stolz blicken sie Jeldrik entgegen. Unweigerlich fragt er sich, wie sie in seiner Lage reagiert hätten. Hätten sie eine Lösung gefunden, um die Zerstörung abzuwenden? Oder wären sie ebenso ratlos, wie er es im Moment ist? Definitiv ist er mit seiner Weisheit am Ende. Selbst seine Brüder, die anderen Könige der Monde, konnten ihm nicht weiterhelfen. Obwohl ihnen allen das gleiche Schicksal droht, scheint es keine Hoffnung zu geben.
Jeldriks Beine versagen plötzlich ihren Dienst. Hart stürzt er auf den Boden. Er unterdrückt einen Fluch. Auch er wird immer schwächer. Niemals hätte er sich so etwas vorstellen können. Jeldrik dachte, ihm würden noch Jahrhunderte bleiben. Dass er jetzt dieses vorzeitige Ende findet, ist nicht fair. Vor allem seine Untertanen haben das nicht verdient. Vorhin hatte er eine Rede gehalten. Er sprach ganz offen zu ihnen. Das war das Einzige, was er noch für sie tun konnte. Sie sollten Frieden finden und die letzten Stunden mit ihren Familien verbringen.
Auch Jeldrik beschließt seinem Rat zu folgen. Mit letzter Kraft rappelt er sich auf, um per Hologramm seine Brüder zu kontaktieren. Er will die letzten Augenblicke zusammen mit ihnen verbringen, bevor ihr aller Ende gekommen ist.
Kapitel 1
Piper
»Erzählen Sie mir etwas über sich.«
Nervös knete ich meine Hände unter dem Tisch.
Egal, wie viele Vorstellungsgespräche ich bereits hatte, es fühlt sich immer noch an, als wäre es das erste.
Und heute ist es sogar noch schlimmer, weil ich diesen Job mehr will als alles andere auf der Welt.
Mein Herz schlägt so heftig, dass ich befürchte, dass es mir gleich aus der Brust springt.
Ich richte meinen Blick auf meine Gesprächspartnerin, die mir hinter ihrem vollgepackten Schreibtisch offen entgegensieht.
»Äh, es steht doch alles in meinem Lebenslauf.«
Okay, diese Antwort war nicht gut, das sehe ich an ihrem Gesichtsausdruck.
Ihre bis eben noch glatte Stirn runzelt sich, aber Abigail Smith nimmt sich meine Bewerbungsunterlagen zur Hand und blättert durch die einzelnen Seiten.
»Miss Davies, Sie hatten schon viele Aushilfsjobs.«
»Ja.«
»Hat es einen bestimmten Grund, weshalb Sie so oft umgezogen sind?«
»Nein.«
»Und Sie haben überhaupt keine Erfahrung als Rednerin in einem Planetarium?«
»Richtig.«
Verdammt, ich muss endlich anfangen, mehr zu sagen. Ich bin schließlich bei einem Vorstellungsgespräch! Und wie soll sich die Chefin ein Bild von mir machen, wenn ich weiter so wortkarg bin?
»Wieso wollen Sie in meinem Planetarium arbeiten?«
Gute Frage.
Ich könnte ihr jetzt erzählen, dass ich, seit ich denken kann, von den Sternen fasziniert bin und bereits im Kindesalter begonnen habe, alle nennenswerten Bücher über unser Sonnensystem zu lesen. Aber stattdessen zucke ich nur mit den Schultern. Dabei hatte ich mir zuvor genau überlegt, was ich sagen werde. Doch gerade bin ich wie gelähmt und kein Laut kommt über meine Lippen.
»Alles klar, ich denke, ich habe genug gehört«, bestimmt sie. »Es tut mir leid, aber Sie kommen für diesen Job nicht infrage.«
Ich muss hart schlucken.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft.«
Die Enttäuschung über ihre Entscheidung ist mir bestimmt ins Gesicht geschrieben, aber ich versuche mich trotzdem an einem halbherzigen Lächeln.
»Danke«, erwidere ich, stehe auf und verlasse ihr Büro.
Leise fällt die Tür ins Schloss und es kommt mir so vor, als hätte ich gerade die Chance auf etwas ganz Großes verpasst. Meine Brust fühlt sich wie zugeschnürt an. Ich muss hier dringend raus. Ich schaue nach links, dann nach rechts. Versuche mich zu erinnern, woher ich gekommen bin. In dem ausladenden Flur sieht alles identisch aus. In einem Abstand von vielleicht einem halben Meter stehen abwechselnd Dracena Massangeana, Areca Palmen und Yucca-Palmen. Allerdings steht die Dracena Massangeana, kurz Drachenbaum genannt, hier an der völlig falschen Stelle. Diese Pflanzen brauchen einen hellen Platz. In Michigan habe ich in einer Gärtnerei gearbeitet und viel über die Flora und Fauna lernen dürfen. Ich war für die Bewässerung zuständig. Ein richtiger Knochenjob. Ich weiß noch, wie ich nach der Arbeit einfach ins Bett geplumpst und schnell weggeschlummert bin.
Leicht streiche ich mit den Fingern über ein Blatt des Drachenbaums. Die Oberfläche ist glatt und diese Mischung aus Dunkelgrün von außen und hellgrün in der Mitte erinnert mich an ein Stück geschälter Gurke. Diese Pflanze ist echt cool. Ja, okay, für kleine Tiere ist sie giftig. Aber die Aussicht, dass sich Hunde, Katzen oder andere Vierbeiner ins Planetarium verirren, ist doch sehr gering. Ansonsten ist sie wirklich besonders. Zum Beispiel filtert sie schädliche Umweltstoffe aus der Luft, fördert das Raumklima und produziert Sauerstoff. Eine sehr interessante Eigenschaft, die mir aber in diesem Moment nicht weiterhilft.
Ich versuche mich irgendwie zu orientieren, aber keine Chance. Dieser Flur gibt nicht mehr preis. Die Wände sind weiß gehalten. Keine Bilder oder irgendwelche Dekorelemente. Was vielleicht auch besser ist. Der Boden ist dafür umso farbenfroher. Ich betrachte den kunterbunten Teppich. Er ist wie ein großes abstraktes Gemälde. Als hätte der Künstler alle Farben, die er zur Verfügung hatte, wild ausgeschüttet und dann alles mit einem Rechen vertikal, diagonal und horizontal verteilt. Was auf mich irgendwie einen beruhigenden Effekt hat. Die Luft strömt wieder vollständig durch meine Lungen. Allerdings bin ich dem Ausgang dadurch auch nicht nähergekommen.
Ich könnte zurück in Abigail Smiths Büro gehen und mir den Weg erklären lassen, aber nach meiner Blamage möchte ich ihr lieber nicht erneut unter die Augen treten. Ich sehe mich noch einmal um, bevor ich mich für eine Richtung entscheide. Und selbst wenn es der falsche Weg ist, macht das nichts. Zumindest kann ich dann noch etwas länger in diesem fantastischen Planetarium bleiben.
Egal, wo ich bisher war, wenn ich durch meine Jobs Geld übrig hatte, was leider selten der Fall war, besuchte ich das Planetarium. Ich hörte mir Vorträge an und schlenderte durch die Hallen. Es war interessant und höchst informativ, aber etwas störte mich. Ich konnte es bisher nicht benennen, aber jetzt verstehe ich es. Obwohl alle mit den modernsten Techniken ausgestattet waren, schien alles so kalt und eintönig. Etwas, das es hier nicht gibt. Das war mir schon aufgefallen, kaum dass ich das Planetarium betreten habe. Die Atmosphäre hier lädt zum Verweilen ein. Ein Gefühl, als wäre dies der Ort, an dem du sein solltest. Der dich von der Außenwelt abholt und in eine Welt entführt, die sehr real ist, dich aber aus deinem Alltag wegzieht.
Ich gehe eine Wendeltreppe nach unten und betrete einen weiteren Flur. Wie gerne hätte ich hier gearbeitet und mein Wissen über unser Sonnensystem geteilt. In meiner Vorstellung sah ich bereits alles vor mir. Wie ich durch meine Erzählungen die Zuhörer in den Bann ziehe und sie hinterher den Sternenhimmel mit der gleichen Faszination betrachten würden, wie ich es jeden Abend tue. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding. Ich zwinge mich in Bewegung zu bleiben, aber weit komme ich nicht. Das Gefühl, auf der Stelle zusammenzubrechen, wird unerträglich stark. Nicht weit entfernt entdecke ich eine kleine Nische und steuere zielstrebig darauf zu. Auf der schmalen, weißen Bank lasse ich mich fallen. Dieser Platz ist so verwinkelt, dass man mich hier gar nicht sehen wird, wenn ich mich ganz ruhig verhalte.
Ich ziehe die Luft durch die Nase ein und lasse sie aus meinem Mund wieder entweichen. Einatmen, ausatmen.
Nach meiner überstürzten Abreise aus San Antonio hatte ich in einem Onlinecafé die Jobangebote in der Nähe durchforstet. Mein Geld ist knapp, weswegen ich keine großen Sprünge machen kann. Schließlich will mein Auto getankt werden und ich muss mit meinen wenigen Ersparnissen auch haushalten. Es war für mich wie ein Wink des Schicksals, als ich die Annonce von Abigail Smith fand, und Austin liegt auch nur etwas über eine Stunde von San Antonio entfernt. Doch das Gespräch mit der Besitzerin des Planetariums lief ja mal so was von beschissen. Das kommt alles durch meine blöde Nervosität. Je heftiger mein Herz pocht, umso verschlossener werde ich.
Mir ist die Ironie der Sache durchaus bewusst.
Wie konnte ich auch nur eine Sekunde annehmen, als Rednerin vor wildfremden Menschen stehen zu können?
Auch wenn das Universum mit seinen unzähligen Wundern meine Leidenschaft, mein Leben ist, schaffe ich es ja noch nicht einmal, vor nur einer Person zu sprechen.
Gelächter dringt an mein Ohr. Eine Gruppe von Kindern bleibt vor den Miniaturnachbildungen der Planeten stehen, die sich nicht weit von meinem Zufluchtsort befinden.
»Mister Reid, Mister Reid. Sehen Sie nur. Das ist Neptun«, höre ich eine fröhliche Kinderstimme sagen.
Neugierig sehe ich zu der Abbildung, auf die der Junge zeigt.
»Ben, wir hatten das Thema Planeten doch erst kürzlich im Unterricht. Das ist Uranus«, erwidert eine Männerstimme, die alles andere als freundlich klingt.
Ich runzle die Stirn.
»Mister Reid, das ist ganz klar Neptun.«
Gut so, Kleiner. Lass dir nichts erzählen.
»Ich werde mit dir jetzt nicht darüber diskutieren. Das ist Uranus. Punkt aus.«
Automatisch spannt sich mein Kiefer an. Der Junge hat doch vollkommen recht.
»Hier seht ihr einen kleinen Splitter von einem Asteroiden.«
Der monotone Klang seiner Stimme nervt mich. Sollte man als Lehrer nicht über mehr Ausdruckskraft verfügen? Ich hätte überhaupt keine Lust mehr, ihm zuzuhören.
»Was ist ein Asteroid?«
»Das sind Kleinplaneten, die ihren Namen daher haben, dass sie sich wie Planeten relativ zu den Sternen bewegen. Das ist aber auch schon das Einzige, was Asteroiden ausmacht.«
Bitte was?
»Sie werden auch als Schmutz des Weltalls bezeichnet. Das ist Abfall.«
»Boah, jetzt reicht es aber«, entfährt es mir.
Das habe ich wohl etwas zu laut gesagt, denn acht kleine Augenpaare sehen zu mir hinüber.
Mist. Dieser Platz ist doch nicht so versteckt, wie ich angenommen habe.
»Haben Sie irgendetwas an meiner Ausführung auszusetzen?«
Meine Wangen fühlen sich deutlich wärmer an als zuvor. Betreten sehe ich zu Boden und schüttle den Kopf.
»Das habe ich mir doch gleich gedacht. Also Kinder, merkt euch das fürs Leben. Wenn ihr nichts Produktives zu sagen habt, dann haltet besser euren Mund.«
Ruckartig hebe ich meinen Kopf. Mein Zorn überschattet meine Schüchternheit. Ich stehe auf und gehe entschlossen auf ihn zu. »Was sind Sie denn überhaupt für ein Lehrer? Wenn hier noch jemand etwas lernen muss, dann ja wohl Sie.«
»Was bilden Sie sich ein?« Er betrachtet mich herausfordernd und mustert mich von Kopf bis Fuß.
Aber anstatt ihm zu antworten, gehe ich vor dem kleinen Ben in die Hocke und grinse ihn an.
»Es war vollkommen richtig, was du gesagt hast.« Ich zeige auf die Nachbildungen der Planeten. »Auch wenn Uranus ähnlich aussieht, betrachtet man die großen dunklen Flecken auf seiner Oberfläche, so kann man ihn eindeutig als Neptun identifizieren. Das hast du völlig richtig erkannt.«
Ben grinst mich ebenfalls an, bevor er seinen Lehrer anschaut. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Er braucht die Worte gar nicht auszusprechen: Ich habe es doch gesagt.
»Und ein Asteroid ist auch nicht der Schmutz des Weltalls«, erkläre ich weiter und sehe dabei in die interessierten Gesichter der Kinder. »Wörtlich übersetzt bedeutet er sternartig. Ein Asteroid ist so klein, dass er wie der Lichtpunkt eines Sterns aussieht, wenn man ihn durch ein Teleskop beobachtet.«
»Was unterstehen Sie sich? Ich werde mich bei Ihrer Chefin über Sie beschweren!«
Meine Mundwinkel bewegen sich leicht nach oben und ich will ihn gerade darüber aufklären, dass ich gar nicht hier arbeite, als ich eine Stimme hinter mir höre.
»Das brauchen Sie nicht. Ich habe bereits alles mitbekommen.«
Ich zucke zusammen.
Kann dieser Tag noch mehr aus dem Ruder laufen?
»Miss Davies. In mein Büro, sofort.«
Die Kinder werfen mir einen mitfühlenden Blick zu. Sie scheinen zu spüren, dass ich jetzt gewaltigen Ärger bekommen werde.
»Ach, und Mister Reid«, fährt sie in einem zuckersüßen Ton fort, »Sie und ihre Schülerinnen und Schüler sind herzlich zur nächsten Show eingeladen. Dort erfahren Sie alles über Planeten und welche spezifischen Unterschiede sie haben.«
Nach diesen Worten dreht sie sich um und marschiert davon. Ich folge ihr mit einem unguten Gefühl im Bauch.
***
»In Zukunft müssen Sie diplomatischer vorgehen, Miss Davies. Sie dürfen nicht so offensichtlich zeigen, dass diese Leute im Grunde keine Ahnung haben«, beginnt Abigail Smith, kaum dass ich mich hingesetzt habe.
»Es tut mir leid.«
Mit dem Zeigefinger schiebt sie ihre Brille weiter nach oben auf ihre Nase. Die kleinen schwarzen und weißen Perlen an der Kette, die mit dem Gestell verbunden ist, geraten dabei in Bewegung. Ihr Gesichtsausdruck verrät mir jedoch nichts.
»Ich muss gestehen, Sie haben mich überrascht.«
Ich runzle die Stirn.
»Vorhin dachte ich noch, Sie wären für die Arbeit in meinem Planetarium völlig ungeeignet.«
Mir fällt nichts ein, was ich darauf erwidern könnte.
»Als Rednerin kommt es darauf an, frei heraus vor wildfremden Menschen zu sprechen. Sie in den Bann zu ziehen und ihnen die Komplexität des Universums näher zu bringen.« Abigail Smith holt tief Luft. »Ehrlich gesagt, konnte ich mir nicht vorstellen, dass Sie das hinbekommen. Aber Sie haben mich positiv überrascht. Die Kinder hingen förmlich an Ihren Lippen. Das haben Sie gut gemacht. Sie haben nicht von oben herab gesprochen, sondern waren mit ihnen auf Augenhöhe.«
Dieses Kompliment zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht.
»Hören Sie, Piper. Ich werde Ihnen eine Chance geben.«
»Sie wollen … was?«
»Auch wenn Sie es mir nicht einfach gemacht haben, sehe ich in Ihnen Potenzial. Sie müssen nur lernen, aus sich heraus zu kommen.«
Wenn das nur so einfach wäre.
»Eine Chance. Vermasseln Sie es, sind Sie gefeuert.«
Ich nicke wild. »Danke!«
Kapitel 2
Als ich erneut das Büro von Abigail Smith verlasse, fühle ich mich, als wäre ich gerade aus einem sehr lebhaften Traum aufgewacht. Meine Beine zittern. Ab nächster Woche werde ich über meine einzige und wahrhaftige Leidenschaft referieren dürfen: das Universum. Das ist fantastisch!
Kaum wird mir das so richtig bewusst, pulsiert Adrenalin durch meinen Körper und ich könnte vor Freude wild umhertanzen.
Rasch sehe ich mich um, aber weit und breit ist keine weitere Menschenseele zu sehen. Ich greife nach dem Gurt meiner Tasche und stelle sie mit den eingerollten Unterlagen meiner Chefin an der Wand ab. Fix werfe ich noch einen allerletzten Blick durch den Flur. Erst dann strecke ich meine Arme weit aus und drehe mich schnell im Kreis.
Als Kind habe ich das geliebt. Ich war dann wie in meiner eigenen Welt, wo nichts und niemand mir etwas anhaben konnte.
Ich spüre bereits dieses vertraute Kribbeln, das durch meinen ganzen Körper fährt. Die Welt um mich herum verschwimmt und ich stoße beinahe mit einer der Topfpflanzen zusammen. Ich stütze mich an der Wand ab. Es dreht sich alles und mir ist etwas übel. Wann werde ich auch endlich schlau? Ich bin schließlich kein kleines Kind mehr, sondern 21 Jahre alt.
Hoffentlich kommt jetzt nicht Abigail Smith aus ihrem Büro. Wie ich ihr dieses Szenario erklären soll, weiß ich beim besten Willen nicht.
Ich atme mehrere Male tief durch und scheine wirklich Glück zu haben. Der Schwindel lässt nach, sodass ich zumindest geradeaus gehen kann, und niemand hat etwas von meiner kleinen Aktion mitbekommen.
Die bestimmt vierte Yucca-Palme kreuzt meinen Weg, als ich plötzlich denke, etwas verloren zu haben. Meine Hand greift nach meiner Tasche. Nicht dass ich die Unterlagen verloren habe, die ich für das Referieren benötige. Doch meine Finger landen auf meiner Hüfte. Verflixt. Schnellen Schrittes gehe ich wieder zurück und finde meine Handtasche unbeaufsichtigt vor. Fix sammle ich sie noch auf.
Jetzt, wo ich den richtigen Weg kenne, finde ich mich schnell in der großen Halle wieder. Von außen würde man gar nicht denken, dass das Planetarium zwei Stockwerke hat. Im oberen sind die Büroräume inklusive Pausenraum für das Personal. Und hier im Erdgeschoss findet die Magie statt. Das Verzaubern der Besucher. Ich muss wieder grinsen und mein Herz schlägt deutlich kräftiger. Ich bin überglücklich, nun ein Teil von alldem zu sein.
Ohne Eile betrachte ich die Fotos an den Wänden der Halle. Ich sehe Merkur, daneben den Mars, und Pluto mit seinen Ringen. So muss sich ein Kind in einem Süßigkeitenladen fühlen. Mit den Fingern streiche ich über das Kunststoffgehäuse eines der vielen Teleskope. Bereits bei meiner Ankunft im Planetarium zogen sie mich magisch an. Erneut sehe ich hindurch. Was mit der modernen Technik alles möglich ist, fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Als würde ich tatsächlich den Sternenhimmel betrachten. In diesen Hallen gibt es so viel zu entdecken, dass ich mich schon darauf freue, das Planetarium bis zur hintersten Ecke zu erforschen.
***
Wie auf Wolken schwebe ich aus dem Gebäude. Kaum schließt sich hinter mir die Tür, umweht mich eine warme Brise. Es ist ein sonniger Tag in Austin und ich muss sofort meine Jacke ausziehen. Das Planetarium ist von innen gut klimatisiert. Hier draußen komme ich mir vor, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Normalerweise schwitze ich nicht so leicht, aber jetzt rinnt Schweiß über meinen Rücken. Schnell überquere ich die Straße zum gegenüberliegenden Parkplatz. Ein süßlicher Duft liegt in der Luft. Die Pflanzenwelt steht noch in ihrer ganzen Pracht und ich genieße diesen Augenblick, denn nicht mehr lange und das schmuddelige Herbstwetter wird Einzug halten.
Ich hole den Schlüssel aus meiner Tasche und lasse mich in den Sitz meines Fieros fallen. Hier habe ich einen perfekten Blick auf das Planetarium. Von außen ist es eher unscheinbar, mit seinen weißen Backsteinen, dem schwarzen Dach und seinen Bogenfenstern ganz oben. Man würde nicht vermuten, welche Schätze sich hinter diesen Mauern befinden. Auch ich wäre vorhin beinahe daran vorbeigelaufen. Nur das kleine Logo neben der Eingangstür verriet mir, dass ich richtig bin. Smith Planetarium.
»Oh je.«
Plötzlich ist meine gute Laune wie weggefegt. Das Adrenalin ist verschwunden. In nicht einmal einer Woche werde ich hinter diesen Mauern als Rednerin arbeiten. Dieser Job ist gewaltiger als alles, was ich bisher gemacht habe, das macht mir schon etwas Angst. Auf der einen Seite habe ich wirklich Bammel davor, vor wildfremden Menschen zu stehen, andererseits gefällt mir die Vorstellung, tagtäglich über unser Universum zu sprechen. Ich möchte unbedingt etwas bewegen. Zeigen, dass unser Leben alles andere als selbstverständlich ist. Die Menschen hetzen im Tunnelblick an mir vorbei, ohne sich ihre Umgebung anzusehen, ohne einen Moment innezuhalten und sich der Wunder um sie herum bewusst zu werden. Sie wissen gar nicht, dass wir alle nicht existieren würden, wenn das Universum nicht so aufgebaut wäre, wie es ist. Nehmen wir nur einmal die Elektronen. Wenn sie nur ein klein wenig anders geladen wären, könnten zum Beispiel keine Wasserstoffatome verbrannt werden, was zur Folge hätte, dass keine Temperatur, die wir zum Leben benötigen, hergestellt werden könnte. Es gibt so viel Interessantes über unser Sonnensystem zu berichten.
Seit ich denken kann, bin ich von den Sternen und den Galaxien gefesselt. Woher meine Faszination kommt, weiß ich nicht, es ist einfach so. Für mich gibt es nichts Bedeutenderes. Und dann erst dieser majestätische Mond. Es vergeht kein Abend, an dem ich nicht meinen Blick in den Nachthimmel richte und ganz automatisch nach ihm Ausschau halte. Habe ich ihn dann entdeckt, grinse ich unweigerlich. Ich kann es nicht erklären, warum mich der Mond so sehr fasziniert. Es ist einfach so.
Eine Frau kommt mit einem jungen Mädchen an meinem Auto vorbei. Sie sehen sich sehr ähnlich. Bestimmt sind es Mutter und Tochter. Die Mutter sagt etwas, was ich nicht verstehen kann. In der nächsten Sekunde lacht das Mädchen.
Unvermittelt wandern meine Gedanken zurück an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin.
Bis ich 18 wurde, lebte ich in einem Waisenhaus. Ich weiß weder, woher ich eigentlich komme, noch wer meine Eltern sind.
Als Kind habe ich mich oft gefragt, ob ich ihnen ähnlich bin und was ich Schreckliches angestellt habe, dass sie mich wie ein Tier einfach am Straßenrand ausgesetzt hatten. Aber je älter ich wurde, desto weniger interessierte es mich. Zumindest stimmt das für die meiste Zeit in meinem Leben. Auch wenn ich es mir anders wünsche, gibt es immer noch Augenblicke, in denen ich gerne eine Antwort auf meine Fragen hätte. In ihre Gesichter blicken will, um ihnen all meinen Zorn, die Wut und die Enttäuschung über ihren Verrat entgegenzuschleudern. Ich schüttle den Kopf. Nein! Das würde für sie nichts bedeuten. Wer keine Skrupel hat, ein kleines Baby seinem Schicksal zu überlassen, würde auf die Worte einer erwachsenen Frau erst recht nichts geben. Ich muss einen Weg finden, damit meinen Frieden zu schließen, sonst wird es mich bis an das Ende meines Lebens verfolgen. Dabei sollte ich doch stolz darauf sein, was ich bisher alles geschafft habe. Und jetzt Referentin dieses Planetariums zu sein, ist für mich das Größte. Also werde ich es schon irgendwie hinbekommen, meine blöde Schüchternheit zu überwinden. Abigail Smith glaubt an mich und das gibt mir einen zusätzlichen Ansporn, nicht gleich aufzugeben und es zu versuchen.
Motiviert starte ich den Fiero und fahre zu meiner neuen Unterkunft auf Zeit. Ich gebe mich da überhaupt keiner Illusion hin, denn ich werde nicht länger als ein paar Monate hierbleiben.
Seit das Waisenhaus nicht mehr über mich bestimmen kann, hält es mich nicht lange an einem Fleck. Nach kurzer Zeit in einer Stadt habe ich das Gefühl, bald zu ersticken. Ein eindeutiges Zeichen, dass ich weiterziehen muss. Ich habe mich daran gewöhnt und schätze die tollen Orte, die ich dadurch zu Gesicht bekomme. Auch, wenn es mitunter ganz schön einsam sein kann.
Ich schüttle diese unliebsamen Gedanken ab. Jetzt reicht es aber mit dem Selbstmitleid.
An einer Ampel wühle ich in meiner Handtasche und fische ein zusammengefaltetes Papier heraus. Es ist ein Ausdruck einer Straßenkarte. Eine dicke blaue Linie zeigt mir den Weg. Abigail Smith hat es mir ausgedruckt. Sie ist wirklich eine sehr nette Frau. Nachdem sie mir den Job angeboten hatte, kam auch langsam meine Stimme wieder zurück und ich fragte sie, ob sie zufällig wüsste,wo man eine günstige Wohnung finden kann. Zur Not hätte ich auch in meinem Fiero geschlafen, das wäre schließlich nicht das erste Mal. Aber sie klemmte sich sofort hinters Telefon. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich sollte Abigail Smith für ihre Hilfsbereitschaft ein paar Blumen mitbringen.
Ich studiere die Karte und die Wegbeschreibung, bevor die Ampel auf Grün springt.
Mit einigen Zwischenstopps schaffe ich die Strecke in einer Viertelstunde. Ich schalte den Motor aus. Dieser riesige Wohnkomplex sieht gar nicht so übel aus.
Zumindest macht er einen besseren Eindruck als die letzten Unterkünfte, in denen ich zwangsläufig wohnen musste. Wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat, darf man nicht wählerisch sein.
Auf einer großen Grünfläche spielen einige Kinder. Sie lachen ausgelassen und ich habe sofort ein gutes Gefühl. Wie auch zuvor im Planetarium.
Mein Blick geht wieder zurück zum Gebäude und ich sehe hinauf. Die kleinen Balkone regen meine Fantasie an. Ich sehe mich bereits dort stehen und den Nachthimmel betrachten. Auch wenn ich mir auf meinen Reisen nicht immer einen Schlafplatz leisten konnte, der Blick zum Nachthimmel nahm mir keiner.
Manchmal habe ich den Eindruck, als würde der Mond ganz allein für mich so hell leuchten. Sein Schein umhüllt mich wie ein warmer Mantel und ich fühle mich nicht mehr einsam. Manche Menschen würden das für schwachsinnig halten, aber mir hat die Anwesenheit des Mondes schon über so manche dunklen Gedanken hinweggeholfen.
Entschlossen steige ich aus dem Auto und folge dem gepflasterten Weg zum Eingang. Ein Ball landet plötzlich vor meinen Schuhen. Überrascht sehe ich auf, aber ein Mädchen kommt bereits auf mich zugelaufen. Ihre Zöpfe wippen bei jedem Schritt. Ich grinse die Kleine an, während ich ihr den Ball zuschieße. Ohne mich weiter zu beachten, nimmt sie ihn und rennt zurück zu ihren Freunden. Belustigt schüttle ich den Kopf und betrete das Haus.
»Hallo, Sie müssen Miss Davies sein.«
»Und Sie sind Mister Williams.«
Vor der Treppe erwartet mich ein älterer Herr und lächelt mich an. Wir geben uns die Hand. Sein Blick zeugt von Erfahrung. Um seinen Mund, die Augen und die Wangen ziehen sich feine Fältchen. Seine buschigen grauen Brauen heben sich leicht bei meinem Anblick. Sein weißes Hemd steckt im Bund einer beigen Cordhose. Er sieht aus wie ein freundlicher Opa aus der Werbung.
Ich folge Mister Williams in die fünfte Etage. Es geht steil nach oben und er muss immer wieder kurze Verschnaufpausen einlegen. Ich frage mich, warum er keinen Assistenten hat. So ein großes Gebäude macht bestimmt sehr viel Arbeit.
Als wir endlich das Ende der Treppe erreichen, werde ich schon etwas aufgeregt. Obwohl ich es mir nicht gerade aussuchen kann, wo und vor allem wie ich wohne, hoffe ich, dass ich mich hier halbwegs heimisch fühlen werde.
In der Luft liegt eine Mischung aus Waschpulver, Essen und einem Geruch, den ich nicht zuordnen kann. Am Ende des Gangs bleibt Mister Williams stehen und holt den Schlüssel aus seiner Brusttasche. Seine Bewegung ist etwas zittrig, als er versucht, ihn ins Schloss zu stecken. Ich unterdrücke das Bedürfnis, ihm den Schlüssel aus der Hand zu nehmen.
Innerlich atme ich erleichtert aus, als er es endlich geschafft hat. Freundlich sieht mich Mister Williams an, bevor er die Tür öffnet. Ich betrete nach ihm die Wohnung und finde mich sogleich in einem großzügigen Flur wieder. Auf einem Sideboard steht eine kleine Glasschale. Als wäre es das Normalste der Welt, legt Mister Williams den Schlüssel dort hinein. Die Wände sind in einem zarten Mintgrün gehalten und über unseren Köpfen hängt eine längliche Lampe, die jeden Winkel des Flurs erhellt. Es riecht leicht muffig, aber nach einem ordentlichen Lüften wird der Geruch bestimmt verschwinden. Mister Williams zeigt mir jeden Raum und erläutert mir, dass er die Wohnung höchstens für ein Jahr untervermietet, denn dann würde die rechtmäßige Besitzerin zurückkommen.
Mir kommt sofort dieser eine Film in den Sinn.
»Solange Reese Witherspoon nicht plötzlich als Geist hier auftaucht, kann ich schon damit leben.«
Diese Worte sind schneller heraus, als ich genauer darüber nachdenken kann. Natürlich versteht Mister Williams nicht, worauf ich damit anspiele, und erklärt mir stattdessen, dass dies die Wohnung seiner Enkelin sei, die für ein Jahr im Ausland studiert, aber danach zurück nach Austin kommt.
»Ich muss Rechnungen bezahlen und kann es mir nicht leisten, die Wohnung für ein Jahr leerstehen zu lassen.«
Das spielt mir natürlich in die Karten. Bisher habe ich es nie länger an einem Ort ausgehalten. Auch wenn ich nun meinen Traumjob habe, bezweifle ich, dass meine Reise hier enden wird. Über kurz oder lang werde ich weiterziehen. Ich habe mich daran gewöhnt, obwohl ich mich doch ab und an frage, ob es nicht irgendwo einen Platz gibt, wo ich mich endgültig niederlassen werde. Zwar bin ich erst 21, mache mir aber mittlerweile doch über meine Zukunft Gedanken. Werde ich je heiraten und Kinder bekommen? Oder bleibe ich für immer alleine?
***
Nachdem wir uns über die Miete geeinigt haben, geht Mister Williams. Noch einen Moment lasse ich die Wohnung auf mich wirken, bevor auch ich mich in Bewegung setze. Ich spaziere die Treppe hinunter und verlasse den Wohnkomplex. Den Sandsack, der sich in meinem Fiero befindet, schultere ich, bevor der große Karton an der Reihe ist. Behutsam hebe ich ihn heraus. Er beinhaltet meinen wichtigsten Schatz: meine Bücher. Das Universum in der Nussschale oder Mensch und Universum: Unser Platz in Raum und Zeit sind nur einige davon. Ich entdeckte sie und noch so viele mehr auf Flohmärkten. Zu meiner großen Überraschung kosteten sie nur den Bruchteil des Normalpreises.
Dort fand ich auch Der geheime Schlüssel zum Universum. Obwohl ich damit eine schöne und gleichzeitig traurige Erinnerung verbinde, musste ich es einfach haben.
Es war das erste Buch, das mir Mimi vorgelesen hat.
Kapitel 3
Duncan
(zur gleichen Zeit auf dem Mond der Menschenwelt)
»Ich möchte aber nicht.«
In meinem gepolsterten Sitz lehne ich mich zurück. Dieses Thema läuft in letzter Zeit in Endlosschleife und ich kann es nicht mehr hören. Ich verschränke die Hände locker auf meinen Bauch. Meine Arme ruhen dabei auf den verschnörkelten Armlehnen aus Holz. Der Stuhl war ein Geschenk von Dad. Das Material stammt vom Arbor Versatile, einer Baumart, die es hier auf dem Mond zuhauf gibt. Das Holz ist sehr robust und gleichzeitig so leicht, dass jedes Kleinkind einen ganzen Stamm hochheben könnte. Seine großen, ovalen Blätter sind mit ihrer saftigen grünen Farbe eine Delikatesse und zugleich ein schnell nachwachsender Rohstoff. Egal ob man den kompletten Baum fällt oder nur seine Blätter abpflückt: Innerhalb weniger Tage ist alles wieder nachgewachsen. Ich wackle ein bisschen mit dem Hintern. Trotz seines stolzen Alters ist dieser Stuhl sehr bequem und hat auch sonst keine Alterserscheinungen. Ursprünglich gehörte er meinem Dad. Er bekam ihn von seinem Dad und dieser von seinem und so weiter. Es ist seit ewigen Zeiten ein Symbol dafür, dass die Verantwortung des Königs bald auf den Nächsten übergeht. Dad überreichte ihn mir letztes Jahr.
»Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?«
Ich zucke leicht zusammen, als ich Harrisons Stimme höre. Da habe ich es doch komplett geschafft, ihn auszublenden. Das zeigt nur einmal mehr, wie leid ich dieses Thema bin.
Harrison steht direkt vor meinem Schreibtisch. Er ist bereits mehrere Jahrhunderte alt, genau wie Dad. Wären wir auf der Erde, würde man ihn trotzdem nur für Ende 50 halten. Seine kleine schlaksige Statur steht im Gegensatz zu seinem energischen Auftreten.
»Ich habe dich gerade gefragt, was dagegen spricht.«
Und schon geht es wieder los.
Meinen Unmut versuche ich gar nicht erst zu unterdrücken.
»Ich verstehe diesen ganzen Unsinn nicht. Was soll das bringen, zur Menschenwelt zu reisen?«
Mit meiner Antwort sichtlich unzufrieden, schüttelt er den Kopf. Seine grauen Augen wenden nicht eine Sekunde ihren Blick von mir ab. Meine Mundwinkel wandern leicht nach oben. Harrison ist Dads Diener. Zumindest wurde er weit vor meiner Geburt deswegen eingestellt. Aber über die Jahrhunderte hinweg ist er mehr ein Vertrauter für meinen Vater geworden. Deswegen kann ich es ihm nicht übelnehmen, dass er sich gerade so wenig respektvoll mir gegenüber zeigt. Ich kenne ihn gar nicht anders. Seine Worte kommen immer völlig ungefiltert aus seinem Mund.
»Muss ich dir nun wirklich eine Lehrstunde in deinen Pflichten geben?« Herausfordernd reckt Harrison das Kinn.
Ich verziehe das Gesicht und spüre das dringende Bedürfnis, mich zu bewegen. »Nein, das musst du nicht.«
Ich gehe hinüber zur anderen Seite des Raums, der ganz aus Glas besteht. Hier verbringe ich am liebsten meine Zeit. Licht durchflutet das Zimmer und wärmt meine Haut auf eine Weise, wie es kein Kleidungsstück vermag. Draußen sehe ich Kinder, die sich gegenseitig fangen und vergnügt lachen. Tief atme ich durch. Gerne würde ich mit ihnen tauschen und mit dieser Unbeschwertheit durchs Leben gehen. Aber das ist mir nicht vergönnt. Nur noch wenige Jahre und ich werde der neue Mondkönig der Menschenwelt sein. Eine unausweichliche Tatsache, die ich zutiefst verabscheue. Ich möchte überhaupt kein König sein. Diese Verantwortung, die dann auf meinen Schultern lastet, schnürt mir jetzt schon die Kehle zu.
»Warum siehst du es nicht als eine Art … Urlaub an?«
Diesen Tonfall kenne ich. Den hat Harrison früher schon immer benutzt, wenn er mich davon überzeugen wollte, dass etwas doch gar nicht so schlimm sei, wie ich denke. Wie das eine Mal, als er mir sagte, ich könnte ruhig Barabas, sein Haustier, berühren. Er würde mir schon nichts tun. Ich vertraute ihm und wurde zum Dank in die Hand gebissen. Daher zieht sein Schachzug nicht.
»Es ist wichtig, dass dir die Tragweite deiner Verantwortung bewusst wird«, wiederholt Harrison.
Pah, als ob mir das nicht schon längst klar wäre.
Aus diesem Grund sehe ich es auch nicht ein, zur Erde zu reisen.
»Duncan, ich denke, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, die menschliche Spezies zu erforschen«, mischt sich jetzt noch Gideon ein.
Ich drehe mich um. Mein Kumpel sitzt in einem Sessel. Ein Bein liegt locker auf seinem Oberschenkel. Aus eisblauen Augen sieht er mich an.
Dass er mir jetzt in den Rücken fällt, obwohl er meine Meinung dazu kennt, nervt mich.
»Dann geh du doch. Auf deinen Bericht bin ich schon sehr gespannt.«
Blitzschnell versteift sich seine Haltung und ich bereue meine Worte. Es ist nur den zukünftigen Mondkönigen der Menschenwelt gestattet, diese Reise zu machen. Wie ich Gideon kenne, würde er keinen Moment zögern, dieses Abenteuer zu starten. Aber mich interessiert diese Menschenwelt einfach nicht.
***
Es ist bereits tiefste Nacht, aber ich finde keine Ruhe. Ich streife durch die verwaisten Hallen. Die einzigen Geräusche sind meine Schritte und mein pochendes Herz. Obwohl mir bereits als kleiner Junge eingehämmert wurde, dass ich irgendwann der König sein werde, konnte ich diese unausweichliche Tatsache im letzten Jahrhundert gut verdrängen. Aber seit Harrison tagtäglich von dieser Reise zur Menschenwelt spricht, fühle ich mich ruhelos. Als würde ich in meinem Innersten einen Kampf austragen, ohne absehbares Ende. Der Gedanke, meinen Dad bald als König abzulösen, verursacht mir Magenschmerzen. Die Verantwortung für ein Volk zu übernehmen und für seine Sicherheit zu sorgen – ich weiß nicht, ob ich das kann. Wie würde ich wohl reagieren, wäre ich irgendwann einmal in der Situation wie mein Ururururgroßvater Jeldrik. Ich stelle mir vor, wie er sich gefühlt haben muss, als er vor der größten Prüfung seines Lebens stand. Es muss furchtbar gewesen sein, zu wissen, dass das Ende unmittelbar bevorsteht und man nichts dagegen machen kann. Und dann die Rettung in letzter Sekunde. Gerade als mein Ururururgroßvater mit seinen Brüdern per Hologramm Kontakt aufnehmen wollte, meldete sich sein jüngerer Bruder Kian. Er hatte das Notizbuch des legendären Elrik, des allerersten Mondkönigs, gefunden. Diese Entdeckung brachte die Lösung und die Heilung aller Monde.
Ohne es zu bemerken, bin ich im Thronsaal angekommen. Ich sehe hinüber zur hohen Glasvitrine. Auf einer fächerförmigen Stütze liegt ein großes in Leder gebundenes Buch. Es beinhaltet alle Weisheiten unserer Geschichte. Man lernte aus der Katastrophe. Hätte man damals nicht das Notizbuch gefunden, würde es heute keine Monde mehr geben. Und auch keine Erde. Denn was auf der Menschenwelt keiner weiß, ist, dass die Erde durch einen Teil des Mondes entstanden ist. Deswegen ist das Schicksal beider Reiche auch stark miteinander verknüpft.
Ein Geräusch weckt meine Aufmerksamkeit. Draußen im Gang höre ich Schritte. Jetzt würde ich lieber keinem begegnen. Ich bin viel zu durcheinander. Als die Schritte näherkommen, weiche ich automatisch zurück bis in eine dunkle Ecke des Saals. Ich kann nur hoffen, dass niemand das Licht einschalten wird. Zwei Gestalten kommen herein, eine groß, mit breiten Schultern, und die andere klein. Ich erkenne sie sofort.
»Euer Sohn verschließt sich immer noch vor der Reise«, seufzt Harrison.
»Wir sollten Duncans Wunsch respektieren und ihn nicht zwingen«, erwidert Dad.
»Aber mein König, was ist mit der alten Tradition …«
»Traditionen können sich ändern!«
»Das kann nicht Euer Ernst sein … Die damaligen Könige … Euer Urururgroßvater hatte sich schon etwas dabei gedacht, als er diese Reise für die nachfolgenden Mondkönige beschloss.«
»Harrison, willst du mir ernsthaft meine Familiengeschichte erklären? Glaub mir, ich weiß ganz genau, was ich tue.«
»Bei allem Respekt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß, Ihr habt Vorbehalte, weil damals Euer …«
»Schluss jetzt, HARRISON!«
Bei Dads harschen Worten zucke ich zusammen. So kenne ich ihn gar nicht. Auch Harrison holt deutlich Luft, bevor er antwortet: »Jawohl, mein König.«
Kapitel 4
Piper
Den Seesack lasse ich im Flur fallen und gehe weiter ins Wohnzimmer. Meine Klamotten kann ich auch noch nachher auspacken, viel ist es ja nicht. Der Karton mit den Büchern wird langsam wirklich schwer und ich stelle ihn auf dem Sofa ab. Ich richte mich auf und atme mehrere Male ganz tief durch. So muss es Mister Williams vorhin gegangen sein. Ich warte, bis sich mein Atem zumindest halbwegs beruhigt hat, bevor ich den kleinen Holztisch umrunde und hinüber zum Balkon gehe. Die Schiebetür öffnet sich geräuschlos. Frische Luft strömt an mir vorbei. Die Räume der Wohnung sind nicht sonderlich groß, aber die Besitzerin hat es geschafft, jeden Winkel zu nutzen, ohne ihn zu überladen. Im Wohnzimmer befindet sich gleichzeitig eine Küche, direkt in der Ecke des Eingangs. Sie besitzt sogar einen Tresen mit zwei Hockern davor. Neben mir steht ein länglicher Esstisch. An der Wand darüber hängt ein Brett. Darauf stehen Topfpflanzen und dazwischen sind mehrere Kochbücher in unterschiedlichen Größen und Breiten platziert. Die Einrichtung gefällt mir und sie strahlt gleichzeitig eine Ruhe aus, dass ich mich optimal auf meine Arbeit als Rednerin vorbereiten kann. Entschlossen gehe ich zum Sofa. Wenn ich nächste Woche eine gute Show abliefern will, darf ich keine wertvolle Zeit verschwenden. Ich setze mich, rutsche bis an den Rand des Polsters und öffne den Karton. Ein Buch nach dem anderen nehme ich daraus hervor. Es gibt so viele interessante Dinge, über die ich berichten will, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll.
Was als Nächstes zum Vorschein kommt, lässt mich schmunzeln. Das kleine würfelförmige Buch ist violett und wird eigentlich von einem Schloss zusammengehalten. Aber das habe ich bereits als Kind verloren. Ich kann nicht widerstehen und schlage die ersten Seiten meines Tagebuchs auf.
Sofort fühle ich mich in eine frühere Zeit zurückversetzt.
An ein ganz besonderes Ereignis kann ich mich noch genau erinnern.
Ich war fünfeinhalb, als wir mit einer kleinen Gruppe das Waisenhaus verließen, um einen Ausflug in die Stadt zu machen.
Wir liefen durch die belebten Straßen und ich konnte mich gar nicht an den vielen Leuten und den bunten Schaufenstern sattsehen. Dabei kamen wir auch an einer Bücherei vorbei, die ich schon einmal gesehen hatte. Damals waren dort Bilderbücher über Prinzessinnen und Märchenfiguren ausgestellt. Damit hatte ich allerdings nichts anfangen können. Ich glaube nicht an Märchen und gute Feen, die über einen wachen und einem zur Hilfe eilen, wenn man sie braucht.
Doch an diesem Tag war das Schaufenster völlig anders dekoriert worden und eins der Bücher weckte meine Aufmerksamkeit. Es zeigte ein Kind, das auf einer schwebenden Strickleiter spazierte. Unter ihm ein Schornstein, über ihm der Nachthimmel mit vielen glitzernden Sternen. Daneben Saturn mit seinen Ringen.
Ich wollte unbedingt herausfinden, worum es in dieser Geschichte geht. Aber die Betreuer zogen uns weiter. Für mich war das eine furchtbare Ungerechtigkeit. Mit meinem kindlichen Verstand konnte ich das einfach nicht akzeptieren. Auch war es für mich unvorstellbar, dass ich mich bis zum nächsten Ausflug gedulden müsste. Hatte ich mich erst einmal für etwas begeistert, konnte man mich nicht mehr davon abbringen.
Das ist heute noch genauso.
Mein Plan stand in der Sekunde, als die Bücherei aus meinem Blickfeld verschwand. Obwohl ich noch sehr jung war, konnte ich doch sehr kreativ sein, wenn ich etwas unbedingt haben wollte. Der tägliche Ablauf im Waisenhaus half mir dabei. Wir jüngeren Kinder mussten nach dem Mittagessen in unseren Zimmern bleiben, um uns dort ruhig bis zum Nachmittag zu beschäftigen. So schlich ich mich heimlich davon. Dabei mied ich das Büro der Betreuer, wo sie sich alle um diese Uhrzeit versammelt hatten. Die Haustür war verschlossen. Deswegen stieg ich durch ein Fenster im Erdgeschoss und machte mich hastig zur Innenstadt auf.
Die Bücherei wiederzufinden war kein Problem, allerdings hatte ich einen sehr wichtigen Punkt nicht bedacht. Ich konnte noch gar nicht lesen.
Diese bittere Erkenntnis machte mich traurig, wollte ich doch die Geschichte erfahren, die sich in diesem Buch verbarg. Ich fragte mehrere Erwachsene, ob sie es mir bitte vorlesen könnten, aber entweder wurde ich komplett ignoriert oder sie sagten mir, ich sollte sie nicht nerven und gefälligst zu meinen Eltern gehen. Ich traute mich nicht zu sagen, dass ich keine hatte. Traurig und enttäuscht schlich ich mich wieder zurück ins Waisenhaus. Niemand hatte meinen kleinen Ausflug bemerkt.
Aber ich gab nicht auf. So oft es ging, trickste ich die Betreuer aus und lief zur Bücherei. Das Buch hatte ich sicher in einem hinteren Regal versteckt. Schließlich wollte ich nicht, dass es mir jemand anderes wegschnappte. Heimlich nahm ich es dann an mich und ging zu jedem einzelnen Erwachsenen, aber ich hatte keine Chance. Sie waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Doch ich ließ mich dadurch nicht entmutigen.
Während ich also immer wieder die Erwachsenen abklapperte, wurde ich von den Mitarbeitern der Bücherei aufmerksam beobachtet. Diese Stadt war nicht sehr groß und die Leute kannten sich untereinander. Daher wussten sie auch, dass ich aus dem Waisenhaus kam. Aber sie haben mich nicht gemeldet. Wahrscheinlich hatte es sich herumgesprochen, welche strengen Regeln dort herrschten.
Eine besagte, dass es den Kindern verboten war, das Waisenhaus ohne Begleitung eines Erwachsenen zu verlassen. Einmal wurde ich dann doch erwischt. Als Strafe schlug mir eine Betreuerin mit dem Lineal auf meinen Handrücken. Ich erinnere mich daran, wie weh sie danach taten, dass sogar das Händewaschen Höllenschmerzen verursachte. Aber das war mir egal. Ich hätte alles ertragen, nur um das Geheimnis meines Buches zu erfahren.
Ich lehne mich gegen das weiche Rückenpolster und denke an den Moment zurück, als meine Hartnäckigkeit endlich belohnt wurde. Eine Frau wurde auf mich aufmerksam. Mit ihrem buntbedruckten Shirt, der dunkelblauen Jeans und den Sneakers wirkte sie auf mich jung. Nur ihre kurzen grauen Haare und die Lachfältchen in ihrem Gesicht verrieten mir, dass sie älter war. Mimi tat mir nur zu gerne den Gefallen, mir das Buch vorzulesen.
Diese Geschichte war so spannend, dass sie meine Neugier auf das Universum weckte. Ich wollte alles darüber wissen. Mimi unterstützte mich tatkräftig dabei. Sie erzählte mir, dass sie vor ihrer Pensionierung Lehrerin gewesen war und sich freuen würde, wenn sie mir vorlesen könnte. Wir trafen uns, so oft es ging, in der Stadtbücherei. Dabei erfuhr ich nicht nur Geschichten aus dem Universum, sondern auch von Mimis Leben. Gerne hätte sie Kinder gehabt, aber ihr Mann war früh gestorben und sie konnte sich danach nicht auf einen neuen Partner einlassen.
Mimi war es auch, die mir das Lesen beibrachte. Zwar hatten wir im Waisenhaus auch Unterricht, aber der war so langweilig, dass ich diese Zeit stattdessen dazu nutzte, mich in Gedanken auf Abenteuerreisen durch unser Universum zu begeben. So wie in den Geschichten, die sie mir vorgelesen hatte.
Während ich also auf dem Saturn Schlitten gefahren war und auf Uranus nach Diamanten suchte, lernten die anderen Kinder das Alphabet: A wie Apfel, B wie Banane und M wie Maus. Ich hingegen hatte sie mit Begriffen wie Gravitationswellen, Quantenmechanik und Schwarze Löcher gelernt.
Es war eine unglaublich schöne Zeit für mich, doch dann kam Mimi eines Tages nicht mehr in die Bücherei. Ich dachte, es wäre meine Schuld. Dass ich irgendetwas Falsches gesagt oder gemacht hätte. Ein Schatten legt sich über mein Herz und ich versuche den aufkeimenden Kloß in meinem Hals herunterzuschlucken.
Energisch schlage ich das Tagebuch wieder zu und lege es neben mich. Ich muss mich schnellstens irgendwie ablenken, bevor mich die Traurigkeit wieder in ihre Fänge bekommt. Ruckartig stehe ich auf und begutachte die Schränke in der Küche. Ich werde mir eine Liste machen, mit den Dingen, die ich noch in der Stadt besorgen muss. Was aber nicht nötig ist, wie ich kurz darauf feststelle. Die Wohnung ist bereits mit allem ausgestattet, was man für den täglichen Gebrauch benötigt. Es ist wirklich sehr nett von Mister Williams, dass ich die Sachen seiner Enkelin benutzen darf. Schließlich hätte er sie auch wegräumen können. Aber so muss ich mir zumindest darüber keinen Kopf machen. Im Vorratsschrank und im Kühlschrank finde ich sogar einige Lebensmittel, die für ein paar Tage reichen sollten.
Unschlüssig gehe ich zurück zum Sofa. Ohne mein Büchlein anzusehen, nehme ich meinen Karton und trage ihn zum Esstisch hinüber. Ich beschließe, dass hier mein Arbeitsplatz sein wird. Neben meinen Büchern breite ich auch die Unterlagen, die mir Abigail Smith mitgegeben hat, vor mir aus. Als Erstes nehme ich mir den genauen Ablaufplan zur Hand. Dort hat sie mir auch einige Infos notiert, die ich in meinem Vortrag einbauen soll. Ich überlege, womit ich beginnen könnte. Schließlich will ich eine hervorragende Show abliefern.
Nicht lange und mein Magen knurrt. Gegen einen kleinen Snack hätte ich jetzt nichts einzuwenden. Um keine Zeit mit Kochen zu verschwenden, schneide ich schnell etwas Obst in eine Müslischale. Als i-Tüpfelchen streue ich Kokosflocken darüber. Während ich einen vollgepackten Löffel nach dem anderen im Mund verschwinden lasse, lese ich mir die Notizen durch.
Ich versuche die richtigen Worte zu finden, aber das ist gar nicht so einfach.
Als meine Schüssel leer ist, unterdrücke ich den Drang, sofort wieder aufzustehen und das Geschirr zu spülen. Ich muss mich endlich auf meine Arbeit konzentrieren. Meine Hände umfassen die Lehnen des gepolsterten Stuhls und ich rücke näher an den Tisch heran. Fest entschlossen, mich nur noch meinem Vortrag zu widmen, brüte ich über den Unterlagen. Weit komme ich allerdings nicht. In meinem Kopf schwirren die Gedanken nur so umher, aber nichts davon kann ich für die Show verwenden. Es sei denn, das Tanken meines Fieros oder welche Klamotten ich nächste Woche anziehen könnte, würde als Thema für ein Planetarium passen. Meiner Kehle entschlüpft ein frustrierter Laut. Aus einer Intuition heraus schließe ich die Augen und stelle mir den Raum vor, wo ich die Shows abhalten werde. Ich konzentriere mich und kann mir sogar ein paar Menschen vorstellen. Sie sehen mich an und warten gespannt auf die Dinge, die ich gleich sagen werde. Schnell öffne ich wieder meine Augen und beginne zu schreiben. In meinen Gedanken sehe ich gerade alles direkt vor mir und weiß genau, was ich wann und wie sagen werde.
Die Worte fließen nur so aus mir heraus. Als hätte sich ein hartnäckiger Knoten gelöst.
Ich arbeite konzentriert und mache nur Pausen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Es ist fast erschreckend, wie einfach mir das Ganze fällt.
***
Zufrieden betrachte ich meine Notizen. Die nächste Woche kann kommen. Und doch mischt sich zu allem Enthusiasmus auch ein mulmiges Gefühl in meine Magengegend. Was nützt es, eine supergute Show vorzubereiten, wenn mir der Gedanke, vor fremden Menschen zu sprechen, den Schweiß auf die Stirn treibt? Irgendwie muss ich das in den Griff bekommen.
Es ist schon eigenartig, wie man sich die Jahre über verändern kann. Als Kind war ich nie nervös. Sogar in dieser Bibliothek habe ich wildfremde Menschen angequatscht. Und heute möchte ich mich am liebsten irgendwo verkriechen, wenn ich in die gleiche Situation komme.
Als Maßnahme des Heims musste ich mich einmal für einen Job in einem kleinen Elektroladen bewerben. Am Ende bekam ich sogar die Anstellung, aber schnell stellte sich heraus, dass ich keine Verkäuferin war. Erst einmal mit Kunden ins Gespräch zu kommen und ihnen dann auch noch ein Produkt schmackhaft zu machen, das bekomme ich nicht auf die Reihe. Selbst die banalsten Höflichkeitsfloskeln konnte ich nur stotternd über die Lippen bekommen … »G-guten Morgen«, »G-guten Tag«, »W-wie kann ich h-helfen?« Am nächsten Tag brauchte ich gar nicht mehr aufzutauchen. Damals dachte ich mir nichts dabei. Aber bei meinem nächsten Job am Empfang eines Massagestudios sagte mir die Chefin knallhart ins Gesicht, dass ich mit Menschen einfach nicht umgehen könne und besser in einem Job aufgehoben wäre, wo ich keinen Kundenkontakt hätte. Ihre Worte verletzten mich tief. Ich fühlte mich schlecht, nutzlos und weinte die ganze Nacht. Ich war gerade einmal 16. Von diesem Zeitpunkt an konzentrierte ich mich nur auf Jobs, wo man so wenig wie möglich mit anderen zu tun hat. Bisher hat das auch super funktioniert. Und jetzt bringt mich der Job im Planetarium in eine Zwickmühle. Doch den Teil habe ich einfach ausgeblendet. So viel Wissen habe ich über die Jahre zum Universum gesammelt, dass ich nun darauf brenne, sie mit anderen zu teilen.
Ich gehe hinüber zur Verandatür. Es klickt, als ich den Schlüssel umdrehe. Es ist bereits tiefste Nacht und die Sterne glitzern am Firmament. Ich lasse ihren Anblick auf mich wirken. Lange betrachte ich den Halbmond, hoffe auf ein Zeichen, das aber nicht kommt.
Enttäuscht gehe ich wieder hinein. Eine tiefe Müdigkeit steigt in mir auf. Ich schaffe es gerade noch, das Licht auszuschalten und ins Schlafzimmer zu schlurfen. Aber kaum liege ich im Bett, bin ich wieder hellwach. Ich denke über mein Leben nach und wie mich meine Schüchternheit ausbremst. Gerne hätte ich irgendetwas mit Kindern gemacht, zum Beispiel Erzieherin oder so. Aber nach meinem Job in dieser Massagepraxis begrub ich diesen Wunsch sofort.
Es wäre vernünftiger, wenn ich morgen zu Abigail Smith gehe und ihr absage. Ihr sage, dass sie sich geirrt hat und ich das nicht schaffe. Dann suche ich mir eben einen anderen Job. Ich werde schon etwas finden. Das habe ich bisher immer. Und doch zögere ich. Eigentlich sollte ich erleichtert sein, stattdessen fühle ich mich mies, als würde ich eine große Dummheit begehen, wenn ich nun absage. Entschlossen schlage ich die Bettdecke zurück und marschiere aus dem Zimmer. Langsam habe ich es satt, mit einer Handbremse durchs Leben zu gehen. Ich will keine Drückebergerin mehr sein. Mir meine Wünsche nicht durch meine Empfindungen beeinflussen lassen. Ich setze mich wieder zurück an den Esstisch und arbeite an meinem Vortrag weiter.
Die Sonne ist bereits aufgegangen, als ich das letzte Wort auf meinen Notizblock schreibe.
Kapitel 5
Duncan
Seit ich das Gespräch zwischen meinem Dad und Harrison gehört habe, grüble ich darüber nach. Warum hat sich Dad so sehr über seine Worte aufgeregt? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und fragen kann ich keinen der beiden.
»Willst du nicht endlich darüber reden, was dich die ganze Zeit beschäftigt?«
Gideon lehnt mit verschränkten Armen locker am Türrahmen und grinst schief.
»Wie kommst du darauf, dass mich etwas beschäftigt?«
Er zuckt mit den Schultern. »Ich kenn dich eben. Also spuck es schon aus.«
Lange muss ich nicht überlegen. Gideon und ich sind quasi miteinander aufgewachsen. Wenn es jemanden gibt, dem ich vertraue, dann ist er es.
»Vor einigen Tagen habe ich ein Gespräch zwischen Dad und Harrison mitbekommen.«
»Na und?«
»Die Unterhaltung war sehr hitzig. Dad hat Harrison sogar angebrüllt.«
»Livian? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.« Gideon stößt sich vom Türrahmen ab und betritt mein Arbeitszimmer. »Er ist doch immer die Ruhe in Person.«
»Genau. Seit dem Gespräch versuche ich zu verstehen, was das zu bedeuten hatte.«
»Worüber haben sie denn gesprochen?«
»Meine Reise zur Menschenwelt.«
Gideon lässt sich in seinen Stammsessel plumpsen und sieht mich an. »Was spricht denn gegen die Reise?«
»Sie dient einfach keinem logischen Zweck.«
»Liest du deswegen darin?« Mit dem Kinn deutet er auf das Buch, das aufgeschlagen vor mir liegt.
»Ja. Ich versuche herauszufinden, warum mein Ururururgroßvater Jeldrik es zum Gesetz machte, dass alle zukünftigen Mondkönige der Menschenwelt erst diese Reise dorthin machen müssen.«
»Und, schon was entdeckt?«
Ich seufze. »Nein, bisher noch nichts. Nur das Übliche. Dass nur ein direkter Nachfahre der Blutlinie Umbragh über die Monde herrschen kann. Kein Neffe, Cousin, Großonkel oder sonst wer. Nur das erstgeborene Kind kann seinen Vater ablösen. Und so weiter und so weiter.«
»Das ist schon alles sehr merkwürdig«, beginnt Gideon. »Diese Reise scheint eine wichtige Bedeutung zu haben, aber sie wird in den Aufzeichnungen nicht erwähnt? Obwohl alles, was die Geschichte des Mondes betrifft, dort notiert wurde.«
»Das begreife ich eben auch nicht.«
»Und worüber hat sich dein Dad aufgeregt?«
»Er scheint nicht zu wollen, dass ich zur Erde reise.«
Gideon beugt sich nach vorne, stützt seine Ellenbogen auf seine Oberschenkel und legt eine Hand unter sein Kinn. »Das verstehe ich nicht. Gerade er müsste doch darauf bestehen.«
»Eben.«
»Hast du mit ihm darüber gesprochen?«
»Das kann ich nicht machen.«
»Wieso?«
»Dann würde er wissen, dass ich sie belauscht habe. Zwar unabsichtlich, aber trotzdem.«
Gideons Augenbraue wandert nach oben. »Seit wann spionierst du denn deinem Dad hinterher?«
Mit gerunzelter Stirn sehe ich ihn an. »Das tue ich doch überhaupt nicht. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort.«
»Und wie sieht dann dein Plan aus?«
Bevor ich reagieren kann, kommt Harrison hereinmarschiert. Sein Gesichtsausdruck ist entschlossen.
»Duncan, ich glaube, ich weiß nun, warum du nicht zur Menschenwelt reisen willst.«
Das glaube ich eher weniger.
Er wirft einen Blick auf Gideon und nickt ihm zur Begrüßung zu. Mit großen Schritten kommt er an meinen Schreibtisch marschiert.
»Was ist, wenn du nicht alleine reisen müsstest?«
»Wie meinst du das?«
»Damals ging es deinem … Vater nicht anders. Er wehrte sich mit Händen und Füßen gegen diese Reise.«
Na, sieh einer an. Dad hatte also auch Bedenken.
»Er las wochenlang in den alten Schriften und fand dabei heraus, dass es ihm zustand, jemanden mitzunehmen.« Freudestrahlend sieht mich Harrison an.
Mir ist, als hätte ich gerade etwas überhört. Gideon steht grinsend auf und schlägt mir über den Tisch kameradschaftlich auf die Schulter.