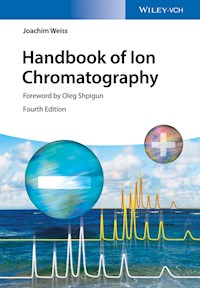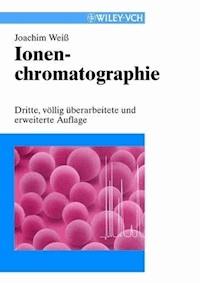
184,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk zur Ionenchromatographie jetzt in einer erweiterten und gründlich überarbeiteten dritten Auflage! Seit vielen Jahren hat sich der "Weiß" als umfassendes Handbuch der Ionenchromatographie bewährt. Der Anwender findet darin alle wesentlichen Informationen zu den Grundlagen, den Geräten, den stationären und mobilen Phasen sowie zu den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Neu in der dritten Auflage sind:
- ein eigenes Kapitel zur Ionenaustausch-Chromatographie
- Informationen zur Validierung ionenchromatographischer Methoden
- Kopplungstechniken zur Massenspektrometrie, einschließlich ICP/MS
- Anwendungen zur Analyse von Kohlenhydraten, Proteinen und Nukleinsäuren
- Viele neue Abbildungen und Chromatogramme
Joachim Weiß arbeitet für den führenden Gerätehersteller auf dem Gebiet der Ionenchromatographie und ist Gastprofessor an der Universität Innsbruck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1174
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur 3. Auflage
1 Einführung
1.1 Historischer Abriß
1.2 Arten der Ionenchromatographie
1.3 Das ionenchromatographische System
1.4 Vorteile der Ionenchromatographie
1.5 Auswahl von Trenn- und Detektionssystemen
2 Formale Theorie des chromatographischen Prozesses
2.1 Chromatographische Grundgrößen
2.2 Parameter zur Beurteilung der Güte einer Trennung
2.3 Die Efikienz einer Trennsäule
2.4 Das Konzept des theoretischen Bodens (van-Deemter-Theorie)
2.5 Van-Deemter-Kurven in der Ionenchromatographie
3 Anionenaustausch-Chromatographie (HPIC)
3.1 Allgemeines
3.2 Der Ionenaustausch-Prozeß
3.3 Thermodynamische Aspekte
3.4 Stationäre Phasen
3.5 Elutionsmittel in der Anionenaustausch-Chromatographie
3.6 Suppressorsysteme in der Anionenaustausch-Chromatographie
3.7 Anionenaustausch-Chromatographie anorganischer Anionen
3.8 Anionenaustausch-Chromatographie organischer Anionen
3.9 Cradiententechniken in der Anionenaustausch-Chromatographie anorganischer und organischer Anionen
3.10 Kohlenhydrate
3.11 Proteine
3.12 Nucleinsäuren
4 Kationenaustausch-Chromatographie (HPIC)
4.1 Stationäre Phasen
4.2 Elutionsmittel in der Kationenaustausch-Chromatographie
4.3 Suppressorsysteme in der Kationenaustausch-Chromatographie
4.4 Kationenaustausch-Chromatographiev on Alkalimetallen, Erdalkalimetallen und Aminen
4.5 Analyse von Übergangs- und Schwermetallen
4.6 Analyse von Polyaminen
4.7 Gradiententechniken in der Kationenaustausch-Chromatographie anorganischer und organischer Kationen
5 Ionenausschluß-Chromatographie (HPICE)
5.1 Der Ionenausschluß-Prozeß
5.2 Stationäre Phasen
5.3 Elutionsmittel in der Ionenausschluß-Chromatographie
5.4 Suppressorsysteme in der Ionenausschluß-Chromatographie
5.5 Analyse anorganischer Säuren
5.6 Analyse organischer Säuren
5.7 HPICE/HPIC-Kopplung
5.8 Analyse von Alkoholen und Aldehyden
5.9 Analyse von Aminosäuren
6 Ionenpaar-Chromatographie (MPIC)
6.1 Übersicht über existierende Retentionsmodelle
6.2 Suppressorsysteme in der Ionenpaar-Chromatographie
6.3 Experimentelle retentionsbestimmende Parameter
6.4 Analyse oberflächeninaktiver Ionen
6.5 Analyse oberflächenaktiver Ionen
6.6 Anwendungen der Ion-suppression-Technik
6.7 Anwendungen der mehrdimensionalen Ionenchromatographie an Multimode-Phasen
7 Detektionsarten in der Ionenchromatographie
7.1 Elektrochemische Detektionsmethoden
7.2 Spektroskopische Detektionsmethoden
7.3 Andere Detektionsarten
7.4 Kopplungstechniken
8 Quantitative Analyse
8.1 Allgemeines
8.2 Analytisch-chemische Informationsparameter
8.3 Bestimmung der Peakflächen
8.4 Statistische Kennzahlen
8.5 Kalibrierung eines analytischen Verfahrens (Grundkalibrierung)
8.6 Nachweiskriterium, Nachweis- und Bestimmungsgrenze
8.7 Das Qualitätsregelkarten-System
9 Anwendungsmöglichkeiten
9.1 Ionenchromatographie in der Umweltanalytik
9.2 Ionenchromatographie in der Kraftwerkschemie
9.3 Ionenchromatographie in der Halbleiter-Industrie
9.4 Ionenchromatographie in der galvanischen Industrie
9.5 Ionenchromatographie in der Wasch- und Haushaltsmittel-Industrie
9.6 Ionenchromatographie in der Nahrungs- und Genußmittel-Industrie
9.7 Ionenchromatographie in der pharmazeutischen Industrie
9.8 Ionenchromatographie in der klinischen Chemie
9.9 Oligosaccharid-Analyse von Membran-gekoppelten Glycoproteinen
9.10 Weitere Anwendungsmöglichkeiten
9.11 Probenvorbereitung und Matrixprobleme
Literaturnachweis
Register
Dr. Joachim Weiss
Dionex Corporation
Am Wörtzgarten 10
D-65510 ldstein
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Die Deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme
Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei derDeutschen Bibliothek erhältlich
© 2001 WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind. All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527287024
Epdf ISBN 978-3-527-62504-8
Epub ISBN 978-3-527-66080-3
Mobi ISBN 978-3-527-66079-7
Geleitwort
Die Ionenchromatographie hat heute einen wichtigen Stellenwert im breiten Anwendungsfeld der Trenntechnologie-Chromatographie. Neben den Grundlagenarbeiten ist es vor allem die angewandte Forschung und nicht zuletzt die breite praktische Anwendung der ionenchromatographischen Verfahren, die diese Technologie aus dem täglichen Laborleben nicht mehr wegdenkbar machen. Betrachtet man die wachsende Publikationstätigkeit auf diesem Gebiet, die zahlreichen internationalen Tagungen und die Vielfalt der Applikationen, so wird einem klar vor Augen geführt, wie wichtig die qualitative, quantitative und qualitätsgesicherte Datenerfassung ist und wie bedeutungsvoll ein grundlegendes Werk, wie das nun vorliegende Buch von Herrn Dr. Joachim Weiß, tatsächlich ist.
Der Bereich der Ionenchromatographie und die wirtschaftliche Bedeutung dieser Methode erstreckt sich heute von den klassischen anorganischen Ionen bis hin zu organischen ionalen Verbindungen wie organischen Säuren, Kohlenhydraten und Glycoproteinen, um nur einige zu nennen.
Schon die bisherigen Bücher von Herrn Dr. Joachim Weiß auf dem Gebiet der Ionenchromatographie sind Klassiker geworden. Das neue Buch trägt wieder allen Ansprüchen der Wissenschaft, aber auch den industriellen Anwendungen dieser Technologie Rechnung.
Mit den theoretischen Grundlagen, trennmechanistischen Überlegungen, neuen stationären Phasen für Anionen- und Kationenaustausch, Ionenausschluß- und Ionenpaar-Chromatographie sowie neuesten Detektionsmethoden wird diese Technik detailliert beschrieben. Auch die statistische Datenerfassung einschließlich der dazugehörenden Grundlagen, die heute im Alltag der chemisch-analytischen Labors unerläßlich geworden ist, wird genauso erfaßt wie spezielle Anwendungsmöglichkeiten beispielsweise in der Halbleiterindustrie.
Ich bin mir sicher, daß das vorliegende Buch den bisherigen erfolgreichen Werken von Herrn Dr. Joachim Weiß folgend wiederum als bedeutendes Nachschlagewerk in Wissenschaft, Labor und Industrie Verwendung finden wird.
Ich wünsche dem Autor und dem Verlag viel Erfolg für dieses gelungene Werk.
Innsbruck, im Januar 2001
Dr. Günther Bonn
Professor für Analytische Chemie
Universität Innsbruck
Vorwort zur dritten Auflage
Seit dem Erscheinen der zweiten Auflage dieses Buches im Jahre 1991 sind fast zehn Jahre vergangen, in denen sich die Methode der Ionenchromatographie nicht nur weiter etabliert, sondern auch rasant entwickelt hat. In diesem Zusammenhang sind vor allem die vielen neuen Trennsäulen mit ihren zum Teil außergewöhnlichen Selektivitäten und Trennleistungen zu nennen. Neuartige, mit großen Injektionsvolumina kompatible Pfropfpolymere ermöglichen Analysen bis in den sub-μg/L-Bereich ohne zeitaufwendige Vorkonzentrierung. Besonderer Erwähnung bedarf die Entwicklung der kontinuierlichen und kontaminationsfreien Eluens-Herstellung durch Anwendung der Elektrolyse, durch die der Einsatz der Gradientelution in der Ionenchromatographie drastisch vereinfacht werden konnte. Entsprechend konfigurierte Ionenchromatographen werden lediglich mit entionisiertem Wasser gespeist. Einhergehend mit dieser Entwicklung beobachtet man in der Anionenaustausch-Chromatographie den Trend, vermehrt Hydroxid als Elutionsmittel zu verwenden, das für die Gradientelution besonders geeignet ist. Gegenüber dem klassischen Carbonat/Hydrogencarbonat-Gemisch, das für einfache Anwendungen nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat, erzielt man mit Hydroxid zudem eine deutlich höhere Empfindlichkeit. Dieser Trend wird durch die stürmische Entwicklung Hydroxid-selektiver stationärer Phasen unterstützt. In Analogie zur klassischen Flüssigkeitschromatographie gewinnt auch in der Ionenchromatographie die Kopplung mit atom und molekülspektrokopischen Verfahren wie ICP und ESI-MS zunehmend an Bedeutung, der mit dem Abschnitt Kopplungstechniken Rechnung getragen wird. Da auch Kohlenhydrate, Proteine und Oligonucleotide mit der Ionenaustausch-Chromatographie analysiert werden, aber lediglich die Kohlenhydrat-Analyse in der zweiten Auflage berücksichtigt ist, wurden die Abschnitte Proteine und Nucleinsäuren neu aufgenommen. In Verbindung mit der integrierten Amperometrie als direkte Detektionsmethode revolutionierte die Ionenaustausch-Chromatographie auch die Aminosäure-Analytik. Damit ist die Ionenchromatographie für die Analyse anorganischer und organischer Anionen und Kationen in vielen Bereichen unverzichtbar geworden.
All diese Entwicklungen seit Erscheinen der zweiten Auflage haben dazu geführt, daß auch diese dritte Auflage getrost als neuer Text bezeichnet werden kann, denn fast jedes Kapitel wurde neu geschrieben oder erheblich erweitert. Der besseren Übersichtlichkeit wegen wurde das bisherige Kapitel Ionenaustausch-Chromatographie in die Kapitel Anionen- bzw. Kationenaustausch-Chromatographie unterteilt. Die übrige Einteilung des Buches hat sich bewährt und wurde deshalb beibehalten. Im Unterschied zur zweiten Auflage wurden die Abschnitte Kohlenhydrate aus Glycoproteinen (Kapitel 3), Proteine (Kapitel 3), Nucleinsäuren (Kapitel 3) und Oligosaccharid-Analyse von Membran-gekoppelten Glycoproteinen (Kapitel 9) von einem Experten, Herrn Dr. Dietrich Hauffe, verfaßt, dem ich dafür zu großem Dank verpflichtet bin. Auch das Kapitel Quantitative Analyse wurde neu geschrieben und um die Validierungsparameter und das Qualitätsregelkarten-System erweitert. Die Kapitel über Detektion und Anwendungsmöglichkeiten wurden durch neues Material sehr stark erweitert und mit einer Vielzahl praktischer Beispiele in Form von Chromatogrammen unterlegt. Neu aufgenommen wurden Einsatzmöglichkeiten der Ionenchromatographie in der petrochemischen Industrie und Papier- und Zellstoffindustrie.
Die Zielsetzung dieser dritten Auflage ist die gleiche wie bei den ersten beiden Auflagen. Angesprochen sind alle Analytiker, die sich mit dieser Methode vertraut machen wollen, aber auch die Praktiker, die diese Methode tagtäglich anwenden und einen Leitfaden zur Methodenentwicklung sowie einen Überblick über existierende Anwendungen suchen.
Allen meinen Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zur Vorbereitung der dritten Auflage beigetragen haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Zu besonderem Dank bin ich Herrn Dr. Detlef Jensen für seine stete Bereitschaft zur Diskussion und wertvollen Anregungen sowie Herrn Dr. Frank Höfler für die große Mühe bei der kritischen Durchsicht des Manuskriptes verpflichtet. Für Kritik und Anregungen, die der Weiterführung des Buches dienlich sein könnten, bin ich auch in Zukunft aufgeschlossen.
Schließlich wende ich mich in großer Dankbarkeit an meine Frau und meine Kinder, die gerade in der letzten Zeit mit unglaublich viel Verständnis so oft auf ihren Mann bzw. Vater verzichten mußten, der viele Abende, Wochenenden und Feiertage am Computer verbracht hat.
Idstein, im Oktober 2000
Joachim Weiß
1
Einführung
1.1 Historischer Abriß
Der Begriff „Chromatographie“ ist die allgemeine Bezeichnung für eine Vielzahl von physikalisch-chemischen Trennverfahren, die auf der Verteilung eines Stoffes zwischen einer mobilen und einer stationären Phase beruhen. Die Einteilung der unterschiedlichen Chromatographie-Arten richtet sich dabei nach dem jeweiligen Aggregatzustand dieser beiden Phasen.
Die Entdeckung der Chromatographie wird dem Russen Tswett [1,2] zugesprochen, dem es im Jahre 1903 als erstem gelang, Blattpigmente durch Adsorption an einer festen polaren stationären Phase zu trennen und diesen Prozeß zu interpretieren. In den darauffolgenden Jahren beschränkte sich die Anwendung der Chromatographie auf Verteilungen zwischen einer festen stationären und einer flüssigen mobilen Phase (LSC, Liquid Solid Chromatography). 1938 entwickelten Izmailov und Schraiber [3] die Grundlagen der Dünnschicht-Chromatographie (TLC, Thin Layer Chromatography). Stahl [4,5] verfeinerte diese Methode 1958 zu der heute bekannten Technik. Martin und Synge [6] übernahmen in ihrer vielbeachteten Arbeit von 1941 das Konzept des theoretischen Bodens aus der Terminologie der Destillationstechnik als formale Größe für die Chromatographie. Mit diesem Konzept wurde die Flüssigkeitschromatographie (LC) revolutioniert und die Grundlage für die Entwicklung der Gaschromatographie (GC) und Papierchromatographie geschaffen.
Im Jahre 1952 publizierten Martin und James [7] ihre erste gaschromatographische Arbeit und leiteten damit eine sehr rasche Entwicklung dieser Methode ein.
Die Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) entwickelte sich aus der klassischen Säulenchromatographie und gehört heute – neben der Gaschromatographie – zu den wichtigsten Methoden der modernen instrumentellen Analytik. Sie nahm ihren Aufschwung, als es gelang, trennleistungsstarke Säulen mit sehr kleinen Packungsteilchen (≈10 μm) herzustellen und diese unter hohem Druck zu betreiben. Die Entwicklung der HPLC und das theoretische Verständnis des Trennprozesses beruhen auf den grundlegenden Arbeiten von Horvath [8], Knox [9], Scott [10], Snyder [11], Guiochon [12], Möckel [13] u. a.
Die Ionenchromatographie (IC) als neue analytische Methode ist 1975 von Small, Stevens und Baumann [14] eingeführt worden und hat sich innerhalb kurzer Zeit von einer neuartigen Detektionsart für einige wenige anorganische Anionen und Kationen zu einer vielseitigen Analysentechnik für ionische Spezies entwickelt. Für die empfindliche Detektion von Ionen über ihre elektrische Leitfähigkeit verwendete Small eine sog. Suppressorsäule, durch die das Effluat der Trennsäule geleitet wird. Die Suppressorsäule ermöglicht auf chemischem Wege, die Grundleitfähigkeit des Elutionsmittels zu verringern und die zu analysierenden Ionen in eine stärker leitende Form zu überführen.
Alternativ zu diesem ionenchromatographischen System beschrieben Fritz et al. [15] im Jahre 1979 eine Trenn- und Detektionsmethode für anorganische Anionen, bei der die analytische Trennsäule direkt mit einer Leitfähigkeits-Meßzelle verbunden ist. Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit einer solchen Anordnung ist die Verwendung eines Ionenaustauschers niedriger Kapazität, so daß mit Elutionsmitteln geringer Ionenstärke gearbeitet werden kann. Die verwendeten Elutionsmittel müssen zudem eine geringe Eigenleitfähigkeit besitzen, um eine empfindliche Leitfähigkeits-Detektion der zu analysierenden Spezies zu ermöglichen.
Gegen Ende der 70er Jahre wurde die Ionenchromatographie erstmals auch für die Analyse organischer Ionen eingesetzt. Die Notwendigkeit, schwache organische Säuren zu quantifizieren, führte zur Entwicklung eines ionenchromatographischen Verfahrens auf Basis des Ionenausschlusses, das erstmals 1953 von Wheaton und Bauman [16] beschrieben wurde.
In den 80er Jahren stand vor allem die Entwicklung hocheffizienter Trennsäulen mit Teilchendurchmessern zwischen 5 μm und 8 μm im Vordergrund, die eine erhebliche Verringerung der Analysenzeiten zur Folge hatte. Darüber hinaus wurden ionenpaarchromatographische Techniken als willkommene Alternative zur Ionenaustausch-Chromatographie eingeführt, da mit diesem Verfahren sowohl Anionen als auch Kationen getrennt und bestimmt werden können.
Seit Beginn der 90er Jahre liegt das Ziel der Säulenentwicklung in der Bereitstellung von stationären Phasen mit besonderen Selektivitäten. So wurde im Bereich der anorganischen Anionenanalyse das Ziel verwirklicht, Fluorid vom Totvolumen zu trennen und dennoch zusammen mit den wichtigsten Mineralsäuren und Oxyhalogeniden wie Chlorit, Chlorat und Bromat zu analysieren [17]. Darüber hinaus werden Anionenaustauscher hoher Kapazität entwickelt, um beispielsweise Spuren von Anionen in konzentrierten Säuren und salinaren Proben zu analysieren. Problemlösungen dieser Art sind u. a. für die Halbleiter-Industrie, die Meerwasser-Analytik und die klinische Chemie von großer Bedeutung. Im Bereich der Kationenanalyse steht die simultane Analyse von Alkaliund Erdalkalimetallen im Vordergrund, die in einem akzeptablen Zeitrahmen von maximal 15 Minuten nur durch Einsatz schwach saurer Kationenaustauscher möglich ist [18]. Zunehmende Bedeutung gewinnt die Analyse aliphatischer Amine, die an ähnlichen stationären Phasen unter Verwendung von organischen Lösemitteln getrennt werden können.
Auf dem Gebiet der Detektion konnte die Anwendungsbreite der Ionenchromatographie durch den Einsatz elektrochemischer und spektrophotometrischer Detektoren erheblich erweitert werden. Ein vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung war die Einführung der gepulsten amperometrischen Detektion im Jahre 1983, die eine äußerst empfindliche Detektion von Kohlenhydraten, Aminosäuren und divalenten organischen Schwefelverbindungen ermöglicht [19,20].
Mit dem verstärkten Einsatz von Nachsäulenderivatisierungs-Techniken mit anschließender photometrischer Detektion erlangten ionenchromatographische Verfahren auch für die Analyse von Polyphosphaten und -phosphonaten sowie Übergangs- und Schwermetallen eine rasche Akzeptanz und können als leistungsfähige Ergänzung zu konventionellen titrimetrischen bzw. atomspektrometrischen Verfahren angesehen werden.
Mit diesen Entwicklungen ist die Methode der Ionenchromatographie zu einem integralen Bestandteil der modernen anorganischen und organischen Analytik geworden.
Auch wenn die Ionenchromatographie nach wie vor die bevorzugte Analysenmethode für anorganische und organische Ionen ist, werden Ionenanalysen in letzter Zeit auch mit der Kapillarelektrophorese (CE) [21] durchgeführt, die im Vergleich zur IC Vorteile bei der Analyse von Proben mit extrem komplexer Matrix bietet. Im Bereich der Detektion sind zur Zeit jedoch nur spektroskopische Methoden wie UV/Vis- und Fluoreszenz-Detektion kommerzialisiert. Da anorganische Anionen und Kationen, aber auch aliphatische Carbonsäuren über die direkte UV-Detektion entweder gar nicht oder nur sehr unempfindlich nachgewiesen werden können, sind die Anwendungsmöglichkeiten der CE im Vergleich zur IC mit der universell einsetzbaren Leitfähigkeits-Detektion auf diesem Gebiet sehr beschränkt.
Dasgupta et al. [22] sowie Avdalovic et al. [23] gelang es unabhängig voneinander als erste, eine Leitfähigkeits-Meßzelle sowie die in der IC bewährte Suppressortechnik in den für die CE notwendigen Maßstab zu miniaturisieren. Da die Leitfähigkeits-Detektion durch Miniaturisierung nicht an Empfindlichkeit einbüßt, erzielt man für total dissoziierte Anionen und niedermolekulare Organika Nachweisgrenzen, die mit denen ionenchromatographischer Verfahren konkurrieren können. Die Kapillarelektrophorese mit Leitfähigkeits-Detektion und Suppressortechnik kann damit als willkommene Ergänzung bei der Analyse von kleinen Ionen in einfacher und komplexer Matrix angesehen werden.
1.2 Arten der Ionenchromatographie
Das vorliegende Buch behandelt die verschiedenen Trennverfahren, die unter dem Namen „Ionenchromatographie“ zusammengefaßt werden können. Die moderne Ionenchromatographie als Teilgebiet der Flüssigkeitschromatographie basiert auf drei verschiedenen Trennmechanismen, die zugleich die Grundlage für die Nomenklatur bilden.
Ionenaustausch-Chromatographie (HPIC)
(High Performance Ion Chromatography)
Diese Trennmethode beruht auf einem Ionenaustausch-Prozeß zwischen der mobilen Phase und den am Trägermaterial gebundenen Austauschergruppen. Speziell bei stark polarisierbaren Ionen tragen auch nicht-ionische Adsorptionsprozesse zum Trennmechanismus bei. Die stationäre Phase be steht aus einem Harz auf Styrol-, Ethylvinylbenzol- oder Methacrylat-Basis, das mit Divinylbenzol copolymerisiert und mit Austauschergruppen modifiziert ist. Die lonenaustausch-Chromatographie wird für die Trennung von anorganischen und organischen Anionen und Kationen herangezogen, wobei die Austauschfunktion für die Trennung von Anionen eine quartäre Ammoniumbase und für die Trennung von Kationen eine Sulfonat-, Carboxyl- oder Phosphonatgruppe ist. Die nähere Beschreibung dieser Trennmethode entnehme man den Kapiteln 3 und 4.
lonenausschluß-Chromatographie (HPICE)
(High Performance Ion Chromatography Exclusion)
In der Ionenausschluß-Chromatographie wird der Trennmechanismus durch Donnan-Ausschluß, sterischen Ausschluß, Adsorption und – je nach Trennphase – durch Wasserstoffbrückenbindungen bestimmt. Als stationäre Phasen verwendet man total sulfonierte Kationenaustauscher hoher Kapazität auf der Basis Polystyrol/Divinylbenzol. Sind Wasserstoffbrückenbindungen für die Selektivität entscheidend, wird dem Ausgangsmaterial Styrol ein merklicher Anteil Methacrylat beigefügt. Die Ionenausschluß-Chromatographie dient vor allem zur Trennung von anorganischen und organischen Säuren geringer Säurestärke von den vollständig dissoziierten Säuren, die im Totvolumen als Summenpeak eluieren. Darüber hinaus eignet sich diese Trennmethode bei Verwendung geeigneter Detektionssysteme zur Bestimmung von Aminosäuren, Aldehyden und Alkoholen. Eine ausführliche Erläuterung dieser Trennmethode erfolgt in Kapitel 5.
lonenpaar-Chromatographie (MPIC)
(Mobile-Phase Ion Chromatography)
In der Ionenpaar-Chromatographie ist der dominierende Trennmechanismus die Adsorption. Die stationäre Phase besteht aus einem neutralen porösen Divinylbenzol-Harz mit schwach polarem Charakter und hoher Oberfläche. Alternativ können auch chemisch gebundene Octadecyl-Phasen auf Basis Kieselgel verwendet werden, die einen noch weniger polaren Charakter haben. Die Selektivität der Trennsäule wird ausschließlich durch die mobile Phase bestimmt. Dem Eluens (Wasser, wäßrige Puffer usw.) wird neben organischen Lösemitteln (modifier) ein Ionenpaar-Reagenz zugegeben, dessen chemische Natur von der Art der zu analysierenden Ionen abhängig ist. Die lonenpaar-Chromatographie eignet sich vor allem für die Trennung von oberflächenaktiven Anionen und Kationen, höheren Schwefelverbindungen und Aminen sowie von komplexgebundenen Übergangs- und Schwermetallen. Diese Trennmethode wird in Kapitel 6 näher beschrieben.
Alternative Methoden
Neben diesen drei klassischen Trennmethoden werden auch Mechanismen der Reversed-phase-Chromatographie (RPLC) zur Trennung von stark polaren bzw. ionischen Verbindungen herangezogen. Langkettige Fettsäuren beispielsweise können nach Protonierung in der mobilen Phase mit geeigneten wäßrigen Puffersystemen an einer chemisch gebundenen Octadecyl-Phase getrennt werden. Diese Verfahrensweise wird in der angelsächsischen Literatur mit „ion suppression mode“ [24] bezeichnet.
Auch chemisch gebundene Aminopropyl-Phasen sind erfolgreich zur Trennung anorganischer Anionen verwendet worden. So trennten Leuenberger et al. [25] an einer solchen Phase Nitrat und Bromid in Lebensmitteln mit einem Phosphatpuffer als Elutionsmittel. Trennungen dieser Art sind hinsichtlich ihrer Anwendungsbreite limitiert, da sie in der Regel nur auf UV-absorbierende Spezies angewendet werden.
Interessant sind darüber hinaus Anwendungen der mehrdimensionalen Ionenchromatographie an Multimode-Phasen. Hierunter versteht man Trennungen, bei denen Ionenaustausch- und Reversed-phase-Wechselwirkungen an ein und derselben stationären Phase ablaufen und somit zur Trennung ionischer und stark polarer Spezies beitragen [26]. Diese alternativen Techniken werden ebenfalls in Kapitel 6 näher beschrieben.
1.3 Das ionenchromatographische System
Der prinzipielle Aufbau eines Ionenchromatographen ist in Abb. 1-1 in Form eines Blockbildes dargestellt und ähnelt dem konventioneller HPLC-Geräte.
Mit einer Pumpe wird die mobile Phase durch das gesamte chromatographische System gefördert. Hierfür werden in der Regel Ein- oder Zweikolbenpumpen eingesetzt. Die für den Einsatz von Detektoren notwendige maximale Pulsfreiheit wird bei Einkolbenpumpen durch mechanische Pulsdämpfer und bei Zweikolbenpumpen durch eine aufwendige elektronische Steuerung gewährleistet.
Das Aufbringen der zu analysierenden Probe erfolgt mit einem Schleifen-Injektor, wie er in Abb. 1-2 schematisch dargestellt ist. Benötigt wird ein Dreiwege-Ventil, bei dem zwei Ausgänge über eine Probenschleife miteinander verbunden sind. Das Füllen der Probenschleife erfolgt bei atmosphärischem Druck. Nach Umschalten des Ventils wird die Probe in der Schleife durch die mobile Phase zum Trennsystem transportiert. Typische Injektionsvolumina liegen zwischen 5 μL und 100 μL.
Der wichtigste Bestandteil eines Chromatographen ist die analytische Trennsäule. Die Wahl einer geeigneten stationären Phase (s. Abschn. 1.5) sowie der entsprechenden chromatographischen Bedingungen bestimmen die Qualität der Analyse. Die Säulenrohre werden aus Inertmaterialien wie Tefzec, Epoxidharzen oder PEEK (Polyetheretherketon) gefertigt und in der Regel bei Raumtemperatur betrieben. Nur in wenigen Fällen – beispielsweise für die Analyse von langkettigen Fettsäuren – ist eine erhöhte Säulentemperatur zur Verbesserung der Lösefähigkeit notwendig. Aber auch für die Analyse von Polyaminen wird eine Anhebung der Säulentemperatur zur Steigerung der Peakeffizienz empfohlen.
Abb. 1-1. Schematischer Aufbau eines lonenchromatographen.
Abb. 1-2. Schematische Darstellung eines Schleifen-Injektors.
Zum Nachweis und zur Quantifizierung der zu untersuchenden Spezies dient der Detektor. Die Bedeutung der Leistungsfähigkeit eines Detektors erfolgt nach den Kriterien:
Empfindlichkeit
Linearität
Auflösung (Zellvolumen)
Grundrauschen (Nachweisgrenze)
Der am häufigsten verwendete Detektor in der Ionenchromatographie ist der Leitfähigkeits-Detektor, der mit oder ohne Suppressorsystem eingesetzt werden kann. Aufgabe des Suppressorsystems als Teil der Detektionseinheit ist es, die hohe Grundleitfähigkeit des als Eluens fungierenden Elektrolyten chemisch zu verringern und die zu analysierende Probe in eine stärker leitende Form zu überführen. Neben den Leitfähigkeits-Detektoren finden auch UV/Vis-, amperometrische und Fluoreszenz-Detektoren Verwendung, die in Kapitel 7 detailliert beschrieben werden.
Die Darstellung der chromatographischen Signale kann auf einem x,t-Schreiber erfolgen. Quantitative Ergebnisse erhält man durch Auswertung der Peakflächen bzw. -höhen, die in einem weiten Bereich proportional zur Konzentration der zu analysierenden Verbindung sind. Hierfür kann man Digital-Integratoren verwenden, die an den Analog-Ausgang des Detektors direkt angeschlossen werden. Digital-Integratoren als Auswertesystem verlieren jedoch durch den Preisverfall auf dem Computer-Markt und wegen mangelnder GLP/GLAP-Konformität zunehmend an Bedeutung. Moderne Detektoren verfügen heutzutage zusätzlich über eine serielle Schnittstelle (z. B. RS-232C), so daß über ein entsprechendes Interface auch der Anschluß an einen Personal-Computer mit geeigneter Chromatographie-Software möglich ist. Bei den üblicherweise eingesetzten Computer-gestützten Ionenchromatographen übernimmt der Rechner darüber hinaus auch Steuerfunktionen und ermöglicht somit einen vollautomatischen Betrieb.
Da in der Ionenchromatographie häufig korrosionsverursachende Elutionsmittel wie verdünnte Säuren und Laugen eingesetzt werden, sollten die mit Flüssigkeiten in Berührung kommenden Teile des chromatographischen Systems aus metallfreien Inertmaterialien gefertigt sein. Herkömmliche HPLC-Geräte mit Kapillaren und Pumpenköpfen in Edelstahlausführung sind für den Einsatz in der Ionenchromatographie nur bedingt geeignet, da mit der Zeit selbst rostfreier Edelstahl von aggressiven Elutionsmitteln angegriffen wird. Dies hätte erhebliche Kontaminationsprobleme zur Folge, denn Metall-Ionen besitzen eine hohe Affinität zur stationären Phase von Ionenaustauschern und fuhren daher zu einem signifikanten Verlust an Trennleistung. Metallteile im chromatographischen Flußsystem würden darüber hinaus die Analyse von Orthophosphat, Komplexbildnern sowie Übergangs- und Schwermetallen im Spurenbereich deutlich erschweren.
1.4 Vorteile der Ionenchromatographie
Die Bestimmung ionischer Verbindungen in Lösung ist ein klassisches analytisches Problem mit einer Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Während für den Bereich der Kationenanalytik schon seit geraumer Zeit ausreichend schnelle und empfindliche Analysenmethoden zur Verfügung stehen (AAS, ICP, Polarographie u.a.), bestand gerade auf dem Gebiet der Anionenanalytik ein Mangel an hochempfindlichen Nachweismethoden. Gegenüber konventionellen naßchemischen Methoden wie Titration, Photometrie, Gravimetrie, Turbidimetrie und Ko-lorimetrie, die arbeitsintensiv, zeitaufwendig und teilweise störanfällig sind, bietet die Ionenchromatographie folgende Vorteile:
Schnelligkeit
Empfindlichkeit
Selektivität
Simultaneität
Stabilität der Trennsäulen
Schnelligkeit
Die Schnelligkeit einer Analyse gewinnt in zunehmendem Maße an Bedeutung, da mit steigenden Produktionskosten für qualitativ hochwertige Produkte und den besonderen Anstrengungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes die Zahl der zu untersuchenden Proben gerade in letzter Zeit drastisch zunimmt.
Mit den in den letzten Jahren eingeführten Hochleistungstrennsäulen für die Ionenaustausch-, die Ionenausschluß- und die Ionenpaar-Chromatographie konnte die durchschnittliche Analysenzeit auf ca. 10 Minuten begrenzt werden. Die Analyse der sieben wichtigsten anorganischen Anionen [27] kann bei basislinienaufgelöster Trennung sogar auf drei Minuten verkürzt werden. Quantitative Resultate erhält man somit in einem Bruchteil der Zeit, die für traditionelle naßchemische Methoden aufgewendet werden muß, so daß der Probendurchsatz entsprechend gesteigert werden kann.
Empfindlichkeit
Durch Einführung der Mikroprozessor-Technologie in Verbindung mit modernen stationären Phasen hoher chromatographischer Effizienz ist der Nachweis von Ionen im mittleren und unteren ppb-Bereich ohne Vorkonzentrierung heute zur Routine geworden. Die Bestimmungsgrenze für einfache anorganische Anionen und Kationen beträgt bei einem Injektionsvolumen von 50 μL ca. 10 ppb. Die absolute injizierte Menge liegt dabei im untersten ng-Bereich. Nach Anreicherung auf entsprechenden Konzentriersäulen lassen sich auch Reinstwässer, wie sie in der Kraftwerkstechnik und in der Halbleiterfertigung benötigt werden, auf ihren Gehalt an Anionen und Kationen untersuchen. Mit diesen Konzentriertechniken konnte die Bestimmungsgrenze auf ca. 10 ppt gesenkt werden. Es muß jedoch betont werden, daß der apparative Aufwand für die Messung dieser unvorstellbar kleinen Gehalte enorm hoch ist. Zudem sind an die Schaffung geeigneter Umweltbedingungen höchste Anforderungen gestellt. Limitierender Faktor für das Vordringen in noch niedrigere Gehaltsbereiche ist die Kontamination durch die allgegenwärtigen Chlorid- und Natrium-Ionen.
Hohe Empfindlichkeiten bis in den pmol-Bereich erzielt man auch in der Kohlenhydrat-Analytik über die gepulste amperometrische Detektion sowie in der Aminosäure-Analytik über die Fluoreszenz-Detektion nach Derivatisierung mit o-Phthaldialdehyd.
Selektivität
Die Selektivität ionenchromatographischer Verfahren bei der Analyse von anorganischen und organischen Anionen und Kationen wird durch die Auswahl geeigneter Trenn- und Detektionssysteme gewährleistet. Im Zusammenhang mit der Leitfähigkeits-Detektion ist die Suppressionstechnik von elementarer Bedeutung, da mit deren Hilfe die entsprechenden Gegen-Ionen der zu analysierenden Ionen als Quelle möglicher Interferenzen durch H+- bzw. OH~-Ionen ausgetauscht werden. Ein hohes Maß an Selektivität erzielt man durch Einsatz eines substanzspezifischen Detektors wie beispielsweise eines UV-Detektors für die Analyse von Nitrit in Gegenwart hoher Mengen Chlorid. Neuere Entwicklungen in der Ionenchromatographie auf dem Gebiet der Nachsäulenderivatisierung zeigen, daß bestimmte Substanzklassen wie Schwermetalle, Erdalkalimetalle, polyvalente Anionen, Silicat usw. mit hoher Selektivität bestimmt werden können. Beispiele dieser Art erklären, warum die Probenvorbereitung für ionenchroma-tographische Verfahren in vielen Fällen nur in einer einfachen Verdünnung und Membranfiltration der Probe besteht. Dieses hohe Maß an Selektivität erleichtert zudem die Identifizierung unbekannter Probenkomponenten.
Simultaneität
Ein großer Vorteil der Ionenchromatographie – gerade gegenüber anderen in-strumentellen Methoden wie der Photometrie und der AAS – ist die Möglichkeit der simultanen Bestimmung von Probenkomponenten. So erhält man innerhalb kurzer Zeit Anionen- bzw. Kationenprofile, die Aufschluß über die Zusammensetzung der Probe geben und zeitaufwendige Tests vermeiden helfen. Die Simultaneität ionenchromatographischer Verfahren wird jedoch durch das Vorliegen extremer Konzentrationsunterschiede zwischen einzelnen Probenkomponenten begrenzt. In einer Meerwasser-Matrix beispielsweise lassen sich Haupt- und Nebenkomponenten nur in wenigen Fällen simultan erfassen, d. h. Haupt- und Nebenkomponenten müssen in zwei getrennten Läufen entweder bei verschiedenen Empfindlichkeitseinstellungen oder durch unterschiedliche Verdünnungen der Probe bestimmt werden.
Stabilität der Trennsäulen
Die Stabilität der verwendeten stationären Phasen ist in starkem Maße von ihrer Bauart abhängig. Im Gegensatz zu den überwiegend auf Kieselgel basierenden Säulen in der konventionellen HPLC haben sich in der Ionenchromatographie organische Polymere wie beispielsweise Styrol/Divinylbenzol-Copolymere als Trägermaterial durchgesetzt. Die hohe pH-Stabilität dieser Materialien ermöglicht die Verwendung starker Säuren und Basen als Elutionsmittel, eine Voraussetzung für die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Methode. Starke Säuren und Basen können andererseits auch zur Reinigung kontaminierter Trennphasen herangezogen werden. Organische Polymere sind inzwischen auch gegenüber organischen Lösemitteln wie Methanol oder Acetonitril stabil, so daß diese zur Beseitigung organischer Kontaminationen eingesetzt werden können (s. auch Kap. 9). Trennphasen auf Basis organischer Polymere zeichnen sich somit durch ein hohes Maß an Unempfindlichkeit gegenüber so komplexen Matrices wie Abwasser, Lebensmittel oder Körperflüssigkeiten aus. Die Probenvorbereitung beschränkt sich auch hierbei oftmals nur auf eine Verdünnung mit entionisiertem Wasser und anschließende Filtration.
1.5 Auswahl von Trenn- und Detektionssystemen
Wie bereits erwähnt, werden heutzutage unter dem Begriff „Ionenchromatographie“ eine Vielzahl verschiedener Trennmethoden zusammengefaßt. Daher soll an dieser Stelle ein Überblick über die Kriterien zur Auswahl der für die Lösung eines Trennproblems geeigneten stationären Phasen und Detektoren gegeben werden.
In der Regel besitzt der Analytiker Kenntnisse über die Natur (anorganisch oder organisch), die Oberflächenaktivität, die Ladungszahl und die Acidität bzw. Basizität des zu bestimmenden Ions. Mit diesen Informationen und den in Tab. 1-1 schematisch dargestellten Auswahlkriterien sollte es dem Analytiker nicht schwerfallen, die geeignete stationäre Phase und Detektionsart auszuwählen. Oftmals bieten sich für die Lösung eines Trennproblems gleich mehrere Verfahren an. In diesen Fällen bestimmen letztendlich die Art der Matrix, die Einfachheit der Handhabung und verstärkt auch kommerzielle Gesichtspunkte die Wahl des Verfahrens. Zwei Beispiele sollen dies erläutern:
Zu bestimmen seien verschiedene Schwefelspezies im Waschkreislauf einer Rauchgasentschwefelungsanlage (s. auch Abschn. 9.2). Unpolarisierbare Ionen wie Sulfit, Sulfat und Amidosulfonsäure mit pK-Werten <7 werden demzufolge nach Tab. 1-1 mit der HPIC unter isokratischen Bedingungen an einem konventionellen Anionenaustauscher getrennt und über ihre elektrische Leitfähigkeit detektiert. Zur Erhöhung der Empfindlichkeit und der Spezifität des Verfahrens kann ein Suppressorsystem eingesetzt werden. Die oftmals in diesen Lösungen in geringer Konzentration vorhandenen Ionen Thiocyanat und Thiosulfat sind dagegen polarisierbar und besitzen daher eine hohe Affinität zur stationären Phase eines konventionellen Anionenaustauschers. Für deren Analyse sind allein drei verschiedene Verfahren denkbar. So kann ein konventioneller Anionenaustauscher mit einer mobilen Phase hoher Ionenstärke verwendet werden, wobei in Abhängigkeit von der Konzentration der zu analysierenden Ionen Empfindlichkeitsprobleme bei Detektion über die Leitfähigkeit auftreten können. Eine Alternative ist die Verwendung eines speziellen Anionenaustauschers auf Methacrylat-Basis, an denen polarisierbare Anionen nicht so stark sorbieren und daher zusammen mit den unpolarisierbaren Anionen analysiert werden können. Berücksichtigt man, daß auch höhere Schwefelspezies wie beispielsweise Dithio-nat bestimmt werden sollen, muß auf die Gradientelution ausgewichen werden, mit der heutzutage alle oben erwähnten Komponenten an einem Anionenaustauscher hoher chromatographischer Effizienz in einem Lauf getrennt und über ihre Leitfähigkeit detektiert werden können. Dazu ist jedoch ein Konzentrationsgradient notwendig, der den Einsatz eines Suppressorsystems unumgänglich macht. Die Gradiententechnik hat jedoch auch ihre Grenzen. Bei extrem polarisierbaren Anionen wie z. B. Nitrilotrisulfonsäure ist die Ionenpaar-Chromatographie (MPIC) wesentlich besser geeignet, da bei diesem Verfahren die Retention durch Zugabe organischer Lösemittel zur mobilen Phase festgelegt werden kann.
In einem weiteren Beispiel sollen organische Säuren in einem KafFeeaufguß bestimmt werden. Folgt man Tab. 1-1, können aliphatische Carbonsäuren mit der HPICE an einem total sulfonierten Kationenaustauscher getrennt und über die Leitfähigkeit detektiert werden. Während sich dieses Verfahren durch eine hohe Selektivität für aliphatische Monocarbonsäuren niedriger C-Zahl auszeichnet, erhält man für die im Kaffee ebenfalls vorhandenen offenkettigen und cycli-schen Hydroxycarbonsäuren aliphatischer Natur keine ausreichende Trennung. Erst nach Einfuhrung einer neuen stationären Phase mit spezieller Selektivität für Hydroxycarbonsäuren gelang es, die wichtigsten Vertreter dieser Substanzklasse in dieser Matrix zu trennen. Für die Trennung der im Kaffee in großer Zahl vorhandenen aromatischen Carbonsäuren wie beispielsweise der Kaffeesäure, der Ferulasäure und der Substanzklasse der Chlorogensäuren ist die Methode der Ionenausschluß-Chromatographie gänzlich ungeeignet. Aromatische Säuren besitzen aufgrund von π-π-Wechselwirkungen mit den aromatischen Ringen des organischen Polymers als Substratmaterial der stationären Phase eine sehr hohe Retention und sind demzufolge nicht analysierbar. Gute Trennergebnisse erzielt man dagegen mit der Reversed-phase-Chromatographie an chemisch gebundenen Octadecyl-Phasen hoher chromatographischer Effizienz. Die Detektion dieser Verbindungen erfolgt in jedem Fall über die Messung der Lichtabsorption bei 254 nm.
Weitere Einzelheiten zur Auswahl von Trenn- und Detektionssystemen können in den Kapiteln 3 bis 6 nachgelesen werden.
Tabelle 1-1. Schematische Darstellung der Auswahlkriterien für Trenn- und Detektionssysteme.
2
Formale Theorie des Chromatographischen Prozesses
2.1 Chromatographische Grundgrößen
Die Darstellung chromatographischer Signale in Form eines Chromatogramms hat im allgemeinen das in Abb. 2-1 gezeigte Aussehen.
Abb. 2-1. Allgemeine Darstellung eines Chromatogramms.
Zwei verschiedene Substanzen können nur dann in einer chromatographischen Säule voneinander getrennt werden, wenn sie unterschiedlich lange in oder an der stationären Phase verweilen. Die Zeit, in der sie nicht wandern, bezeichnet man als Nettoretentionszeit, ts. Als Totzeit, tm, definiert man die Zeit, die eine Verbindung zum Durchlaufen der Trennsäule benötigt, ohne mit der stationären Phase in Wechselwirkung zu treten. Die Verweilzeit einer Substanz in der Säule, die Gesamtretentionszeit oder auch Bruttoretentionszeit,tms, berechnet sich somit nach Gl. (1) aus Totzeit und Nettoretentionszeit:
(1)
Die verwendeten Begriffe zur Charakterisierung der Trennsäulen sind aus Abb. 2-1 ersichtlich.
Die Form eines chromatographischen Peaks läßt sich in erster Näherung durch eine Gauß-Kurve beschreiben (Abb. 2-2):
Abb. 2-2. Gauß-Kurve.
Die Peakhöhe an der Stelle x kann nach Gl. (2) wie folgt berechnet werden:
(2)
Asymmetrie-Faktor As
Die Elution chromatographischer Signale – die Praktiker sprechen von Peaks [engl, peak (Gipfel)] – in Form einer Gaußschen Kurve wird in der Praxis selten erreicht. Üblicherweise zeigen die Peaks eine Asymmetrie, die definiert ist als (vgl. Abb. 2-3):
(3)
Sind die As-Werte größer als 1, bezeichnet man die Asymmetrie als „tailing“. Der Tailing-Effekt, der sich vorwiegend auf Adsorptionskräfte zurückführen läßt, ist charakterisiert durch einen schnellen Anstieg und ein vergleichsweise langsameres Abfallen des Signals. Bei As-Werten kleiner als 1 bezeichnet man die Asymmetrie als „leading“ oder „fronting“. Dieser Effekt ist durch ein langsames Ansteigen und vergleichsweise schnelleres Abfallen des Signals gekennzeichnet. Der Leading-Effekt tritt auf, wenn ein Teil der den Peak bildenden Probenmole.küle bzw. -ionen an der stationären Phase keine geeigneten Haftstellen mehr vorfindet und dadurch das Peakzentrum überholt. In der Praxis wird eine Trennsäule als gut bezeichnet, wenn die Asymmetrie-Faktoren zwischen 0,9 und 1,2 liegen.
Abb. 2-3. Definition des Asymmetrie-Faktors.
2.2 Parameter zur Beurteilung der Güte einer Trennung
Auflösung
Das Ziel einer chromatographischen Analyse ist die Trennung der Probenkomponenten in einzelne Signale. Die Auflösung, R (engl, resolution), zwischen zwei benachbarten Peaks ist als Quotient aus dem Abstand der beiden Peakmaxima (ausgedrückt als Differenz der beiden Bruttoretentionszeiten) und dem arithmetischen Mittel aus den beiden zugehörigen Basisbreiten, definiert.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!