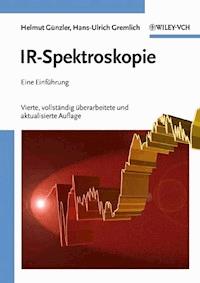
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die lange erwartete, vierte Auflage des Lehrbuchklassikers zur IR-Spektroskopie! Will man Substanzen eindeutig charakterisieren und auf ihre Reinheit überprüfen, führt kein Weg an der IR-Spektroskopie als Analysemethode vorbei. Präzise und leicht verständlich, aktuell und sehr praxisbezogen lernen die künftigen Anwender alles, was sie über die IR-Spektroskopie wissen müssen: - Aufbau und Handhabung von Spektrometern, - Vorbereitung der Proben und deren Messung, - qualitative Interpretation der Spektren, - quantitative Bestimmungen, - spezielle Anwendungsgebiete und - spezielle und verwandte Methoden. Zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur vermitteln eine gute Orientierung bei speziellen Fragestellungen, und helfen dabei, sich zum Experten weiterzuentwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
1 Einführung
1.1 Entwicklung der Infrarottechnik
1.2 Anwendungsmöglichkeiten der IR-Spektroskopie
2 Absorption und Molekülbau
2.1 Grundlagen
2.2 Die Absorption der IR-Strahlung
3 Das Spektrometer
3.1 Aufbau
3.2 Strahlungsquellen
3.3 IR-Detektoren
3.4 Spektralzerlegung
3.5 Spektrenbearbeitung
4 Substanzpräparation
4.1 Allgemeine Bemerkungen
4.2 Festsubstanzen
4.3 Flüssigkeiten und Lösungen
4.4 Gase
5 Spezielle Untersuchungstechniken
5.1 Reflexionsmethoden
5.2 IR-mikroskopische Messungen
5.3 IR-Imaging
5.4 Photoakustische Detektion
5.5 IR-Emissionsspektroskopie
5.6 Messungen unter extremen Zustandsverhältnissen
5.7 Messungen mit polarisierter Strahlung
5.8 Kombination der IR-Spektroskopie mit chromatographischen Methoden
6 Qualitative Spektreninterpretation
6.1 Grundlagen
6.2 Erste Spektrenbetrachtung
6.3 Zuordnungen allgemeiner Art
6.4 Die IR-Spektren der einzelnen Stoffklassen [11]
6.5 Ursachen von Bandenverschiebungen; Beeinflussungen des Spektrums
6.6 Die Spektreninterpretation als mehrdimensionale Aufgabe
6.7 Besonderheiten und Artefakte
6.8 Spektrenberechnung
7 Quantitative Spektrenaussagen
7.1 Grundlagen
7.2 Kalibrierung
7.3 Die Interpretation quantitativer Ergebnisse
7.4 Kalibrierfunktionen und Vertrauensbereiche
7.5 Mehrkomponentenanalyse mit multivariater Auswertung
8 Spektroskopie im Nahen und Fernen IR, sowie verwandte Verfahren
8.1 Spektralbereiche außerhalb des Mittleren IR
8.2 IR-Laserspektroskopie
8.3 Raman-Spektroskopie
9 Vergleichsspektren und Expertensysteme
9.1 Spektrensammlungen
9.2 Rechnerunterstützte Recherchen
9.3 Interpretative Systeme
9.4 Qualitative Gemischanalyse
10 Anhang
10.1 Lage der wichtigsten Störbanden im IR-Spektrum
10.2 Spektren gebräuchlicher Lösungsmittel
Stichwort- und Spektrenverzeichnis
Weitere Lehrbücher zur Spektroskopie von Wiley-VCH
Matthias Otto
Analytische Chemie
Zweite Auflage
2000, ISBN 3-527-29840-1
Werner Schmidt
Optische Spektroskopie
Eine Einführung
Zweite Auflage
2000, ISBN 3-527-29828-2
Horst Friebolin
Ein- und zweidimensionale NMR-Spektroskopie
Eine Einführung
Dritte Auflage
1999, ISBN 3-527-29514-3
Herbert Budzikiewicz
Massenspektrometrie
Eine Einführung
Vierte Auflage
1998, ISBN 3-527-29381-7
Prof. Dr. Helmut Günzler
Bismarckstraße 11
D-69469 Weinheim
Dr. Hans-Ulrich Gremlich
Novartis Pharma AG
Analytics
WSJ-503.1001
CH-4002 Basel
Schweiz
Diese Auflage basiert auf der dritten Auflage von 1996, die durch Ergänzungen von H. M. Weise zu der zweiten Auflage von H. Günzler entstanden ist.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei Die Deutsche Bibliothek erhältlich
© 2003 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527308019
Epdf ISBN 978-3-527-66288-3
Epub ISBN 978-3-527-66287-6
Mobi ISBN 978-3-527-66286-9
Vorwort
Das vorliegende Buch ist für alle diejenigen gedacht, die zum ersten Mal die IR-Spektroskopie zur Charakterisierung, Identifizierung oder Bestimmung einer Substanz anwenden möchten. Hierzu soll vorrangig mit den spektroskopischen Techniken im Bereich der Molekülschwingungen vertraut gemacht werden. Außer Grundkenntnissen in Chemie und Physik wird kein spezielles Wissen vorausgesetzt. Der Leser wird zunächst über den Aufbau und die Handhabung verschiedenartiger Spektrometer sowie über die vielfältigen Methoden zur Probenvorbereitung und -messung unterrichtet. Schließlich kann er anhand geeigneter Beispiele die Kunst der qualitativen Interpretation des Spektrums kennenlernen, wobei ebenfalls auf die neuesten Entwicklungen unter Einsatz von Computern eingegangen wird. Abschnitte über quantitative Bestimmungen, spezielle Anwendungsgebiete und über verwandte Methoden innerhalb der Schwingungsspektroskopie wie z. B. die Raman-Spektroskopie, dienen zur Abrundung des Grundwissens. Hinweise auf weitere Literatur vermitteln die Orientierung bei speziellen Fragestellungen.
Die einzelnen Themenkreise sind weitgehend in sich geschlossen behandelt, sodass die Kapitel auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Auf notwendige Vorkenntnisse aus den vorangegangenen Abschnitten wird durch entsprechende Querverweise hingewiesen. Dies versetzt den Anfänger rasch in die Lage, ein einfaches IR-Spektrometer zu bedienen und eine Probe „kunstgerecht“ für die Messung vorzubereiten und zu messen. Für eine optimale Nutzung der umfangreichen Möglichkeiten, die die IR-Spektroskopie bietet, ist jedoch eine systematische Erarbeitung des ganzen Stoffes ratsam.
Die theoretischen Betrachtungen werden in dieser Einführung naturgemäß kurz abgehandelt, obwohl die IR-Spektroskopie auf dem Gebiet zur Bestimmung von Molekülstrukturen und Molekülstrukturen-Dynamik Erhebliches zu leisten vermag, z. B. bei Verwendung von hochauflösenden Fourier-Transform-(FT-) und Laser-Spektrometern. Für eine ausführliche Abhandlung hierzu muss auf andere Werke verwiesen werden, da praktisch-analytische Fragestellungen im Vordergrund stehen.
Die IR-Spektroskopie hat seit dem Erscheinen der dritten Auflage erneut weitere Veränderungen erlebt. So stehen in den Laboratorien heute überwiegend FT-Spektrometer, deren Möglichkeiten hinsichtlich des erzielbaren Signal/Rausch-Verhältnisses, spektraler Auflösung und breiter nutzbarer Spektralbereiche vom Sichtbaren bis zum Fernen IR erheblich erweitert wurden. Bedingt durch bessere Geräte und Techniken, sowie den Einsatz von Computern, verfügt das analytische Labor über eine vielseitige physikalische Methode zur schnellen Identifizierung und Quantifizierung von Substanzen mit Nachweisgrenzen bis in den Pikogramm-Bereich.
Die stürmische Entwicklung hat der IR-Spektroskopie auch neue Anwendungsfelder erschlossen. Außerhalb molekülspektroskopischer Grundlagenforschung und üblicher Routineanalytik wird diese z. B. zur Prozesskontrolle, bei biologischen Fragestellungen und im klinisch-chemischen Labor eingesetzt, um nur einige Gebiete zu nennen.
Nachdem H. M. Heise, Wissenschaftler am Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie in Dortmund, die dritte Auflage wesentlich erweitert und überarbeitet hatte, wurden die für die vorliegende vierte Auflage notwendigen Anpassungen und Ergänzungen von H.-U. Gremlich, Leiter des Labors für Optical Spectroscopy and Imaging bei der Novartis Pharma AG in Basel, vorgenommen.
Wir freuen uns, dass unser Buch bereits so viele Freunde gefunden hat und hoffen, dass auch die vierte, überarbeitete Auflage den gleichen Zuspruch findet. Im Sinne einer stetigen Vervollkommnung sind wir dem aufmerksamen Leser für kritische Anmerkungen zur Verbesserung immer dankbar.
So wünschen wir den Lesern bei der Lektüre viele Aha-Erlebnisse und vor allem Erfolg bei der praktischen Anwendung des Gelernten.
Weinheim und Basel,
Mai 2003
Helmut Günzler
Hans-Ulrich Gremlich
1
Einführung
1.1 Entwicklung der Infrarottechnik
Im Jahr 1800 führte Sir William Herschel [1] im Rahmen seiner Untersuchungen über die Energieverteilung im Sonnenspektrum einen Versuch durch, der für die Entwicklung der Infrarotspektroskopie von grundlegender Bedeutung geworden ist:
Das durch ein Prisma in den Experimentierraum eintretende Sonnenlicht fiel, in seine Spektralfarben zerlegt, auf eine Tischfläche. Zur Untersuchung der Wärmeverteilung waren dort mehrere Quecksilberthermometer mit geschwärzter Kugel angeordnet. Das überraschende Ergebnis des Versuchs war, dass das Temperaturmaximum nicht etwa im Bereich der größten physiologischen Helligkeitsempfindung – nämlich bei Gelbgrün – sondern jenseits von Rot im unsichtbaren Strahlungsbereich zu finden war. In weiteren Untersuchungen bewies Herschel, dass es sich dabei nicht um eine neue Strahlungsart handelte, sondern dass diese ebenso den Gesetzen der Optik gehorchte wie sichtbares Licht. Er nannte diesen Bereich Infrarot*.
Solange nur das Thermometer, sowie seit 1830 auch das Thermoelement und die Thermosäule, zum Nachweis infraroter Strahlung zur Verfügung standen, waren eingehendere Untersuchungen kaum möglich. Genauere Wellenlängenmessungen konnten erst nach der Einführung des Bolometers – eines Widerstandsthermometers – durch Langley nach 1880 erfolgen. Messungen von Rubens, der mit Hilfe einer nach ihm benannten Reststrahlenmethode bis in den Wellenlängenbereich um 300 µm vordrang, ließen einen kontinuierlichen Übergang vom sichtbaren Gebiet des Spektrums über den infraroten Strahlungsbereich bis zu den Hertzschen Wellen vermuten.
Nach Entwicklung ausreichend empfindlicher Detektoren war das Auffinden geeigneter Prismenmaterialien und schließlich die Einführung des Echelette-Gitters zu Anfang des letzten Jahrhunderts von grundlegender Bedeutung für die Möglichkeit, gut aufgelöste IR-Spektren zu messen.
Aber auch dann war die Infrarotstrahlung im Wesentlichen ein physikalisches Phänomen und dessen eingehende Untersuchungen eine Domäne der Physiker, solange noch die Aufnahme eines Spektrums eine viele Stunden beanspruchende Fleißarbeit war, die zur Erhaltung ausreichend konstanter Umweltbedingungen nachts in abgedunkelten und übertemperierten Kellerräumen durchgeführt werden mußte. Für Zwecke der Spektralanalyse gewann der infrarote Spektralbereich erst an Bedeutung, seitdem vollautomatische Spektralphotometer gebaut werden konnten. Die erste Entwicklung eines solchen Gerätes erfolgte im Jahr 1937 durch Lehrer bei der BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen a. Rh. [2]. Nach 1940 begann – vor allem in den USA – eine stürmische Entwicklung der Gerätetechnik, derzufolge es seit 1950 möglich ist, gut aufgelöste IR-Spektren innerhalb weniger Minuten in normalen Laboratoriumsräumen aufzunehmen. Bereits 1946 erschien der erste umfangreiche und systematische Katalog infraroter Absorptionsspektren für analytische Zwecke [3].
Während der zugängliche Spektralbereich sich zunächst von 2–15 µm und nur unter Zuhilfenahme verschiedener Prismenmaterialien mittels hochentwickelter, teurer Umbautechniken in Etappen auch bis 50 µm erstreckte, ist mit Gitter-Spektrometern der Bereich zwischen 2 und 50 µm nahtlos und vollautomatisch zugänglich. Die jüngste Entwicklung, die in den 60er Jahren begann, erlaubt unter Anwendung der Fourier-Transformation die Erfassung des gesamten infraroten Bereiches zwischen 780 nm und 1000 µm.
Der erste Einsatz eines Interferometers für die Spektroskopie geht auf Michelson zurück. Eine ausführliche Abhandlung über die Entstehungsgeschichte ist zum hundertsten Jahrestag der von ihm vorgeschlagenen Apparatur erschienen [4]. Die Vorteile der interferometrischen Technik gegenüber der dispersiven wurden schon in den fünfziger Jahren (u. a. Fellgett) erkannt, doch die ersten kommerziellen FT-Spektrometer erschienen erst nach 1960. Ein Problem war die Fourier-Transformation der Interferogramme, die mit den damaligen Rechnern extrem aufwendig war. Die Wiederentdeckung des FFT (Fast-Fourier-Transform) Algorithmus 1965 hatte enorme Auswirkungen hinsichtlich der Verbreitung dieser interferometrischen Technik. Durch die Computerrevolution in den achtziger Jahren hat diese eine solche Dominanz erfahren, dass vielfach nur noch der Begriff des FT-IR in Erscheinung tritt.
Einen umfangreichen und weiterhin aktuellen historischen Überblick über die Entwicklung der gesamten Infrarottechnik findet der interessierte Leser in dem Beitrag von Jones [5].
1.2 Anwendungsmöglichkeiten der IR-Spektroskopie
Die große Bedeutung der IR-Spektroskopie beruht auf dem hohen Informationsgehalt eines Spektrums und auf der Vielfalt der Möglichkeiten für Probenmessung und Substanzpräparation. Die IR-Spektroskopie entwickelte sich deshalb zu einer der wichtigsten Arbeitsmethoden, sowohl für den präparativ wie auch für den analytisch arbeitenden Chemiker. Sie steht gleichrangig neben Kernresonanz (NMR)-Spektroskopie, Massenspektrometrie (MS) und Ultraviolett (UV)-Spektroskopie und vermag – je nach Art des Problems allein oder in geeigneter Kombination mit jenen – zum gewünschten Resultat zu führen oder beizutragen. Für eine möglichst effektive Nutzanwendung der IR-Technik ist die Kenntnis ihrer Möglichkeiten und Grenzen von entscheidender Bedeutung [6]. Es soll daher im Folgenden einleitend ein kurzer Überblick darüber gegeben werden, welche Informationen aus dem IR-Spektrum mit besonderem Vorteil zu entnehmen sind, um den Leser in die Lage zu versetzen, sich in kürzester Zeit über die grundsätzliche Anwendbarkeit der Methode für einen speziellen Fall zu informieren. Dabei ist es allerdings unvermeidlich, einige Begriffe zu benutzen, deren Definition erst späteren Kapiteln vorbehalten bleibt.
1.2.1 Direkte Aussagen zur Konstitution
Unter direkten Aussagen verstehen wir solche, die dem Spektrum einer unbekannten Probe ohne Zuhilfenahme von Vergleichssubstanzen allein aufgrund theoretisch abzuleitender oder empirischer Zusammenhänge zu entnehmen sind. Bei der IR-Spektroskopie bestehen solche Zusammenhänge zwischen der Lage von Absorptionsbanden innerhalb bestimmter Abszissenbereiche des Spektrums und gewissen Strukturgruppen. So kann die Anwesenheit oder Abwesenheit von Carbonylfunktionen, Hydroxygruppen, Aminogruppen, Nitrilen, aber auch von Doppelbindungen, Aromaten und vielen anderen Strukturelementen sozusagen „auf den ersten Blick“ mit zumeist sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden. Eine genauere Untersuchung von Lage und Intensität dieser Banden unter Berücksichtigung anderer Bereiche des Spektrums und gegebenenfalls unter Zuhilfenahme empirisch gewonnener Korrelationstabellen aus der Literatur [7, 8] lassen in den meisten Fällen eine nähere Zuordnung der erkannten Strukturgruppe zu: Keton, Säure oder Ester; primärer, sekundärer oder tertiärer Alkohol; Substitutionstyp von Aromaten und dergleichen mehr.
Die direkte Aussagemöglichkeit über Strukturgruppen, die mit anderen Methoden vielfach weit schwieriger oder gar nicht abzuleiten sind, bildet das wesentliche Merkmal der IR-Spektroskopie und begründet ihre Bedeutung als eine der wichtigsten Methoden der Instrumentellen Analytik. Das Schwergewicht der empirischen Anwendung liegt zweifellos bei der Konstitutionsaufklärung organischer Moleküle, jedoch zeigen auch anorganische Atomgruppen charakteristische Absorptionsspektren.
1.2.2 Substanzidentifizierung durch Spektrenvergleich
Lage und Intensität der Absorptionsbanden einer Substanz sind außerordentlich stoffspezifisch. Das IR-Spektrum läßt sich infolgedessen in ähnlicher Weise wie der Fingerabdruck beim Menschen als hochcharakteristische Eigenschaft zur Identifizierung benutzen. Die hohe Spezifität beruht auf der guten Reproduzierbarkeit, mit der die Koordinaten von Absorptionsmaxima (i. Allg. Wellenzahl und Transmission) gemessen werden können. Für die Identifizierung sind natürlich besonders solche Banden geeignet, die dem Kohlenstoffgerüst des Moleküls zuzuordnen sind. Absorptionsbanden dieser Art sind mit besonders großer Häufigkeit in dem leicht zugänglichen Wellenlängenbereich zwischen etwa 1500 und 1000 cm−1 zu finden, weshalb dieser Spektrenausschnitt oft auch als „Fingerprint-Gebiet“ bezeichnet wird.
Entscheidend für eine erfolgreiche Substanzidentifizierung durch das IR-Spektrum sind außerdem zwei Faktoren:
Bei einem derartig großem Umfang an Vergleichsmaterial ist die Spektren-Recherche kaum mehr manuell zu bewältigen. Verschiedene Systeme wurden entwickelt, um aufgrund der Absorptionsbanden die Auffindung des Spektrums einer unbekannten Verbindung zu ermöglichen oder um mit Hilfe der Summenformel (aus der Elementaranalyse) die Suche nach einem Vergleichsspektrum in entsprechend geordneten Verzeichnissen zu erleichtern. Einen entscheidenden Fortschritt auf diesem Gebiet brachte die Nutzung der elektronischen Datenverarbeitungstechnik, mit deren Hilfe es heute gelingt, ein unbekanntes Spektrum mit der gesamten Zahl der katalogisierten und veröffentlichten IR-Spektren innerhalb weniger Minuten zu vergleichen.
1.2.3 Quantitative Analyse
Wenn I0 die Strahlungsintensität von monochromatischer Strahlung ist, die in eine Probe eindringt, und I die Intensität der von der Probe durchgelassenen Strahlung ist, dann wird das Verhältnis I/I0 als die Transmission der Probe bezeichnet. Sie hat das Symbol T und wird auf der y-Achse eines Spektrums aufgetragen. Die prozentuale Transmission (%T) ist 100 × T. Für eine Messzelle mit der Schichtdicke b und einer absorbierenden Komponente mit der Konzentration c lautet die fundamentale Gleichung zur Beschreibung der Absorption von Strahlung
Hierbei ist a der Absorptionskoeffizient, der charakteristisch ist für eine bestimmte Probe bei einer bestimmten Wellenlänge. Gewöhnlich wird diese Gleichung durch Logarithmieren umgewandelt, wobei I/I0 durch I0/I ersetzt wird, um das Minuszeichen zu eliminieren:
Der Ausdruck log10I0/I heißt Absorbanz mit dem Symbol A. Diese Beziehung ist als Bouguer-Lambert-Beer’sches Gesetz oder einfach Beer’sches Gesetz bekannt und beschreibt den Zusammenhang zwischen der Absorbanz und der Konzentration der absorbierenden Substanz als lineare Funktion:
Die Einheit des Absorptionskoeffizienten a variiert mit den Einheiten, die für b und c verwendet werden. So hat z. B. a die Dimension l mol−1 cm−1, wenn c in mol l−1 und b in cm angegeben werden. Andere Ausdrücke für die Absorbanz A lauten:
Das Beer’sche Gesetz wird als additiv angenommen, d. h. in einer Mischung ist die Absorbanz bei einer bestimmten Wellenlänge gleich der Summe der abc-Werte für jede einzelne Komponente:
wobei über alle i Komponenten summiert wird. Das impliziert allerdings, dass die Absorption von Strahlung durch eine Komponente nicht durch die Anwesenheit der übrigen Komponenten beeinflusst wird.
Das Beer’sche Gesetz gilt unter folgenden beiden Voraussetzungen:
Erstens ist der Absorptionskoeffizienten a streng genommen nur für eine Wellenlänge gültig. Zweitens wird angenommen, dass der Absorptionskoeffizient a unabhängig von der Konzentration ist und nicht durch z. B. Aggregations-Effekte beeinflusst wird. Dann ist die Darstellung Absorbanz gegen Konzentration eine Gerade für eine einzelne Komponente, falls Schichtdicke und Wellenlänge konstant gehalten werden. Falls das Beer’sche Gesetz nicht exakt gilt, wird die Darstellung leicht nicht-linear sein, kann aber dennoch für Analysen verwendet werden. In der Praxis wird der Zusammenhang zwischen Absorbanz und Konzentration empirisch durch Kalibrieren ermittelt, wobei Kalibrieren bedeutet, den Zusammenhang zwischen Messwert und Konzentration durch eine mathematische Beziehung zu beschreiben. Im Allgemeinen ist es erforderlich, dabei den gesamten interessierenden Konzentrationsbereich einzuschließen.
Gestützt auf diese Gesetzmäßigkeiten lässt sich aus dem IR-Spektrum jede Komponente eines Gemisches quantitativ bestimmen, sofern sich eine genügend intensive Absorptionsbande finden lässt, die durch die übrigen Gemischpartner oder durch das Lösungsmittel nicht oder in bekanntem Maß gestört wird. Im Falle unbeeinflusster Absorptionsbanden und unter optimalen apparativen Bedingungen lassen sich bei quantitativen Analysen relative Standardabweichungen bis s ≥ 0,1 % erreichen (vgl. Abschn. 7.3).
Da die Auswertung in den meisten Fällen durch einen Rechner unterstützt wird, sind auch kompliziertere Mehrkomponentenanalysen durch die Vorgabe breiter Spektralbereiche und entsprechender Probenstandards möglich (sogenannte multivariate Kalibrierung; siehe auch Abschn. 7.5).
Die Konzentrationsbereiche und Stoffmengen, die mittels IR-Spektroskopie quantitativ bestimmt werden können, haben sich gegenüber früher drastisch verändert, als die Aussage gültig war, dass die IR-Spektroskopie für Spurenbestimmungen ungeeignet sei. Quantitative Analysen wurden hauptsächlich für den Bereich zwischen 1 und 100 % durchgeführt, wobei die absoluten Massen im Mikrogramm-Bereich vorliegen konnten. Mittels der neuen Techniken sind Konzentrationen unter 0,01 % bestimmbar, wobei in der IR-spektrometrischen Gasanalytik ohne Anreicherungsschritte z. B. unter Verwendung spezieller Techniken Volumenanteile im ppb-Bereich erreichbar sind. Mittels sogenannter Kryotechniken ist es möglich, die zu einer Identifikation vieler Stoffe notwendigen Substanzmengen (Stoffportionen nach DIN) unter 1 ng zu senken.
Durch quantitative IR-spektroskopische Messungen lassen sich auch zeitabhängige Vorgänge verfolgen, wie z. B. chemische Reaktionen und Ordnungsänderungen beim Strecken einer Polymerfolie. Vielfach wurden Geschwindigkeitskonstanten von Reaktionen und ihre Ordnung, Gleichgewichtslagen und Aktivierungsparameter bestimmt. Ein anderes Beispiel sind zeitaufgelöste Studien von biologischen Membranen, bei denen Strukturänderungen unmittelbar verfolgt werden konnten.
1.2.4 Weitere Anwendungen
Neben den bisher erwähnten, mehr praxisbezogenen Anwendungsmöglichkeiten sind aus dem IR-Spektrum wichtige Daten über den Molekülaufbau abzuleiten. Dies ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass ein IR-Spektrum auf der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und den Schwingungen und Rotationen des Moleküls beruht („Rotations-Schwingungs-Spektrum“). Demgemäß lassen sich aus dem Gasphasen-Spektrum auch Angaben über Trägheitsmomente, Bindungslängen, Kraftkonstanten und Symmetrie-Eigenschaften berechnen. Im Allgemeinen werden die Spektren der Substanz in verschiedenen Phasenzuständen herangezogen.
Von besonderer Bedeutung ist das IR-Spektrum für die Berechnung thermodynamischer Konstanten, weil ein bestimmter Anteil der spezifischen Wärme jedes Stoffes in der Schwingungsenergie der Atome festgelegt ist. Dieser Schwingungsanteil der spezifischen Wärme kann infolgedessen aus der Gesamtheit der Molekülschwingungen, die oft unter Einbeziehung des Raman-Spektrums bestimmt werden, berechnet werden.
Literatur zu Kap. 1
[1] W. Herschel, Philos. Trans. MDCCC, 284 (1800)
[2] E. Lehrer, Z. techn. Phys. 23, 169 (1942)
[3] American Petroleum Research Program 44
[4] P. Giacomo, Mikrochim. Acta III, 19 (1987)
[5] R. N. Jones, “Analytical Applications of Vibrational Spectroscopy – A Historical Review”, in: J. R. Durig (Hrsg.), Chemical, Biological and Industrial Applications of Infrared Spectroscopy, John Wiley & Sons, Chichester, 1986, S. 1
[6] Gremlich, H.-U., Infrared and Raman Spectroscopy, in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Vol. 5, 6th Edition, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000
[7] N. B. Colthup, L. H. Daly, S. E. Wiberley: “Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy”, 3. Aufl., Academic Press, San Diego, 1990
[8] D. Lin-Vien, N. B. Colthup, W. G. Fately, J. G. Grasselli: “The Handbook of Infrared and Raman Characteristic Frequencies of Organic Molecules”, Academic Press, Boston, 1991
[9] Bio-Rad Laboratories, Sadtler Division, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP27TD United Kingdom
* Im deutschen Sprachraum wurde dafür die Bezeichnung Ultrarotstrahlung benutzt, jedoch drang der angelsächsische Begriff Infrarot seit 1945 in zunehmendem Maße auch in die deutsche Literatur ein. Mit Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Nomenklatur wird im Folgenden stets die angelsächsische Bezeichnung Infrarot (IR) – in abkürzender Form, z. B. „IR-Spektroskopie“ – verwendet.
2
Absorption und Molekülbau
2.1 Grundlagen
2.1.1 Die elektromagnetische Strahlung
2.1.1.1 Die Natur der elektromagnetischen Strahlung
Aus der Elektrizitätslehre ist bekannt, dass bewegte elektrische Ladungen magnetische Felder induzieren und dass Änderungen des magnetischen Flusses umgekehrt die Entstehung eines elektrischen Feldes bewirken. Schwingende elektrische Ladungen verursachen also eine periodische Änderung elektromagnetischer Felder, die sich als elektromagnetische Wellen geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit im Raum ausbreiten. Je nach ihrer Erscheinungsform oder ihrer Wirkung auf die Materie und die menschlichen Sinnesorgane spricht man von verschiedenen Strahlungsarten (z. B. Licht, Wärme, Röntgenstrahlen), die sich nur hinsichtlich der Wellenlänge bzw. der Schwingungsfrequenz voneinander unterscheiden, physikalisch aber wesensgleich sind. Der Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums umfasst eine weite Skala und reicht von den γ-Strahlen bis zu den Radiowellen (Abb. 2-1).
Abb. 2-1. Das elektromagnetische Spektrum.
2.1.1.2 Größen und Einheiten
Wellenlänge: Kennzeichnende Größe für die elektromagnetische Strahlung ist die Wellenlänge; Formelzeichen: λ, Basiseinheit: m, übliche Einheiten µm, nm.
Für die Wellenlängenmessungen im metrischen Maßsystem ist im Bereich der Infrarotstrahlung die Einheit µm zweckmäßig. Im nahen IR ist jedoch auch die Einheit nm üblich, wie sie sonst im sichtbaren Spektralbereich bis zum UV verwendet wird. Diese und einige weitere gebräuchliche Längeneinheiten stehen zueinander in folgendem Zusammenhang:
(2.1)
Frequenz: Eine zweite, für die Charakterisierung einer Wellenbewegung häufig benutzte Größe ist die Schwingungsfrequenz ν (Abb. 2-1). Sie ist definiert als die Anzahl der Schwingungen, die der oszillierende elektrische (oder magnetische) Vektor der Strahlung in der Zeiteinheit ausführt. Ihre Einheit ist s−1 (Schwingung pro Sekunde), häufig wird auch die Einheit Hertz (Hz) angegeben.
Proportionalitätskonstante der Beziehung zwischen Frequenz ν und Wellenlänge λ einer Strahlung ist deren Fortpflanzungsgeschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit c mit der Einheit cm s−1:
(2.2)
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























