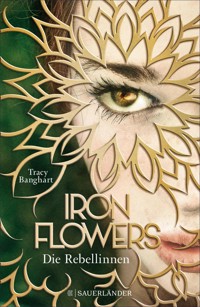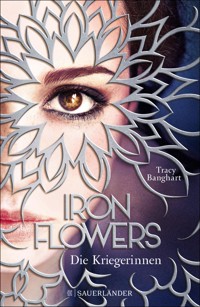
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Iron Flowers
- Sprache: Deutsch
Sie haben alles verloren. Doch sie kämpfen weiter. Denn das Schicksal aller Frauen und Mädchen liegt allein in ihrer Hand. Die Schwestern Serina und Nomi sind Gefangene: Nomi in der Gewalt eines brutalen Regenten, der alle Frauen unterdrückt. Serina auf einer Gefängnisinsel, auf die sie verschleppt wurde. Um in dem brutalen Regime zu überleben, bleibt den Schwestern nur eins: erbittert zu kämpfen – gegen die Unterdrückung und für ihre Liebe. Mit allen Mitteln und jede auf ihre Weise. Atemberaubende Spannung, mitreißende Gefühle und der Kampf gegen Unterdrückung: der zweite und abschließende Band der fulminanten Serie! Hochwertig ausgestattet mit Schutzumschlag und Silberfolienveredelung Die Bände der zweiteiligen Serie: Band 1: »Iron Flowers – Die Rebellinnen« Band 2: »Iron Flowers – Die Kriegerinnen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Tracy Banghart
Iron Flowers
Die Kriegerinnen
Über dieses Buch
Sie haben alles verloren.
Doch sie kämpfen weiter.
Denn das Schicksal aller Frauen und Mädchen liegt allein in ihrer Hand.
Die Schwestern Serina und Nomi sind Gefangene: Nomi im Palast eines brutalen Regenten, der alle Frauen unterdrückt. Serina auf einer Gefängnisinsel, auf die sie verschleppt wurde. Um in dem brutalen Regime zu überleben, bleibt den Schwestern nur eins: erbittert zu kämpfen – gegen die Unterdrückung und für ihre Liebe. Mit allen Mitteln und jede auf ihre Weise.
Der zweite und abschließende Band der fulminanten Serie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Alloy Enterainment ((Alloy Entertainment-Logo))
Produced by Alloy Entertainment, LLC
Published by arrangement with Rights People, London
Titel der amerikanischen Originalausgabe: ›Queen of Ruin‹ (Hachette)
© 2019 Tracy Banghart
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5081-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1 Serina
2 Nomi
3 Serina
4 Nomi
5 Serina
6 Nomi
7 Serina
8 Nomi
9 Serina
10 Nomi
11 Serina
12 Nomi
13 Serina
14 Nomi
15 Serina
16 Nomi
17 Serina
18 Nomi
19 Serina
20 Nomi
21 Serina
22 Nomi
23 Serina
24 Nomi
25 Serina
26 Nomi
27 Serina
28 Nomi
29 Serina
30 Nomi
31 Serina
32 Nomi
33 Serina
34 Nomi
35 Serina
36 Nomi
37 Serina
38 Nomi
39 Serina
40 Nomi
41 Serina
42 Nomi
1Serina
Mit jedem Atemzug schoss ein scharfer Schmerz durch Serina Tessaros gebrochene Rippe. Der kaum verheilte Schnitt an ihrem Arm brannte, die Schusswunde in ihrer Schulter pochte, und die Blutergüsse, die Kommandant Riccis Fäuste in seiner rasenden Wut hinterlassen hatten, taten immer noch weh. Genau genommen war es schwierig, eine Stelle zu finden, wo die Schmerzen nicht heiß und hungrig an ihr zehrten.
Doch die größte Qual bereitete ihr die Erinnerung an Jacanas leblosen Körper, an Oracles blicklose Augen und an die unzähligen Frauen, die in der Schlacht mutig gekämpft und doch ihr Leben verloren hatten.
Sie hätte wissen müssen, dass Überleben hier auf dem Berg des Verderbens Schmerz bedeutete.
Schon seit sie diese Insel betreten hatte, seit sie in Ketten hierher geschleppt worden war, weil sie angeblich lesen konnte – ein Verbrechen, das ihre Schwester begangen hatte, nicht sie selbst –, war sie davon umgeben gewesen. Der Schmerz, den ihr die Eisenfesseln an ihren Handgelenken zufügten und den sie im Klagen ihrer Mitgefangenen hörte. Der Schmerz, den es ihr bereitete, sich vor Kommandant Ricci ausziehen und von ihm untersuchen lassen zu müssen. Und dann war da auch noch das unerträgliche Leid, das die Kämpfe mit sich gebracht hatten – zusehen zu müssen, wie sich die Frauen im Kampf um Rationen gegenseitig umbrachten. Zusehen zu müssen, wie ihre Freundin Petrel starb. Als Serina an der Reihe gewesen war zu kämpfen, war ihr klargeworden, dass sie dazu nicht imstande war. Sie hatte sich lieber ergeben, als Anika, ein Mädchen aus dem Hotel Misery, zu töten. Und auch für diese Entscheidung hatte sie mit Schmerz bezahlt. Verbannung, Angriffe und letztendlich gestern Abend Kommandant Riccis Rache. Er hatte sie gefangen genommen, auf die Bühne gezerrt und sie dann vor die Wahl gestellt, gegen welche der Frauen sie kämpfen würde.
Als Serina ihm die Stirn geboten und sich geweigert hatte, gegen irgendeine der Frauen zu kämpfen, als sie stattdessen ihn herausgefordert hatte, gegen sie zu kämpfen, war sie fest davon ausgegangen, dass sie sterben würde.
Niemals hätte sie mit einer Rebellion gerechnet.
Doch Slash und die ganze Crew vom Hotel Misery hatten die Wachen angegriffen, Oracle und Ember hatten sich auf Kommandant Ricci gestürzt, und Serina hatte – im Gegensatz zu so vielen anderen – irgendwie die Nacht überlebt.
Jeder schmerzhafte Atemzug war ein Geschenk, das Oracle, Slash und all die anderen Frauen ihr gemacht hatten, indem sie die Wachen bekämpften statt einander. Während Serina das Blut vom Boden des Amphitheaters wischte, schwor sie sich eins: Sie würde nicht zulassen, dass sie umsonst gestorben waren. Und sie würde auch jene, die überlebt hatten, nicht enttäuschen.
Die ersten Sonnenstrahlen tanzten über die Insel wie Graces in goldenen Kleidern und sprenkelten jedes Blatt und jeden schroffen Felsen mit zarten Lichtmustern, während Serina und ihre Kameradinnen noch hart daran arbeiteten, jeden Hinweis auf das Gemetzel letzte Nacht zu tilgen. Die Leichen waren alle fort – die gefallenen Kriegerinnen waren dem Feuer des Vulkans und die Wachen den kalten Tiefen des Ozeans übergeben worden. Bald würden auch alle Blutspuren beseitigt sein.
Serina unterdrückte ein Stöhnen und richtete sich vorsichtig auf. Sonnenlicht wärmte ihr Gesicht. Neben ihr hievte Cliff einen Eimer mit rotgefärbtem Wasser hoch. Ihre breite, sonnengegerbte Stirn furchte sich – ob vor Konzentration oder Erschöpfung, konnte Serina nicht sagen. Die ältere Frau kümmerte sich um die Neulinge der Höhlencrew und war neben Oracle eine der Ersten, die Serina auf der Insel kennengelernt hatte.
Serina stockte der Atem. Sie erinnerte sich noch genau an jene Nacht – wie verängstigt sie gewesen war, schon bevor der Kampf losging und die Frauen sich gegenseitig umbrachten, um die Rationen für ihre Crew zu gewinnen. Wie allein sie sich gefühlt und wie sehr sie ihre Schwester vermisst hatte.
Daran hatte sich nichts geändert. Von Nomi getrennt zu sein schmerzte Serina noch viel mehr – und viel tiefer im Innern – als jede gebrochene Rippe oder Schussverletzung.
Cliff trug den Eimer zum Rand des halbzerstörten steinernen Amphitheaters, wo das gelbe Gras, die einzige Vegetation hier auf dem Berg des Verderbens, im Wind wogte. Eine andere Frau, gebeugt und sichtlich erschöpft von der Arbeit, sammelte die Stofffetzen auf, mit denen sie das Blut von den Steinen geschrubbt hatten. Serina wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
Nomi.
Serina brauchte einen Plan. Ihre Schwester saß in Bellaqua fest als eine der drei Graces des Thronerben. Vor gar nicht langer Zeit hatte sich Serina genau das gewünscht, was Nomi nun vergönnt war – ein Leben, erfüllt von Luxus und Schönheit, an der Seite des mächtigsten Mannes von ganz Viridia –, doch für ihre Schwester war dieses Leben ein ebenso schreckliches Gefängnis wie der Berg des Verderbens für sie. Und Serina war fest entschlossen, Nomi zu befreien.
Anika und Val erschienen am oberen Rand des Amphitheaters, mit einem rostigen Karren, auf dem sich einige Jutesäcke türmten; die Rationen, die Kommandant Ricci gehortet hatte. Als sie die Beute den Gang hinunter auf sie zuschoben, bildeten die Frauen hinter ihnen eine lange Schlange, vorbei an dem Vulkangestein, das sich über einen Bereich der Steinbänke ergossen hatte. Noch mehr kamen aus dem unteren Teil des Theaters herbei, wo eine Handvoll Frauen an der Mauer des Wachturms gelehnt hatte. Serina schätzte, dass noch etwa hundertfünfzig Frauen übrig und am Leben waren, vielleicht ein Dutzend mehr oder weniger. Und sie alle starrten die Jutesäcke hungrig an.
Val und Anika blieben stehen, als sie das Podest unten im Amphitheater erreichten.
Vals widerspenstige braune Haare kräuselten sich in alle Richtungen um sein braungebranntes Gesicht. Auf seinem Kiefer prangte ein dunkler Bluterguss, und sein Hals war mit Dreck beschmiert. Serina strahlte ihn dankbar an. Er hatte die Möglichkeit gehabt zu fliehen, sie zurückzulassen. Doch er hatte es nicht getan. Er war geblieben und hatte ihnen geholfen. Als er bemerkte, wie sie ihn ansah, entspannte er sich, und auf seinem Gesicht erschien ein Lächeln.
»Wie sollen wir die zusätzlichen Rationen verteilen?«, fragte Anika. Das Sonnenlicht überzog ihre tiefbraune Haut mit einem goldenen Schimmer. Ihr eines Auge war zugeschwollen, und einige Strähnen hatten sich aus ihren straffen Zöpfen gelöst, doch sie strahlte noch das gleiche Selbstvertrauen – den gleichen Widerstandswillen – aus wie von dem Moment an, als sie auf die Insel gekommen waren.
Serina hatte ein Gerücht gehört, dass die Frauen im Hotel Misery Anika hatten Shade nennen wollen, sie sich jedoch geweigert hatte, auf irgendeinen anderen Namen als Anika zu hören, weil dieser das Einzige war, was sie von ihrer Mutter je bekommen hatte.
Es war Anika, der sich Serina ergeben hatte, anstatt sie zu töten, als sie an der Reihe waren zu kämpfen. Dieser Moment hatte all das hier ins Rollen gebracht und eine Zielscheibe auf Serinas Rücken hinterlassen. Wenn Kommandant Ricci sie nicht zu einem weiteren Kampf gezwungen hätte, wäre es vielleicht nie zu diesem Aufstand gekommen.
»Das Essen wird leichter gerecht zu verteilen sein, wenn wir alle in einem Camp bleiben«, sagte Serina. »Denkst du, das Hotel Misery wäre groß genug für uns alle?« Sie hatten bereits eine Art Lazarett in einem der alten Ballsäle im ersten Stockwerk eingerichtet.
Serina wäre froh, wenn sie nie wieder auch nur eine Nacht in dem Lavatunnel verbringen müsste, den ihre Crew ihr Zuhause genannt hatte. Oracle hatten der Schwefelgestank, der vom Krater ausströmte, und die Nähe zum aktiven Teil des Vulkans offenbar nicht gestört, aber für Serina hatte es sich immer angefühlt, als würde der Fels sie niederdrücken, und sie hatte nie vergessen können, dass der Tunnel von fließender Lava ausgehöhlt worden war … was ihr vor Augen führte, dass der Vulkan jederzeit aufs Neue würde ausbrechen können.
Anika sah zu den anderen Frauen aus ihrer Crew. Nach dem Kampf, in dem Slash gefallen war, hatte Anika die Rolle der Anführerin vom Hotel Misery übernommen und ihren Kameradinnen Befehle erteilt, während sie Val half, die fünf noch lebenden Wärter in die Zellen auf dem Wachgelände zu schaffen.
Schließlich wandte sie sich wieder Serina zu und nickte. »Wir haben genug Platz.«
»Wie können wir der Crew vom Hotel Misery trauen?«, fragte jemand. »Sie werden uns alle im Schlaf umbringen.«
Serina fand den Ursprung der Stimme in der Menge – eine Frau in den Zwanzigern mit langen weißblonden Haaren und einem verkniffenen, vor Wut geröteten Gesicht.
»Wie heißt du?« Serina spannte die Muskeln in ihren Beinen an, um nicht ins Wanken zu geraten. Sie war so müde.
»Fox«, fauchte die Frau. »Ich führe die Dschungelcrew an, jetzt, wo Venom tot ist.« Ihr grimmiger Blick richtete sich auf Anika. »Dank ihr.«
»Venom hat auch viele von uns getötet«, erwiderte jemand anderes ebenso zornig. Lautes Stimmengewirr erhob sich, so beharrlich und wütend wie ein aufgescheuchter Wespenschwarm.
»Hey!«, rief Serina und hob die Hände, um für Ruhe zu sorgen. »Die Kämpfe wurden von Kommandant Ricci angeordnet, schon vergessen? Anika hat Venom nicht freiwillig getötet. Niemand von uns hat freiwillig getötet. Wir sind keine Feinde. Wir brauchen einander. Wir werden nur überleben, wenn wir zusammenarbeiten, wie wir es letzte Nacht getan haben.«
»Du denkst, wir werden überleben?« Claw, eine gnomenhafte Frau aus der Höhlencrew, stieß ein raues Lachen aus. »Wir haben nur wenig zu essen und keine Möglichkeit, mehr zu beschaffen. Wir werden alle hier sterben.«
Serina verschränkte die Arme vor der Brust und ignorierte den scharfen Schmerz, der durch ihren Oberkörper fuhr. »Nein, werden wir nicht. Die nächste Bootsladung Gefangene wird in ein, zwei Wochen ankommen. Mit Rationen. Wir können die Wachen überwältigen und uns das Essen holen. Wir können mit dem Schiff fliehen …«
Sie verstummte, als sie die Zuversicht auf einmal verließ. Wohin sollten sie gehen? Und was war mit Nomi?
Anika neigte den Kopf zur Seite. »Hatten die Wachen nicht ihre eigenen Boote? Können wir nicht die nehmen? Wir können jetzt gleich von diesem verdammten Felsen verschwinden und zu unseren Familien zurückkehren.«
»Meine Familie hat mich hierhergeschickt!«, schrie jemand.
»Es gibt keine Boote.« Val erhob die Stimme, um sich über den anschwellenden Lärm Gehör zu verschaffen. »Diese Insel war auch für die Wachen eine Strafe. Selbst für Kommandant Ricci. Wir haben den Regenten alle auf irgendeine Weise enttäuscht – zu skrupellos, nicht skrupellos genug. All seine gescheiterten Soldaten hat er hierhergeschickt. Wir hatten keine Boote, nicht einmal für eine Notfallevakuierung. Die Schiffe, in denen die Gefangenen ankommen, sind unser einziger Kontakt zur Außenwelt.«
Er sah Serina an, und in seinen Augen glitzerte eine unausgesprochene Frage.
Sie wusste, was er wissen wollte. Val hatte ein Boot, ein Geheimnis, das er jahrelang verborgen gehalten hatte. Sie hatten geplant, damit zu fliehen, nach Bellaqua zurückzukehren und Nomi zu retten. Ein diskretes Nicken von ihr, und er würde Schweigen bewahren. Das Boot würde ihr Geheimnis bleiben – und Serinas beste Chance, ihre Schwester wiederzusehen.
Gestern war sie drauf und dran gewesen zu verschwinden, aber sie hatte es nicht über sich gebracht, Jacana zurückzulassen, die ihr bei der Suche nach einem Fluchtweg geholfen hatte. Jetzt war Jacana tot. Serina hatte sie nicht retten können. Es gab nichts mehr, was sie zurückhielt, nichts, was sie daran hinderte, Vals Boot zu nehmen und ihre Schwester zu retten.
Nichts außer den Frauen auf dem Berg des Verderbens. Die Toten, wie Jacana und Oracle, die sie geschworen hatte zu rächen. Und die Lebenden, denen sie zur Freiheit verhelfen wollte, was immer es kostete.
Serina konnte sich nicht zu einem versteckten Boot davonstehlen und die Frauen zurücklassen. Nicht einmal für Nomi. Sie würde ihre Schwester aus den Fängen des Thronerben befreien, sie vor dem kalten, wachsamen Blick des Regenten in Sicherheit bringen. Aber nicht so.
»Es gibt ein Boot auf der Insel«, sagte sie, ohne den Blick von Val abzuwenden. Er nickte leicht, aber seine Brauen zogen sich zusammen – ein deutliches Zeichen, dass er ihren Kummer teilte. »Es ist klein, gerade mal groß genug für zwei oder drei Leute. Aber es könnte trotzdem von Nutzen sein.«
»Und woher weißt du von diesem Boot?«, fragte Anika mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen.
»Es gehört mir«, sagte Val. »Und es ist so gut versteckt, dass keiner der Wärter oder Gefangenen es finden konnte. Ich habe es auf die Insel geschmuggelt, um meine Mutter zu retten, die hier gefangen gehalten wurde, aber …« Seine Stimme stockte. »Als ich ankam, war sie schon fort.«
Anikas Misstrauen legte sich. Vals Antwort hatte sie sichtlich erschüttert.
»Aber … aber das verstehe ich nicht«, meldete sich eine der anderen Frauen mit leiser Stimme zu Wort. Theodora, die aufgrund ihrer hochgewachsenen, schlaksigen Statur und ihres runden, goldbraunen Gesichts inzwischen nur noch Doll genannt wurde. Sie war mit Serina auf der Insel angekommen und ebenfalls der Höhlencrew zugeteilt worden. »Was sollen wir machen, wenn das Schiff mit den Gefangenen kommt? Du sagtest, wir würden fliehen. Aber wohin?«
Serina öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, musste sich aber eingestehen, dass sie darauf keine Antwort hatte.
Val trat neben sie auf das Podest und wandte sich der Menge zu, die sich im Amphitheater drängte. Er räusperte sich. »Es gibt ein Land namens Azura, östlich von Viridia, jenseits der Gallatianischen See«, sagte er. »Mein Vater, ein Kaufmann, war einmal auf Geschäftsreise dort. Er hat mir erzählt, dass Frauen in Azura viel mehr Freiheiten haben – dass sie arbeiten, Grundbesitz haben und ihr Geld selbst verwalten dürfen. Sie können lesen. Die Grenze ist nicht weit von hier, doch abgesehen von der einen oder anderen Delegation, die der Regent zu sich einlädt, darf nicht nach Viridia eingereist werden. Doch ihre Grenze ist für uns nicht gesperrt.«
Val hatte Serina erzählt, dass sein Vater in Azura gewesen war. Dieses Erlebnis hatte ihn dazu inspiriert, seiner Frau Lesen beizubringen und mit ihrer Hilfe heimlich eine Schule für Mädchen in ihrem Haus einzurichten. Deswegen war er getötet und seine Frau auf den Berg des Verderbens geschickt worden.
»Und dort sollen wir hin?«, fragte Fox und strich sich die weißen Haare von ihrer gerunzelten Stirn. »Warum sollten sie uns aufnehmen?«
Val zuckte die Achseln. »Ich kann nicht sicher sagen, dass sie das tun würden. Aber es wäre sicherer, als hierzubleiben oder nach Viridia zurückzukehren.«
Dann werde ich gehen, dachte Serina. Wenn wir das Schiff haben, wenn die Frauen auf dem Weg nach Azura und in Sicherheit sind, wenn sie mich nicht mehr brauchen, werde ich Vals Boot nehmen und Nomi retten.
Aber was, wenn Nomi nicht gerettet werden wollte? Serina schürzte die Lippen. Es war durchaus möglich, dass ihre Schwester am Leben im Palast Gefallen gefunden hatte, dass sie ihre Rolle als Grace weniger schrecklich fand als gedacht. Aber das bezweifelte Serina stark. Als sie eine Grace hatte werden wollen, als sie ihrer Schwester gesagt hatte, dass sie dazu bereit war, hatte Nomi erwidert, dass das völlig belanglos war, wenn sie nicht nein sagen durfte.
Und sie hatte recht.
Es spielte keine Rolle, wie luxuriös Nomis Leben jetzt sein mochte. Serina würde ihr die Möglichkeit geben, selbst über ihr Leben zu entscheiden. Das war alles, was Nomi je gewollt hatte: ihr Schicksal selbst zu bestimmen.
Und genau das würde Serina ihrer Schwester ermöglichen, und wenn es sie umbrachte.
»Also werden wir das Gefangenenschiff nehmen«, rief Serina laut genug, um das skeptische Gemurmel der Frauen zu übertönen. »Wir fahren nach Azura. Und bauen uns dort ein neues Leben auf.«
Anikas Schultern sackten in sich zusammen. Serina bemerkte ihre Reaktion und fragte sich, warum sie so enttäuscht war. Ihr Blick wanderte über die Frauen vor ihr, von denen manche auf den Steinbänken saßen und andere auf dem erstarrten Vulkangestein standen, das eine Hälfte des kreisförmig angelegten Sitzbereichs bedeckte.
So viele ausgemergelte Gesichter, so viele Wunden und Prellungen, so viele eingesunkene Augen. Serina sah den Hunger, der ihr entgegenstarrte, und die Angst. Manche dieser Frauen waren seit Jahren hier, hatten unzählige Kämpfe mitangesehen, hatten unzählige Frauen sterben sehen.
»Ihr alle kämpft schon so lange«, sagte Serina, und die Worte blieben ihr fast in der Kehle stecken. »Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass es vorbei ist. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass es jetzt besser wird. Aber das wird es. Für die nächsten zehn Tage ist das unsere Insel. Genau wie unsere Namen, genau wie unser Leben. Wir haben uns die Freiheit verdient. Daran wird sich nie etwas ändern, ganz gleich, was uns in Azura erwartet.«
Die Stimmung heiterte sich sichtlich auf. Serina sah einen Funken Hoffnung inmitten der Erschöpfung, in einem Lächeln hier und da, in einigen Gesichtern, die nicht mehr ganz so schwermütig dreinblickten. Selbst die Anführerinnen der anderen Crews waren munterer geworden. Twigs muskulöse, an Eisenstangen erinnernde Arme hingen entspannt herunter. Über Blazes mit Narben bedecktes Gesicht huschte ein kleines Lächeln. Nur Anika sah immer noch bekümmert aus.
»Wir sind keine Gefangenen mehr«, sagte Serina und musste selbst schlucken. Selbst für sie, die gerade einmal ein paar Wochen auf der Insel war, fühlte sich diese Tatsache immer noch an wie ein Traum.
Sie wandte sich an Anika. »Kannst du dich darum kümmern, wer wo schläft, und das Essen verteilen? Val und ich sehen solange nach den Wachen.«
Anika straffte die Schultern und nickte. Sie schob den quietschenden Karren den Gang hinauf und rief den anderen Crews dabei Anweisungen zu: Bringt eure Verwundeten in den alten Ballsaal. Wenn ihr noch Rationen oder andere Sachen in eurem Camp habt, holt sie her. Wir haben nicht viele Zimmer – ihr werdet euch zu zweit eins teilen müssen.
Als Serina ihr folgen wollte, gaben ihre Beine fast unter ihr nach. Sie blieb einen Moment stehen, um sich zu fangen. Sie konnte es sich nicht leisten, jetzt zusammenzubrechen.
»Ich kann allein nach den Wachen sehen«, sagte Val und umfasste sanft ihren Arm. »Warum ruhst du dich nicht ein bisschen aus?«
Serina schüttelte den Kopf und humpelte den steilen Gang des Amphitheaters hoch, musste sich dabei aber auf seinen Arm stützen. »Bald.«
Er versuchte nicht, mit ihr zu diskutieren, was gut war, da sie vermutlich nicht die Kraft gehabt hätte, sich durchzusetzen. Wenn sie ehrlich war, hatte Serina Angst davor, langsamer zu machen. Sie wollte sich nicht ausruhen. Nicht innehalten. Wenn sie das tat, würde die Erinnerung an Jacanas zierlichen, gebrochenen Körper sie überwältigen.
Wenn sie Zeit zum Nachdenken hatte, würde sie in Reue ertrinken.
Und Jacana war nicht die Einzige, deren Tod sie verfolgen würde. Jedes Mal, wenn Serina eine Pause einlegte, jedes Mal, wenn sie sich nicht einzig und allein auf ihre nächste Aufgabe konzentrierte, sah sie, wie Oracles Kopf zurückgeworfen wurde, als die Kugel sie zwischen die Augen traf. Sie fühlte wieder das Gewicht ihres leblosen Körpers auf den Schultern, als sie den Vulkan erklommen hatten. Sie erinnerte sich an Slashs blutigen Leichnam zwischen all den Männern, die sie getötet hatte.
»Serina?«, fragte Val besorgt und drückte sanft ihren Arm.
Sie lehnte sich an ihn. »Ich bin so froh, dass du da bist.«
Sie folgten dem Pfad zum Hotel Misery, wo Anika auf dem rissigen Marmorrand eines ausgetrockneten Springbrunnens stand, Befehle rief und Essen austeilte, und weiter zum Wachgelände. Das Gebäude war trügerisch; als Serina auf der Insel angekommen war, hatte sie gedacht, sie würde dort eingesperrt werden wie eine Prinzessin in einem Turm. Aber die Anzahl der Gefangenen auf dem Berg des Verderbens hatte die Kapazität des Gebäudes schon lange vor ihrer Ankunft überstiegen; jetzt wurden die Zellen nur noch zur Lagerung von Waffen und Rationen benutzt und dienten den Wachen als Schlafräume.
Die wenigen Wachen, die den Aufstand überlebt hatten, waren in ihre »Schlafzimmer« gesperrt worden und die Räume somit zu ihrer ursprünglichen Funktion zurückgekehrt. Die Ironie war ihr nicht entgangen. Das Gewicht der Schlüssel zu ihren Zellen drückte gegen Serinas Oberschenkel. Sie griff in ihre Tasche und schloss ihre Finger um das kalte Metall.
»Du hast ihnen von dem Boot erzählt«, sagte Val, sobald sie außer Hörweite der anderen waren. »Was ist mit Nomi?«
»Ich werde sie befreien, aber jetzt noch nicht. Nicht bevor die anderen auf dem Weg nach Azura und in Sicherheit sind.« Sie rieb sich den Nacken. »Ich glaube, Anika hat auch eine Familie, um die sie sich sorgt. Und die anderen vielleicht auch. Wenn ich nach Viridia zurückkehre, und andere ebenfalls dorthin zurückwollen … dann wäre es nicht richtig, allein zu gehen und das Boot vor ihnen geheim zu halten.«
Val scharrte mit dem Stiefel über den steinigen Pfad. »Das Boot ist klein, Serina. Anika könnte mit uns kommen, aber sonst niemand.«
»Uns?« Ihr Fuß blieb an einem spitzen Felsen hängen, und sie stolperte.
Val zog sie näher an sich. »Ich gehe mit dir. Wann auch immer. Wohin auch immer.«
Serinas Herz machte einen Satz. »Brauchen sie dich nicht, um Azura zu finden? Um mit den Bewohnern zu verhandeln, wenn sie dort ankommen?«
Sie wollte ihn bei sich haben, wenn sie sich auf den Weg zu Nomi machte. Aber sie wollte auch, dass jede Frau auf der Insel den Weg in die Freiheit fand. Sie hatte angenommen, dass Val sie nach Azura bringen würde. Vielleicht würden Nomi und sie nachkommen, wenn es ihnen möglich war.
»Kommandant Ricci hat Karten. Manche dieser Frauen kommen aus Fischerfamilien. Selbst wenn sie keine Karte lesen können, kann ich es ihnen zeigen. Sie werden wissen, wie man das Schiff steuert.« Er strich ihr zärtlich über den Rücken. »Und was die Verhandlungen angeht – dafür werden sie keinen Mann brauchen. Sie werden für sich selbst sprechen wollen.«
Plötzlich war Serinas Kehle wie zugeschnürt, so viele Gefühle wallten gleichzeitig in ihr auf. »Ja«, brachte sie mit rauer, belegter Stimme heraus. »Sie wollen für sich selbst sprechen.«
Eine Weile gingen sie schweigend weiter, die Arme umeinandergeschlungen, sich gegenseitig stützend.
Schließlich tauchte der Gefängniskomplex vor ihnen auf, grau und imposant. Serina spürte immer noch ein Echo der Angst, die sie überkommen hatte, als sie den unebenen Pfad von der Anlegestelle hier herauf zum ersten Mal erklommen hatte und dieses mit Eisen vergitterte Monstrum über sich hatte aufragen sehen.
Ihr Blick huschte zum Meer, das sich so glitzernd blau bis zum Horizont erstreckte. Von hier aus konnte sie gerade so den Rand des Piers ausmachen, und dahinter …
»Val«, keuchte sie und blieb wie angewurzelt stehen. Ihr verstauchter Knöchel schrie vor Schmerz. Ihr Magen krampfte sich zusammen.
Sie bekam keine Luft.
Sie streckte eine zitternde Hand aus. »Val, sieh nur. Ein Schiff.«
2Nomi
Nomi stand an Bord des wogenden Decks, ihr schweres goldenes Kleid mit Blut verkrustet, und weinte hilflos, als vor ihr der dunkle Schatten der Gefängnisinsel auftauchte. Das war nicht die triumphale Rettungsmission, die sie sich vorgestellt hatte. Auf Nomi wartete ihre eigene kleine Zelle, ihr eigenes Leben (oder ihr Tod) in Gefangenschaft. Asa hatte versprochen, sie wieder mit Serina zu vereinen, aber sie hätte nicht gedacht, dass er das damit meinte. Nicht bis sie hatte mitansehen müssen, wie er seinem Vater die Kehle durchschnitt.
Maris, wie Nomi eine Grace des Thronerben, hatte es leider auch gesehen. Also hatte Asa sie beide als Gefangene fortgeschickt, damit er die Illusion aufrechterhalten konnte, sein älterer Bruder, der Thronerbe, hätte den Mord begangen. Jetzt lehnte Maris ein paar Schritte von Nomi entfernt zusammengesunken an der Reling, ihr schwarzes Haar völlig zerzaust, ihr rotes Kleid von Meerwasser durchnässt. Sie beugte sich über das Geländer und starrte in die vorbeirauschenden Fluten. Vielleicht wäre sie gesprungen, wenn ihre Handgelenke nicht ans Schiff gekettet wären. Sie hatte schon lange nichts mehr gesagt.
Nomi öffnete den Mund, um sie zu trösten, ihr Mut zu machen oder sich wenigstens erneut zu entschuldigen, doch der Wind raubte ihr den Atem. Vielleicht wusste er, dass alles, was sie zu sagen hatte, nur leere Worte waren.
Inzwischen hatten sie den Berg des Verderbens fast erreicht, sie konnte schon den ramponierten Betonpier sehen. Nomi atmete die Meeresluft tief ein und schluckte schwer.
Die Matrosen gingen zum Bug des Schiffes, wo Malachi lag. Der Thronerbe war nur ein zusammengesunkener Schatten an Deck, sein burgunderrotes Wams mit seinem eigenen Blut und dem Blut seines Vaters, des Regenten, getränkt. Asa hatte den Regenten getötet und auch Malachi zu töten versucht.
Nur weil Nomi Asa vertraut hatte, weil sie geglaubt hatte, er wäre ein besserer Thronerbe – ein besserer Regent. Wie sehr sie sich doch geirrt hatte.
Die Matrosen beugten sich über Malachis reglosen Körper.
»Fasst ihn nicht an!«, schrie Nomi heiser, wie sie es auf der Überfahrt schon ein Dutzend Mal getan hatte – und jedes Mal hatte sie verzweifelt gebetet, dass sie auf sie hören würden, dass sie sehen würden, wie sich seine Brust hob und senkte. Asa hatte seinen Männern befohlen, Malachi über Bord zu werfen, wenn er aufhörte zu atmen. Aber das war nicht passiert.
»Wir sollen ihn über Bord werfen, wenn er stirbt«, sagte einer der Matrosen – seine tiefe, grollende Stimme ging fast im ohrenbetäubenden Rattern des Dampfmotors unter. »Aber wir sind fast da, und er ist noch nicht tot.«
»Die Gefängniswärter wissen nichts von unseren Befehlen.« Der andere Matrose kratzte sich das stopplige Kinn. »Wir müssen weniger Fragen beantworten, wenn wir ihn jetzt noch schnell loswerden.«
Nomi schrie erneut, aber die Männer ignorierten sie einfach.
»Es ist zu spät«, flüsterte Maris. Ihre langen schwarzen Haare peitschten um ihre totenbleichen Wangen, und ihre toten dunklen Augen waren blutunterlaufen. Irgendwann auf der langen Reise hatten sie beide die Masken verloren, die sie auf dem Ball getragen hatten. Nomi konnte sich nicht erinnern, wann sie das unangenehm steife Material zum letzten Mal auf der Nase gespürt hatte. Sie konnte kaum glauben, dass der Ball gerade mal ein paar Stunden her war. Erst vor wenigen Stunden hatte sie ihrem Bruder gesagt, er solle sich in Sicherheit bringen, anstatt Asa zu helfen, seinem Bruder ein Verbrechen anzuhängen. Da hatte sie bereits gewusst, dass man Asa nicht trauen konnte, aber sie hatte keine Ahnung gehabt, wozu er fähig war. Jetzt wusste sie es. Sie hoffte inständig, dass Renzo auf sie gehört hatte. Denn wenn Asa ihn fand, würde er ihn töten – da war sie sich vollkommen sicher.
Die Matrosen hoben Malachi auf ihre Schultern. »Könnt ihr nicht sehen, dass er noch lebt?«, schrie Nomi verzweifelt, als sich seine Lider flatternd öffneten und ein schwaches Husten von ihm zu vernehmen war. Er war wach und rang nach Atem. Doch in diesem Moment warfen die Männer Malachi über Bord.
Ein Schluchzen entrang sich Nomis Kehle.
Ihre Ketten rasselten, als sie auf die Matrosen zustürzte und mit aller Kraft gegen die Fesseln ankämpfte. Die Haut an ihren Handgelenken riss auf und fing an zu bluten. »Ihr habt ihn getötet!«, schrie sie, immer und immer wieder. Die Matrosen ignorierten sie, und vielleicht sollten sie das auch. Sie wusste selbst nicht, ob sie mit ihnen oder mit sich selbst sprach.
Ihr habt ihn getötet.
Es war allein ihre Schuld. Sie hatte dem falschen Bruder vertraut. Asa hatte ihr die Freiheit versprochen, für sie und ihre Schwester. Er hatte versprochen, dass es keine Graces mehr geben würde, dass er die Regeln und Gesetze Viridias ändern würde. Er hatte gesagt, er würde dafür sorgen, dass Frauen mehr Rechte bekamen, dass sie lesen durften. Er hatte ihr genau das gesagt, was sie hören wollte. Und sie war darauf hereingefallen. Es war so leicht – zu leicht – gewesen zu glauben, dass Malachi genauso grausam und unberechenbar war wie sein Vater … weil Asa ihr genau das eingeredet hatte. Aber es war alles eine Lüge gewesen. In Wahrheit war Asa der Grausame, Unberechenbare von ihnen.
Der Mörder.
Malachis Worte ließen sie nicht los. Ich will niemanden zwingen, meine Grace zu sein. Ich werde dich nicht länger hier festhalten. Das war das Letzte, was er zu ihr gesagt hatte, und mit diesen Worten hatte er sie aller Pflichten entbunden. Er würde sie nicht zwingen, eine Grace zu sein.
Und jetzt war er tot.
Das Schiff legte mit einem Ruck am Pier an. Nomis Beine gaben unter ihr nach, doch der steife Brokatstoff ihres Kleides hielt sie aufrecht. Die Matrosen nahmen erst Maris, dann Nomi die Handschellen ab. Nomi spuckte dem, der ihr am nächsten stand, ins Gesicht, woraufhin er sie so hart in Richtung Landungsbrücke stieß, dass sie stolperte. Maris hielt ihren Rücken erbarmungslos gerade, aber über ihre Wangen strömten Tränen. Der Anblick brach Nomi das Herz. Maris hätte nie in diese ganze Sache verwickelt werden dürfen. Sie sollte nicht hier sein. Sie hatte nichts getan, womit sie dieses Leid verdient hätte – sie war nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Doch Maris hatte recht. Es war zu spät.
Die Matrosen schleiften Nomi und Maris an Land. Am Rand des Piers wartete bereits ein Gefängniswärter, die Mütze tief ins Gesicht gezogen.
»Das Schiff ist kleiner als sonst«, sagte er barsch. »Und die Ladung anscheinend auch. Nur zwei Gefangene?«
Der Matrose, der Nomi am Arm festhielt, zuckte die Achseln. »Ja. Na und?«
»Und die Rationen?«, fragte der Gefängniswärter, als die Matrosen Nomi und Maris vor ihm abluden.
Der andere Matrose kratzte sich am Nacken. »Rationen? Uns wurde nur gesagt, dass wir diese Mädchen herbringen sollen. Niemand hat irgendwas von Rationen gesagt.«
»Habt ihr die Aufnahmepapiere?« Der Wärter streckte die Hand aus, nun hörbar ungeduldig.
Nomi fragte sich, was wohl passieren würde, wenn sie die Wahrheit herausschrie – dass Asa den Regenten ermordet und sie hergeschickt hatte, damit sie ihn nicht verraten konnten. Den Gefängniswärter würde das wahrscheinlich kaum kümmern.
»Papiere haben wir auch keine«, sagte der Matrose neben ihr mit einem Achselzucken. »Die beiden kamen aus dem Palazzo. Keine Ahnung, wie das normalerweise läuft, aber uns wurde gesagt, wir sollen sie herbringen. Was wir hiermit getan haben.« Er wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. »Jetzt sind sie dein Problem.«
Der Wärter beäugte argwöhnisch das Blut auf Nomis Kleid und Maris’ aschfahle Wangen. Hatte er Angst, das könnte eine Falle sein? Als könnten sie irgendjemandem gefährlich werden … Doch nachdem er das Schiff noch einmal gründlich in Augenschein genommen hatte, entließ er die Matrosen mit einem knappen Nicken. Nomis Lungen zogen sich zusammen, eingeschnürt von ihrem Korsett und der kalten Angst, die sie durchlief. Sie stemmte die Hände in die Hüften. Wenn sie sich doch nur von diesem Kleid befreien könnte – von all diesen Fehlern, diesem Leben. Ihre Finger stießen auf ein Loch im Stoff; es dauerte einen Moment, bis ihr einfiel, dass Asa auch sie fast erstochen hatte. Er hätte sie genauso skrupellos getötet, wie er Malachi getötet hatte – ein Schluchzen stieg aus ihrer Kehle auf –, wenn das Korsett, das sie spätestens jetzt umzubringen schien, nicht gewesen wäre.
Sie konnte noch immer die kalten Augen des Regenten vor sich sehen, wie sie blicklos ins Leere starrten, seine Kehle rot vor Blut.
»Kommt mit«, sagte der Gefängniswärter schroff. Als er Maris am Arm packte, wimmerte sie leise.
Nomi warf einen letzten Blick auf das Schiff und die stürmische See jenseits des Piers. Die Matrosen beobachteten sie immer noch, selbst während sie sich auf die Rückreise vorbereiteten. Keine Spur von Malachi. Nomi wandte sich ab und schlurfte Maris und dem Gefängniswärter langsam widerwillig hinterher. Das Einzige, was sie davon abhielt, sich in die tosenden Fluten zu stürzen, war die Hoffnung, dass sie Serina bald wiedersehen würde.
Bitte.
Der Wärter schritt rasch aus und zog Maris einen steilen Pfad hinauf. Dabei sah er immer wieder zu Nomi zurück, die Hand griffbereit an seiner Waffe. Sein Blick warnte sie, sich nicht zu weit zurückfallen zu lassen.
Das Licht der Sonne wärmte die geschwärzten Klippen, die sich am Rand des Pfades erhoben, und schon bald kam Nomi in ihrem bleischweren Kleid ins Schwitzen. Der unebene Boden war keine Hilfe; ständig blieben ihre Schuhe an dem ungewohnt rauen Gestein hängen. Zweimal knickte sie mit dem Fuß um.
Ein Stück vor ihr erhob sich das Gefängnis aus dem Fels wie ein Krebsgeschwür, die vergitterten Fenster und Betonmauern wirkten auf dem grazil geformten Vulkangestein seltsam unnatürlich.
Vor dem Stacheldrahtzaun, der das Gelände umgab, stand jemand. Zuerst dachte Nomi, es wäre ein Wärter. Aber irgendetwas an der Gestalt – sie konnte nicht ganz an Maris vorbeisehen – kam ihr bekannt vor …
»Wir sind außer Sichtweite der Matrosen«, sagte der Wärter und ließ Maris’ Arm los. »Ihr seid sicher.«
»Sicher?«, fragte Maris ungläubig, wich ein Stück vor ihm zurück und gab Nomis Sicht frei. Endlich erkannte sie, wer dort auf sie wartete.
Die Frau warf ihren Pferdeschwanz über die Schulter zurück – eine Bewegung, die Nomi so vertraut war, dass sie sie oft unbewusst nachmachte.
Erstaunen durchzuckte Nomis Körper, jeder Nerv schien unter Strom zu stehen. Von einem Moment auf den anderen vergaß sie den Wärter, die Matrosen, Renzo, Maris, Malachi.
Das Einzige, was sie noch sah, war ihre Schwester.
»Serina!«
Sie raffte ihre Röcke, schob sich an Maris vorbei und rannte los.
»Nomi?«, keuchte Serina mit weit aufgerissenen Augen, und noch im selben Moment warf sich Nomi ihr mit einem Freudenschrei in die Arme.
Die Wucht ihrer Umarmung ließ Serina einen Schritt zurücktaumeln. Aber Nomi konnte sich nicht beruhigen. Sie konnte nicht loslassen.
»Serina. Serina!« Der Name ihrer Schwester schmeckte so süß auf ihrer Zunge wie ein erhörtes Gebet.
»Wie kommst du hierher?«, rief Serina aus und schlang die Arme um ihre Schwester. »Du bist verletzt. Bist du verletzt? Da ist Blut auf deinem Kleid …«
»Mir geht’s gut. Das ist nicht meins. Ich bin …«
»Du bist hier. Du bist wirklich hier.«
Offenbar konnte keine von ihnen einen klaren Gedanken fassen. Nomi sank an Serinas Brust und atmete zum ersten Mal seit Monaten frei auf. Nichts anderes zählte. Die ganze Welt verschwamm zu einem diffusen, vergessenen Traum. Nichts war real außer Serina, die sie in den Armen hielt.
Nomi kamen die Tränen.
»Es tut mir so leid, dass ich das Buch genommen habe«, schluchzte sie, das Gesicht an Serinas Schulter vergraben. »Ich hatte keine Ahnung. Ich …«
»Schon gut, schon gut. Mir tut es auch leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich habe die Dinge nicht so gesehen wie du, aber jetzt schon. Ich …« Serina umarmte sie noch fester. »So viel von dem, was geschehen ist, haben wir dir zu verdanken.«
Irgendetwas in Nomis Innern zerbrach. Ihre Schwester sagte das, als wäre es etwas Gutes, als wäre das, was ihretwegen geschehen war, gut. Doch Nomi hatte zugesehen, wie der Regent ermordet worden war. Sie hatte das Blut des Thronerben an ihren Händen gespürt. Sie hatte Renzo mit einer Zielscheibe auf dem Rücken zur Flucht gezwungen. Daran – an ihr war nichts Gutes.
»Oh, Serina. Wenn du wüsstest …« Nomi setzte dazu an, ihr alles zu erzählen, was geschehen war, all die schrecklichen, schändlichen Dinge, die sie getan hatte.
»Schhh«, unterbrach Serina sie sanft. »Das spielt keine Rolle. Jetzt bist du hier. Du bist in Sicherheit. Wir beide sind in Sicherheit.«
Da lichtete sich der Schleier langsam, und die Realität brach hindurch. Nomi löste sich ein Stück von Serina. Die Haare ihrer Schwester waren zu einem unordentlichen Zopf zusammengebunden, ihr Gesicht war geschwollen und mit Schrammen und Prellungen übersät. Sie unterschied sich so sehr von der perfekt zurechtgemachten, beherrschten Serina, die Nomi kannte, dass sie sich fragte, wie sie ihre Schwester überhaupt wiedererkannt hatte.
»Wir sind in Sicherheit? Wie das?«, fragte Nomi und starrte entsetzt auf Serinas Wunden. Wunden. Ihre Kleidung war zerrissen und blutbefleckt. Wo war ihre Zelle? Und die Gefängniswärter? Der Wärter, der sie vom Schiff abgeholt hatte …
Sie wollte sich nach ihm umdrehen, doch Serinas Gesichtsausdruck, die Mischung aus Erschöpfung und Stolz, der in ihren Augen aufleuchtete, ließ sie innehalten.
»Wir sind sicher«, sagte Serina. »Jedenfalls fürs Erste. Die Frauen auf dem Berg des Verderbens haben rebelliert. Wir sind keine Gefangenen mehr. Wir sind frei.«
Für einen Moment verschlug es Nomi die Sprache. Erneut starrte sie die dunkelvioletten Prellungen in Serinas Gesicht an. »Ihr seid frei? Du siehst aus, als wärst du verprügelt worden.«
»Das bin ich auch. Aber ich hab mich gewehrt«, sagte Serina. »Ich bin jetzt eine Rebellin, genau wie du.«
Während diese radikalen Worte noch in ihr nachklangen, fiel Nomi auf, wie selbstsicher und respekteinflößend ihre Schwester wirkte, und erinnerte sich an ihre kraftvolle Umarmung. »Ich … ich glaube, du bist noch weit mehr«, sagte sie mit zittriger Stimme.
Serina grinste.
Nomi erwiderte ihr Lächeln, aber es verblasste schnell. Serina wusste noch nicht, warum sie hier war. Sie wusste nicht, was Nomi getan hatte. Sie wusste nichts von Malachi oder warum Nomis Kleid mit seinem Blut bedeckt war.
»Serina, ich …«
»Das ist Val«, sagte Serina und deutete auf den Wärter. Auf seinem Gesicht zeigte sich ein erstaunlich freundliches Lächeln, das Nomi überhaupt nicht einordnen konnte. »Er hat uns geholfen … Er ist … nun, kein richtiger Wärter, wie sich herausgestellt hat.« Serina tauschte ein wissendes Grinsen mit dem jungen Mann aus.
Nomi winkte ihm etwas unbeholfen zu. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sie schreckliche Angst vor ihm gehabt. Alles in ihr warnte sie, dass er sich immer noch als Bedrohung herausstellen könnte.
»Es ist wirklich Pech, dass wir nicht schon vorher von dem Schiff erfahren haben«, sagte Val und nahm die Hand von seiner Waffe. »Es waren nur zwei Matrosen an Bord.«
»Nur zwei?«, wiederholte Serina sichtlich verblüfft. »Aber dann hätten wir es uns holen können, wir hätten von hier verschwinden können, jetzt gleich. Warum hast du …?«
»… sie nicht umgebracht?«, unterbrach er sie, und sein gesamter Körper versteifte sich. »Sie waren unschuldig, Serina. Das waren nicht die üblichen Wachen – sie hatten keine Ahnung, wie eine Gefangenenübergabe abläuft.«
Nomi wollte ihm sagen, dass die Matrosen nicht unschuldig waren – dass sie den Throneben getötet hatten –, aber sie verstand nicht, worüber die beiden redeten oder warum ihre Schwester trotzig das Kinn vorschob.
»Aber wir hätten noch heute von dieser Insel verschwinden können«, sagte sie in wehmütigem, aber auch ungeduldigem Ton.
»Wir sind noch nicht bereit.« Val blickte zu Nomi und Maris. »Wäre dieses Schiff nicht zum Palazzo zurückgekehrt, hätten wir nur noch ein paar Stunden gehabt, bevor der Regent jemanden herschickt, um nach dem Rechten zu sehen.«
Val trat einen Schritt auf Serina zu, und irgendetwas in seinem Gesicht warf in Nomi die Frage auf, was für eine Beziehung die beiden zueinander hatten. Warum machte es ihm so viel aus, dass Serina enttäuscht von ihm war? »Es tut mir leid. Ich musste schnell eine Entscheidung treffen.«
Serinas Gesichtsausdruck wurde sanfter. »Ist schon in Ordnung. Du hast uns mehr Zeit verschafft. Das ist gut. Wir können bei unserem ursprünglichen Plan bleiben.«
Nomi wollte gerade fragen, was für einen Plan sie meinte, als Serina sich an Maris wandte.
»Maris? Das ist dein Name, richtig?«, fragte sie. »Ich erinnere mich an dich. Du bist auch eine Grace des Thronerben.«
»Nicht mehr«, sagte Maris ausdruckslos. »Der Thronerbe ist tot. Und sein Vater auch. Jetzt regiert Asa.«
Unzählige Fragen blitzten in Serinas Augen auf.
»Ich erkläre dir alles«, sagte Nomi. Sie musste ihrer Schwester auch noch von Renzo erzählen. Ein Schluchzen drohte ihre Stimme zu ersticken. »Es … es ist viel passiert.«
»Grace! Grace!« Eine junge Frau eilte den Pfad hinunter auf sie zu, ihre sommersprossigen Wangen von der Anstrengung gerötet. »Wir brauchen dich.«
Serina wandte den Blick widerwillig von Nomi ab. »Was ist passiert, Mirror?«
Grace? Mirror?
Mirror hielt einen Moment inne und beäugte Nomi und Maris argwöhnisch. »Wer seid ihr?«
»Ein Schiff hat unangekündigt hier angelegt …« Serina unterbrach sich. »Es ist kompliziert.«
»Das auch.« Mirror deutete zum Pfad.
Serina und Val folgten ihr.
Nomi hastete ihnen nach – auch wenn sie nicht verstand, was vor sich ging, schlug ihr Herz schneller. Maris hielt Nomis Arm umklammert, als hätte sie Angst loszulassen.
»Du hast deine Schwester gefunden«, murmelte sie. »Das ist wenigstens etwas.«
»Das ist der reinste Wahnsinn«, erwiderte Nomi.
Das schwarze Vulkangestein stieg an und fiel wieder ab, für immer in seinem Ansturm erstarrt. Hier und da streckten sich Bäume aus kleinen Löchern dem Himmel entgegen, und ein robustes gelbes Gras wuchs überall, wo es Halt fand. Sie gingen an dem furchteinflößenden Gebäude vorbei, das Nomi für das Gefängnis gehalten hatte. Ein paar Minuten später kam ein anderes großes Gebäude in Sicht, das zum größten Teil eingestürzt war, aber dennoch eine gewisse Schönheit ausstrahlte. Davor stand ein zerborstener Springbrunnen aus Marmor. Eindeutig kein Gefängnis.
Serina und Mirror wurden langsamer.
»Hier lang«, sagte Mirror, und die anderen folgten ihr in den Schatten eines gigantischen, mit Marmor verkleideten Saals, der aussah, als wäre er früher einmal das Foyer eines teuren Hotels gewesen. In der Mitte drängte sich eine große Gruppe von Frauen um etwas auf dem Boden.
»Was ist los?«, fragte Serina. Die Frauen machten ihr Platz. Nomi und Maris blieben ein Stück abseits stehen. Aber sie waren nah genug, um Serinas überraschtes Keuchen zu hören und ihren erschrockenen Ausruf: »Ich kenne ihn! Das ist der Thronerbe!«
Nomi wurde einen Moment schwarz vor Augen. Dann drängte sie sich durch die Menge, ohne auf das ärgerliche Fauchen der Frauen und die als Gegenreaktion ausgefahrenen Ellbogen zu achten, bis sie endlich sehen konnte, was die anderen vor sich hatten. Den Mann, der dort auf dem Boden lag.
Sie fiel neben ihm auf die Knie. Wasser sammelte sich unter ihm und durchnässte ihre schweren Röcke. Hinter ihr erhob sich aufgeregtes Gemurmel: »Malachi.« »Der Thronerbe.« »Ist er tot?«
Nomis Hände huschten über Malachis Brust, seine totenblassen Wangen, seine geschlossenen Lider, die vor Kälte lila angelaufen waren. Er war tot. War er tot?
»Was ist passiert? Wo habt ihr ihn gefunden?«, fragte Serina.
Ein anderes Mädchen antwortete: »Er lag am Strand südlich des Piers. Mit einer ziemlich üblen Stichwunde in der Seite.«
»Er war mit uns auf dem Schiff«, flüsterte Nomi. »Sie … sie haben ihn über Bord geworfen.«
Und da sah sie es, so schwer auszumachen, dass es ihr wahrscheinlich entgangen wäre, hätte sie nicht danach Ausschau gehalten und inständig darauf gehofft; das ganz leichte Auf und Ab seiner Brust. »Er lebt noch.« Die Worte kamen ihr kaum über die Lippen.
»Maris hat gesagt, er sei tot. Und der Regent auch. Was ist passiert?« Serina ging neben Nomi in die Hocke und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Ich wollte dich retten«, stieß Nomi hastig hervor. »Ich dachte, ich könnte … ich dachte, ich würde Viridia verändern. Aber Malachis Bruder hat mich betrogen. Er … er hat seinen eigenen Vater ermordet. Und Malachi … Was Maris gesagt hat, ist wahr. Asa ist der neue Regent.« Die Worte blieben ihr fast in der Kehle stecken, schmerzhaft wie Messerstiche. »Und das ist meine Schuld.«
»Asa hat versucht, seinen eigenen Bruder umzubringen?«, fragte Serina und blickte mit schreckgeweiteten Augen auf Malachi hinunter.
»Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, wird er Erfolg haben«, erwiderte Nomi. Malachi hatte zu viel Blut verloren, er hatte schon zu lange gelitten. Er war stark, aber selbst er konnte in diesem Zustand nicht ewig durchhalten.
»Gut«, erklang eine barsche Stimme aus der Menge. »Lasst sie alle sterben.«
»Sein Vater hat meinen Cousin getötet«, stimmte jemand zu.
»Sein Vater hat meine Schwester zu seiner Grace gemacht. Zwei Jahre später ist sie bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Wir sollten seinen Sohn auch sterben lassen.«
Nomi strich mit den Fingerspitzen über Malachis kalte Wange. Nein. Nein, er darf nicht sterben.
»Lasst ihn sterben!« Immer mehr Frauen stimmten in den Chor mit ein. Die Worte hallten überall um sie herum wider, dröhnten ihr in den Ohren.
»Nein!«, schrie sie schließlich, lauter als alle anderen. Urplötzlich trat Stille ein. Sie stand nicht auf. Sie sah die Frauen nicht an, die sich um sie scharten. Sie wendete den Blick keine Sekunde von Malachis sich leicht hebender und senkender Brust und dem schwachen Puls an seinem Hals ab.
»Ihr wollt nicht, dass dieser Mann stirbt«, sagte sie, klar und nachdrücklich.
Sie wusste, was keine von ihnen wusste. Sie hatte Asas Gesicht gesehen, nachdem er seinen Vater ermordet hatte. Die Leere in seinen Augen, das Fehlen jeglichen Bedauerns. Sie wusste, wie gut er darin war, andere zu benutzen.
»Ihr glaubt, der Regent war schlimm?«, fuhr sie fort, und in ihrer Stimme schwang eine düstere Überzeugung mit. »Ihr denkt, er war launisch und grausam? Ihr habt ja keine Ahnung. Sein Sohn Asa hat ihn, seinen eigenen Vater, kaltblütig ermordet. Asa hat mir wochenlang etwas vorgemacht, mich glauben lassen, dass er das Gleiche will wie ich: dass die Frauen in diesem Land frei sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Er hat mich so vollkommen von seinen guten Absichten überzeugt, dass ich ihm geholfen habe, mit Hilfe einer List Malachis Platz als Thronerbe einzunehmen. Er hat mir weisgemacht, Malachi wäre genauso aufbrausend und brutal wie sein Vater. Aber das ist er nicht. Er ist nicht wie sein Vater.« Die Worte strömten nur so aus ihr heraus, als sich ihre Wut Bahn brach. Nomi stand auf und wandte sich an Serina. »Ihr könnt ihn nicht sterben lassen. Er ist der Einzige, der Asa aufhalten kann. Und glaub mir, Serina, Asa muss aufgehalten werden.«
Ihr Herz schlug so heftig, dass sie es hämmern hörte.
Serina blickte sich um, sah die Frauen, die sie umzingelten, durchdringend an. »Nomi …«, sagte sie, und Nomi konnte genauso deutlich wie sie die Mordlust in ihren Augen erkennen. Diese Frauen hatten gelitten. Und sie wollten, dass der Thronerbe ebenso litt.
Nomi umfasste Serinas Hände. Sie verstand nicht, was hier vor sich ging, warum diese Frauen auf ihre Schwester zu hören schienen. Aber sie warteten alle ab, was Serina zu sagen hatte. »Malachi verdient es nicht zu sterben«, sagte Nomi, leiser diesmal. »Er ist nur meinetwegen in dieser Situation. Sein Blut klebt an meinen Händen. Ich kann ihn nicht sterben lassen.«
Serina sah einen langen Moment auf Malachis bewusstlosen Körper hinab. Dann richtete sie sich auf, zuckte bei der Bewegung leicht zusammen und drückte eine Hand an ihre Seite. Als sie das Wort ergriff, sprach sie mit fester, eindringlicher Stimme und einem Ausdruck im Gesicht, den Nomi noch nie zuvor an ihr gesehen hatte: hart und lodernd, ohne auch nur eine Spur ihrer früheren Beherrschtheit. »Das ist meine Schwester, Nomi. Sie hat im Palazzo gelebt. Wenn sie sagt, dass der Thronerbe überleben muss, dann dürfen wir ihn nicht sterben lassen.«
»Was, wenn sie sich irrt? Was, wenn er genauso schlimm ist wie der Rest?«, fragte ein Mädchen mit einer geschwollenen Wange und verschränkte die Arme vor der Brust.
Nomi wollte ihr sagen, dass er das ganz sicher nicht war, wollte ihnen allen erzählen, was er auf dem Maskenball zu ihr gesagt hatte. Dass er bereit war, sie aus ihrem Dienst als Grace zu entlassen, wenn sie es wünschte.
Doch Serina kam ihr zuvor. »Sie ist meine Schwester, Anika. Ich vertraue ihr, und wir werden versuchen, sein Leben zu retten. Vielleicht stirbt er trotzdem. Wenn er überlebt, wenn er sich erholt, werden wir ihn im Auge behalten. Denn der Berg des Verderbens steht ihm nicht zu. Wenn er uns auf irgendeine Weise bedroht … wenn er nicht der Mann ist, als den meine Schwester ihn beschreibt, werden wir ihn eigenhändig töten. Das ist unsere Insel, für die wir geblutet haben, für die wir gestorben sind. Wir werden sie ihm nicht überlassen.«
Nomi starrte Serina an, als wäre sie eine Fremde. Ihre Schwester hatte jede Zartheit verloren, jedes Anzeichen von Unterwürfigkeit. Sie ähnelte längst keiner Grace mehr. Statt von Tanzschritten und Gesichtscremes sprach sie von Blut und Tod. Von Mord.
Und die Wahrheit, die Nomi vom ersten Moment ihres Wiedersehens an gedämmert hatte, wurde nun zur Gewissheit: Serina war eine Kriegerin geworden.
»Bist du … bist du ihre Anführerin?«, fragte Nomi erstaunt.
»Sie ist der Grund dafür, dass wir frei sind«, sagte Anika. »Die Wärter haben uns gezwungen, gegeneinander zu kämpfen. Einander zu töten.«
Ihre Worte raubten Nomi den Atem. Dazu hatte ihr Geheimnis Serina verdammt? Serina war hier, weil sie angeblich ein Buch gestohlen hatte, weil sie angeblich lesen konnte – aber diese Verbrechen hatte Nomi begangen. Sie hätte auch die Strafe verbüßen müssen.
»Deine Schwester hat sich geweigert, mich zu töten«, fuhr Anika fort. »Grace sollte mir den Todesstoß versetzen. Ihre Crew hätte die Rationen bekommen, aber stattdessen hat sie sich ergeben. Sie hat sich geweigert zu kämpfen. Das hat noch nie jemand gewagt.« Sie warf einen Blick auf Serina, die immer noch an Malachis Seite stand. »Sie hat alles auf den Kopf gestellt. Und dadurch einige der Clans dazu gebracht, zusammenzuarbeiten, zurückzuschlagen. Wir haben gewonnen.«
»Ich verstehe das nicht«, sagte Maris mit rauer, brüchiger Stimme, als wäre sie den Tränen nah. »Sie haben euch gezwungen, einander zu töten?«
»Serina wurde hierhergeschickt, weil sie angeblich lesen kann«, fügte Nomi hinzu. »Wie kann … wie …«
»Wie kann das mit dem Tod bestraft werden?«, beendete Anika ihren Satz. Ihre dunklen Augen wurden schmal. »Dieses Gefängnis ist nicht nur für Mörderinnen und Verräterinnen, begreifst du das denn nicht? Es ist für alle Frauen, die sich dem kranken System von Viridia widersetzen, wenn auch nur auf geringfügige Art. Es ist für alle Ungehorsamen.«
Und da begriff Nomi es endlich. Sie dachte an die Königinnen von Viridia – wie sie aus der Geschichtsschreibung getilgt worden waren. Wie die Regenten damals wie heute versucht hatten, jedes noch so kleine Anzeichen von Unabhängigkeit oder Widerstand der Frauen in diesem Land im Keim zu ersticken.
»Wie hast du dich widersetzt?«, fragte sie und blickte hoch in Anikas kantiges Gesicht.
Anikas Lippen verzogen sich zu einem grimmigen Grinsen. »Nun ja, ich war eine der Mörderinnen.«
Maris entfuhr ein ersticktes Keuchen.
»Als Mädchen kann man sich in diesem Land auch nicht verteidigen.« Anikas Gesicht verfinsterte sich.
In der Stille, die auf ihre Worte folgte, stieß Malachi ein Stöhnen aus.
3Serina
»Bitte, hilf ihm«, flehte Nomi.
Serina betrachtete Nomis zerzauste Haare, die sich größtenteils aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hatten. Ihre glatte, makellose Haut, ihre sanften bernsteinfarbenen Augen. Ihre einer Grace würdige Haltung.
![Iron Flowers. Die Rebellinnen [Band 1] - Tracy Banghart - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/905bf1352a93f652b564f95be1eadaf1/w200_u90.jpg)
![Iron Flowers. Die Kriegerinnen [Band 2] - Tracy Banghart - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/83a79142053dc5fac6ebe98f91480e78/w200_u90.jpg)