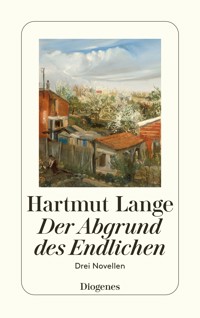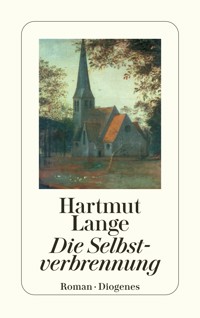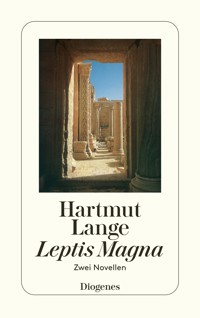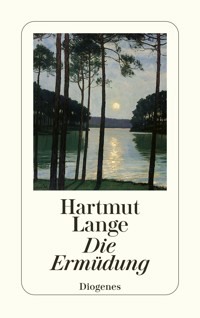14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Irrtum als Erkenntnis – eine intellektuelle Autobiographie, die sich mit den prägenden Ideologien und Glaubensfragen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt. Teil i beschreibt den Bildungsweg eines Außenseiters in der ddr. Teil ii versammelt Essays und Aphorismen von kristalliner Schönheit und Gedankenschärfe. Teil iii umfaßt drei Vorträge, die im wesentlichen um Sinn und Aufgabe von Kunst und Wissenschaft heute kreisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hartmut Lange
Irrtum als Erkenntnis
Meine Realitätserfahrung als Schriftsteller
Diogenes
Meine Realitätserfahrung als Schriftsteller
Wie kommt man zum Schreiben? Ausgangspunkt: Die naive Vorstellungswelt.
Wie kommt man zum Schreiben! Diese Frage muß der Schriftsteller bei Diskussionen immer wieder beantworten, offensichtlich vermutet man da ein Geheimnis. Es gibt aber kein Geheimnis. Zunächst könnte man sagen: Jeder von uns hat die Fähigkeit, ja er wird geradezu gezwungen, einen Wechsel von der tatsächlichen Welt in die Vorstellungswelt zu vollziehen. Montaigne umschreibt dies klar mit seiner Bemerkung: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns ein Leben lang umtreiben, sondern es sind die Vorstellungen, die wir uns von den Dingen machen.
Trotzdem gilt die landläufige Meinung, der Mensch sei vor allem ein erkennendes Wesen und er müsse, was seiner Vorstellungswelt angehört, durch den Begriff hinwegleuchten. Das auf Erkenntnis ausgerichtete Denken gilt mehr als das spekulative Denken der Phantasie. Das war nicht immer so. In der Antike waren Erkenntniswelt und Vorstellungswelt ununterscheidbar. Wir wissen, daß Homers Ilias den Griechen als wissenschaftliche Geschichte galt ebenso wie den Römern die Werke des Tacitus, der munter Legenden und Fakten durcheinandermischte, oder die Schriften des Polybius, der alle mediterranen Vorgänge seit Alexander und Hannibal harmonisch aufeinander abstimmte. Ähnlich verfährt die römische materialistische Philosophie. De rerum natura von Lukrez, in Hexametern geschrieben, behandelt die Bewegungen der Materie ganz so wie die Bewegung der vorgestellten Götter. »Wie Zeus«, schrieb Marx, »unter den tosenden Waffenkämpfen der Kureten aufwuchs, so hier die Welt unter dem klingenden Kampfspiel der Atome.« Marx nannte die Antike »die natürliche Kindheit der Menschheit«, und auch die Scholastik des Mittelalters betrieb Wissenschaft einzig zu dem Zweck, die Vorstellungswelt des Christentums begrifflich zu untermauern.
Das erste ernsthafte Auseinanderdriften von Erkenntnis und Vorstellung begann mit dem Satz: »Ich denke, also bin ich.« Descartes hat den Wahrheitsgrund des Menschen über die Grenze zum Intellekt verschoben. Und für Spinoza sind Realität und Gottesbegriff schon identisch. Hegel geht einen Schritt weiter. Erst seit Hegels Philosophie wird die Vorstellungswelt, auch wo sie im Absoluten, also bei Gott, endet, mit dem Erkennen gleichgesetzt, und nach Hegel haben die Wissenschaften unter dem Einfluß des Positivismus jeden spekulativen Ansatz gestrichen.
Heute, im wissenschaftlichen Zeitalter, leben wir unter dem rationalistischen Verdikt, daß mit dem Erkennbaren auch alle Realität endet und daß nur das Erkennbare, nicht das Unerkennbare, dem Wahrheitsgrund der menschlichen Existenz zugerechnet werden darf.
Man kann also sagen, und Hegels Geschichtsphilosophie läuft darauf hinaus, daß der Zustand naiven Wissens, das sich in poetische Formen fassen kann, leider vergänglich ist. Das gesellschaftliche Bewußtsein schreitet fort, und es verliert in dem Maße poetische Begrifflichkeit, wie es sich dafür das positive Wissen über die Welt aneignen kann. Hegel definierte schon seine gegenwärtige preußische Welt als kunstunfähig, weil zu vernünftig, und nur der Renaissance, vor allem Shakespeare, gestand er noch die Fähigkeit zu, menschliche Geschichte spekulativ als Legende mit Ausschmückungen persönlicher Art auf die Bühne zu bringen.
Nun gibt es einen Abschnitt in unserem Leben, in dem sich der eben beschriebene Vorgang, der sich als Gattungsgeschichte vollzieht, als Geschichte des Individuums wiederholt. Das Kind hat noch keine oder nur eine sehr geringe Fähigkeit zur Erkenntnis. Seine Realitätserfahrung wird gespeist aus der einfachen Anschauung; wo es diese übersteigt, beginnt die naive Vorstellungswelt. Und hier, würde ich sagen, und nirgends sonst beginnt auch die Realitätserfahrung des Schriftstellers.
Wie also kommt man zum Schreiben! Es versteht sich von selbst, daß ich nur über mich reden kann, und wenn ich versuche, möglichst weit zurück in meiner Kindheit nach Indizien hierfür zu suchen, dann fällt mir zunächst ein, daß ich als Erst- und Zweitklässler besonders rasch, sozusagen ohne Punkt und Komma, laut lesen konnte. Das Buchstabieren war etwas, das mir wenig Mühe machte.
Mit neun Jahren, als ich wieder in Berlin war, von 1939 bis 1946 lebte meine Familie in Polen, mit neun Jahren begann ich Gespenstergeschichten zu erzählen. Meine Mutter verlor damals ihre Lebensmittelkarte, und da es keinen Ersatz gab, bot ich meinen Mitschülern an, sie zu unterhalten, das heißt, es gelang mir, sie in wenigen Minuten zu fesseln, indem ich etwas Spannendes erzählte. Dafür bekam ich belegte Brote, die ich mit nach Hause nahm.
Irgendwann danach fing ich an zu reimen. Auch das ging mühelos, und was mich heute noch irritiert: Die unbedingte Naivität, mit der dies geschah, ging bis weit in die Pubertät hinein. Mit vierzehn reimte ich folgenden Vers:
Mütterchen hält Märchenstunde,
Sitzet traulich am Kamin
Und erzählt vom goldnen Schlosse,
Das der liebe Mond beschien.
Zwei Jahre später klang alles schon etwas reifer. Mit sechzehn schrieb ich in einem Ferienlager während der Nachtwache folgende drei Strophen:
Der Wind hat sich verhangen,
Das Mondlicht hockt im Strauch,
Ist übers Moor gegangen
Und brennt und knistert auch.
Die Eiche grinst gespalten,
Verstohlen treibt das Boot,
Am Himmel ziehn Gestalten,
Die Fledermaus ist tot.
Die Nacht hat sie begraben,
Jetzt grillt der letzte Gast,
Zwei Totengräber schaben,
Und Nebel fällt vom Ast.
Das war schon Lyrik, und ich erinnere mich genau, daß ich alles, was ich da beschrieb, auch vor Augen hatte. Aber was merkwürdig war: Ich hatte, wenn man die Realität berücksichtigt, in der ich mich befand, gar keinen Grund, so etwas zu schreiben, denn Naturnähe und romantische Schwärmerei waren in einem FDj-Lager so ziemlich das letzte, was einem nahegebracht wurde. Wir sangen politische Lieder, wurden auf den Sozialismus und auf Stalin eingeschworen, erfuhren von den Verbrechen der Nationalsozialisten, aber dies war eine Komplexität, die meine Vorstellungswelt nicht erreichte.
Ähnlich war es Jahre zuvor in Polen gewesen. Ich erinnere mich daran, wie ich beim Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen Teich plötzlich eine Vi über uns hinwegfliegen sah, die irgendwo am Horizont explodierte. Das hielt mich keineswegs davon ab, weiter Schlittschuh zu laufen. Auf dem Hof der Gendarmerie sah ich durchschossene Sträflingskleidung liegen, und immer wieder kamen polnische Frauen zu meiner Mutter, um sie weinend und lamentierend darum zu bitten, daß mein Vater ihre Pakete, die sie an Verwandte nach Warschau schicken wollten, nicht öffnete. Mein Vater leitete eine Gendarmerie auf dem Lande, und es war den Polen verboten, Fleisch und Geflügel zu verschicken. Die Zeichen des Krieges und die alltägliche Unterdrückung der Polen waren unübersehbar, aber ich konnte dies für mich noch nicht in Erfahrung bringen, das heißt, meine Vorstellungswelt war noch begriffsarm und außerstande, von der einfachen Wahrnehmung zu abstrahieren. Die Komplexität im politischen Umfeld, an der ich teilnahm, blieb meinem kindlichen Gemüt undurchschaubar. Es war, wenn ich daran zurückdenke, eine merkwürdige Autonomieerfahrung.
Obwohl ich meinen Vater liebte, war ich empört, als er den Befehl gab, eine alte Polin ins Gefängnis zu schleppen und sie gegebenenfalls zu prügeln. Warum dies geschah, sie hatte etwas gegen Hitler gesagt, wurde ebenfalls erörtert, aber es entzog sich meinem Verständnis.
Ebenso erinnere ich mich, daß oft Leute von der ss bei uns zu Besuch waren und mich auf den Knien schaukelten. Man hörte von der Front her Geschützdonner, und sie erzählten, daß die Russen den Kindern die Bäuche aufschlitzen würden, und das machte mir angst. Ich sah auf die Totenköpfe ihrer Mützen, die sie auf dem Tisch abgelegt hatten, aber was da in Wirklichkeit vor sich ging, gehörte nicht meiner Vorstellungswelt an. Ich spielte mit der Ritterburg, die mir mein Bruder aus Holz geschnitzt hatte und die ich 1944 als Weihnachtsgeschenk bekam.
Zwei Wochen später mußten wir vor der Roten Armee fliehen, und die Irrfahrt bei minus dreißig Grad auf einem Pferdewagen gab mir keine eigentliche Vorstellung von der tödlichen Gefahr, in der wir uns befanden. Sicher, da explodierte eine Munitionsfabrik, so daß Wagen und Pferde durcheinanderrasten, Tiefflieger tauchten auf, wir waren immer wieder gezwungen, unter den Wagen Schutz zu suchen. Zuletzt, als wir schon von der Roten Armee eingekesselt waren, versuchte mein Vater durchzubrechen. Es war Nacht, wir fuhren mit dem Pferdewagen durch den Wald, man hörte ununterbrochenes Maschinengewehrfeuer, und als wir den Wald hinter uns hatten, sahen wir brennende Gehöfte.
Ich erlebte auch, wie russische Soldaten meinen Vater gefangennahmen, das heißt, ich sah, wie er ihnen mit erhobenen Händen entgegenging, aber ich wußte nicht, was das zu bedeuten hatte. Und irgendwann nahmen mich russische Soldaten, genauso wie vorher die Leute von der ss, auf die Knie und gaben mir Kekse zu essen. Beide Vorgänge blieben für mich ununterscheidbar.
Worauf ich hinauswill: Die Autonomieerfahrung, die wir in unserer Kindheit machen, blendet nicht etwa den Erlebnishorizont aus, wir sind nur unfähig, diesen objektiv zu deuten. So wird die einfache Wahrnehmung ständig durch die kindliche Vorstellungswelt selektiert, und auch wo wir das Bedrohliche unmittelbar und ganz unausweichlich erfahren, bleibt es abstrakt und somit im Bereich des Grundlosen. Ich erwähne dies hier, weil das Grundlose eine der Hauptprämissen der Existenzphilosophie ist und weil sich hier die Autonomieerfahrung der kindlichen Welt auf höherer Stufe wiederholt. Ich werde darauf zurückkommen. Jetzt genügt der Hinweis, daß wir die naive Vorstellungswelt ernst nehmen müssen, da sie im Entdecken der tatsächlichen Welt, also in unserem Erwachsenwerden, nicht verschwindet, sondern auf eine qualitativ höhere Stufe gehoben wird.
In der Kindheit besteht die Autonomie des Subjektiven darin, daß tatsächliche Welt und Vorstellungswelt immer wieder auseinanderdriften. So erinnere ich mich daran, daß ich auf der Oberschule, statt die Hausaufgaben zu machen und mich auf Prüfungen vorzubereiten, mit dem Abfassen von Versen beschäftigt war. Ich schrieb Epen über mittelalterliche Helden oder faßte Erinnerungen an Klassenfahrten in Reime zusammen, die man dann zur allgemeinen Belustigung am Schwarzen Brett öffentlich aushängte. So wie ich mit neun Jahren Gespenstergeschichten erzählte, trat ich mit sechzehn als Entertainer bei Schülerversammlungen und Elternabenden auf. Aber das Abitur, worauf es schließlich ankam, schaffte ich keineswegs. Und so mußte ich die elfte Klasse verlassen und wurde Büroangestellter.
Der Leiter des Leichtathletikvereins, dem ich damals angehörte, war Bezirksstaatsanwalt. Er brachte mich in seinem Büro als Hilfskraft unter, und nun wurde ich Nutznießer jenes merkwürdigen Karriereprinzips, das in der DDR herrschte. Das heißt, man hatte den obligatorischen Bildungsweg abgeschwächt, und es war immer möglich, als Seiteneinsteiger in der jeweiligen Hierarchie voranzukommen, vorausgesetzt, man war begabt und gehörte den unterprivilegierten Schichten an.
Für das SED-Regime war meine soziale Herkunft sozusagen makellos: der Vater Fleischermeister, die Mutter Verkäuferin und Reinemachefrau. Und so gab man mir immer die Möglichkeit, auch in der Diskontinuität meinen Wilhelm Meister fortzusetzen. Das sah etwa folgendermaßen aus: Zunächst mußte ich Botengänge erledigen. Nach einigen Monaten vertraute man mir die Leitung einer Geschäftsstelle an, und wieder Monate später bestellte man mich zur Kaderabteilung, um mir zu sagen, daß ich Staatsanwalt werden sollte. Man wollte mich auf die Walter-Ulbricht-Akademie nach Babelsberg schicken, wo die juristische Elite der DDR ausgebildet wurde. Ich fühlte mich hochgeehrt und war einverstanden. Jetzt gab es nur noch eine Formalität zu erledigen. Ich war nicht Mitglied der SED. Ich erinnere mich, wie mir der Kaderleiter lächelnd das Beitrittsformular zuschob und wie ungläubig er mich ansah, als ich ihm erklärte, es käme für mich überhaupt nicht in Frage, einer Partei beizutreten. Die Situation war absurd. Ich war einverstanden, Staatsanwalt zu werden, lehnte es aber gleichzeitig ab, der Partei dieses Staates beizutreten, und ich ging völlig unbeirrt in mein Büro zurück und schrieb weiter an meinem Roman Der ewige Jude. Ich dachte auch nicht im entferntesten daran, daß dies Konsequenzen haben könnte.
Hier also wieder das Phänomen einer Autonomieerfahrung, in der die Vorstellungswelt die reale Welt majorisiert. Das Schreiben schien mir von jetzt an das wichtigste. Diese Tätigkeit war beinahe wie eine Sucht, hier herrschte ein Gefühl von ›alles oder nichts‹, und so schrieb ich, ohne Rücksichten und indem ich die Geschäftsstelle vernachlässigte, immer nur an diesem Roman. Als ich Anklageschriften, statt sie dem Staatsanwalt vorzulegen, im Papierkorb verschwinden ließ, nahm man dies zum Anlaß, um mich auf die Straße zu setzen, was man ohnehin vorhatte, und nun begann für mich eine Existenz auf der untersten Sozialebene. Ich wurde Gelegenheitsarbeiter und arbeitete fast immer nur bis zur ersten Lohnauszahlung, schrieb dann, bis das Geld verbraucht war, an meinem Roman, um wieder irgendeine Handlangerarbeit anzunehmen. Ich stapelte auf einem Holzplatz Bretter, verkaufte Eis, war in einem Elektrowerk Transportarbeiter, machte in einer Brauerei Fässer sauber und fühlte mich sehr erniedrigt. Andererseits war da das Hochgefühl beim Schreiben, und mein Phantasiepotential und damit meine Vorstellungswelt blieben von dem, was ich täglich erlebte, unberührt.
Der Roman war ein Produkt jugendlichen Größenwahns. Das konnte auch gar nicht anders sein. Ich hatte zwar etwas von der Judenvernichtung gehört, aber mir waren weder die näheren Zusammenhänge noch der Ahasver-Topos bekannt. Was mich umtrieb, waren ein naiver moralischer Impuls, ein abstraktes soziales Gewissen und das Sendungsbewußtsein aus dem diffusen Verlangen nach Gerechtigkeit.
Dies waren allerdings Befindlichkeiten, die sich aus dem selbstgewählten Zwang zur Vereinzelung ergaben. Im Sportverein war ich ein Rabauke wie jeder andere gleichen Alters, und wir haben uns auf Wettkampfreisen übel aufgespielt. Ich war also kein Eigenbrötler oder jemand, der zum Außenseiter neigte. Freundschaften oder Kollektiverlebnisse hätte ich nicht entbehren können, und doch war der Drang zum Schreiben derart elementar, daß jeder andere Ehrgeiz, zum Beispiel der einer Ausbildungskarriere, keine Rolle spielte. Und hier sind wir am entscheidenden Punkt einer wirklichen Schriftstellerexistenz.
Ist der Schriftsteller nicht ein Triebtäter, der von der Welt, in der er sich befindet, abgelöst bleiben muß? Meine Autonomie ist meine Selbstbezogenheit, das heißt, ich schreibe nicht, um anderen zu gefallen oder berühmt zu werden oder Geld zu verdienen. Natürlich möchte man anerkannt werden, aber für mich sind die Gelegenheiten zum gesellschaftlichen Erfolg kein Kriterium. Ich will auch keine Welterfahrung vermitteln, wie dies etwa ein Reiseschriftsteller tut. Was mich umtreibt, ist die Selbstdarstellung, die aber, wie wir gesehen haben, aus der naiven Vorstellungswelt noch keine Substanz entwickeln kann. Überhaupt scheint mir wichtig, daß die Autonomieerfahrung, die der Schriftsteller als Kind und Jugendlicher macht, nicht als Mangel definiert werden darf und daß seine Weitabgelöstheit, auch nachdem er die tatsächliche Welt entdeckt hat, bestehen bleibt.
Ich sagte anfangs: Jeder von uns hat die Fähigkeit, jenen Wechsel von der tatsächlichen Welt in die Vorstellungswelt zu vollziehen. Fast jeder schreibt in seiner Kindheit und Jugend Gedichte, es kommt aber darauf an, ob er fähig oder unfähig ist, davon wieder zu lassen. Die meisten folgen früher oder später dem Realitätsprinzip. Der Schriftsteller aber wird seine Autonomieerfahrung nie wirklich los. Dies unterscheidet ihn zum Beispiel vom Wissenschaftler. Dem Wissenschaftler ist die Vorstellungswelt null und nichtig. Sein Erkenntnisbegehren gilt der tatsächlichen Welt. Der Schriftsteller erfaßt die tatsächliche Welt nur über den Umweg einer hinzugedichteten Metamorphose. Es ist immer das Erfundene, Ausgedachte, die poetische Metapher, genauer, das Brennglas des Subjektiven, das das Objektive mit aufscheinen läßt. Aber dies sind Vorgänge, die erst nach der Entdeckung der tatsächlichen Welt möglich werden. In der Kindheit und Jugend bleiben die Versuche zur Poesie von der tatsächlichen Welt im wesentlichen unberührt. Wie sehr aber die Vorstellungswelt des Kindes schon im Wahrheitsgrund des Existentiellen verankert ist, zeigt mir ein Erlebnis, das ich als Achtjähriger im Sommer 1945 hatte.
Nach der mißglückten Flucht wurde ich mit meiner Mutter zivilinterniert, und zuletzt lebten wir in einem Lager mit Schwarzmeerdeutschen zusammen. Die Zustände waren sicher katastrophal, aber solange ich meine Mutter in der Nähe hatte, kam mir alles wie ein Abenteuer vor.
Eines Morgens mußte sie in die nächste Kreisstadt zu einem Arzt fahren und versprach, vor Einbruch der Dunkelheit zurückzusein. Als es soweit war, stand ich vor dem Tor aus Stacheldraht und wartete. Es wurde dunkel, und meine Mutter war immer noch nicht da. Das machte mir angst, aber darüber hinaus stellte sich etwas ein, das meine verständliche Unruhe weit übertraf und das ich damals nicht hätte benennen können. Ich erinnere mich genau, wie rasch mir alles, was ich vor Augen hatte, zu entgleiten schien. Der Himmel, das Tor und die Straße, das Lager, das ich in meinem Rücken hatte. Heute würde ich sagen: Es war ein Gefühl von Ungesichertheit, ja Unbehaustheit, eine Erfahrung, die ich später bei Heidegger als Existentialprämisse wiederfand. Ich fühlte mich sozusagen »primär ungestützt«, und dieser Prämisse könnte man noch weitere Sätze von Heidegger hinzufügen, etwa: »In der Unheimlichkeit steht das Dasein ursprünglich mit sich selbst zusammen.« Das klingt verschroben und realitätsfern, trifft aber im Begrifflichen sehr genau jenen Zustand, den ich als Kind erfahren habe, und dies scheint mir auch ein Beweis dafür, daß Kindheit und Erwachsensein ein und denselben Wahrheitsgrund haben. Dies wurde mir allerdings erst bewußt, nachdem ich die tatsächliche Welt entdeckt und von dieser Entdeckung wieder losgelassen hatte.
1957 bewarb ich mich mit dem Romanfragment Der ewige Jude für ein Dramaturgiestudium an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Ich wurde immatrikuliert und einem Seminar zugewiesen, in dem das Verfassen von Drehbüchern gelehrt wurde. Damit endete meine Autonomieerfahrung, und das Schreiben wurde für mich zur öffentlichen Angelegenheit.
Ich war immerhin zwanzig Jahre alt, und diese Immatrikulation wurde wieder nur möglich, weil für die Kulturpolitik der SED der übliche Bildungsweg nicht obligatorisch war. Ich hatte kein Abitur, meine Mitbewerber waren mir allesamt an Bildung überlegen, und ich erinnere mich genau, wie ich unter Minderwertigkeitskomplexen litt, als mir dies klar wurde. Wir warteten in einem Zimmer auf die Eignungsprüfung, die jeder einzelne zu absolvieren hatte, und ich war sicher, daß ich chancenlos war, zumal nur einer von den Bewerbern angenommen werden sollte. Und nun geschah etwas, das nicht nur für meine schriftstellerische Entwicklung, sondern auch für meine Psyche entscheidend war. Irgendwann öffnete sich die Tür, jemand rief meinen Namen, und sofort wurde klar, daß ich als einziger favorisiert war. Man gab mir eine kurze Erzählung zu lesen, und ich mußte vor einer Kommission aus dem Stegreif die Ideenskizze zu einem Drehbuch entwickeln. Vor allem interessierte man sich für meinen Lebenslauf, und der war im Sinne der permanenten Kulturrevolution mustergültig. Daß ich bis zu diesem Tag in dem volkseigenen Betrieb »Faß und Bottich« als Hilfsarbeiter tätig gewesen war, war offenbar mehr wert als jedes Abitur.
Ich kam ins zweite Studienjahr, und wir bewohnten Einzelzimmer in requirierten Villen mit wunderbaren Parks. Potsdam-Babelsberg war die bevorzugte Wohnlage ehemaliger Ufa-Stars und reicher Fabrikanten, sehr schön in der Nähe der Havel gelegen. Hier hatte auch Stalin während der Potsdamer Verhandlungen gewohnt, und unsere täglichen Seminare fanden in seinen Konferenzräumen statt. Ich erwähne dies nur, weil die Entdeckung der tatsächlichen Welt für mich von Anfang an unter dem begrifflichen Raster der marxistischen Geschichtsphilosophie begann. Alles, was ich der Realität zurechnen durfte, war ab sofort historisch bedingt und politisch streng determiniert. Trotzdem muß ich sagen, daß ich hier wie Goethes Wilhelm Meister meine Turmgesellschaft gefunden hatte.
Wie bei Goethe das pantheistische Weltbild existentiell beruhigend wirkte, so konnte man sich auch dem dialektischen Materialismus, der alle Seinsfragen regelte, guten Gewissens anvertrauen, und daß die SED durchaus Ähnlichkeit mit einer Turmgesellschaft hatte, die den einzelnen, auch wo er sozial strauchelte, immer wieder auffing, um ihn auf den rechten Weg zurückzuführen, dies hatte ich mehrmals erfahren.
Hinzu kam: Die SED verstand sich, wie Goethes Turmgesellschaft, als Garant der Hegelschen Vernunft, hier war der einzelne sowieso dazu ausersehen, sich dem Weltgeist durch immerwährende Erkenntnis anzunähern. Es war die Idee vom wissenschaftlichen Sozialismus, die nachdrücklich und zuverlässig aus dem Hintergrund wirkte, und wer protegiert war und von den Verbrechen der stalinistischen Parteien noch nichts wußte, der konnte den Eindruck gewinnen, er befände sich trotz aller Parolen von Klassenkampf und Weltrevolution in der unwiderstehlichen Idylle des Weimarer Parks.
Entdeckung der tatsächlichen Welt. Das soziale Gewissen.
Die Entdeckung der tatsächlichen Welt begann für mich mit der Zerstörung der Vorstellungswelt, genauer: Die Vorstellungswelt wurde zur Metapher der erkannten Realität. Was wir an der Filmhochschule in Babelsberg zu absolvieren hatten, war immer nur ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja man kann sagen, wir erlebten die Realität überhaupt nur als Reflex im Bereich des Ästhetischen. Von der Expropriation auf dem Lande erfuhr man entweder, indem man das einschlägige Parteiprogramm las, oder wir sahen im Vorführraum den zweiteiligen DEFA-Film Schlösser und Katen. Dieser Film hat mich sehr beeindruckt. Es war eine Kolportage, einzig zu dem Zweck hergestellt, das soziale Gewissen für die unteren Klassen zu mobilisieren, und so erlebten wir auch die revolutionären Vorgänge in Rußland in den genialen Surrogaten von Eisenstein und Pudowkin, Surrogat hier bezogen auf die Realitätserfahrung durch ästhetische Widerspiegelung. Habe ich überhaupt die tatsächliche Welt in ihrer Unvermitteltheit, das heißt, nicht als Produkt einer Simulation erfahren?
Dazu gab es selten Gelegenheit. Ich werde noch darauf zurückkommen. In den Seminaren jedenfalls wurde uns gesellschaftliche Realität als vorgegebene Tendenz vermittelt, das heißt, wie in Hegels Philosophie verlief die Geschichte nach einem teleologischen Prinzip, mit dem Unterschied: Hegel definiert dies als Selbsterkenntnis des absoluten Weltgeistes, nach Marx erkennt sich der Mensch in seinen Produktionsprozessen lediglich selbst. Aber das Schema wurde beibehalten. Nach Marx gibt es in der Geschichte des Menschen eine Tendenz zur Selbsterlösung, und es sind die Produktionsverhältnisse, die es auf vernünftige Weise zu regeln gilt. Es ist also eine Frage der Zeit, wann er fähig und willens wird, die klassenlose Gesellschaft zu errichten. Und wie Hegel den absoluten Weltgeist als Endpunkt seiner Erkenntniseschatologie feiert, so feiert der Marxismus die kommunistische Produktionsweise als letzte Bestimmung der menschlichen Vernunft.
Ich muß das hier so abstrakt sagen, weil die Entdeckung der tatsächlichen Welt für mich unter eben diesem abstrakten Raster geschah. Und wie bei Hegel nur das Vernünftige der Wirklichkeit zugerechnet werden durfte, so wurde bei Marx alles Geschichtliche einer Tendenz zum sozialen Gewissen untergeordnet, und ich stimmte dem begeistert zu. Ich war sicher, daß hier ein neues, ein gerechteres Zeitalter mit den Mitteln der Diktatur des Proletariats herbeigezwungen werden sollte und daß es darauf ankam, die gesellschaftliche Realität auf richtige, das heißt auf marxistische Weise zu deuten.
Aber auch der gesamte Existenzgrund des Menschen wurde streng weltanschaulich geregelt. Auch hier berief man sich auf Marx, der gefordert hatte, Hegels Philosophie zu entidealisieren, das heißt, die Dialektik wurde beibehalten, die Erkenntniseschatologie wurde vom Kopf auf die Füße gestellt. Die Einheit der Welt bestand in ihrer Materialität, und der Mensch, selber Materie, war lediglich in der Lage, diesen Sachverhalt richtig oder falsch widerzuspiegeln.
Und so war es auch das ständige Bemühen unserer Lehrer, uns auf die richtige Widerspiegelung der tatsächlichen Welt einzuschwören. Wir hatten ganz vorzügliche Literaturseminare, in denen uns bewiesen wurde, daß auch die Ästhetik in ihren historischen Modifikationen der marxistischen Theorie recht gab.
Alles war sozial und klassenkämpferisch bestimmt, und besonders an den Dramen Shakespeares konnte man die Gültigkeit der politischen Ökonomie von Marx nachweisen. Marx beschreibt in seiner Kapitalanalyse, wie das England der Renaissance das Phänomen der ursprünglichen Akkumulation erlebt, das heißt, die naturalwirtschaftlich bestimmte Produktionsweise wird plötzlich von einer bewußt herbeigeführten Monokultur überlagert: Die Feudalherren vertreiben die bäuerlichen Pächter, um in großem Umfang Schafzucht zu betreiben. Die gewonnene Wolle wird nach Flandern verschifft, wo Textilmanufakturen entstanden waren. Es war ein blutiger und plötzlicher Wechsel der Feudalwirtschaft zur Warenwirtschaft, der auch alle gewachsenen moralischen Bindungen zerstörte, und dies war zweifellos der gesellschaftspolitische Hintergrund, der in der Dramaturgie Shakespeares mit aufscheint. So wurde zum Beispiel König Lears Bewußtseinskrise als Folge einer neuen Interessenlage seiner Töchter Goneril und Regan gedeutet. Hier war nicht mehr Vasallentreue, sondern die Profitgier der Renaissance maßgebend, so wie in Troilus und Cressida alle Feudaltugenden durch Hinterlist und Verstellung ad absurdum geführt werden. Dies ist aber nur die halbe, sozusagen in die Objektivität verschobene Wahrheit. Was uns, und zwar mit Absicht, vorenthalten wurde, war die durch nichts zu determinierende Subjektivität der Shakespeareschen Figuren. Othellos Eifersucht beispielsweise wurde als Resultat einer Intrige aus dem Geiste der beginnenden Warenwirtschaft gedeutet. Aber Shakespeare blickt tiefer. Othello liebt seine Desdemona eifersuchtslos. Er ist außerstande, sich über jeden Verdacht, den Jago ihm eingegeben hat, Klarheit zu verschaffen. Ja er wünscht die Unklarheit, da er nun seine Zuneigung, die schon als Normalität sein Gemüt übererregt, bis zur Selbstzerstörung genießen kann. Und hier beginnt der freie Fall. Das stolze, starke Individuum wählt eher den Tod als die Ernüchterung. Ihm ist die vom Verdacht gereinigte Leidenschaft keine Leidenschaft mehr. Othello erhält sich die Liebe zu Desdemona, indem er die behauptete Treulosigkeit hinzuaddiert und die dadurch entstandene Unvereinbarkeit zum Exzeß steigert.
Eine solche Deutung aber hätte man niemals zugelassen. Überhaupt wurde alles, was der Wahrheit des Subjektiven angehört, als Ausdruck von Dekadenz gedeutet oder als Individualismus, den es zu bekämpfen galt. Die Autonomieerfahrung, die für mich als Kind und Jugendlicher selbstverständlich war, wurde nun zurückgedrängt und für unerheblich erklärt, und was mich als Subjekt fortan definierte, war die Fähigkeit, die tatsächliche Welt ins Begriffliche zu zwingen. Und so war auch das Schreiben nicht mehr eine Sache aus privater Befindlichkeit und Weitabgelöstheit, es war eine Sache des gesellschaftlichen Auftrags. Ich schrieb Drehbücher über Produktionsschlachten im Braunkohletagebau, meine Protagonisten waren Helden der Arbeit, und immer war es ein Bemühen, die gesellschaftlichen Veränderungen, die einem begrifflich nahegebracht worden waren, in ein poetisches Bild zu fassen. Dabei fühlte ich mich der politischen Avantgarde zugehörig und partizipierte an einer Weltanschauung, die zuversichtlich und überlegen stimmte, weil sie wissenschaftlich begründet und damit unangreifbar war. Ich empfand die Allmacht der Partei wie das sichernde und beruhigende Wirken einer Turmgesellschaft.