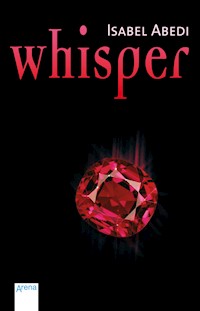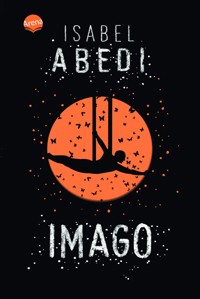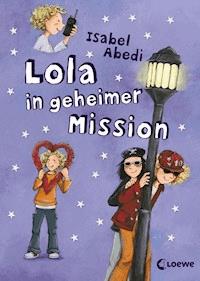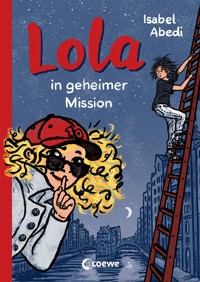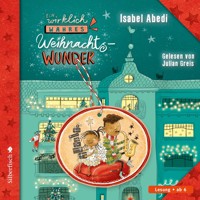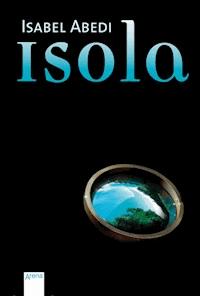
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zwölf Jugendliche, drei Wochen allein auf einer einsamen Insel vor Rio de Janeiro - als Darsteller eines Films, bei dem nur sie allein die Handlung bestimmen. Doch bald schon wird das paradiesische Idyll für jeden von ihnen zu einer ganz persönlichen Hölle. Und am Ende müssen die Jugendlichen erkennen, dass die Lösung tief in ihnen selbst liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Isabel Abedi Isola
Weitere Romane von Isabel Abedi im Arena Verlag:
ImagoWhisper
Isabel Abedi
ISOLA
Roman
Veröffentlichung als E-Book 2010© 2007 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Arena Verlag unter Verwendung der Fotos vonBruce Byers und Alberto Incrocci © gettyimagesISBN 978-3-401-80003-5
www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Für Sylvia
ISOLA
Ein Film von Quint Tempelhoff
STARRING
Joy Reichert
als VERA
Ulla Sjöberg
als ELFE
Belinda Edgeworth
als MOON
Nana Makhetha
als PEARL
Kristina Peters
als KRYS
Beatá Krall
als DARLING
Sven Werner
als ALPHA
Richard Bussman
als MILKY
Naoki Shangyn
als LUNG
Tristan Leander
als NEANDER
Italo Mackenzie
als JOKER
Raphael T. Liebermann
als SOLO
Eins
Er war wie jedes Jahr um diese Zeit der einzige Mensch im Garten des Evangelischen Klinikums in Berlin. Es war sechs Uhr morgens, am Himmel stand noch der Mond und die kleinen Scheinwerfer auf der Wiese funkelten wie wachsame Augen. Aus einem der Fenster drang leise klassische Musik. Lauschend wandte er den Kopf. La Mer, von Debussy. Er lächelte, als wäre die Musik ein Zeichen, und das war sie ja auch. Langsam ging er auf den weißen Marmorengel zu. Die kleine Statue stand im hinteren Winkel des Gartens vor der Birke, an deren Zweigen sich die letzten Blätter festhielten. Ihm schien, als wären es in diesem Jahr noch weniger Blätter als sonst. Behutsam wickelte er die Orchidee aus dem braunen Papier und legte sie dem weißen Marmorengel in die steinernen Hände. Der Engel lächelte nicht. Still und stumm stand er da, genau wie immer. Von Norden her wehte ein schneidend kalter Wind und über der Wiese lag wie eine dünne Decke der Nebel. Aber die tiefrote Blüte strahlte Wärme aus. Wärme, Licht und Leben.
Er hatte Friedhöfe nie gemocht und verstand nicht, warum man die Toten dort besuchte. Mirjam hatte ihre letzten Stunden hier verbracht, hinter einem dieser Fenster, auf den Tag genau vor neunzehn Jahren. Auch das war ein Zeichen für ihn. Es war ein guter Tag zum Abschiednehmen.
Der Wind blies jetzt noch unbarmherziger. Ein Blatt löste sich von der Birke und trieb lautlos durch die beißend kalte Luft. Er fing es mit den Händen auf, wischte den gefrorenen Tau von der Oberfläche und sah noch einmal auf die Orchidee. Die Musik hinter dem Fenster verstummte und das tiefe Rot der Blüte erinnerte ihn plötzlich an frisches Blut. Fröstelnd zog er die Schultern hoch.
»Es tut mir so leid«, flüsterte er.
Dann drehte er sich um und verließ den Garten.
Es wurde Zeit. Seine Maschine ging in drei Stunden und am Tag darauf würde er auf der Insel sein. Vor den anderen natürlich. Wenn sie in der Luft waren, würde er schon am Ziel sein, um sie zu erwarten. Er rief sich noch einmal ihre Gesichter in Erinnerung und die Namen, die sie sich für ihre Zeit auf der Insel ausgesucht hatten. Wie passend sie waren, vor allem der Name von Raphael.
ICH GLAUBE an die Bedeutung von Namen. Das ist schon damals so gewesen. Es gibt ein Zitat von John Steinbeck, das ich mir einmal aus einer Schullektüre herausgeschrieben habe und an das ich im Flugzeug plötzlich wieder denken musste. »Ich bin mir nie ganz klar darüber geworden«, so heißt es in Steinbecks Jenseits von Eden, »ob der Name sich nach dem Kind formt oder sich das Kind verändert, um zum Namen zu werden. Eines ist sicher: Wenn ein Mensch einen Spitznamen hat, so ist das ein Beweis dafür, dass ihm der gegebene Taufname unrichtig war.«
Dabei war es in meinem Fall genau umgekehrt. Joy war der Name, den Erika und Bernhard für mich gewählt hatten, aber zu einer Joy war ich nicht geworden. Mein Geburtsname war Vera und zu diesem Namen würde ich nun zurückkehren. Als sich die Maschine auf der gestreuten Startfläche in Bewegung setzte, schneller und immer schneller wurde, nahm ich Abschied. Abschied von Deutschland, von der Kälte und dem Regen, von Erika und Bernhard und von Joy Reichert, meinem deutschen Namen. Es ist schwer, das Gemisch aus Gefühlen zu beschreiben, das in diesen Minuten in mir tobte, lauter und rasender als der Lärm um mich herum. Die Motoren heulten auf, mein Körper wurde in den Sitz gedrückt, alles vibrierte. Ich krallte meine Hände in die Lehnen und für einen kurzen Moment dachte ich, dass meine Entscheidung, auf die Insel zu fliegen, der helle Wahnsinn war. Dann, ganz plötzlich, wurde es ruhig. Wir hatten abgehoben.
»Ihr erster Flug?«
Der Sitz neben mir war frei, aber daneben, am Gang, saß ein älterer Herr. Freundlich lächelte er mich an. Der brasilianische Akzent in seiner Stimme ließ mein Herz noch schneller schlagen.
Ich nickte und dachte, dass man nicht sprechen muss, um zu lügen.
Dann sah ich aus dem Fenster. Frankfurt verschwand hinter den Wolken.
Quint Tempelhoff würde jetzt schon auf der Insel sein. Er war sicher von Berlin aus geflogen, während wir, seine Besetzung, den Flug nach Rio von Frankfurt aus angetreten hatten. Wir waren zwölf, aber die anderen kannte ich nicht und der ältere Herr in meiner Reihe gehörte bestimmt nicht dazu. Sechs Jungen, sechs Mädchen sollten wir sein und alle saßen wir im selben Flieger. Das gehörte zu den spärlichen Informationen über unsere Besetzung, die ich von Quint Tempelhoff erhalten hatte, als er mir Anfang Oktober in seinem Studio mitteilte, dass ich an seinem neuen Filmprojekt teilnehmen würde.
Mädchen und Jungen, erst jetzt merkte ich, wie unpassend das klang. Aber wären die Bezeichnungen Frauen und Männer passender? Was war ich – mit siebzehn? Wenn es stimmt, dass die deutsche Sprache aus ungefähr einer halben Million Wörtern besteht, dann frage ich mich, warum ein so wesentlicher Begriff wie der zwischen Mädchen und Frau nicht darin enthalten ist.
Im Brasilianischen ist es genauso. Menina heißt Mädchen, Mulher heißt Frau. Aber in der Umgangssprache, wie ich mittlerweile weiß, gibt es zahllose Begriffe für das weibliche Geschlecht. Gathina, das Kätzchen, Gata, die Katze, Flor, die Blume, Brotinho, die Knospe …
Über meinem Sitz gingen die Anschnallzeichen aus.
Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen. Sie waren rissig und trocken von der Kälte. Wie so oft war der Winter über Nacht gekommen, um sich grob und ungebeten für die nächsten Monate in Deutschland breitzumachen. Aber wir flogen in den Sommer und das deutsche Grau würde durch ein Meer aus Farben ersetzt werden.
Ich hielt Ausschau nach der Stewardess, die vorne in der ersten Klasse beschäftigt war. Es würde dauern, bis ich etwas zu trinken bekam. Stattdessen tauchte ein lilafarbener Wuschelkopf vor meiner Sitzreihe auf.
»Hey, bist du dabei?«
Ich zuckte zusammen.
Der lila Wuschelkopf gehörte zu einem molligen – ich entschied mich für Mädchen. Auf jeden Fall sah sie jünger aus als ich. Sie trug ein langes, wallendes Kleid, das aus unzähligen blauen, lilafarbenen und grünen Stoffmustern zusammengestückelt war. Manche von ihnen waren mit glitzrigen Pailletten und kleinen Spiegelscherben bestickt. Die Lippen des Mädchens waren pechschwarz geschminkt und verzogen sich zu einem breiten Lachen, während mich seine goldbraunen Augen neugierig musterten. Ehe ich etwas erwidern konnte, zwängte sich das Mädchen mit einem gemurmelten »’tschuldigung« an dem älteren Herrn vorbei, um sich zwischen uns auf dem freien Sitz niederzulassen. Sie roch süß, nach Moschus oder Patschuli, irgendetwas Indischem jedenfalls, und ich hielt unwillkürlich die Luft an.
»Du fliegst auf die Insel, stimmt’s?« Das schwarze Lippenstiftlachen wurde noch breiter, dann streckte mir das Mädchen die Hand entgegen – eine Hand, an deren Gelenk drei Reihen bunter Glasperlen klimperten – und stellte sich, ohne meine Antwort abzuwarten, als »Elfe« vor.
»Das ist mein Inselname, ich schätze mal, der echte interessiert nicht, oder? Also, ich wette jedenfalls, du bist dabei. Wie heißt du?«
Für einen Moment überlegte ich, ob es mir passte, mich auf diese mollige Wallewalle-Elfe einzulassen. Die Vorstellung, dass ich die nächsten zwölf Stunden ihren süßen Moschusduft einatmen musste, machte mich noch nervöser, als ich ohnehin schon war. Aber etwas an ihr mochte ich seltsamerweise sofort und vielleicht würde sie mich ablenken – von mir selbst.
»Vera«, sagte ich.
»Vera?« Elfe runzelte die Stirn. »In echt oder auf der Insel?«
Ich zögerte. »Auf der Insel.«
»Hm.« Elfe streifte ihre Schuhe ab und versuchte, sich in einer Schneidersitzposition auf den schmalen Sitz zu quetschen, wobei sie dem älteren Herrn das Knie in die Seite rammte. »’tschuldigung ...« Sie griff in die Tasche ihres Kleides, kramte ein zusammengefaltetes Stück Zeitungspapier hervor, klappte es auf und hielt mir einen Artikel mit einem Foto von Quint Tempelhoff unter die Nase.
»Lies mal, was da über unser Projekt steht«, sagte sie, aber ehe ich dazu kam, tippte sie auf das Foto unseres Regisseurs. »Warst du auch bei Tempelhoff im Studio zu Probeaufnahmen? Wie fandest du ihn?« Elfe kräuselte ihre winzige Nase. »Seltsame Augen, oder? Hat er dich auch so gemustert? Wo hat er dich entdeckt? … ’tschuldigung!« Elfe hatte dem älteren Herrn erneut ihr Knie in die Seite gerammt, machte aber keinerlei Anstalten, ihre Schneidersitzposition aufzugeben.
Ich musste lächeln. Ich verstand nicht viel vom Film, schon gar nicht von Projekten dieser Art, aber wenn die anderen Mitglieder unserer Crew nur halb so schräg waren wie diese Elfe, dann würden wir eine wilde Mischung sein.
Ich betrachtete das Foto von Quint Tempelhoff. Genau wie bei unserer ersten Begegnung fielen mir auch hier wieder seine verschiedenfarbigen Schuhe auf. Es waren halbhohe Schnürschuhe aus glänzend poliertem und sicher sündhaft teurem Glattleder – der eine war schwarz, der andere rot. Vielleicht sollten sie sein Markenzeichen sein, mir waren sie jedenfalls schon bei unserer ersten Begegnung etwas affektiert vorgekommen.
Und seine Augen waren wirklich seltsam, das hatte ich bei meinem Casting-Gespräch genauso empfunden. Klein, schwarz, kieselrund. Und unbeschreiblich flink. Die Art, wie sie sich hinter der roten Hornbrille bewegt hatten, rasend schnell hin und her gehuscht waren, um einen dann ganz plötzlich zu fixieren, stechend und fordernd.
Ich hatte mich gefürchtet vor diesen Augen.
Und auch sonst hatte ich mich in der Gegenwart dieses Mannes irgendwie unbehaglich gefühlt. Seine selbstherrliche, fast unheimliche Autorität spiegelte sich nicht nur in seinen Gesten, sondern auch in seinem Gesicht wider. Einem hageren Gesicht, scharf geschnitten mit einer Kerbe im Kinn und ausgefeilten Linien um den Mund. Schmerzfalten hatte Erika diese Linien genannt und dem Regisseur eine traurige Kindheit angedichtet, worüber Bernhard lächelnd mit dem Kopf geschüttelt hatte, nach dem Motto »Du und deine Psychotherapeutenkrankheit, allen Menschen ihre Vergangenheit vom Gesicht ablesen zu müssen«.
Aber Tempelhoffs Stimme war tief und warm gewesen. Er hatte mich nach unserer Tanzaufführung angesprochen, aber natürlich war das Projekt auch ausgeschrieben worden und sicher hatten sich Tausende von Jugendlichen dafür beworben. Quint Tempelhoff, dessen letztes Projekt mit dem europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, war ein gefeierter Star und schon jetzt sorgte sein neues Filmprojekt für Schlagzeilen – und Kontroversen.
Ich überflog den Artikel.
Tempelhoff is watching you – oder sieht das die Branche falsch? Im Rahmen der Verleihung des europäischen Filmpreises berichtet Starregisseur Quint Tempelhoff von seinen Zukunftsplänen und tritt eine Kritikerdiskussion von erstaunlichem Ausmaß los. Denn im Gegensatz zu der spröden Intellektualität seiner vergangenen Filme verankert Tempelhoff sein neuestes Projekt ausgerechnet im Zentrum der Populärkultur. Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Casting-Shows will der mehrfach preisgekrönte Regisseur deren Prinzip auf die Spitze treiben und schickt zwölf Jugendliche im Alter zwischen sechzehn und neunzehn Jahren für drei Wochen auf eine kleine Insel vor der Küste Brasiliens. Lediglich drei Dinge dürfen die Teilnehmer mit auf das hermetisch überwachte Eiland nehmen, das ursprünglich einem Resozialisierungsprojekt für Häftlinge dienen sollte. Das Projekt scheiterte, was jedoch blieb, war die lückenlose Kameraüberwachung der gesamten Insel, deren Technik sich Tempelhoff bedient, um seine zwölf Probanden unbeobachtet filmen zu können. Ob aus den Überwachungsvideos am Ende tatsächlich ein Film entsteht, beantwortet Tempelhoff mit seiner Lieblingsaussage »Das wird sich zeigen oder nicht«. Ungeachtet dessen muss sich Tempelhoff jedoch die Frage gefallen lassen, ob er mit einem solchen Projekt nicht genau die Grenze zu dem bloßen Voyeurismus überschreitet, den er ins Zentrum seiner filmerischen Aussage stellen will. Reicht es aus, die Gesetze, die für »Big Brother« gelten, mit den Mitteln der Filmkunst zu adaptieren, um eine kritische Aussage über ebenjenes Medium zu erzielen? Das – um Quint Tempelhoff beim Wort zu nehmen – wird sich zeigen oder nicht.
»Ganz schön bissig, was?« Elfe nahm mir die Zeitschrift aus der Hand. »Aber jetzt sag mal, wie hast du dich bei Tempelhoff beworben? Noch kannst du frei sprechen oder glaubst du, der Maestro hat seine versteckten Kameras auch im Flieger installiert? … Oh, ’tschuldigung!«
Der Mann neben Elfe erhob sich.
Elfe wurde rot. »Ich wollte Sie wirklich nicht … «
»Schon gut. Drüben sind noch freie Plätze.« Der ältere Herr zwinkerte mir zu und ließ mich mit Elfe allein zurück.
»Tempelhoff hat mich auf einer Tanzaufführung gesehen.«
»Tanz?« Elfes Augen wurden kugelrund. »Ich dachte, Tempelhoff hat nur Leute von Schauspielschulen engagiert?«
»Offensichtlich nicht.« Mit Schauspielerei hatte ich nichts zu tun, dazu war ich viel zu schüchtern. Tanzen war etwas anderes. Dabei musste ich nicht sprechen, vor allem nicht bei Sabiá, meinem brasilianischen Meister. Ich war schon lange in seiner Gruppe und die Aufführung in der Hamburger Fabrik war unser erster großer Auftritt gewesen. Vor mehr als vierhundert Zuschauern hatten wir die Tänze der Orixás präsentiert, der brasilianischen Götter des Candomblé-Kultes. Mein Part war der Göttin Yansã gewidmet gewesen. Sie ist die Herrin der Blitze und Winde, aber auch die Führerin der Toten und wird in Brasilien als machtvolle, mutige Kriegerin verehrt. Begleitet von Atabaque-Trommeln und Sabiás Berimbau hatte ich Yansãs wildes, ungezähmtes Wesen zum Ausdruck gebracht und wie immer, wenn ich tanze, alles um mich herum vergessen. Als Quint Tempelhoff anschließend in unserer Garderobe stand, um mich zu fragen, ob ich Interesse hätte, bei seinem Filmprojekt mitzumachen, hatte mich fast der Schlag getroffen. Dann war alles ganz schnell gegangen; Tempelhoffs Einladung zum Casting in Berlin, die Informationen über das Projekt und schließlich die Zusage und das Gespräch mit meinen deutschen Eltern.
Erika zu überreden, war das Schwierigste gewesen, und am Ende war es Bernhard, der mir die Erlaubnis gegeben hatte. »Irgendwann wird Joy ohnehin gehen, Erika, mit oder ohne uns. Vielleicht ist es so am besten.« Mein Mund war plötzlich wie ausgetrocknet. Ich sah den Gang hinunter. Hoffentlich kam bald die Stewardess mit den Getränken.
»Ich spiele klassisches Theater«, kam es von Elfe. »Neben der Schule natürlich. Ich bin in der Elften und du?« Elfe wartete meine Antwort nicht ab. »Jedenfalls kennt meine Lehrerin Tempelhoff, sie hat mal bei ihm hospitiert. Er kann angeblich ziemlich jähzornig sein, bin gespannt, ob wir ihn auf der Insel überhaupt zu Gesicht bekommen. Na ja.« Elfe fuhr sich durch ihre lila Wuschelhaare und ließ dabei ihre Glasperlen klimpern. »Jedenfalls bin ich postwendend zum Casting nach Berlin gefahren – und tätää … drei Wochen später kam der Lottogewinn. Musstest du ihm auch deinen Inselnamen sagen? Bei meinem hat er gelächelt und meine drei Dinge für die Insel hat er auch abgenickt. Was sind deine drei Dinge? Meine sind im Rucksack, muss gleich mal schauen gehen, ob der noch am Platz liegt. Mann, das war ganz schön schwer, mich zu entscheiden. Sonnencreme und Zahnbürste werden die uns ja wohl ins Zimmer stellen, denk ich mal, oder? Und hat die Stylistin bei dir auch die Maße genommen?« Elfe schüttelte sich. »Ich hoffe, die hängen mir keine Jeans in den Kleiderschrank. Für nichts in der Welt zwänge ich meine Beine in Hosen, das sag ich dir. Ich bin jedenfalls so aufgeregt, dass ich platze.«
Ich seufzte. Das merkte man. Dabei war ich nicht weniger aufgeregt. Bei mir zeigt sich das nur anders – oder genauer gesagt: gar nicht. Je aufgeregter ich innerlich bin, desto ruhiger werde ich äußerlich. Das muss schon immer so gewesen sein. Jedenfalls hatte mir auch Erika so etwas gesagt. »Still«, sagte sie. »Du warst so still und stumm wie eine Puppe, als wir dich … «
Ich presste die Lippen zusammen. Nein, nicht daran denken, nicht jetzt, nicht hier.
Die Stewardess kam. Elfe wollte Tomatensaft mit Salz und Pfeffer, ich bestellte ein stilles Wasser. Elfe leerte ihren Tomatensaft in einem Zug und wischte sich mit dem Handrücken den roten Bart über den schwarz geschminkten Lippen ab.
»Komm, wir sehen nach, ob wir noch ein paar aus der Crew finden. Die Blonde da drüben, die könnte doch auch eine von uns sein, was meinst du?« Elfe streckte ihren Finger aus und zeigte auf ein Mädchen, das eine Reihe vor uns saß. Seine hellen Locken fielen bis auf die Sitzlehnen. Als Elfe pfiff, drehte sich das Mädchen um. Eine lebendige Barbiepuppe, das war das Erste, was mir in den Kopf schoss. In der allerersten Sekunde wirkte das Mädchen überrascht, dann scannte sie Elfe mit den Augen ab, von oben nach unten und wieder zurück nach oben. Auf ihren Lippen erschien ein spöttisches Lächeln. Elfe stieß beleidigt die Luft aus. »Was hat die denn gebissen?«, murmelte sie. Dann drehte sie sich um, kniete sich auf den Sitz und begann, die Reihen hinter uns zu inspizieren.
»Schau mal, der dahinten. Ich wette, der ist auch dabei.«
Widerstrebend drehte ich meinen Kopf.
Und da sah ich ihn zum ersten Mal.
Er saß drei Reihen hinter uns. Er hatte dunkle, schulterlange Haare und sein Gesicht war über eine Zeitschrift gebeugt. Doch dann, als hätte er unsere Blicke bemerkt, hob der Junge den Kopf. Ich sage in diesem Fall bewusst der Junge, obwohl er deutlich älter war als ich. Er hatte ein schmales Gesicht mit großen dunklen Augen. Aber er sah nicht Elfe an, sondern mich.
Und dann lächelte er. Sein Lächeln war so warm und offen, wie ich es bisher bei keinem deutschen Lächeln gesehen hatte, und vielleicht war es das, was mich sofort zu ihm hinzog. Obwohl … nein. Ich glaube, was mich von der ersten Sekunde an zu ihm hinzog, war etwas anderes. Es lag in seinem Lächeln und ich kannte es, ich kannte es so verdammt gut. In seinem Lächeln lag Einsamkeit.
Ich tat etwas, was ich bisher nie getan hatte. Ich lächelte zurück.
Dann beugte sich das Gesicht des Jungen wieder über die Zeitschrift.
»Siehst du?«, sagte Elfe triumphierend. »Ich wette, da haben wir schon Nummer vier.« Sie kicherte. »Ich glaub, der mochte dich. Zumindest wirkt er nicht so arrogant wie die blonde Zicke. Komisch … « Elfe drehte sich noch einmal zu dem Jungen um. »Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Komm, wir fragen ihn, ob er dabei ist.« Elfe zog mich am Ärmel, aber ich schüttelte den Kopf.
»Lass mal. Ich brauch ein bisschen Ruhe. Hab nicht viel geschlafen letzte Nacht.«
»Ooch … « Elfe zog eine Flunsch. »Aber halt mir den Platz frei, okay?«
Dann rauschte sie zu dem Jungen hinüber. Ein paar Sekunden später drang ihre helle Stimme an mein Ohr.
Ich schloss die Augen.
Die Maschine hatte die Lufthöhe erreicht und der Pilot meldete sich mit ersten Informationen zum Flug. Wir würden in São Paulo zwischenlanden und am nächsten Morgen um sechs Uhr brasilianischer Zeit in Rio de Janeiro ankommen.
Hitze stieg in mir auf, eine unangenehme, kribbelnde Hitze, die ich fast nicht aushalten konnte. Ich angelte meinen Rucksack zwischen meinen Füßen hervor und öffnete ihn.
Die weiße Kerze.
Das Feuerzeug.
Das Foto von Esperança.
Das waren die drei Dinge, die ich mit auf die Insel nehmen würde.
Zwei
ICH HÄTTE weglaufen können. Noch heute spukt dieser Gedanke oft durch meinen Kopf. Ich hätte mich heimlich von der Gruppe entfernen können, genügend Gelegenheiten hatte es gegeben; in Rio am Flughafen, auf dem Weg zu den Wagen, die uns nach Angra dos Reis brachten, oder am Hafen, kurz bevor wir ins Boot stiegen und zur Insel fuhren. Aber hätte das etwas geändert? Hätte Tempelhoff mich suchen lassen und wäre das Projekt dann womöglich abgebrochen worden? Wäre vielleicht kein Blut geflossen? Es ist so sinnlos, sich diese Fragen zu stellen, mein Verstand weiß das. Aber die Fragen wissen es nicht. Sie kommen – ohne vorher anzuklopfen und sich zu erkundigen, ob es gerade passt. Sie wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt, egal, zu welcher Zeit sie aufkreuzen. Ich habe mir angewöhnt, sie gut zu behandeln. Ich antworte ihnen, dass ich es nicht weiß. Manchmal sage ich ihnen auch, dass ich es nicht glaube. Es hätte nichts geändert. Vielleicht hätte es jemand anderen getroffen und vielleicht – oder sogar wahrscheinlich – wäre alles noch schlimmer gekommen, wenn ich weggelaufen wäre. Das beruhigt sie dann immer ein wenig.
Tatsache ist, dass der Gedanke, mich von der Gruppe zu entfernen, vor dem Anflug auf Rio da war.
Als über unseren Köpfen die Anschnallzeichen aufleuchteten und der Kapitän die Landung ankündigte, flüsterte eine Stimme in mir: Du kannst gehen. Du bist hier und gleich kannst du gehen. Du kannst die Telefonnummer auf der Rückseite von Esperanças Foto wählen, und wenn du Glück hast, bist du am Ziel. Wenn du Glück hast, bist du bei Esperança.
Warum habe ich es nicht getan?
Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Ich konnte nicht.
Unzählige Male hatte ich mir diesen Moment ausgemalt, aber auf das, was ich empfand, als es endlich so weit war, hatte mich nichts vorbereiten können.
Ich saß noch immer allein. Elfe hatte ich während des zwölfstündigen Fluges nicht mehr zu Gesicht bekommen und trotz der drei Spielfilme, die ich mir auf dem kleinen Monitor über meinem Sitz angeschaut hatte, war die Zeit quälend langsam verstrichen.
Jetzt ging plötzlich alles so schnell – viel zu schnell. Die Maschine sackte ruckartig tiefer und ich musste schlucken, um den schmerzhaften Druck in meinen Ohren auszugleichen. Aber viel mehr machte mir der Druck zu schaffen, der auf meiner Brust lastete. Wir waren unter die weiße Wolkendecke gesunken, die uns wie ein dichter Vorhang von der Erde getrennt hatte, und es kostete mich körperliche Überwindung, meinen Blick zum Fenster zu richten. Als ich in die Tiefe sah, schob sich hinter dem Zuckerhut gerade die Sonne hervor. Ein rosafarbener Schimmer überzog den Himmel und die Wolken sahen aus, als ob sie Feuer fingen. Sie begannen zu glühen, erst an den Rändern, dann durch und durch, bis sie voller Licht und Wärme waren. Nur direkt vor meinem Fenster schwebte eine kleine, noch nebelblasse Wolke, deren Form mich an einen fallenden Engel mit ausgebreiteten Armen erinnerte.
Die Stadt sah aus, als ob sie dem Meer zu Füßen lag und träumte. Sanft und lagunenartig zogen sich die breiten Strandbuchten in das kristallblaue Wasser, auf dessen Oberfläche wie winzige Geisterwesen die Schaumkronen tanzten. Auch die Hochhäuser waren in dieses magische Licht getaucht, die grün bewachsenen Berge glänzten feucht und ich weiß noch, dass ich in diesen unwirklichen Minuten an Gott denken musste; an einen Gott, wie wir Menschen ihn uns meistens vorstellen, der von oben auf die Erde schaut; auf eine friedliche und zauberhafte Welt –in der es von diesem Blickwinkel aus betrachtet kein Leiden gab.
Es ist eine seltsame Sache mit den Wahrheiten. Von hier oben aus sah man alles – und von hier oben aus sah man nichts. Um zu erkennen, was es für Millionen von Menschen bedeutete, in einer Stadt wie Rio zu leben, musste man hinabsteigen, man musste, wie es so schön heißt, auf dem Boden der Tatsachen landen.
Das Flugzeug sackte durch ein letztes Luftloch und in diesem Moment fühlte ich, dass ich nicht die Kraft haben würde wegzulaufen. In diesem Moment wusste ich, dass ich mit auf die Insel fahren musste und dass ich weit, unendlich weit davon entfernt war, die Nummer auf der Rückseite des Fotos zu wählen.
Ich zog den Anschnallgurt enger. Der Druck auf meine Ohren und auf meine Brust war verschwunden, stattdessen breitete sich in meinem Magen eine flattrige Unruhe aus. Mein Herzschlag pochte spürbar gegen meine Rippen, unter mir klappte das Räderwerk des Flugzeugs heraus und ich spürte, wieder, wie wir sanken, tiefer und tiefer. Dann nahm die Maschine eine lang gestreckte Linkskurve, neigte sich noch einmal abwärts, verharrte einen Moment lang in der Luft und glitt schließlich auf das strahlend blaue Meer zu, als wollte der Pilot direkt im Wasser landen. Als wir stattdessen mit einem unsanften Ruck auf der Landebahn aufsetzten, hörte ich um mich herum erleichtertes Aufseufzen. Einige Passagiere klatschten, in der Kabine ging die Innenbeleuchtung an und aus den Lautsprechern ertönte eine Instrumentalversion von Girl from Ipanema, die so fürchterlich klang, dass sie den Namen Musik nicht verdiente. Meine Füße kribbelten und meine Beine fühlten sich vom stundenlangen Sitzen an, als gehörten sie nicht mehr zu mir. In das Lautsprechergedudel mischte sich das Stimmengewirr der anderen Passagiere und der nervöse Drang, endlich ins Freie zu kommen, machte sich im ganzen Flugzeug breit.
Mit einem müden Lächeln wünschte mir die Stewardess einen angenehmen Aufenthalt in Rio de Janeiro, und als ich die Gangway hinabstieg, drückte sich die feuchte Tropenluft wie ein unsichtbarer Waschlappen auf mein Gesicht, während hinter meinem Rücken noch die Motoren des Flugzeugs lärmten.
Im Bus, der uns zum Flughafengebäude fuhr, war ich eingepfercht zwischen einer hageren Frau mit verschmiertem Kajalstrich, aus deren roter Lackledertasche der Kopf eines schwarzen Pudels hervorlugte, und einem jungen Mädchen mit Glatze. Obwohl es mir den Hinterkopf zugewandt hatte, wusste ich, dass es ein Mädchen war. Ich erkannte es an seiner zierlichen Figur. Ganz unten am Hinterkopf, direkt über dem glatt rasierten Nacken war ein kleines Tattoo, ein Yin-Yang-Symbol, und als sich der Bus in Bewegung setzte, begann das Mädchen, mit einer leisen, ungewöhnlich hohen Stimme zu summen.
In meiner Nase war der Geruch von Schweiß und Staub, auf meiner Zunge lag ein feiner metallischer Geschmack, meine Finger waren taub.
Mit Hunderten von Menschen schleppte ich mich zur Passkontrolle, einem riesigen, durch eine Glastür abgetrennten Raum mit grünem Linoleumboden. Eine Klimaanlage summte, Füße scharrten, hinter mir hörte ich etwas zu Boden fallen, ein hartes Klirren, vielleicht waren es Münzen. Eine Frau fluchte, ein Kind weinte und ein Stück vor mir entdeckte ich Elfes lilafarbenen Schopf. Ihr helles Lachen drang an mein Ohr, eine dunkelhäutige Frau im hellblauen Kittel wischte den Flur, sie sang. Ich hielt Ausschau nach dem Jungen mit dem traurigen Lächeln, aber ich konnte ihn nirgends entdecken.
Zwei Schlangen hatten sich gebildet; rechts die Brasileiros, links die Estrangeiros, die Fremden. Ein Teil von mir drängte nach rechts, aber dort gehörte ich nicht hin. Seit meinem vierten Lebensjahr hatte ich einen deutschen Pass und der bedeutete, dass ich mich links einordnen musste, in die Reihe der Fremden.
Die rechte Schlange schrumpfte zusehends auf eine Handvoll Brasilianer zusammen, während wir, die Fremden, im Schneckentempo vorwärtskrochen.
Mein Kopf tat weh, meine Muskeln machten schlapp und in meinem Magen rumorte der Hunger. Es roch nach Eukalyptus-Putzmittel und Müdigkeit und eins der Neonlichter über mir flimmerte wie blöde, bis es mit einem elektrischen Sirren erlosch. Gleich war ich an der Reihe. Vor mir stand nur noch das Mädchen mit der Glatze, das jetzt schon eine kleine Ewigkeit mit dem Passbeamten debattierte. Ob sie auch zu unserer Gruppe gehörte? Der Beamte hielt ein Papier in den Händen, das er, ohne eine Miene zu verziehen, studierte. Neben ihm stand der Rucksack des Mädchens.
Ich kramte in meiner Jackentasche. Wir alle hatten für die Einreise ein Schreiben erhalten, das wir zusammen mit unserem Pass vorzeigen sollten, denn Tempelhoffs Assistentin würde uns erst in der Empfangshalle abholen, um von dort unsere Überfahrt zur Insel zu leiten. Natürlich hatte der Zeitungsartikel, den Elfe mir im Flieger in die Hand gedrückt hatte, nur die halbe Wahrheit gesagt. Selbstverständlich würde Tempelhoff nicht der Einzige sein, der unser Projekt betreute. Ihm stand ein Team zur Seite –wenn auch ein kleines. Eine Designerin hatte unsere Unterkunft auf der Insel neu ausgestattet, eine Stylistin hatte unsere Garderobe bereitgelegt. (Um Elfes Frage zu beantworten, ja – auch meine Maße hatte die Stylistin in Deutschland notiert: Gewicht 52 kg, Größe 1,68, Schuhgröße 37, Brust 78, Taille 68, Oberweite schmal, Körbchengröße 70 A).
In Angra dos Reis würden ein Helikopterpilot und eine deutsche Ärztin abrufbereit für Notfälle sein. Aber für die Überwachung der Monitore hatte Tempelhoff lediglich einen Kameraassistenten eingestellt, der ihn schichtweise ablösen sollte. Ich war erleichtert darüber gewesen, denn die Vorstellung, von einer ganzen Horde von Filmleuten beobachtet oder gar belacht zu werden, war mir unerträglich. Dennoch fand ich es seltsam, dass nur ein einziger Assistent Tempelhoff zur Seite stand. Ich fragte mich, was das über den Regisseur aussagte. Wollte Tempelhoff die ersten Bilder von uns nicht mit anderen teilen? Wollte er Diskussionen aus dem Weg gehen? Seine Ruhe haben? Oder nahm er vielleicht sogar Rücksicht auf uns?
Wie auch immer: Unter ständiger Aufsicht waren wir in jedem Fall – zumindest hatte Tempelhoff das unseren Eltern garantiert.
Der Passbeamte verwies das Mädchen mit der Glatze an einen Kollegen und nickte mir zu. Meine Knie zitterten so sehr, dass ich Mühe hatte weiterzugehen.
Ich hielt den Kopf gesenkt, während mein Pass und die Einreisepapiere geprüft wurden, zu denen auch die Erlaubniserklärung von Erika und Bernhard gehörte. Die schwarzen Finger des Beamten waren sehnig, über den Handrücken zog sich eine wellenförmige Narbe und seine Fingernägel schimmerten hell wie geschliffenes Elfenbein. Hinter ihm, an der Glastür war ein Militärpolizist aufgetaucht, ich sah ihn nur aus den Augenwinkeln; seine beige Uniform mit schwarzen Kampfstiefeln, Schlagstock – und Pistole. Bei ihrem Anblick hatte ich plötzlich das Gefühl, als ob kurze, grelle Blitze durch mein Gehirn schossen. Meine Augen zuckten, in meinem Bauch wurde es heiß und gleich darauf eiskalt, es war eine Mischung aus Todesangst und abgrundtiefem Hass. Der Polizist verschwand wieder und der Beamte gab mir die Papiere zurück.
»Pode passar. Bem vindo ao Brasil.«
Die dunkle Stimme des Beamten war ausdruckslos, aber in seinem Akzent war dieses Singen, dasselbe gelassen weiche Singen, das ich auch von Esperança im Ohr hatte, jedes Mal wenn ich an ihren Namen dachte – und an das Gesicht, das ich nur noch vom Foto und aus dem Internet kannte. Die schwarzen Locken, die ernste Stirn und die mandelförmigen, strahlenden Augen. Esperança bedeutet Hoffnung.
In der Empfangshalle sah ich Elfe wieder. Sie war barfuß und schwirrte in ihrem wallenden Kleid wie ein riesiger Schmetterling in einer Gruppe von Jugendlichen umher, die sich um eine junge Frau geschart hatten. Ich kannte sie von den Casting-Gesprächen, es war Maja, Tempelhoffs Assistentin. Sie trug ein sandfarbenes Leinenkleid und eine sonnengelbe Schirmmütze und neben ihr stand unverkennbar ein großes Schild mit einer schlichten Aufschrift: Isola.
Ich wich einer dicken Brasilianerin aus, die sich mit weit ausgebreiteten Armen auf zwei schwarzhäutige Jungen stürzte, und ging zögernd auf die Gruppe zu. Isola war der Titel, den Tempelhoff für unser Inselprojekt ausgewählt hatte. Eigentlich ist Isola das italienische Wort für Insel, die auf Portugiesisch Ilha heißt. Aber während in Ilha etwas Sinnliches, Sehnsuchtsvolles mitschwingt, verbirgt sich Isola in dem Wort Isolation – und genau das würde ja auch auf uns zutreffen. Unsere Insel gehörte zwar zu Brasilien, aber davon würden wir nichts mehr mitbekommen, wenn wir erst einmal dort waren. Auf der Insel würden wir abgetrennt sein vom Rest der Welt.
Neben Tempelhoffs Assistentin stand ein riesiger Junge mit einem hellen Strohhut und breiten, kantigen Schultern. Sein Gesicht war rot verschwitzt, er hatte beide Hände in den Hosentaschen vergraben und kaute nervös auf seiner Unterlippe herum. Vor ihnen kramte ein dünnes Mädchen mit flammend rotem Haar in ihrem Rucksack herum. Eine pelzige Tatze lugte aus der Rucksacköffnung hervor und das Mädchen stopfte sie mit einer hektischen Handbewegung zurück ins Innere.
Die blonde Barbie, die Elfe im Flugzeug so spöttisch gemustert hatte, gehörte offensichtlich auch zur Gruppe. Sie lehnte ein Stück weiter rechts an einem Leuchtplakat für Colawerbung. Die schweren, glänzend frisierten Locken reichten ihr bis zum Po. Zu ihren verwaschenen Hüftjeans trug sie rote Flip-Flops und ein bauchfreies Tanktop im Army-Look, das ihre Oberweite – die Betonung liegt auf Weite – deutlich zur Schau stellte. Ihr rechter Unterarm war bandagiert, mit einer knallroten Handgelenkschiene, an der sie ständig herumfummelte.
»Ist das hier die Gruppe?« Die helle Stimme an meinem Ohr gehörte zu einem Jungen mit langen, filzigen Rastalocken. Er hatte ein lustiges, offenes Gesicht mit einer Stupsnase und unzähligen Sommersprossen auf der milchfarbenen Haut. Unter dem Arm trug er ein Surfbrett und aus seiner Tasche ragte die glatte Oberfläche einer Trommel heraus.
Ich nickte.
»Richa… «, setzte der Junge an, dann grinste er. »Ich meinte Milky. Ich bin Milky. Und du?«
»Vera. Das ist Vera.« Elfe war zu uns herübergeschwirrt. Sie legte mir den Arm um die Schultern, als wären wir alte Freundinnen, und zeigte auf ein dunkelhäutiges Mädchen, deren krauses Haar unter einem afrikanischen Tuch hervorlugte. »Und das da drüben ist Pearl. Ihre Eltern kommen aus Trinidad, aber Pearl ist in Heidelberg aufgewachsen. Sie geht auch zur Schauspielschule, mit Schwerpunkt Gesang. Tempelhoff hat sie bei einer Musicalaufführung in Heidelberg entdeckt, cool, oder?« Elfe ließ ihre Glasperlen klimpern. »Der große Kleiderschrank, mit dem Tempelhoffs Assistentin gerade redet, nennt sich Neander, passt ja auch irgendwie, findet ihr nicht? Und das dahinten«, Elfe zeigte auf einen asiatischen Jungen mit langem lackschwarzem Haar, der im Schneidersitz und mit kerzengerader Haltung auf dem Boden hinter der Assistentin saß, »ist Lung. Neben dem hab ich die letzten Stunden im Flieger gesessen, und ob ihr es glaubt oder nicht, er kommt aus einem chinesischen Zirkus, eigentlich heißt er Noki oder Naki oder so ähnlich, das hab ich ihm aus der Nase gezogen, obwohl wir unsere echten Namen ja eigentlich nicht nennen dürfen, jedenfalls bedeutet sein echter Name im Chinesischen gerader Baum, während er auf der Insel Lung heißt, also Drache, tja, und die blonde Püppi da drüben … « Elfe nutzte die kurze Atempause, um ihr Gesicht zu verziehen »… ist wohl leider auch mit von der Partie. Bin gespannt, wie die sich nennt. Ich tippe auf Paris Hilton und ihr?
»Ich tippe auf Ohne-Punkt-und-Komma, was dich betrifft«, kam es von Milky, aber dabei lachte er Elfe so offen an, dass sie ihn in die Seite knuffte und mich mit dem anderen Arm an ihren weichen Körper drückte. Noch immer roch sie nach dem indischen Parfüm.
»Dann bin ich ja eine gute Ergänzung zu Vera-ohne-Worte, stimmt’s?«, sagte sie. »Los, kommt, wir gehen mal zu Tempelhoffs Assistentin und fragen, wann wir endlich losfahren. Wie viele sind wir denn bis jetzt?«
»Acht«, sagte Tempelhoffs Assistentin, als Elfe mich zu ihr hingezogen hatte. »Ihr seid jetzt acht – nein, neun.«
Sie hakte die Liste auf ihrem Klemmbord ab und nickte einem schlaksigen Jungen zu, der gerade auf uns zugeschlurft kam. Er hatte fettiges Haar und ein dunkles Ziegenbärtchen und auf seinem braunen T-Shirt stand in orangefarbenen Buchstaben: Wusstest du, dass es unmöglich ist, deinen eigenen Ellenbogen zu lecken?
»Nee, das wusste ich nicht«, bemerkte Elfe kichernd, aber es scheint zu stimmen. Seht mal, hinter euch macht sich gerade Nummer zehn zum Affen.«
Ich drehte mich um und mein Blick fiel auf einen Jungen mit hellen, fast weißen Haaren, der sich wohl schon länger im Schatten der Gruppe aufgehalten hatte. Offensichtlich in dem Gefühl, noch immer unbeobachtet zu sein, versuchte er, den Spruch auf dem T-Shirt des ziegenbärtigen Jungen zu überprüfen. Er hielt den einen Arm hinter seinem Kopf und zog mit der Hand am Gelenk des umgeknickten anderen Arms, um den Ellenbogen zu seinem Mund zu bewegen, was natürlich nicht funktionierte. Eine gute Handbreit fehlte. Mit weit ausgestreckter Zunge versuchte der Junge, den Abstand auszugleichen, wobei sich sein Gesicht zu einer grotesken Grimasse verdrehte. Mittlerweile hatte Elfe auch den Rest der Gruppe auf ihn aufmerksam gemacht. Lautes Gelächter erscholl und der Junge ließ wütend die Arme sinken. Sein hübsches Gesicht wurde feuerrot und sein betont lässiges Schnauben brachte die anderen nur noch mehr zum Lachen.
»Glückwunsch«, bemerkte der ziegenbärtige T-Shirt-Träger trocken. »Du hast den Idiotentest bestanden. Ich hab übrigens noch ein anderes T-Shirt, auf dem steht: Wusstest du, dass es unmöglich ist, sich selbst am Arsch zu lecken? Das kannst du uns dann ja auch auf der Insel dokumentieren, dann haben wir das gleich auf Film.« Nummer zehn ballte die Fäuste, aber blieb stumm, während sich Elfe vor Lachen bog.
Das zierliche Mädchen mit der Glatze war Nummer elf.
Ich hatte sie gar nicht kommen sehen, aber plötzlich stand sie da, neben Tempelhoffs Assistentin, klein, zart, die großen Augen weit aufgerissen. Sie sah aus, als hätte sie nicht von Deutschland, sondern von einem anderen Planeten aus den Flug nach Rio de Janeiro angetreten.
»Jetzt fehlt nur noch So… «, setzte Elfe gerade an, als hinter meinem Rücken ein Bellen ertönte. Im nächsten Moment leckte mir eine feuchte Zunge über die Hand.
»Hey, wen haben wir denn da? Gehörst du etwa zu Solo? Davon hat er mir im Flugzeug ja gar nichts erzählt!« Elfe beugte sich über den Hund, ein großer pechschwarzer Labrador, der sich hechelnd und schwanzwedelnd von ihr den Kopf kraulen ließ, ohne dabei von meiner Seite zu weichen. Und dann sah ich ihn, den Jungen mit dem traurigen Lächeln. Solo – der Einzelgänger. Ja, dieser Name passte zu ihm.
In langsamen, gelassenen Schritten kam er auf uns zu und das Instrument, das er wie einen Bogen über der Schulter trug, kannte ich nur allzu gut. Der gebogene Holzstock mit der langen Drahtsaite und dem ausgehöhlten Kürbis war eine Berimbau.
Vielleicht – auch das sage ich manchmal, wenn mich heute die Fragen überfallen –, vielleicht war in Wirklichkeit Solo der Grund, warum ich mich damals nicht von der Gruppe entfernte. Als ich ihn sah, hatte ich ein plötzliches und unerklärlich tiefes Gefühl von Ruhe.
»Dann seid herzlich willkommen«, sagte Tempelhoffs Assistentin und steckte ihr Klemmbord in die Tasche. »Draußen warten die Fahrer auf euch, dann geht es zum Hafen nach Angra dos Reis und von dort nach einer kleinen Erfrischung ab aufs Boot. Wenn wir Glück haben, seid ihr noch vor Sonnenuntergang auf der Insel. Na, aufgeregt?«
Sie zwinkerte in die Runde und zwölf Köpfe nickten zurück.
Unsere Fahrt durch Rio sehe ich im Rückblick nur noch wie eine rasende Abfolge von Bildern vor mir; fiebrige, zuckende, einander jagende Bilder, wie in einem zu schnell geschnittenen Musik-Clip. Es waren Bilder, die mir in den Augen schmerzten, die ich nicht verarbeiten konnte, weil sie zu viele waren, zu viele auf einmal, zu bunt, zu grell, zu widersprüchlich – und viel, viel zu dicht an mir dran.
Ich teilte einen Wagen mit Solo, Elfe und Neander, dem riesigen Jungen mit dem Strohhut und den breiten Schultern. Solo saß mit seinem schwarzen Labrador auf dem Beifahrersitz, ich war hinten eingestiegen und musste die Beine hochziehen, weil der Fahrer seinen Sitz so weit zurückgestellt hatte. Auf der Mitte der Rückbank klemmte Neander, der durchdringend nach Schweiß roch, und am anderen Fenster saß Elfe. Ich nahm ihre Stimme wahr, aber ich hörte ihre Worte nicht, sie rauschten dahin, ohne Unterlass, wie ein Wasserhahn, den man vergessen hat abzustellen, und sie vermischten sich mit den Geräuschen Rios, dieser lärmenden, stinkenden, atemberaubenden Stadt, die mich jetzt mit ihren Eindrücken bombardierte.
Hupende Busse, frisierte Mofas, Autos mit knatternden Motoren, die Skyline der Hochhäuser und Hotelburgen, moderne Banken, alte, sich duckende Kirchen, die im Sonnenlicht glänzende Niteroibrücke, im Hafen die riesigen Frachter und kleinen Fischerboote und an den sattgrünen Hügeln die endlosen Reihen der Baracken. Wie weit weg sie waren und wie schrecklich fremd sie mir vorkamen, diese aus Spanplatten, Wellblech und Pappe zusammengeschusterten Schuhkartons, in einem scheinbar wahllosen Wirrwarr übereinandergeworfen, als wären sie einem Riesen aus der Hand gefallen. Die Luft war ein drückendes Gemisch aus Smog, Meersalz und süßlichem Benzingeruch und sie vibrierte von den Stimmen der Menschen. Unzählige Menschen, überall, auf den Straßen und Gehwegen, auf der Promenade und an den Strandbuden. Mütter mit Babys, Geschäftsmänner in grauen Anzügen, Jogger in schrillen Lycra-Tops, dunkelhäutige Mädchen in winzigen Bikinis, schnorrende Bettler, junge Männer mit Trommeln, alte Männer mit klaffenden Zahnlücken, flirtende Pärchen, barfüßige Straßenkinder in gelb-grünen Trikots, die riesige Schubkarren voller Müll hinter sich herzogen oder am Strand Fußball spielten. Mitten auf einer Kreuzung stand eine große Tonschale mit Maismehl, einer Zigarre und daneben einer Flasche Schnaps – eine Opfergabe für Exú, den Torhüter und Götterboten des Candomblé-Kultes, dem sich auch mein brasilianischer Meister aus Deutschland zugehörig fühlte.
Und über allem schwebte Cristo, das Wahrzeichen Rios. Hoch oben auf seinem Berg, dem Corcovado, breitete er stumm seine steinernen Arme über der Stadt aus. Ich musste die Augen schließen und atmen und hoffen, dass die anderen mir nicht ansahen, wie mir zumute war.
Lange saß ich so da, meinen Kopf an den Rahmen der Hintertür gelehnt, bis ich plötzlich den Fahrer unseres Wagens fluchen hörte. Kurz darauf bremsten wir, scharf und abrupt. Ich flog nach vorn und wurde gleich darauf wieder zurück in den Sitz geworfen. Neben mir keuchte Neander und vorne bellte Solos Hund.
»Was?«, rief Elfe. »Was ist passiert?«
Bei einem Auto vor uns war ein Reifen geplatzt, es schlitterte quer über die Fahrbahn und blieb liegen, während der Verkehr um uns herum hupend zum Stehen kam. Auch unser Fahrer drückte minutenlang auf seine Hupe, aber es war nichts zu machen. Die brütende Hitze, in der wir festsaßen, benebelte meine Sinne und es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, wo wir hier gelandet waren. Als ich zwischen Solo und dem Fahrer aus der Windschutzscheibe sah, presste ich beide Hände vor den Mund. Vor uns lag der Dois Irmaos, der Berg mit den zwei Hügelspitzen, die ihm seinen Namen gaben: zwei Brüder.
»Die Favela«, hörte ich Elfe sagen. »Liegt auf dem Berg da oben nicht dieses schreckliche Armenviertel mit den ganzen Drogendealern? Ich hab in einem Reiseführer gelesen, dass da sogar Touristenbusse hinfahren, das ist ja wohl das Letzte, findet ihr nicht? Obwohl ich schon gerne wissen möchte, wie die Menschen da oben leben. So was können wir uns ja gar nicht vorstellen. Seht mal, da ist einer von ihnen, ein Kind, oh Gott, wie süß … «
Auf der Straße, mitten im Stau zwischen den Autos, stand ein barfüßiger Junge, fünf, höchstens sechs Jahre alt. Er trug kurze Hosen und ein weißes, ölverschmiertes T-Shirt. In den Händen hielt er einen Karton mit Wasserflaschen. Er kam direkt auf uns zugelaufen. Vor meinem Fenster blieb er stehen, klopfte an die Scheibe und zog eine der Plastikflaschen aus seinem Karton hervor. Sein Gesicht verschwamm vor meinen Augen, weil mir die Tränen kamen. Meine Hand krallte sich an den Türgriff und mein Herz schlug, als wollte es aus meiner Brust springen und weglaufen, weg, weg, weg aus diesem Auto. Aber mein Körper war wie gelähmt und im nächsten Moment löste der Stau sich auf. Unser Fahrer gab Gas und der Junge verschwand aus meinem Sichtfeld. Dafür drehte sich Solo zu mir um. Unsere Blicke trafen sich und für eine endlose Sekunde hatte ich das Gefühl, er konnte direkt in mich hineinsehen. Dann schossen wir in das dunkle Loch des Tunnels, hinter dem wir immer am Strand entlang unter hellem Sonnenlicht nach Angra dos Reis, unserem Abfahrtshafen gelangten.
Drei