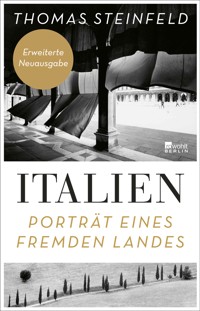
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So vertraut Italien deutschen Reisenden schon immer war und so innig die Liebe der Deutschen zur «italianità», so fremd erscheint das Land heute – denkt man an die zahllosen Regierungskrisen, an einstürzende Brücken oder das Fortbestehen der Mafia. Woher kommt das alles? Thomas Steinfeld hat in Italien gelebt und das Land bereist, von den Gebirgspässen des Nordens bis zu den Olivenplantagen des Südens. Hier zeigt er das ganze Italien: das rege Treiben in Rom, Mailand oder Florenz ebenso wie die Arbeitersiedlungen der Industriegebiete und das Elend der Vorstädte. Er schildert den ländlichen Heiligenkult und die Erfindung des Slow Food, erklärt das Land aber auch aus seiner Geschichte heraus: von der Renaissance bis zum Duce-Faschismus, der noch heute nachwirkt. Er führt vor Augen, wie sich das Land durch die Coronakrise verändert hat, und analysiert den politischen Wandel bis zum Versuch eines Neubeginns unter Mario Draghi. Thomas Steinfeld zeigt eine Gesellschaft, die vielfältiger und oft anders ist, als man es sich nördlich der Alpen vorstellt – und zugleich Landschaften und Kulturschätze, die nie an Anziehungskraft verloren haben. Ein reiches, ebenso sinnliches wie reflektiertes Italien-Porträt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas Steinfeld
Italien
Porträt eines fremden Landes
Erweiterte Neuausgabe
Über dieses Buch
So vertraut Italien deutschen Reisenden schon immer war und so innig die Liebe der Deutschen zur «italianità», so fremd erscheint das Land heute – denkt man an die zahllosen Regierungskrisen, an einstürzende Brücken oder das Fortbestehen der Mafia. Woher kommt das alles? Thomas Steinfeld hat in Italien gelebt und das Land bereist, von den Gebirgspässen des Nordens bis zu den Olivenplantagen des Südens. Hier zeigt er das ganze Italien: das rege Treiben in Rom, Mailand oder Florenz ebenso wie die Arbeitersiedlungen der Industriegebiete und das Elend der Vorstädte. Er schildert den ländlichen Heiligenkult und die Erfindung des Slow Food, erklärt das Land aber auch aus seiner Geschichte heraus: von der Renaissance bis zum Duce-Faschismus, der noch heute nachwirkt. Er führt vor Augen, wie sich das Land durch die Coronakrise verändert hat, und analysiert den politischen Wandel bis zum Versuch eines Neubeginns unter Mario Draghi.
Thomas Steinfeld zeigt eine Gesellschaft, die vielfältiger und oft anders ist, als man es sich nördlich der Alpen vorstellt – und zugleich Landschaften und Kulturschätze, die nie an Anziehungskraft verloren haben. Ein reiches, ebenso sinnliches wie reflektiertes Italien-Porträt.
Vita
Thomas Steinfeld, geboren 1954, war Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», bevor er zur «Süddeutschen Zeitung» wechselte, für die er als Leiter des Feuilletons und zuletzt als Italien-Korrespondent arbeitete. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Thomas Steinfeld ist Autor mehrerer viel beachteter Bücher, darunter «Der Sprachverführer» (2010) und «Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx» (2017).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2022
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Gianni Berengo Gardin/contrasto/laif; Ursula Schulz-Dornburg
ISBN 978-3-644-01289-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort von Ingo Schulze
Prolog: Eine plötzliche Eintrübung des Blicks
1. Wege nach Italien
2. Fünf Ansichten eines schönen Landes (Piemont)
3. Die Welt ist eine Klippe, hinauf führt eine Treppe (Ligurien)
4. Die gute und die schlechte Regierung (Toskana)
5. Die Zentralbauten des modernen Menschen (Florenz)
6. Das Rückgrat eines langen, schmalen Landes (Umbrien und ein wenig Latium)
7. Die Hauptstadt der Welt, gefügt aus Ruinen (Rom I)
8. Das Vergehen und das Umbauen, das Glauben und das Teilen (Rom II)
9. Unter dem Asphalt biegt sich die Pinienwurzel (Kampanien)
10. Die Gemeinschaft der verlorenen Seelen (Neapel)
11. Kathedralen in der Wüste, und die Wolken sind rosa (Der Süden)
12. Die Mitte des Mittelmeers (Sizilien)
13. Auf jedem Berg ein Zentrum der Welt (Marken)
14. Zwischen der Via Emilia und dem Wilden Westen (Emilia Romagna)
15. Dunkle Silhouetten vor nebliger Landschaft (Der Po)
16. Ein herrschaftlicher Blick vom Hügel auf das Land (Venetien)
17. Die Arche und ihr langsamer Untergang (Venedig)
18. Die ästhetische Avantgarde und das Glück der großen Stadt (Mailand)
Epilog: Die Schönheit der Langeweile
Literatur
Karte von Norditalien
Karte von Süditalien
Bildnachweis
Vorwortvon Ingo Schulze
«Nein, es gibt wahrlich genug Bücher über Italien», erwiderte ich jedes Mal auf die Frage, ob ich als Stipendiat der Villa Massimo über Rom und Italien schreiben werde. Es gibt wohl kein anderes Land, über das sich deutsche Autoren so oft und so stetig schreibend verbreitet haben wie über Italien.
Aber warum würde ich dann nach Rom gehen? Um ein Jahr ungestört in schönster Umgebung zu arbeiten?
«Warum nicht?», sagte ich und hoffte, von weiteren Nachfragen verschont zu bleiben. Ich war überzeugt von dem, was ich sagte. Daran änderte auch meine Italiensehnsucht nichts, die ich seit langem hegte und die mit jedem Besuch in Italien nur noch größer wurde.
Italien war mir schon als Kind gegenwärtig gewesen. Das in lobender Absicht gebrauchte Synonym «Elbflorenz» für meine Heimatstadt Dresden hatte mich schon früh irritiert. Sollte die unvergleichliche Schönheit Dresdens denn etwas Abgeleitetes sein, nur der Abglanz von jenem Florenz, über das ich nichts wusste? Der Name «Italienisches Dörfchen» beschäftigte ebenfalls meine Phantasie. Ich zweifelte nicht daran, dass die italienischen Erbauer der Dresdner Hofkirche in jener Gaststätte (das Gebäude war erst 1913 als Begrenzung des Theaterplatzes zur Elbe hin errichtet worden) gelebt hatten. Der Zwinger, so hieß es, sei italienischer Barock, im Gegensatz zum französischen Barock in Preußen. Das wichtigste Bild der Dresdner Gemäldegalerie, die «Sixtinische Madonna» von Raffael, ja überhaupt die wichtigsten Bilder stammten aus Italien. Lange bevor ich Cesare Pavese zu lesen begann, war mir Turin ein Begriff. Im Herbst 1973 besiegte Dynamo Dresden Juventus Turin zu Hause zwei zu null und warf den «haushohen» Favoriten aus dem Pokal der Landesmeister, was niemand für möglich gehalten hätte. Spaghetti galten allgemein als Lieblingsgericht (Pizza, Espresso, Cappuccino blieben bis 1989 weitgehend unbekannt). Als ich in der zehnten Klasse Latein lernte, wurde die Antike gegenwärtig. In der Dresdner Skulpturensammlung lassen sich die Herkulanerinnen bewundern, die zu den frühesten Funden in Herculaneum zählen und über verschiedene Stationen bereits 1736 nach Dresden gelangten. An ihnen entwickelte Winckelmann in der Mitte des 18. Jahrhunderts sein Ideal von «edler Einfalt und stiller Größe» – in Abgrenzung zu dem von ihm verachteten Barock, der den Gelehrten auf Schritt und Tritt in Dresden umgab und sogar jenes Gebäude zierte, das die antiken Statuen beherbergte. Meine erste Arbeitsstelle, das Theater in der ehemaligen Residenzstadt Altenburg, schenkte mir die unmittelbare Nähe mit dem Lindenau-Museum, das die bedeutendste Sammlung frühitalienischer Tafelbilder nördlich der Alpen beherbergt. Das Faszinierende an der Sammlung ist, dass sich in höchster Qualität die Herausbildung der Kunst aus dem Kult nachvollziehen lässt, von der Ikone zum Altarbild, vom Altarbild zum Reisealtar und schließlich weiter zum Tafelbild, das man erwarb, weil man es schön fand und damit repräsentieren konnte, wie sich schon bei Petrarca nachlesen lässt. Es geht um nicht weniger als die Erfindung des Bildes in der Neuzeit.
Heute staune ich, wie ich mich als Student der Klassischen Philologie der Antike im Allgemeinen wie auch den Dresdner und Altenburger Sammlungen im Besonderen zuwenden konnte ohne Aussicht, die Welt, aus der all das stammte – das Bauwerk, die Stadt, die Landschaft, die Gesichter, die Stimmen, die Gerüche und Düfte, das Licht, das Klima –, in absehbarer Zeit zu sehen. Um zu begreifen, was mir vorenthalten worden war, musste ich erst nachvollziehen, was in Deutschland schon fast als platonisches Urbild einer Reise gelten kann: die Überquerung der Alpen gen Süden. Wir folgten diesem Vorbild zwei Tage vor Weihnachten 1990 zum ersten Mal, im Schlafwagen von München nach Venedig, unglücklich, uns um den Anblick der Bergriesen, vor allem des Brennerpasses – den ich mir äußerst erhaben vorstellte –, gebracht zu haben durch den Pragmatismus des Fahrplans und unseres Budgets. Ich hatte nie an der Wirklichkeit von Venedig gezweifelt. Die Stadt jedoch tatsächlich zu betreten war ein traumhaft schöner Schock, sicherlich nicht nur für uns Ostler.
Ich war so euphorisch, dass ich meine Mitreisenden überredete, unsere Ankunft mittags in einem Fischrestaurant nahe der Accademia zu feiern. Danach war unser Reisebudget auf die Hälfte reduziert, Restaurantbesuche kamen nicht mehr in Frage. Doch vermisste ich nicht nur nichts, ich fühlte mich weiterhin privilegiert, weil wir an den Imbissständen und in den kleinen Läden Tag für Tag erlesene Speisen fanden, die wir bisher, wenn überhaupt, nur höchst selten genossen hatten.
Nicht zufällig beginnt mein zweites Buch – das erste, das Deutschland zum Hintergrund hat – mit einer Reise nach Italien: «Sie müssen mal versuchen, sich das vorzustellen. (…) Man befindet sich auf der anderen Seite der Welt und wundert sich, dass man wie zu Hause (…) einen Fuß vor den anderen setzt, als wäre das alles selbstverständlich. Wenn ich mich beim Zähneputzen im Spiegel sah, konnte ich noch viel weniger glauben, in Italien zu sein.» (Simple Storys, Kap. 1)
Ein Künstlerfreund belehrte uns darüber, zu welcher Uhrzeit man abends in ein Restaurant geht, in dem man zuvor reserviert hat, und in welcher Reihenfolge man bestellt – und verbot uns ganz allgemein Cappuccino nach elf Uhr.
Fortan bestanden unsere Ferien darin, über die Alpen zu fahren und uns langsam, als gelte es, Bluthochdruck oder Ärgeres zu vermeiden, nach Süden voranzutasten: Mantua, die Toskana, später Umbrien. In Orvieto wäre ich schon fast der römischen Gravitationskraft erlegen und für einen halben Tag nach Rom gefahren. Zum Glück ließ ich diesen Unsinn bleiben und erfüllte mir den Herzenswunsch später.
Und dann plötzlich ein ganzes Jahr Rom. Ich hatte mir genug Arbeit mitgenommen – und viele Bücher über Italien, die ich in der Hoffnung auf dieses Stipendium angehäuft hatte. Zwei Jahre nach dem römischen Aufenthalt erschien «Orangen und Engel – Italienische Skizzen», neun Erzählungen zusammen mit achtundvierzig fotografischen Skizzen von Matthias Hoch.
War ich wortbrüchig geworden, weil ich mich schreibend mit Italien anders hatte vertraut machen können? Weil ich versucht hatte, etwas ins Bild zu setzen, das ich anders kaum verstand? Weil mich der Alltag überrumpelt hatte?
Thomas Steinfeld nennt sein Italienbuch «Porträt eines fremden Landes». Zum einen setzt ein gelungenes Porträt – das kann man von einer Fotografin oder einem Maler lernen – immer Wissen und Kenntnisse um das Gegenüber voraus. Zum anderen «funktioniert» der Titel nur deshalb, weil uns Deutschen nach landläufiger Meinung Italien gerade nicht fremd ist. Liegt das an den jahrhunderte-, ja vielleicht sogar jahrtausendealten Erfahrungen der Italiener mit Pilgern, Kaufleuten und Reisenden? In keinem anderen Land fühle ich mich als Tourist so wenig fehl am Platz, so wenig störend, ja beinah dazugehörig wie in Italien. Allein schon die Speisekarten muten vertraut an. Ist unser Blick korrumpiert? Sehen wir nur, was wir schon wissen? Stellt der Titel eine Korrektur unseres Italienbildes in Aussicht? Und damit folgerichtig auch eine unseres Selbstbildes?
Bei diesem Buch habe ich den Verdacht, dass es nicht geplant war. Wer als Korrespondent für einige Jahre nach (und durch) Italien zieht, hat den Auftrag zu berichten. Aber dieses Buch hat noch einen anderen Ursprung.
Schon wenige Seiten genügen, um Zutrauen zu dieser Prosa zu fassen. Hier buhlt keiner um Leser, keine Sensationen locken in den Text. Eher kam es mir so vor, als hätte mich der Autor auf einem Parkplatz aufgelesen und eingeladen, mit ihm zu gehen. Schnell überträgt sich der Rhythmus der Sätze wie ein Schritttempo auf mich als Leser.
Die Reise beginnt mit den Wegen nach Italien und führt dann, grob skizziert, vom nördlichen Westen über die Toskana und Umbrien nach Rom, von dort über Neapel in den Südwesten nach Tarent, den Südosten nach Sizilien und schließlich auf der Ostseite des Apennin wieder hinauf in die Poebene, um dann über Venedig, das Friaul und Triest in Mailand zu enden.
Für den Autor ist Italien ein Land, das sich «im Großen fremd geworden ist», ein Land, «das Fremde abweist und anzieht» und «das in dem Maß, in dem es die Vertrautheiten von einst enttäuscht, neu entdeckt werden muss».
An diesen «Entdeckungen» ist das Buch reich, selbst in jenen Landstrichen, in denen ich mich auszukennen glaubte, wurde ich überrascht. Manche Beobachtung erscheint zuerst simpel. Italien, so Thomas Steinfeld, unterscheidet sich in einem wichtigen Aspekt von anderen großen europäischen Staaten: «Die Städte, allesamt schön, eigenartig und interessant, liegen im Abstand von meist dreißig Kilometern zueinander, und das Wetter lädt oft dazu ein, sich im Freien aufzuhalten.» Und man selbst möchte hinzufügen: Stimmt, in Italien liegt das Schöne immer nah. Aber habe ich mir das je bewusst gemacht?
Und so geriet ich auch im Buch von einer Betrachtung und Anregung zur nächsten, ohne je eine Ödnis durchqueren zu müssen. Neben den sparsam gesetzten Vergleichen des Autors sind es oft Passagen aus der Literatur, dem Film oder der Musik, in denen Betrachtungen kulminieren und noch eine zusätzliche und unerwartete Dimension gewinnen. Wer will, kann darin aber auch den Anfang eines Fadens sehen, Anregungen, denen zu folgen jedem freisteht.
Dieses Buch ist die Frucht eines Journalistenlebens, in dem es auf Reaktionsschnelligkeit und Effektivität ankommt. Jetzt aber spielt Zeit keine Rolle mehr. Das akkumulierte Wissen kann mit Muße gesichtet und verdichtet werden und wird mir, dem Leser, eher als Frage denn als Gewissheit vorgelegt. So fragt Steinfeld zum Beispiel, ob es nicht «in Italien einen Typus von Modernität gibt, der Vormodernes anders integriert hat, als dies etwa in Deutschland oder Frankreich der Fall war».
Ohne mir dessen immer bewusst zu sein, gleiche ich beim Lesen die eigenen Italienerfahrungen unentwegt mit jenen des Buches ab. Trotz meines privilegierten Aufenthaltes als Bewohner der Villa Massimo begegneten mir zwischen Kindergarten, Supermarkt, Spielplatz- oder Arztbesuchen, Besichtigungstouren und Ausflügen viel öfter als in Deutschland jene, die am Rand der Gesellschaft mitunter versteckt, ja fast unsichtbar leben oder, besser gesagt, ihr Dasein fristen. Von den Männern, die uns vor dem Supermarkt die Einkaufswagen bereitstellten, nach der Kasse die Einkäufe in Tüten packten und zum Auto oder nach Hause trugen, über einen Hausmeister aus Darfur, der auch auf Sizilien die Erinnerungen an die Metzeleien zu Hause kaum ertrug, und den in eine Phantasieuniform gesteckten afghanischen Jungen, der als Hausangestellter auch das Servieren der Speisen zu übernehmen hatte, oder die Parkplatzanweiser und Straßenverkäufer, die sich davonmachten, sobald Polizei auftauchte, bis hin zu den Prostituierten aus afrikanischen Ländern, die die letzten Kilometer der Straße zum Strand hin säumten. Für die meisten von ihnen ist die Freizügigkeit des Reisens noch immer kein Menschenrecht, sondern etwas, das illegal, mit all den dazugehörigen Gefahren, Demütigungen und Unsicherheiten, erschlichen werden muss. In Italien wurde für mich etwas sichtbar – und in diesem Buch begegnete es mir wieder –, das ich damals in Deutschland entweder in meinem Alltag umgangen hatte oder das einfach noch nicht so sichtbar existierte, weil sich die Staaten nördlich der Alpen hinter dem sogenannten Dublin-Abkommen verstecken konnten, das alle Verantwortung jenen Staaten zuschob, die die Frauen, Kinder und Männer auf ihrem Weg in den Norden als Erstes betraten. Als ich die Passagen dieses Buches über Prato bei Florenz oder die Poebene (eine meiner Lieblingsstellen) las, rieb ich mir die Augen, in welchem Maß Arbeiter aus China und Indien, aus afrikanischen Ländern oder aus Rumänien und Albanien nicht nur legal in die italienische Wirtschaft eingebunden sind, sondern diese gerade in traditionellen Zweigen überhaupt noch am Leben halten.
Ein zweiter Aspekt gerät beim Lesen dieses Buches regelmäßig ins Blickfeld: Nahezu unausweichlich ist man in Italien mit historischen Tiefen und Schichtungen konfrontiert. Schon an der nächsten Straßenecke kann man wie zufällig auf ein Bauwerk oder einen Ort treffen, das oder der einen fünfhundert Jahre, tausend Jahre, zweitausendfünfhundert Jahre oder noch weiter in die Vergangenheit führt, ja gewissermaßen in einen «Schacht» stürzen lässt. Sei es die Kirche unter der Kirche oder der Mysterienschrein unter beiden.
In einer Ferienpension nahe Syrakus machten wir Station und entdeckten beim Lesen eines Reiseführers, dass sich unser Quartier genau auf jenem Landstück befand, auf dem im 5. vorchristlichen Jahrhundert die Athener ihr Feldlager aufgeschlagen hatten, als sie im Peloponnesischen Krieg die Strafexpedition nach Syrakus unternahmen, während der sie entweder im Kampf fielen oder ertranken oder vor die Wahl gestellt wurden, als Gefangene gleich abgestochen zu werden oder etwas langsamer in den Bergwerken zu verenden. Und am selben Tag betritt man den Dom von Syrakus und begreift, noch während sich die Augen an das Dunkel gewöhnen, dass man in einem antiken Tempel steht, an dessen abgegriffene Säulen, deren Kanneluren erst oberhalb der Reichweite menschlicher Körper wieder sichtbar werden, sich schon Platon angelehnt haben könnte, als er den Tyrannen von Syrakus besuchte, um bei ihm seinen Idealstaat zu verwirklichen. Ein Raum, der ungefähr tausend Jahre lang ein Tempel gewesen war und nun seit tausendfünfhundert Jahren eine Kirche ist, ein Raum, den seit zweieinhalbtausend Jahren Menschen Tag für Tag aufsuchen, um Trost, Hoffnung, Schutz oder Ruhe zu finden.
Die heutigen Konflikte werden durch die Gegenwart von zweitausendfünfhundert Jahren Geschichte nicht schlimmer oder besser. Aber ich konnte mich nie des Eindrucks erwehren, als würde all das, was ich im Studium, in Büchern, in Kirchen und Museen, in Straßen und auf Marktplätzen über die Vergangenheit gehört, gesehen und gelernt habe, durch die Anwesenheit derjenigen, die bei uns Schutz suchen, verlebendigt und vergegenwärtigt. Auf bedrängende Art und Weise erlebte und erlebe ich in Italien Geschichte als ein Kontinuum, dessen Teil ich bin.
Mitunter verfalle ich in einen Wettstreit mit dem Autor dieses Buches und will ihm beweisen, manches zu wissen, das er zumindest nicht erwähnt. Wie kann man nur über Italien schreiben und dabei die wunderbaren Socken und Strümpfe der Marke «Gallo» ignorieren, die es seit einigen Jahren nur noch in Italien zu kaufen gibt? Und wie soll man den neuen Heiligen von Neapel überhaupt erkennen, wenn er ohne alle Rangabzeichen als «offensiver Mittelfeldspieler namens Diego Maradona» ein einziges Mal, und das beiläufig, erwähnt wird? Da braucht es viele gute Betrachtungen der musikalischen Szenen Italiens, um das wiedergutzumachen.
Dieses Buch stellt Fragen, die letztlich, ohne dass dies explizit wird, auch immer wieder zu uns zurückführen. Aufschlussreich sind die Analogien in der Geschichte Italiens und Deutschlands, sei es der späte Nationalstaat, sei es die noch in den Anfängen steckende Aufarbeitung ihrer Rollen als Kolonialmächte, sei es die jeweilige Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus. Vielfach ist das heutige Erscheinungsbild von Bauwerken, Plätzen oder Festen – die wir nicht selten gerade als besonders «echt» oder «archaisch» bewundern – letztlich durch eine faschistische Ästhetik bestimmt. Denn sie isolierte das Kunstwerk von seiner Umgebung, tilgte die «Verunreinigungen» des alltäglichen Lebens, seien es An- oder Überbauungen, erfand oder vereinheitlichte Rituale und Ensembles.
In der neueren Zeit sind die Auswirkungen des Umbruchs von 1989/1990 auf die Parteienlandschaft Westeuropas wahrscheinlich nirgendwo so deutlich zu fassen wie in Italien. Die Kämpfe um die Deutung der Vergangenheit sind Kämpfe um den unmittelbaren Machtanspruch hier und jetzt. Und auch wenn es immer um Italien geht, stellt sich oft der Eindruck her, der Autor spreche über Deutschland: «Die Vorstellung, Kultur setze einen deutlichen Abstand zum großen Staat voraus, hat sich allerdings erhalten.»
Dieses Buch zu lesen ist wie eine Reise mit einem kundigen Führer, der, so scheint mir, das Buch in einem Moment geschrieben hat, in dem sich Wissen und Fremdheit die Waage hielten, in dem das Maß an Kenntnis groß genug war, um nicht an der Oberfläche zu verbleiben, und der Blick trotzdem noch voller Fragen und Neugier war, der das, was die Einheimischen für selbstverständlich halten, gar nicht selbstverständlich findet.
Man braucht keinen Vorwand (zum Beispiel ein Buch), um Italien zu bereisen, um dem Genuss und der Kunstbegeisterung zu frönen, sich treiben zu lassen, zu schauen. Aber vielleicht sind Aufzeichnungen unabdingbar, weil einen das Schreiben zwingt, öfter stehen zu bleiben, genauer hinzusehen, ja den Dingen eher auf den Grund zu gehen, auch dann, wenn die Anstrengung größer als die Neugier zu sein scheint. Das Schreiben bringt einen dazu, eine Beobachtung tatsächlich zu formulieren, es bewahrt einen davor, einem Gedanken nur ein paar Stunden oder Tage nachzuhängen, statt ihn weiterzudenken und ihm Kontur zu geben. Diese Anstrengung kommt vor allem dem Schreiber selbst zugute, eine Freude, die sich selbst genug ist. Deshalb vermute ich, dass Thomas Steinfeld dieses Buch für sich selbst geschrieben hat. Für uns als Leser hat es den Vorteil, dass er niemanden überzeugen will, aber selbst zu verstehen sucht. Und jede gute Beobachtung, jeder eigene Gedanke ist ansteckend. Dieses Buch macht einen selbst munterer, wacher, entdeckungsfreudiger und auch selbstkritischer. Und immer wieder ließ es mich Reisen planen.
Mitunter erfüllt sich ja eine Reise erst im Moment der Heimkehr, in der das Eigene fremd erscheint, als hätten sich die Dinge in unserer Abwesenheit ein wenig verschoben oder als betrete man die eigenen vier Wände durch eine bisher übersehene Tür. Von diesen freudig-unheimlichen, in jedem Fall aber erkenntnishaften Augenblicken beschert einem dieses Buch sehr viele.
PrologEine plötzliche Eintrübung des Blicks
Groß war, über die vergangenen drei Jahrhunderte hinweg, die Zahl der Menschen, denen Italien als eine höhere, freundlichere und irgendwie bessere Form des Lebens erschien. Die meisten kamen nur für ein paar Wochen, wie zu einem Besuch. Sie kamen aber immer wieder. Manche von ihnen wollten darüber hinaus in Italien wohnen, möglichst auf Dauer und oft verbunden mit der Vorstellung, überhaupt erst in diesem Land zu ihrem eigentlichen Dasein zu finden. So innig jedenfalls war der Wunsch, dass einige dieser Menschen sogar verlangten, in Italien sterben zu dürfen, so als bewohne man das Land noch mit der Seele, während der Körper dahingegangen ist. Kein anderes Land gibt es, Frankreich vielleicht ausgenommen, dem außerhalb der eigenen Grenzen derart hochgespannte Gefühle gelten: um der Schönheit seiner Landschaften willen, seiner historischen Stätten und seiner Kunstschätze wegen, ob seiner zivilisierten und geselligen Bevölkerung oder des guten Essens. Italiensehnsucht nennt man dieses Gefühl, das vor allem, aber nicht nur, von Deutschen gehegt wird. Erwartungen dieser Art setzen, sollte man meinen, ein hohes Maß an Vertrautheit voraus.
Umso beunruhigender wirken die schlechten Nachrichten, die seit einigen Jahren in dichter Folge aus Italien kommen. Einige von ihnen sind Wiederholungen älterer Meldungen, die aber zu einer Welt jenseits der schönen Erwartungen zu gehören schienen, zu einer Welt, die den Ausländer nicht wirklich etwas anging. Sie galten einem Land, in dem, wie man (irrigerweise) glaubt, wenig funktioniert, einem Land, in dem viele junge Menschen keine Arbeit finden, einem Land, in dem Städte, die von Erdbeben zerstört wurden, nicht wiederaufgebaut werden, in dem das organisierte Verbrechen herrscht und in dem, vor allem im Süden, illegale Müllkippen brennen. Die neuen Meldungen berichten von einem Staat, an dessen Küsten man die Flüchtlinge zu Tausenden ertrinken ließ, in dem fast jeder zweite Erntearbeiter illegal beschäftigt ist, in dem Roma verfolgt werden oder in dem Millionen von Olivenbäumen sterben, vielleicht an einem Bakterium, vielleicht aber auch an undurchschaubaren Interessen.
Als wäre das alles nicht genug, war Italien das erste europäische Land, in dem das Virus SARS-CoV-2 Menschen in großer Zahl befiel. Zehntausende starben, weil weder die Medizin noch die Politik irgendeine Erfahrung mit der Krankheit besaßen. Vulkane brechen aus, und Seilbahnen stürzen ab. Brücken brechen ein, und plötzlich eintretende Überschwemmungen werden zu einem häufigen Phänomen. Italien ist, so ein mittlerweile weitverbreiteter Eindruck, vielleicht immer schon ein anderes Land gewesen, als man jeweils glaubte. Gegenwärtig aber scheint das Land immer fremder zu werden, was offenbar sogar für seine größten Liebhaber gilt: «Im Norden ist sehnsüchtig oder tadelnd immer vom Schönheitskult der Italiener die Rede», sagt der Schriftsteller Martin Mosebach. «Sind damit etwa die bläulich weißes Licht ausgießenden Neonröhren gemeint, die hier überall die gebräunten Sommergesichter grau und faltig machen? Ob in Wirtshäusern oder Wohnungen – die eiskalte Lichtdusche von der Zimmerdecke lässt alles darunter totenstarr werden.» Es mag sein, dass diese Fremdheit erst entsteht, wenn man sehr vertraut miteinander war. Doch ist es mittlerweile, als gäbe es dort jenseits aller Sehnsuchtsbilder etwas Unheimliches, etwas, das in jederlei Hinsicht das Vertraute unterminiert.
Nach Italien zog ich im Dezember 2013, nachdem ich etliche Jahre in der Redaktion der «Süddeutschen Zeitung» verbracht hatte. Ich wurde Kulturkorrespondent, Kundschafter und Berichterstatter in einem fremden Land, das mich seit langem angezogen hatte, das ich aber noch nicht näher kannte. Wenn ich darüber nachdenke, was mich an Italien lockte und immer noch lockt, fallen mir selbstverständlich jene Dinge ein, die viele Nordeuropäer oder Nordamerikaner an diesem Land so faszinierend finden, die Wärme, das Licht, die Landschaft, die heroischen Küsten oder die alten Innenstädte. Aber mir scheint, dass es unter oder jenseits dieser bekannten Vorzüge noch etwas anderes gibt, das sich nur unter Schwierigkeiten formulieren lässt: eine sich immer wieder als ungebrochen darstellende historische Kontinuität, die sich, in völlig einzigartiger Weise, über nunmehr fast dreitausend Jahre erstreckt.
Diese Kontinuität ist nichts Abstraktes. Sie lässt sich aus fast jedem alten Gemäuer, aus jedem Gemälde, aus den Speisen herauslesen, sie wohnt den Landschaften inne, die, fast seit ewigen Zeiten bewirtschaftet, selbst ein gleichsam menschliches Antlitz angenommen haben. Wohin man auch blickt: Man sieht, dass es Menschen gab, die sich mit Klugheit und Umsicht, voller Ideen und mit viel Phantasie in ihrer Welt einzurichten suchten, und zwar keineswegs nur in praktischer Hinsicht, sondern stets auch mit einem Überschuss an Schönheit. Unzählige Kriege wurden in Italien geführt, es gab Erdbeben und Überschwemmungen. Und doch blieb das Land von den ganz großen Umbrüchen verschont, so dass manches Alte zwar dahinsank, nie aber ein historisches Ereignis zu einem völligen Umbruch in der Gesellschaft führte. All diese Dinge lassen sich betrachten, und auf diese Weise erfährt man auch, dass der technische Fortschritt nur einer der Aspekte ist, an denen sich die Qualität eines Lebens messen lässt.
Zu jener Zeit, Ende des Jahres 2013 also, war nicht nur deutlich absehbar, dass Italien schon bald ein großer Konfliktfall innerhalb Europas wie innerhalb der Europäischen Union werden würde, sondern auch, dass die nicht zuletzt kulturell inspirierte Liebe der Nordeuropäer und insbesondere der Deutschen zu Italien heftigen Belastungen entgegenging.
Meine Erlebnisse und Erfahrungen in den darauffolgenden Jahren sind in dieses Buch eingegangen. Es ist das Ergebnis zahlloser Unternehmungen und Aufenthalte, nicht etwa einer einzelnen, längeren Reise. Dennoch ergeben die Kapitel in ihrer Folge einen Weg, der im Piemont beginnt, an der Westküste Italiens entlang bis nach Sizilien führt und sich dann an der Ostküste hinaufzieht bis nach Venetien und in die Lombardei. Dabei ging es mir vor allem um gesellschaftliche Verhältnisse, die sich dem Ausländer erst allmählich, nach genauem Beobachten, nur mit Unterstützung italienischer Mittler und durch einiges Nachdenken erschließen. Was eine Piazza ist, wollte ich wissen, wie die Landschaft der Toskana entstand, was es mit der Popularität des Padre Pio auf sich hat oder warum man im Norden Italiens so viele ältere Herren sieht, die am Wochenende auf Rennrädern über Hügel fahren. Ich hatte ein Buch im Sinn, in dem die Erfahrungen, die man auf Reisen macht, Anlass sind, über die Gründe dieser Erfahrungen nachzudenken. Ich wollte die Dinge, die ich sah, die Städte und Landschaften, aber auch die Menschen und manchmal auch die Ereignisse, selbst sprechen lassen.
Selbstverständlich ergeben die Reisen, die diesem Buch zugrunde liegen, kein vollständiges Bild des Landes. Den Aspromonte, das Bergmassiv im Süden Kalabriens, die vermutlich verlorenste Landschaft Italiens, habe ich nur aus der Ferne erblickt. Es fehlt die Maremma, es fehlt Molise und vieles mehr, und auch von Sardinien ist kaum die Rede. Alle Orte aber, die vorkommen, habe ich mehr als en passant besucht. Fünf Jahre hatte ich Zeit für meine Ausflüge in ein fremdes Land. Für die Neuausgabe dieses Buches war ich wieder dort. Ich kehre heute ebenso gern nach Italien zurück, wie ich damals dorthin gezogen bin.
Über öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden weht in Italien nicht nur die italienische, sondern auch die europäische Flagge. Man mag das für eine bürokratische Routine halten, es könnte aber auch mehr bedeuten. Vielleicht dienen die Fahnen über den oft prächtigen Portalen als Ausweis vergangener, mehr oder minder erloschener Hoffnungen: zuerst auf die Nation, die dem Land Einigkeit, Glanz und allgemeinen Wohlstand bringen sollte; dann auf Europa, das diese Aufgabe übernehmen sollte, als erkennbar wurde, dass die Nation für so hohe Zwecke nicht taugte. Insofern künden die Flaggen in ihrem Nebeneinander mehr vom Auseinanderfallen als vom Zusammentun. Das vereinte Europa, das, seit es diese Vorstellung gibt, nie als Instanz der Gewalt verstanden wurde, wird mittlerweile von vielen Italienern in diesem Sinn empfunden: Sie glauben sich verraten, übervorteilt und im Stich gelassen.
Etwas Älteres setzt sich in diesem Verschwinden und Verfehlen, in der vermeintlichen Abkehr Italiens von sich selbst fort, etwas, das in verschiedenen Graden der Intensität immer schon da gewesen sein muss – zumindest seit es Italien als Nationalstaat gibt, also seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Denn diese Vereinigung vollzog sich nicht so, wie es in Deutschland geschah, wo der mit Abstand größte Teilstaat zur tragenden Kraft des Nationalstaats wurde, sondern als eine Art von Inbesitznahme des Großen durch das Kleine. Gestützt auf Frankreich und Großbritannien, auf fremde Mächte also, übernahm eine Provinz im Nordwesten das ganze Land und brachte seine Herrschaftsform, einen aufgeklärten, bürokratisch durchgestalteten Absolutismus, gleich mit. Daraufhin wurde die Vereinigung im Süden als eine Art Eroberung wahrgenommen: als erzwungene Eingemeindung einer bäuerlichen Gesellschaft in eine andersartige, nördliche Welt, die schon von einer bürgerlichen Mittelschicht beherrscht wurde.
Überhaupt scheint die innere Befriedung des Landes eine keineswegs abgeschlossene Angelegenheit zu sein. Die Carabinieri bilden nicht zufällig eine militärische Organisation, die innerhalb des Landes operiert. Gleiches gilt für die «Guardia di Finanza», die Steuerpolizei. Und wenn der amerikanische Historiker David Forgacs die Geschichte der organisierten, auch politisch motivierten Gewalt in Italien erzählt, von den «briganti» der Unabhängigkeitskriege über den linken und rechten Terrorismus der siebziger und achtziger Jahre bis zu den Morden an Einwanderern in jüngster Zeit, spricht er von einer langen «Legimitationskrise» des republikanischen Staats, die in seinen Augen andauert.
Ein Gefühl der erzwungenen Eingemeindung scheint vor einigen Jahren, unter anderen Vorzeichen, wiedergekehrt zu sein (es war nie vollständig verschwunden) und ganz Italien ergriffen zu haben. Der Journalist Mario Giordano, in Silvio Berlusconis Konzern Mediaset für die Sendeformate zuständig, hatte mit seinem Buch «Italien ist nicht mehr italienisch» im Frühjahr 2019 in Italien beachtlichen Erfolg. Das Werk ist ein Klagelied auf einen Ausverkauf: Es handelt von den Ansprüchen, die Italien an sich selbst stellen sollte, von ehemals stolzen italienischen Firmen, die Weltgeltung besaßen. Und es handelt von nationaler Schmach, vom Gefühl, als Italiener degradiert worden zu sein, von einem Gefühl, das umso absurder erscheint, je offensichtlicher ist, dass es ja Italiener waren, die den Ausländern ihre Unternehmen verkauften, sei es freiwillig oder unter Zwang. Anlässe für die Behauptung, Italien sei nicht mehr italienisch, gibt es in großer Zahl: Der Reifenhersteller Pirelli gehört einem chinesischen Konzern, aus Fiat ist ein niederländisches Unternehmen geworden, die Mailänder Modefirma Versace ist amerikanisches Eigentum. Die Villen der Toskana befinden sich in den Händen von Amerikanern, Briten und Deutschen, einige der besten Weingüter in Montalcino, im Chianti, im Piemont wurden an ausländische Investoren verkauft, und die Geschäfte der Camorra werden von Nigerianern kontrolliert. Unterdessen lassen sich russische Oligarchen, wie die Journalisten Jacopo Iacoboni und Gianluca Paolucci berichten, bevorzugt auf großen Gütern in der Maremma nieder.
Immer mehr Bars, Hotels und Ladengeschäfte im ganzen Land werden von Chinesen betrieben, oft als erster Versuch ihrer Besitzer, sich eine ökonomisch selbständige Existenz aufzubauen. In Venedig zum Beispiel haben Einwanderer aus Asien längst auch das gehobene Gastgewerbe erreicht. Zwei Drittel der Immobilien an der Piazza del Campo in Siena, die Restaurants und Bars, von denen sich der «schönste Platz der Welt» betrachten lässt, gehören einem Geschäftsmann aus Kasachstan. Unterdessen sind die Bahnhofsvorplätze, die Orte, an denen sich die Immigranten aus dem Süden und aus dem Osten treffen, für das soziale Leben der Städte wichtiger geworden als die Piazze in den historischen Zentren. Sie dienen, offensiver als jene alten Plätze, nicht nur der kollektiven Schaulust (man muss zu mehreren sein, um in Gesellschaft ungeniert gucken zu können), sondern auch zur Demonstration öffentlicher Präsenz sowie als Börse zur Vermittlung von Nachrichten, Kontakten und Gelegenheitsarbeiten. Italien scheint unendlich viele und sehr verschiedene Milieus in sich zu bergen.
Und während so immer größere Teile Italiens in ausländische Hände geraten, gibt es in fast jedem Dorf, jeder Kleinstadt eine Piazza Garibaldi, benannt nach dem Helden der italienischen Einheit, eine Statue Viktor Emanuels II., des ersten Königs von Italien, eine Via Mazzini, die nach dem patriotischen Journalisten Giuseppe Mazzini heißt, dem Kopf der italienischen Einheit, und einen Corso Cavour, benannt nach Camillo Benso Graf von Cavour, dem ersten Ministerpräsidenten des Königreichs Italien. Dieser Nomenklatur gehorchen öffentliche Einrichtungen vom äußersten Norden bis in den tiefsten Süden, von Aosta bis Otranto. Zugleich folgt die Namensgebung halböffentlicher Orte völlig anderen Regeln, vor allem im Süden: In Itri findet man nunmehr sogar eine Osteria Murat, benannt nach dem Abenteurer Joachim Murat, dem Schwager Napoleons, der zwischen den Jahren 1808 und 1815 König von Neapel war, bevor er von den Spaniern standrechtlich erschossen wurde. In Gaeta existiert, wie in vielen anderen Städten des Südens, ein Restaurant namens Re Ferdinando II., an den letzten König von Neapel erinnernd, der sich bis zuletzt der italienischen Einheit widersetzt hatte. Und zahllos sind mittlerweile im Süden die Lokale, die Federico von «Svevia» gewidmet sind, also dem Staufer Kaiser Friedrich II., von dem man meint, er habe einst Deutschland und Italien als ein Reich und eine Kultur behandelt.
Das Land ist anders, als es die Leidenschaft für Italien je wahrhaben wollte. Viele Italiener wissen das, was man daran bemerkt, mit welcher Gründlichkeit und Hingabe sie nicht nur ihre Regierung, sondern auch ihre Landsleute verachten. Der gewöhnliche Italiener, behauptete vor einigen Jahren der im eigenen Land hochgeachtete Journalist Ermanno Rea, sei ein Kleinbürger, dem man das Rückgrat gebrochen habe: «ein wenig Muttersöhnchen, ein bisschen Zyniker, ein bisschen Gauner sowie arrogant, eilfertig, prahlerisch, heuchlerisch, übellaunig, verlogen». Vielleicht ist es auch ganz anders, vielleicht lassen sich die alten Klimatheorien umkehren, woraufhin die Sonne mit der Melancholie in einem viel innigeren Verhältnis stünde, als man es sich nördlich der Alpen je vorstellen wollte. Vielleicht sah man bislang zwar die Armut, aber nicht das Traurige und Bittere daran. Vielleicht gibt es tatsächlich so etwas wie die Würde des Verlierers in einem Land, das, wie der britische Historiker David Gilmour in seinem Buch «Auf der Suche nach Italien» behauptet, nie einen Krieg gewann und womöglich nicht einmal eine Schlacht. Und vielleicht geht die gegenwärtige Situation tatsächlich auf etwas Älteres und Beständiges zurück. Das muss nichts Archaisches sein. Es könnte aber bedeuten, dass es in Italien einen Typus von Modernität gibt, der Vormodernes anders integriert hat, als dies etwa in Deutschland oder Frankreich der Fall war. Vielleicht war diese Differenz nur lange Zeit überlagert durch den Faschismus und dessen Überwindung, durch den Gegensatz von Christdemokraten und Kommunisten mit ihren jeweiligen Heilsversprechen – und zuletzt durch einen Aufbruch in ein angeblich vereintes Europa, der sich in vielerlei Beziehung als ruinös erwies.
Wie fremd Italien geworden ist, nicht nur für viele Ausländer, sondern auch für viele Italiener, lässt sich ausgerechnet an den Ereignissen ermessen, die mehr als alles andere dem eigentlich Italienischen – und das heißt, wie immer: dem Regionalen – gewidmet sind: an den unzähligen Festen, die während der warmen Jahreszeit, von Mai bis Oktober, in jedem Dorf und in jeder Stadt veranstaltet werden. Diese Feste haben eine lange Tradition. Vorausgegangen sind ihnen nicht nur die Kirchweih und der Markt, sondern vor allem die Feste der «Unità», wie sie im Jahr 1945 begründet wurden, als Gegenveranstaltung zu kirchlichen Feiern und zunächst zur Unterstützung der kommunistischen Parteizeitung, später vor allem zur Finanzierung der Ortsgruppen. Ihre große Zeit hatten diese Feste in den siebziger und achtziger Jahren, als sie sich zu immer umfassenderen Festivals entwickelten, um nach dem Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems beinahe vollständig zu verschwinden.
An ihre Stelle hat sich eine lokale Folklore mit neuen oder wiedererfundenen Festivitäten gesetzt. Sie gelten den Kastanien oder dem Wein, der Polenta oder einem Pferderennen, dem Käse oder den Eseln, den Schnecken, den Eiern oder den Muscheln. Gewiss verbirgt sich in jedem dieser Feste ein Kalkül mit dem Tourismus, auch wenn sich bei etlichen kaum Besucher aus der Ferne einfinden, weil die Dörfer oft zu abgelegen und touristisch zu unbedeutend sind. Vielleicht irren sich die Arrangeure in ihrer Hoffnung auf die Gäste aus dem Norden, vielleicht überschätzen sie, wie es oft geschieht, den Reichtum und das Interesse der Reisenden. Doch selbst wenn das so wäre, läge darin nur die halbe Wahrheit. Denn diese Feste richten sich ja ebenso an die Einheimischen, denen sie sich als Folklorisierung ihrer selbst anbieten. Sie stellen Versuche dar, das Eigene als Fremdes zurückzugewinnen.
So wird eine zumindest halb fiktive Ausbeutung der Vergangenheit betrieben, indem man jahreszyklische Feiern an Orten einrichtet, wo solche Feiern lange nicht oder gar nie stattfanden, zu einem doppelten Zweck: Man sucht eine halbwegs konsistente Geschichte, so wie es sie seit den späten sechziger Jahren, seit dem Ende des großen wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Krieg, nicht mehr gibt. Womöglich hat es eine solche Geschichte niemals gegeben. Nun will man dem eigenen Ort einen Sinn aufprägen, wie er für jede Erneuerung notwendig ist, als erster Schritt einer Befreiung aus der stagnierenden Zeit und in der Tradition einer volkstümlichen Lehre von den kleinsten Unterschieden, etwa gegenüber dem Nachbardorf.Das Heimatliche, die vertraute Landschaft, die bekannten Riten, der «dialetto» werden in der Vorstellung zu eigentümlichen Quellen der Kraft, deutlich unterschieden von einer Hochkultur, die von diesem Gegenüber merkwürdigerweise eher profitiert, als dass sie darunter leidet. Zugleich aber erscheint in diesen Festen, gleichgültig, ob sie nun eine verbürgte oder eine erfundene Geschichte gestalten, eine Erinnerung daran, dass man schon immer gern gelebt, gegessen und getrunken hat, auf schönen Plätzen und vor herrlichen Panoramen, und dies auch in Zukunft zu tun gedenkt, gern in Gesellschaft ausländischer Gäste.
In dieses Italien, das sich im Kleinen feiert, weil es sich (und anderen) im Großen fremd geworden ist, soll dieses Buch führen, in ein Land, das Fremde abweist und anzieht, in ein Land, das in dem Maß, in dem es die Vertrautheiten von einst enttäuscht, neu entdeckt werden muss.
Erstes KapitelWege nach Italien
Auf halbem Weg von München nach Venedig, zwischen Bozen und Trient, befindet sich das Dorf Margreid. Es liegt unter hohen Felsen, am westlichen Rand des Etschtals, so dass es nachmittags in den Schatten der Berge gerät, im Winter früher, im Sommer später. Unterhalb des Dorfes erstrecken sich, in Tausende von engen Rebreihen gefasst, bewässert, besprüht und von kleinen Traktoren durchfahren, die Weinberge. Längst sind die hölzernen Gestelle für die Rebstöcke durch Pfähle aus Zement ersetzt. In der Mitte des Dorfes gibt es einen kleinen Platz. Eine Linde rauscht dort, mit einer Bank darunter. Umschlossen ist dieser Platz von den großen Häusern der Winzer, mit Gewölben im Erdgeschoss und weit auskragenden, alpinen Dächern. Dazu gehört ein Gasthaus, hinter dem sich ein mit Kopfsteinen gepflasterter Innenhof öffnet. Ein Brunnen plätschert in dessen Mitte. In großen, tönernen Töpfen, die man offenbar aus der Toskana hierhergebracht hat, wachsen Orangen und Zitronen, und über den weißen Sonnenschirmen scheint ein mediterraner Frieden zu liegen. Auf dem Hof ist es meistens still, abgesehen von den Schwalben, die unter der Traufe nisten. Hier verbinden sich, auf angenehme Weise, etwas Südliches, ein Versprechen dessen, was noch kommen wird, und etwas Nördliches, Frisches und Aufgeräumtes. Fast jedes Mal, wenn ich nach Italien oder zurück in den Norden fahre, kehre ich in diesem Gasthaus ein. Der Hof markiert einen Übergang, er bezeichnet eine Grenze. Sie ist nicht scharf gezogen, sondern bildet eine Mark, wie einst die Randgebiete des Heiligen Römischen Reichs hießen, einen breiten Streifen der allmählich hervortretenden Unterschiede. Aber sie ist gegenwärtig.
Ein paar hundert Meter südlich von Margreid liegt die Stelle, wo das Tal der Etsch am engsten ist, wo die steilen Berghänge von beiden Seiten heranrücken, als wollten sie dem Fluss, der Bahnstrecke, der Autobahn und den Obstplantagen gar keinen Platz mehr lassen. Diese Stelle nennt man die «Salurner Klause». Sie wird von der Haderburg bewacht, einem festen Gemäuer auf einem steil aufragenden Kalkfelsen. Nirgendwo in diesem deutlich mehr als hundert Kilometer langen Tal ließen sich die Reisenden und ihre Wagen besser kontrollieren. Das Tal der Etsch ist zwar leicht zu durchreisen, weil in seiner Sohle relativ eben (wenngleich früher oft von Hochwassern überspült und zu großen Teilen versumpft), aber doch auch an der weitesten Stelle allenfalls ein paar Kilometer breit. An der Salurner Klause indessen ist der Abstand zwischen den Bergen auf beiden Seiten so gering, dass man in einer halben Stunde hinüberzugehen vermag.
Die Salurner Klause ist noch in anderer Hinsicht von Bedeutung: Hier verläuft die Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino und damit die Grenze zwischen einer eher deutschsprachigen und einer eher italienischsprachigen Bevölkerung. Das ist noch so, hundert Jahre nachdem Südtirol Italien zugeschlagen wurde, und die Grenze ist deutlich zu erkennen, auch wenn Südtiroler Zeitungen berichten, dass der Anteil der Italienischsprachigen langsam wächst, der Bulgaren, Rumänen und anderen Osteuropäer wegen, die als Arbeiter in der Landwirtschaft oder im Gastgewerbe kommen und sich an der Sprache der nationalen Institutionen orientieren, zumal die einheimischen Deutschsprachigen immer auch Italienisch sprechen können.
Wer über die Brennerautobahn fährt, nimmt diesen Übergang kaum wahr: Die Straße ist mit sich selbst beschäftigt und an vielen Stellen von Schallschutzwänden eingefasst. Irgendwo, ein wenig südlich der Salurner Klause, wird auf einem Schild darauf hingewiesen, dass Südtirol – «Alto Adige» – hier endet und das Trentino beginnt. Dahinter, bei Mezzocorona (deutsch: Kronmetz), scheint sich in der Landschaft das Tor zum Süden zu öffnen. Auch das Licht wirkt anders, und am liebsten möchte man glauben, der Himmel werde plötzlich höher und sei nunmehr von einem anderen, gleichsam von innen heraus leuchtenden Blau.
Der Brennerpass ist der am meisten frequentierte aller Wege, die in den Süden führen. Über diese Route fielen, über mehr als tausend Jahre hinweg, die meisten nördlichen Armeen in Italien ein. Etwa fünfzehn Millionen Fahrzeuge sind heute auf dieser Strecke pro Jahr unterwegs, mehr als das Doppelte der Menge, die den Tunnel durch den St. Gotthard befährt. Der Brenner ist zugleich aber auch die langsamste aller großen Routen nach Italien. Der Pass ist nur um wenige Kilometer überschritten, und es beginnt eine Kaskade, die, Stufe für Stufe und sehr gemach, aus der germanischen Welt hinabführt ins Romanische und Mediterrane – wobei man sich bei jeder Abwärtsfahrt gen Süden verführt sieht, neben dem deutschen Ortsnamen auch den italienischen auszusprechen, gleichsam als Ritual einer Verwandlung. «Fortezza» heißt, seit der faschistische Politiker Ettore Tolomei zu Beginn des 20. Jahrhunderts alle geographischen Bezeichnungen in Südtirol italianisierte, die riesige Festung, eine im frühen 19. Jahrhundert von den Österreichern erbaute, aber nie benutzte Burg, die den südlichen Eingang zum Brennerpass bewachen sollte, «Franzensfeste» hatte sie auf Deutsch geheißen. Aus «Sterzing» wurde ein «Vipiteno», aus «Brixen» ein «Bressanone», aus «Bozen» ein «Bolzano», bis sich dann, hinter «Salurn» oder «Salorno», die Geographie in eine rein italienische Angelegenheit verwandelt. Jedes Mal, wenn ich nach Italien fahre, spreche ich still die italienischen Namen nach, in einem Ritus der Einstimmung. Mit «Salorno» höre ich auf.
Viele Möglichkeiten gibt es, nach Italien zu reisen. Die Landwege führen, ausgenommen die schmale Passage entlang der Riviera am Ligurischen Meer und einen zweiten derartigen Korridor bei Triest, über ein Gebirge, das die Halbinsel in einem weiten Bogen nach Norden abschließt: Wie ein Riegel liegen die Alpen zwischen Italien und allen anderen Staaten Europas, den reicheren, den nicht so reichen und den ärmeren. Sie scheinen Italien vom verbliebenen Kontinent zu trennen. Selten stimmen die tatsächlichen Grenzen eines Staates mit den «natürlichen» so überein wie bei Italien. Fünf Meere scheiden das Land in allen anderen Himmelsrichtungen vom Rest der Welt: das Ligurische, das Tyrrhenische und das Ionische Meer, die Adria und der Golf von Tarent. Was daraus entsteht, gleicht, geographisch wie historisch betrachtet, eher einer Mole oder einem Landungssteg als einer Festung mit Wassergraben und Zugbrücke, wobei diese Mole fest in der europäischen Landmasse verankert ist, aber in Richtung Afrika weist. Zu den Eigenarten dieser Mole gehört es, dass es einfach ist, an ihren Rändern zu landen, jedoch schwierig, von einer Seite auf die andere zu kommen. Dieser Umstand hat die vielen politischen Teilungen, denen die Halbinsel im Lauf ihrer Geschichte unterworfen war, sehr begünstigt.
Die Alpen sind, im Widerspruch zu ihrem Anblick, zu den schroffen Felswänden und schneebedeckten Gipfeln, ein relativ leicht zu überwindendes Gebirge. Die Alpentäler sind seit langer Zeit besiedelt, der Flüsse und Bäche und mithin der Weidegründe wegen. Selten nur herrschen Wetterverhältnisse, unter denen sich der Brenner, der Tauerntunnel oder der Weg durch den St. Gotthard nicht passieren lässt, mit dem Auto oder mit der Bahn. Zwischen den großen Pässen besteht eine Aufgabenteilung. Über die Pässe im Westen, über die St.-Gotthard-Strecke, aber auch über die Wege, die am Großen und Kleinen St. Bernhard entlang verlaufen, reisten und reisen die Engländer, die Franzosen und auch die Westdeutschen nach Italien. Über sie kamen Hannibal, Karl der Große und Napoleon mit ihren Armeen. Im Osten dagegen, nördlich von Udine oder östlich von Gorizia, früher Görz, herrschte Österreich, über mehr als vierhundert Jahre hinweg, vom Beginn des 15. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Dort befand man sich einst an der vordersten Front des technischen Fortschritts, erkennbar etwa an den Piers und Lagerhallen von Triest, die vor dem Untergang des österreichischen Kaiserreichs zu den technisch bestausgerüsteten Hafenanlagen der Welt gehört hatten. Seit vielen Jahren dämmern sie nun in vortrefflicher Lage als Ruinen dahin.
Die italienische Halbinsel beginnt indessen erst viel weiter im Süden, jenseits eines weiten Tals, dort, wo das nächste Gebirge, der Apennin, anfängt. Nach antiker Geographie umfasst Italien gar nur die Halbinsel, ohne Sardinien, Sizilien und die Poebene; die Grenze verlief am Rubikon bei Rimini. Der Apennin ist zwar niedriger als die Alpen, aber er war, historisch betrachtet, schwieriger zu überwinden als die Alpen. Dieser Gebirgszug gewährte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nur an wenigen Stellen Durchlass. Wer mit der Eisenbahn von Florenz nach Urbino reisen will, muss zuerst nach Bologna oder quer durchs Gebirge nach Faenza fahren und dort in einen Zug nach Pesaro umsteigen, bevor er dann den Bus nach Urbino nehmen kann. Manche Strecken, die Schnellstraße zwischen den Städten Fano an der Adria und Gubbio in Umbrien etwa, sind immer noch eher Hindernisse als Verkehrsverbindungen, und der erst im Jahr 1984 eingeweihte Tunnel durch den Gran Sasso droht einzustürzen. Mehr als ein Drittel Italiens besteht aus Gebirge, und ein weiteres gutes Drittel wird von Hügeln gebildet, was nicht zuletzt zur Folge hat, dass das Bauernland nicht mit großen Maschinen zu bewirtschaften ist.
Im Tal der Etsch, bei Bellinzona oder bei Gemona im Friaul beginnt jeweils eine vertikale Teilung des Landes, die zunächst alpin erscheint, sich dann aber auf ähnliche Weise über die ganze Halbinsel fortsetzt und in den Landschaften um den Apennin besonders ausgeprägt ist. Denn die Landschaften Italiens sind, topographisch von unten nach oben betrachtet, dreigeteilt. In den Tälern wird gearbeitet, dort und in den großen Städten (meist eher in der Peripherie als in den Zentren) leben die weniger wohlhabenden Menschen, dort verlaufen die großen Straßen und die Eisenbahnstrecken. Am Hang und in den Hügeln oberhalb dieser Gebiete wohnen die scheinbar Glücklicheren, hier liegen die Villen, die Gärten und Parks. Darüber aber erhebt sich das Bergland, manchmal von Wald, meist nur von Buschwerk bedeckt, und es ist unzugänglich wie eine echte Wildnis. «In den Bergen» versteckten sich die Briganten und der Widerstand in den späten Jahren des Faschismus, und «in die Berge gehen» heißt immer noch, sich der Staatsgewalt entziehen zu wollen.
Die Halbinsel ist schmal: Wenn man ihren Verlauf zugrunde legt und das Land also von Nordwesten nach Südosten misst (von Livorno nach Rimini, von Rom nach Pescara), ist sie an keiner Stelle breiter als zweihundertfünfzig Kilometer. Und sie ist lang: Von den Hügeln hinter Bologna, von Parma, von Alessandria aus gemessen, erstreckt sie sich über mehr als tausend Kilometer, bis sie dann, hinter Reggio Calabria, hinter Tarent oder Lecce, im Mittelmeer versinkt. Das ist viel weiter als von Berlin nach München, von Edinburgh nach London oder sogar von Paris nach Marseille. Es ist ungefähr so weit wie von Moskau nach Rostow am Don, kurz vor dem Schwarzen Meer. Dabei führt der Weg keineswegs nur von Norden nach Süden. Wer von Neapel nach Bari unterwegs ist, also von Kampanien nach Apulien oder, wie man meinen könnte, vom Süden in den äußersten Süden, kommt weiter nördlich an, als er abgefahren ist. Lecce liegt ungefähr auf demselben Längengrad wie Sarajevo. Und in Brindisi, am äußersten Ende der Via Appia, steht seit antiken Zeiten eine Säule an der Ufermauer, als Zeichen, dass der Weg nun über das Wasser führt, um auf der anderen Seite der Meerenge fortgesetzt zu werden, nach Albanien und in den Balkan, nach Griechenland und in den Nahen Osten.
Italien ist groß in seinen Kommunen, in den vielen kleinen und mittelgroßen Städten, die im ganzen Land verstreut liegen und jeweils etwas ganz Eigenes sind. Italien ist groß in den Regionen, die, jede für sich, stets auf eine solche Stadt bezogen sind. Dass sich die meisten Italiener ein und derselben Sprache bedienen, diesseits und jenseits aller Dialekte, ist eine junge Errungenschaft, die wesentlich durch das Fernsehen befördert wurde. Der italienische Zentralstaat, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, entzog den einst mehr oder minder selbständigen Kommunen zwar die politische Bedeutung. Aber ihre kulturelle und soziale Funktion, oft auch ihre wirtschaftliche, blieb erhalten, ganz abgesehen davon, dass sich der Staat seiner Allgemeingültigkeit offenbar nicht sicher sein kann, erkennbar zum Beispiel daran, dass er die Steuerfahndung, die «Guardia di Finanza», in Form einer militärischen Truppe betreibt. Die Schönheit der Piazza, des Ortes in den italienischen Städten, der Bild und repräsentativer Inbegriff ihrer Bürgerschaft war, lebt vom Bewusstsein einer solchen Souveränität, so gebrochen sie längst auch sein mag (was sie womöglich noch schöner werden lässt). Deshalb liegen die schönsten Piazze Italiens nicht in den großen Städten, sondern in der Provinz: in Gestalt der Piazza del Popolo in Ascoli Piceno in den Marken zum Beispiel, der Piazza del Popolo im umbrischen Todi oder der Piazza Ducale von Vigevano in der Lombardei.
Diese Vielfalt kann sich erst durch eine Reise erschließen, die über mehrere oder gar viele Stationen führt. All diese Stationen besitzen jeweils ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Aussehen. Das ist seit den Anfängen des Tourismus so, des inländischen wie des ausländischen. Die «Grand Tour», die Bildungsreise der jungen britischen Aristokraten des 17. und 18. Jahrhunderts, führte von Venedig nach Rom und von dort nach Neapel, mit womöglich etlichen Haltestellen dazwischen. Die jungen Adligen reisten zwar auch nach Paris, manche kamen sogar nach Weimar. Eine «Grand Tour» durch den Norden entstand aber nie, was nicht nur daran lag, dass Paris gleichsam alle anderen französischen Reiseziele in sich aufnahm, sondern auch daran, dass man in Frankreich oder auch in Deutschland, wenn man ein bestimmtes Ziel hatte, weite Strecken der Ödnis durchqueren musste. Das ist in Italien anders: Die Städte, allesamt schön, eigenartig und interessant, liegen im Abstand von meist dreißig Kilometern zueinander, und das Wetter lädt oft dazu ein, sich im Freien aufzuhalten.
Die «Grand Tour» erhielt ihre für die Nachwelt maßgebliche Form, als es mit dieser Art des Reisens schon beinahe zu Ende ging: Johann Wolfgang Goethes «Italienische Reise», mehr als zwanzig Jahre nach den Ereignissen niedergeschrieben, die sich zwischen September 1786 und Mai 1788 zugetragen hatten, wurde zum einflussreichsten Dokument eines solchen Unternehmens schlechthin. Erkennbar ist diese Wirkung an der Beliebtheit des Mottos, das Goethe seinem Buch vorangestellt hatte, um es dann wieder zu streichen: «Et in Arcadia ego» – «auch ich in Arkadien» (wobei über die Beliebtheit vergessen wird, dass die Worte dem gleichnamigen Gemälde des italienischen Barockmalers Barbieri entstammen, wo sie dem Tod zugeordnet werden: Auch er war in Arkadien). Das gilt auch für die Wahrnehmung dieses Reiseberichts in Italien. «Viaggio in Italia» heißt das Buch in der italienischen Übersetzung, genau wie die italienischen Versionen der Reiseberichte des Barons de Montesquieu, des Anarchisten Michail Bakunin oder der französischen Philosophin Simone Weil. Diese Bücher sind in Italien beliebt, unter Italienern. Sie begleiten offenbar gern ihre Besucher aus anderen Ländern, wenn diese sich aufmachen, das ihnen fremde Land kennenzulernen. So war es auch bei Roberto Rossellinis «Viaggio in Italia» aus dem Jahr 1954, einem italienischen Film, der einem britischen Paar, gespielt von Ingrid Bergman und George Sanders, durch Neapel und Umgebung folgt.
«Viaggi in Italia» gibt es also viele. Die meisten gehören zum Genre des Reisebuchs, das von Ausländern für Ausländer geschrieben wurde. Daneben aber sind etliche Bücher desselben oder ähnlichen Titels entstanden, die von Italienern für Italiener verfasst wurden. «Il viaggio per l’Italia di Giannettino» heißt ein Buch in drei Teilen, das Carlo Collodi, der Autor des Pinocchio, im Jahr 1880 veröffentlichte, als Einführung in das vereinte Italien für Kinder. «Viaggo in Italia» ist ein dickes Buch betitelt, das der Journalist und Schriftsteller Guido Piovene in den Jahren 1953 bis 1956 schrieb, auf einer langen Reise vom Norden Italiens in den Süden. Die Berichte, eine Bestandsaufnahme des ganzen Landes, vor allem in ökonomischer und musealer Hinsicht, wurden im Jahr 1957 im staatlichen Rundfunk gesendet und für eine Bevölkerung, die nach dem Krieg plötzlich mehr oder minder wohlhabend wurde, zu einem nationalen Erlebnis. Die meisten dieser Werke dürften von Norditalienern geschrieben sein, die in den Süden vordringen, während es, empirisch betrachtet, weit mehr Süditaliener geben dürfte, die den Norden besuchen, als umgekehrt.
Dreimal reiste der Schriftsteller und Regisseur Pier Paolo Pasolini durch das Land, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Berühmt wurde vor allem seine erste Reise, die im Auftrag der Mailänder Illustrierten «Successo» («Erfolg») über dreitausend Kilometer hinweg an den Küsten entlangführte. Pasolini legte sie im Jahr 1959 in einem Fiat 1100 (mit Mittelarmlehne, Handschuhfach und Balken-Tachometer) zurück, begleitet von Paolo di Paolo, einem Fotografen. Aus dieser Fahrt entstand der Bericht «Die lange Straße aus Sand». In den frühen achtziger Jahren unternahm der Journalist, Schriftsteller und Puppenspieler Guido Ceronetti die Reise noch einmal. Auf Guido Ceronetti folgte, im Jahr 2014, Roberto Napoletano, der Chefredakteur der Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore». Beide Bücher tragen den Titel «Viaggio in Italia». Die Notwendigkeit, das ganze Land zu bereisen und darüber einen Bericht zu schreiben, scheint immer wieder neu zu entstehen und dabei stets nur zu Ergebnissen zu führen, die schon bald wieder unbefriedigend sind: Jüngst erklärte die Historikerin Antonella Tarpino, man müsse die «Grand Tour» wiederaufnehmen, von italienischer Seite, um den radikalen Veränderungen Rechnung zu tragen, die dem Land durch seine Industrialisierung wie durch die nachfolgende Deindustrialisierung widerfuhren.
Es ist, als wäre Italien ein Geheimnis, das sich nur in der Bewegung erschließt, nur dadurch, dass man von einem Ort zum anderen zieht, und zwar nie ganz ohne Mühen und seltsame Überraschungen – diesem Umstand scheinen auch die unzähligen Bücher Rechnung zu tragen, die einem nie genau spezifizierten «anderen» Italien gewidmet sind. Mehr noch: Dadurch, dass diese Reisen offenbar im Abstand von einigen Jahren oder auch nur von wenigen Monaten von neuem unternommen werden müssen, entsteht nicht allein der Eindruck, es gebe da etwas Mysteriöses, ein «Italia invisibile» (Guido Ceronetti), dem man nie wirklich auf die Spur komme. Mehr noch: Es entsteht ein Zweifel, ob es den Gegenstand, der da immer wieder so innig beschworen werden muss, tatsächlich gibt.
Der erste Ursprung des Reisens ist der Krieg. Von ihm übernahm der Tourismus das Prinzip des Umherschweifens und der Erkundung des Terrains, ferner die offensive Gewohnheit, vorübergehende Lager einzurichten und Einheimische als Hilfskräfte zu rekrutieren, kurz: fremdes Gelände zu besetzen. Vom Handel übernahm der Tourismus nicht nur die Verfahren der Verstetigung des Reisens und der Routenbildung, sondern auch die Bereitschaft, sich mit den Einheimischen zu verständigen, gegebenenfalls ihre Sprache zu lernen, und nicht zuletzt das Prinzip der Berichterstattung. Von der Wallfahrt schließlich übernahm der Tourismus das Streben nach einem entlegenen Ort der Heilung, das Wünschen und Sehnen nach einem fernen, an einen geographischen Punkt gebundenen Zweck, der alle anderen Zwecke in sich aufhebt.
Im 17. Jahrhundert begannen die jungen Adligen, zunächst nur Männer, später auch einige junge Frauen, in den Süden zu reisen, dorthin, wo es möglichst zahlreiche und große Relikte der antiken Kultur zu sehen gab. Eher als dass dieses Ziel ein geographischer Ort gewesen wäre, stellte es eine kulturelle und auch eine seelische Bestimmung dar: auf der einen Seite eine Erhebung zu den zeitlosen Hinterlassenschaften einer höheren Kultur, die den jungen Aristokraten als Vorbild und Spiegel dienen sollte, auf der anderen Seite eine Vertrautheit mit den Fürstenhöfen, wo man sich verfeinerte Sitten aneignete. Südlich der Alpen trafen die Reisenden auf die steinernen Helden der Antike. Sie waren dort stehengeblieben, in einer komplizierten, jedoch substanziell ungebrochenen historischen Kontinuität. So kamen die jungen Aristokraten nach Italien, und so kamen sie vor allem nach Rom, für ein Jahr, für zwei, manchmal auch für drei Jahre. Sie kamen, um zu sehen, oft auch, um zu kaufen, und nicht zuletzt, um die letzte Zeit vor dem endgültigen Erwachsensein in relativer, auch erotischer Freiheit zu verbringen. Alle diese Motive blieben im modernen Tourismus erhalten. Die Bildungsreisenden irrten zwischen den Ruinen umher und verharrten ehrfürchtig vor den bekannten Denkmälern. Manchmal wurden sie selber zu Gelehrten, manchmal verstanden sie gar nichts, und manchmal alberten sie herum. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts indessen veränderten sich die Konstellationen. Neben die Idee, Italien sei das Land der Antike und der großen Kunst, trat damals eine andere Vorstellung: ein Bild des Südens als archaischer Landschaft. Die Antike und die Folklore verschmolzen darin. Hinzu kam eine Idee der katholischen Kirche, die, in alten Riten verhaftet und in sinnlichem Prunk schwelgend, den Besuchern aus dem Norden als eine ebenso dunkel attraktive wie aus der Zeit gefallene Institution erschien, als ein auf sonderbare Weise lebendig gebliebenes Produkt aus einer Epoche, in der es den Protestantismus, und mit ihm die Trennung der Religion von der Magie und die Trennung des Geistes vom Buchstaben, noch nicht gegeben hatte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die Ideale der Griechen und des antiken Italiens zu verblassen, wie Johann Joachim Winckelmann sie mit nahezu unglaublichem Erfolg befördert hatte. Stattdessen entstand das Bild einer fremden, irgendwie ursprünglichen Welt, in der ebenso bunte wie heidnische Gebräuche herrschten. Es entstand auch das uns bis heute vertraute Bild lebendiger, aber chaotischer Verhältnisse, die sich eigensinnig gegen die Tugenden der Industrialisierung behaupten und in denen immer dann, wenn man in großer Eile einen Bahnhof in der Provinz betritt und der Zug schon einfährt, auf dem Fahrkartenautomaten ein Zettel mit der Aufschrift «guasto» («kaputt») klebt.
So war Italien nun gleichsam doppelt bestimmt, als Heimat eines antiken Bildungsideals auf der einen, als Land der einfachen Lebensart und der wärmenden Sonne auf der anderen Seite. Eine Weile noch hielten sich diese Motive die Balance: bei Stendhal zum Beispiel, der glaubte, in Italien das Gegenbild zum zunehmend bürgerlichen Frankreich gefunden zu haben, das Land der schönen Natur, der schönen Künste und der schönen Sitten. Oder auch bei Victor Hehn, dem Kulturhistoriker aus Dorpat in Estland, der zwischen 1839 und 1863 dreimal durch Italien reiste. Seine immer wieder aufgelegten «Ansichten und Streiflichter», die gesammelten Reflexionen dieser Fahrten, prägten mindestens für ein halbes Jahrhundert und vermutlich weit darüber hinaus die Vorstellung der Deutschen von Italien, auf der Grundlage einer humanistischen Bildung, mit Goethe und den Bildern idealer Landschaften im Sinn. Und natürlich bei Henry James, dem amerikanischen Schriftsteller und prototypischen Reisenden des 19. Jahrhunderts, der eine Generation später in Italien nach den Wurzeln der eigenen Kultur suchte, nach Ursprüngen, gegen die man sich, im festen Vertrauen auf den technischen Fortschritt, im eigenen Land abgedichtet hatte. Für beide Typen, für den Enthusiasten der Bildung wie für den kosmopolitischen Skeptiker, scheint es in Italien einen Platz gegeben zu haben.
Reisen, die des Vergnügens, des Verehrens oder des Belehrtwerdens wegen unternommen werden, führen in den meisten Fällen in eine weit zurückliegende Geschichte. Oft ist sie fiktiv, zumindest in Teilen. Das war bei den Bildungsreisen so, die der Begegnung mit den klassischen Stätten der Kultur und der Zivilisation gewidmet waren. Das ist aber auch bei den Reisen so, die in die Sonne und unter die Pergola, zum guten Essen und zu den echten Bauern, kurz: in die archaischen Landschaften des Südens führen sollen. Sie zielen auf ärmere, gleichsam in früheren Stadien der historischen Entwicklung befindliche Gegenden und Länder. Solche Reisen gingen dann von Norden nach Süden, von der überlegenen zur unterlegenen Ökonomie. Die südliche Landschaft, derart abgewertet oder aufgewertet (je nachdem, wie man die Dinge sehen will), verwandelte sich allmählich zum imaginären Raum einer gesteigerten Sinnlichkeit, zum Raum einer vorübergehenden Selbsterlösung und Selbstermächtigung. Als es nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Menschen in die Ferne zog, als das große Reisen auch die einfachen Lohnempfänger erreichte, wurde die Reise ins irdische Paradies zum vorherrschenden Modell des Tourismus, ohne Belastung durch die Kultur. So wurde Italien, vor Griechenland, vor Spanien und weit vor den karibischen Inseln oder vergleichbaren, vermeintlich noch ursprünglicheren Fernzielen, zum Musterland des Aus-der-Welt-Fallens, dem auch damals schon weitgehend industrialisierten Norden zum Trotz.





























