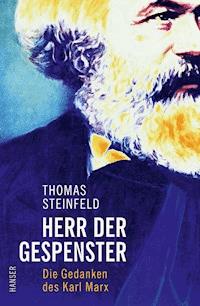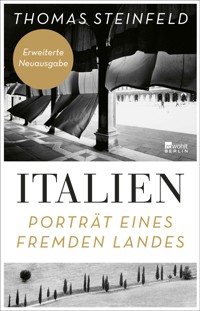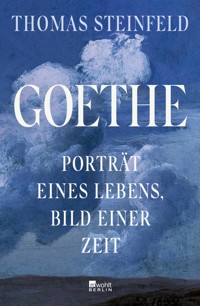
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Goethe im Jahr 1832 starb, hatten die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege und die Industrialisierung Europa von Grund auf verändert. Thomas Steinfeld erzählt Goethe neu – als einen Menschen, in dessen Leben und Werk sich die Umbrüche jener Zeit auf einzigartige Weise spiegeln: beginnend mit der Kindheit in Frankfurt und den Studienjahren in Leipzig und Straßburg, über die Phase des poetischen Aufbruchs bis hin zum «Faust», zur «Farbenlehre» und zum «West-östlichen Divan». Auch das Herzogtum Sachsen-Weimar rückt in ein neues Licht, als eine intellektuelle Landschaft von großer Bedeutung für die Philosophie, die Medizin oder die Physik. Goethe tritt in den vertrauten Rollen des Dichters, Theatermachers oder Reisenden auf, aber auch in den weniger bekannten des Politikers, Kriegsbeobachters und Naturforschers. Steinfeld zeichnet das Bild eines Intellektuellen, der nichts schreiben konnte, ohne zugleich das Gegenteil zu denken, eines Konservativen, der sich stets auf der Höhe der Zeit befand – und eines klugen, neugierigen, aber auch einsamen Menschen, der einige der schönsten und tiefsten Werke schrieb, die es in der deutschen Literatur gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Thomas Steinfeld
Goethe
Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit
Über dieses Buch
Als Goethe im Jahr 1832 starb, hatten die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege und die Industrialisierung Europa von Grund auf verändert. Thomas Steinfeld erzählt Goethe neu – als einen Menschen, in dessen Leben und Werk sich die Umbrüche jener Zeit auf einzigartige Weise spiegeln: beginnend mit der Kindheit in Frankfurt und den Studienjahren in Leipzig und Straßburg, über die Phase des poetischen Aufbruchs bis hin zum «Faust», zur «Farbenlehre» und zum «West-östlichen Divan». Auch das Herzogtum Sachsen-Weimar rückt in ein neues Licht, als eine intellektuelle Landschaft von großer Bedeutung für die Philosophie, die Medizin oder die Physik.
Goethe tritt in den vertrauten Rollen des Dichters, Theatermachers oder Reisenden auf, aber auch in den weniger bekannten des Politikers, Kriegsbeobachters und Naturforschers. Steinfeld zeichnet das Bild eines Intellektuellen, der nichts schreiben konnte, ohne zugleich das Gegenteil zu denken, eines Konservativen, der sich stets auf der Höhe der Zeit befand – und eines klugen, neugierigen, aber auch einsamen Menschen, der einige der schönsten und tiefsten Werke schrieb, die es in der deutschen Literatur gibt.
Vita
Thomas Steinfeld, geboren 1954, war Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», bevor er zur «Süddeutschen Zeitung» wechselte, dort lange Jahre das Feuilleton leitete und zuletzt als Kulturkorrespondent in Italien arbeitete. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Er ist Autor vielbeachteter Bücher, darunter «Weimar» (1998), «Der Sprachverführer» (2010), «Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx» (2017) und «Italien. Porträt eines fremden Landes» (2020). Für seine Übersetzung von Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise» war er 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Thomas Steinfeld lebt in Südschweden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Wolkenstudie (Ausschnitt). Gemälde von Johan Christian Dahl, 1832. Elke Walford/Hamburger Kunsthalle/bpk
ISBN 978-3-644-10083-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
EinleitungDenn alles was entsteht
Im vierten Herbst nach Beginn der Französischen Revolution, im September des Jahres 1792, zog Johann Wolfgang von Goethe in den Krieg. Nur widerwillig hatte er sich auf den Feldzug eingelassen. Als bedürfte er eines besonderen Abstands und eines eigenen Gehäuses, war er den nach Westen vordringenden Soldaten in einer leichten Kutsche hinterhergefahren, bevor er ein Pferd bestieg und sich zu den Offizieren gesellte. Doch nun, an einem trüben, regnerischen Donnerstag, auf halbem Weg zwischen dem Rhein und Paris, sechshundert Kilometer von Weimar, seinem Wohnort, entfernt, ritt der Geheime Rat eines thüringischen Herzogs an die Front. Er war allein. An ausgestreckt daliegenden Toten kam er vorbei, an verendenden Pferden, zerschossenen Häusern und zerstreuten Heuhaufen. Es donnerten die Kanonen, die Erde bebte, und ein paar verirrte Geschosse klapperten die Dachpfannen herunter.
Goethe wollte nicht kämpfen. Nie wollte er kämpfen, außer gegen Isaac Newton, den Physiker, den er mithilfe intellektueller Geschütze aus dem «Ratten- und Eulennest» der Wissenschaft zu vertreiben trachtete, in dem er sich nach Ansicht Goethes zu Unrecht eingerichtet hatte.[1] Als er dem britischen Naturforscher die Feindschaft erklärte, war dieser allerdings schon fast hundert Jahre tot. Auf dem französischen Schlachtfeld, zu seiner Zeit, interessierte ihn dagegen, was es mit dem berühmten «Kanonenfieber» auf sich habe, was von den Krämpfen, Ohnmachten, Angstattacken und plötzlichen Anfällen von Diarrhö zu halten sei, von denen die Kriegsberichte und Romane jener Zeit erzählten.[2] Einige Offiziere aus dem preußischen Generalstab versuchten, den in die Kampfzone reitenden Zivilisten zurückzuhalten. Sie warnten vergeblich: Von disinvoltura, einer lässigen Mischung aus Phlegma und Todesverachtung, spricht man im Italienischen, wenn aus einer vorbereiteten Annäherung an die Gefahr Einsichten gewonnen werden sollen, und so wollte es Goethe halten.
Kurz danach, berichtete er in einem Buch mit dem Titel «Campagne in Frankreich», das er fast dreißig Jahre nach diesen Ereignissen schrieb, habe er das offene Feld erreicht, auf dem «die Kugeln herüber spielten». Fliegende Artilleriegeschosse, notierte er, gäben einen Ton von sich, der zugleich an das Brummen eines Kreisels, an das Sprudeln von Wasser und das Pfeifen eines Vogels erinnere. Bei der Visite auf dem Schlachtfeld sei ihm gewesen, als befinde er sich «an einem sehr heißen Orte». Zugleich habe die Welt einen rötlich braunen Ton angenommen. «Von Bewegung des Blutes habe ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein.»[3] Goethe kehrte wieder ins Feldlager zurück. Von Angst ist in den Erinnerungen nicht die Rede. Bei diesem Aussparen mochte es sich um ein bewusstes Auslassen gehandelt haben, suchte Goethe doch bei ähnlichen Gelegenheiten schnell das Weite, so etwa im April 1813, als Weimar ein zwischen Franzosen und Preußen umkämpftes Gebiet wurde.
In jenem Buch erzählt Goethe, wie er an einem Feldzug teilnahm, den er wenige Wochen nach den Ereignissen als eine der «unglücklichsten Unternehmungen in den Jahrbüchern der Welt» bezeichnete.[4] Die Herrscher von Preußen und Österreich hatten, unterstützt von anderen Monarchen sowie von geflohenen französischen Aristokraten, eine Armee in das revolutionäre Frankreich einmarschieren lassen. Sie sollte Paris erobern und den zunächst nur entmachteten, bald aber auch gefangengesetzten König Ludwig XVI. wieder zum Herrscher über Volk und Land machen. Mit mehr als achtzigtausend Soldaten rückten die Alliierten Ende August in Frankreich ein, fest davon überzeugt, nicht mehr als einen «Spaziergang» nach Paris vor sich zu haben. Doch kamen sie nicht weiter als bis in den Osten der Champagne. Mit einem Artilleriegefecht in den westlichen Ausläufern des Argonner Walds, sechzig Kilometer vor Reims, endete der Feldzug: Angesichts der beweglichen und dann überraschend sicher stehenden Artillerie des Gegners, die mit den überlegenen Geschützen des Systems Gribeauval ausgerüstet war, erschien den Alliierten jeder Versuch, weiter nach Westen vorzudringen, als ein nicht mehr kalkulierbares Risiko.[5] Auch hatte sich die Bevölkerung nicht, wie erwartet, den Invasoren in die Arme geworfen. Allzu groß wurde die Gefahr, bei einem weiteren Marsch nach Westen von Deutschland abgeschnitten zu werden.
Am Abend nach der Kanonade sammelten sich, wie Goethe erzählt, einige Offiziere im Schatten einer Anhöhe. Niedergeschlagen waren sie und verlegen. Unter ihnen befand sich Carl August von Sachsen-Weimar, der die preußische Reiterei befehligte. Auch der Geheime Rat, der beinahe ständige Begleiter des Herzogs, stand unter den Soldaten. Goethe hatte sich vor dem Debakel von Valmy für eine Miete von acht Groschen pro Nacht eine wollene Decke beschafft. In dieser allgemeinen Ratlosigkeit, am 20. September 1792, will Goethe einen Satz für die geschichtsphilosophisch beseelte Nachwelt gesprochen haben: «Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus», lautete die Parole, «und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.»[6] Er sei, wie er schreibt, gebeten worden, als Dichter etwas zur Lage zu sagen. Danach, fährt er fort, habe sich ein jeder im aufgeweichten Lehmboden ein Bett gegraben und sich unter den Mantel gelegt. Er selbst habe sich über die zusätzliche Decke gefreut – und war so frei, darauf hinzuweisen, dass sich unter dem Stoff auch ein antikes Motiv verbarg: «Ulyß kann unter seinem, auf ähnliche Weise erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenügen geruht haben.»[7] Goethe spielt an dieser Stelle auf die «Odyssee» an, auf das Ende des vierzehnten Gesangs: «Und Odysseus legte sich hin. Da bedeckte der Sauhirt / Ihn mit dem großen wollichten Mantel.»[8]
Die Tagebücher aus jener Zeit wurden vernichtet, in einem der vielen Papierfeuer, denen Goethe immer wieder seine Aufzeichnungen übergab. Abgesehen vom Urheber des angeblich gefallenen Satzes erinnerte sich später keiner der damals Anwesenden, dass an diesem Abend eine solche Äußerung gefallen sei. Und für Goethe wäre der Satz, in der überlieferten Form, zumindest ungewöhnlich. Die Gegenwart interessierte ihn, auch die Vergangenheit, niemals aber die Zukunft. In dieser Sentenz jedoch gilt die Gegenwart nur etwas, insofern sie auf das Kommende verweist: «Es hatte Sinn bekommen», erklärt der Philosoph Hans Blumenberg, «beim Sinnlosen dabeigewesen zu sein», was ein Trost für die von aller Hoffnung verlassenen und mit Schlamm bedeckten Verlierer gewesen sein mochte, aber von einem Mann vorgetragen wurde, der die «Weltgeschichte» für eine idealistische Überhöhung disparater Ereignisse hielt.[9]
«Geschichte» war damals ein neues und seltenes Wort. Zwar waren die ersten, in einem modernen Sinn historischen Werke längst erschienen, David Humes «The History of Great Britain» (1754–1762) oder Edward Gibbons «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire» (1776–1789) zum Beispiel. Das deutsche Wort jedoch war erst wenige Jahre zuvor entstanden, als Ausdruck einer neuen Erfahrung, nämlich der Bewegtheit der Zeit.[10] Im selben Sinn und unter denselben Gegebenheiten war auch «Gegenwart» nicht nur eine neue Vokabel, sondern auch ein neuer Gedanke.[11] Goethe also vernahm die Rede von der Geschichte mit Skepsis: Wenn es für ihn eine Historie gab, dann verbunden mit der sich stets erneuernden Erkenntnis, dass Dauer und Bestand nicht zu haben seien, nicht in der Nation, nicht im christlichen Heilsgeschehen, nicht in einem sich verwirklichenden Weltgeist. Der Glaube an den Fortschritt war ihm etwas Suspektes, und in aller Geschichte lag der Tod. Er war kein Demokrat, glaubte nicht an eine Erlösung durch die Liebe und sehnte sich nicht nach einem verlorenen Paradies. Gewiss sei nur, erklärte er Heinrich Luden im August 1806, «daß es zu allen Zeiten und in allen Ländern miserabel gewesen» sei. Der Jenenser Historiker erschrak über diese Äußerung so sehr, dass er meinte, Mephistopheles habe gesprochen. «Goethe lächelte.»[12]
Goethe war kein Reaktionär. Er war konservativ von einer Art, wie es sie schon lange nicht mehr gibt: bewahrend, konservierend, in einem weiten Sinn. Ein Reaktionär verschließt die Augen vor der Gegenwart. Er glaubt an die Zukunft einer Vergangenheit, die nie eine Gegenwart war. Ein Konservativer hingegen träumt nicht von einer fiktiven Vergangenheit. Er will etwas Vergehendes behalten, etwas, das er kennt und schätzt, und zu diesem Zweck muss er den Blick öffnen. So verhielt sich Goethe. Er verteidigte Überzeugungen, die er aus der Tradition übernommen hatte, er bestand auf der Treue zum Landesherrn und Fürsten, die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit blieben ihm fremd. Doch tat er dies in je verwandelter Form, auf der Höhe seiner Zeit und in Kenntnis widerstreitender Lehren: mithilfe der Dichtung, deren Sprache er neu erfand, mit immanenter Kritik und mit den Erfahrungen, die er in seinen Forschungen zur Natur gewonnen hatte. Wenn ihm an etwas lag, so war es der Mensch, der Einzelne, dem die Wunder der Natur und der Kunst aufgehen sollten. Diesen Goethe darzustellen, wider seine Erhebung zum ewigen Helden der deutschen Kultur, wider seine Verklärung zum Botschafter des Guten und Schönen, wider seine Verkleinerung zu einer nur aus historischen Gründen interessanten Gestalt, ihn als den aufgeschlossenen (vor allem im kleinen Kreis), freien, universal gebildeten, gelegentlich widersprüchlichen, manchmal abgründigen, oft isolierten, stets aber hellen Geist zu erkennen, der er gewesen sein muss: Darum soll es in dieser Biographie gehen.
Die Kanonade von Valmy war kein großes kriegerisches Ereignis. Die Geschütze hatten zwar stundenlang gefeuert. Die Geschosse waren aber in nasses Erdreich eingeschlagen und dort stecken geblieben, weshalb die Verluste vergleichsweise gering blieben: Die preußische Armee soll in dieser Schlacht 184 Mann verloren haben, die Franzosen zählten etwa dreihundert tote Soldaten. Die feindlichen Truppen waren einander nicht einmal auf Schussweite der Gewehre nahe gekommen. Ein paar Tage später wurde den Invasoren gestattet, sich hinter die deutschen Grenzen zurückziehen. Doch geriet der schlecht geordnete Rückzug der preußischen Armee durch den neuerlich strömenden Regen zu einer Elendsprozession. Dabei kamen weit mehr Soldaten zu Tode als während der eigentlichen Kämpfe. Sie starben an Hunger, an Ermattung oder an der Ruhr. Goethe nahm dieses Elend wahr. Aber er behandelte es als ein Motiv seiner Erzählung, und daneben tat sich manches andere auf, das Leben in der französischen Provinz zum Beispiel oder die Requirierung von Wein und Würsten.
Auf dem Weg zum Schlachtfeld hatte Goethe die Farbspiele beobachtet, die eine Scherbe Steingut, vom Sonnenlicht beschienen, in einem klaren Teich auf den Rücken der Fische bewirkt hatte – die Passage ist (die «Campagne in Frankreich» wurde, wie erwähnt, dreißig Jahre nach den Ereignissen geschrieben) ein Vorgriff auf die Forschungen zur Natur, die Goethe nach 1792 in hohem Maß beschäftigen sollten. Wann immer ihm die Ereignisse zu viel wurden, zog er sich in seine Arbeiten zur Natur zurück, und dies umso entschlossener, je schlimmer es wurde. Überhaupt offenbarte er einen Sinn für die ästhetischen Spektakel, die solch ein Feldzug bieten konnte. So verglich er die Reflexe, die das Sonnenlicht auf die Bajonette einer bergab steigenden Kompanie zauberte, mit dem Glitzern eines Wasserfalls. Auf dem Rückweg von der Schlacht allerdings gab es keine Ablenkungen mehr. Eine sich auflösende Armee zog, tote Menschen und Tiere sowie große Mengen Kriegsgerümpel in breiter Spur hinter sich lassend, zurück in Richtung Grenze. An «Leib und Seele zerschlagen und zerstoßen» kam Goethe Mitte Oktober in Luxemburg an, in einer Festung, die ihm ob ihrer Bastionen, Forts und Wälle großen Eindruck machte.[13] Die aus Valmy als Andenken mitgenommene Kanonenkugel ließ er in Koblenz liegen.
Sollte Goethe jene Worte über den Anbruch einer neuen Epoche der Weltgeschichte tatsächlich gesprochen haben, wären sie prophetisch gewesen. Der französische Nationalkonvent setzte zwei Tage nach dem französischen Sieg bei Valmy den König ab, erklärte die Monarchie für beendet und führte den republikanischen Kalender ein, der mit ebendiesem 22. September 1792 einsetzte. Prophetisch wären die Worte vor allem gewesen, weil die Revolution bis zu diesem Feldzug eine französische Angelegenheit gewesen war, die nur in Frankreich ausgetragen wurde. Nun aber hatte eine zu großen Teilen mangelhaft ausgebildete Armee über die alten Mächte und ihre oft langgedienten Soldaten gesiegt.
Die deutschen Fürsten reagierten auf die Abschaffung des Königtums und die Ausrufung der Republik mit der Erklärung des Reichskriegs. «Wir werden also auch mit der Heerde ins Verderben rennen», schrieb Goethe damals an Christian Gottlob Voigt, seinen Kollegen im Geheimen Consilium, «Europa braucht einen 30jährigen Krieg um einzusehen was 1792 vernünftig gewesen wäre.»[14] Tatsächlich hatten sich die Ereignisse in den Monaten zuvor in Ehrenstandpunkte verwandelt und unter aktiver Beteiligung des französischen Königs (der etwa den deutschen Kurfürsten verbieten wollte, Flüchtlinge aus Frankreich aufzunehmen[15]) so zugespitzt, dass der Krieg als einzig möglicher Weg erschien, den Konflikt zu entscheiden. Es dauerte danach nicht lange, bis die Revolution ihre Armeen in die Nachbarländer schickte, nach Mainz und nach Frankfurt zum Beispiel, in zwei Städte, die eingenommen wurden, bevor Goethe auf seinem Rückzug auch nur Trier erreicht hatte. Zwanzig Jahre später, fast auf den Tag genau, wurde das brennende Moskau besetzt. Bald danach wurden die Franzosen auf die Grenzen des Jahres 1789 zurückgeworfen. Doch hatte sich Europa von Grund auf verändert.
Goethes Leben teilt sich in zwei Hälften, deren Mitte in die Französische Revolution fällt. Am 26. August 1789 hatte die Nationalversammlung die «Erklärung der Menschenrechte» verabschiedet: «Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich.» Zwei Tage später feierte Goethe seinen vierzigsten Geburtstag. Den ersten Teil seines Lebens hatte er in der alten, feudalen Welt verbracht. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bestand noch: «Das liebe, heil’ge Röm’sche Reich, / Wie hält’s nur noch zusammen?», singt der jüngste Student in «Auerbachs Keller».[16] In Wien herrschte ein Kaiser, und in Frankreich gab es noch einen König. Es galt das «Corpus Iuris Civilis», das aus der römischen Antike überkommene Gemeinrecht, die meisten Dramen wurden nach den Regeln der aristotelischen Poetik geschrieben, und der christliche Glaube war noch in allen Teilen der Gesellschaft ungebrochen (in Weimar gingen Carl August und Goethe allerdings nur selten in die Kirche). Man lebte in einer noch nachmittelalterlichen Welt, und diese war umso altertümlicher, je kleiner die Städte waren und je weiter man aufs Land hinauskam. Die Französische Revolution erschütterte diese Welt bis in die Grundfesten. Sie war ein Ereignis wie die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion des Römischen Reichs, wie die Völkerwanderung oder die Reformation. Zwar war das große Beben in den deutschen Ländern nicht sofort und nicht überall zu bemerken. Es wirkte aber doch, immer größere Kreise ziehend, immer tiefer in die politische, kulturelle und soziale Ordnung eingreifend, bis am Ende die wenigsten Menschen auf dem Kontinent noch so lebten, wie sie es vor der Revolution getan hatten.
Die zweite Lebenshälfte Goethes reichte bis weit in die neue Zeit: Sie war geprägt von der Emanzipation des französischen Volks zum politischen Subjekt, vom Hervortreten der Nationalstaaten, von der Expansion des Maschinenwesens, von der beginnenden Herrschaft des Kapitals und von den frühen Massenmedien. Als Goethe im März 1832 starb, war der Philosophie die göttliche Ordnung abhandengekommen, das Bankwesen hatte sich zu einem eigenen Wirtschaftszweig entwickelt, und von den fast vierhundert «Reichsgliedern», die es in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts noch gegeben hatte (zählte man jeden Reichsritter mit, bis hinunter zu den Herren von Steinau in Euerbach, käme man auf eine Zahl von bis zu zweitausend deutschen Souveränen), waren im deutschen Sprachraum nur noch knapp vierzig Staaten geblieben.[17] In Großbritannien fuhren die ersten öffentlichen Eisenbahnen, in Frankreich hatte das Bürgertum zum zweiten Mal gewaltsam die Macht ergriffen, und die kurz zuvor erfundenen Streichhölzer trugen den Namen «Lucifer». «Wo bleibt Vulkan gegen Roberts et Co., Jupiter gegen den Blitzableiter und Hermes gegen den Crédit mobilier?», fragte Karl Marx wenige Jahre später.[18] Die Antwort hätte lauten können: Zuerst waren sie in Allegorien verwandelt worden, dann gingen sie in die Reklame ein.
Rund sechzig Jahre liegen zwischen den ersten öffentlichen Auftritten Goethes und seinem Tod. «Ich habe den großen Vorteil», soll er zu seinem späteren Mitarbeiter Eckermann gesagt haben, «daß ich zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen und sich durch mein langes Leben fortsetzten, so daß ich vom siebenjährigen Krieg, sodann von der Trennung Amerikas von England, ferner von der französischen Revolution, und endlich von der ganzen Napoleonischen Zeit bis zum Untergange des Helden und den folgenden Ereignissen lebendiger Zeuge war.»[19] Sechzig Jahre sind eine lange Zeit. Goethe verbrachte sie zum größten Teil an ein und demselben Ort, in einer kleinen Stadt in Mitteldeutschland, in einer scheinbar stabilen Umgebung, und er wurde alt, obwohl er häufig unter auch schweren Krankenheiten litt. Nur scheinbar stabil waren die Verhältnisse, weil um diesen Ort herum und manchmal auch darinnen über mehr als zwei Jahrzehnte Krieg herrschte.
Die Beständigkeit, die in diesem Leben zu regieren scheint, verdankte sich einer wie auch immer getroffenen Entscheidung, der großen Stadt auszuweichen, sowie einer Reihe von mehr oder weniger glücklichen Zufällen, die dem Herzogtum allzu heftige Berührungen mit der «neuen Epoche» ersparten. In der Nähe wurden zwar im Oktober 1806 die Schlachten von Jena und Auerstedt ausgetragen. Sie endeten in einer Niederlage für die Preußen und ihre Verbündeten, was in Weimar beinahe zu einer Katastrophe führte – aber eben nur beinahe. In England verdampfte das Ständische und Stehende, überall wurden die fest eingerosteten Vorstellungen aufgelöst, und sogar die neugebildeten Verhältnisse veralteten, noch ehe sie verknöchern konnten. Von einem «Weltkrieg» sprach der politische Schriftsteller Friedrich von Gentz im Jahr 1800. Sein Geheimnis soll darin bestanden haben, die Kräfte einer Nation nicht erschöpft, sondern vervielfältigt zu haben.[20] Fünf Millionen Tote oder mehr sollen Napoleons Kriege gefordert haben, und sie waren nicht die einzigen militärischen Konflikte, die während dieser sechs Jahrzehnte in Europa ausgetragen wurden. Unterdessen wurden in Weimar Dienstjubiläen begangen. Goethes Leben war ein Wunder an Kontinuität in einer vielfach zertrümmerten und sich neu gestaltenden Wirklichkeit.
Eine solche Beständigkeit kann es nur im Überschaubaren geben. Angestoßen im Jahr 1772 von Christoph Martin Wieland, gefördert vom Hof, beflügelt von einem Glauben an die Kunst, versammelte sich in Weimar eine Gruppe Menschen, die sich und anderen etwas zu sagen hatten – oder denen, die etwas zu sagen hatten, als Fachleute im Editionswesen, als Informanten, Schreiber oder Gesprächspartner dienten.[21] In diesem Kreis fand Goethe die Unterstützung, die er brauchte, im Ökonomischen, im Politischen und im Kulturellen. Er betrieb den Zirkel mit der Überzeugung, dass ein kleiner Kreis genauso viel leisten könne wie ein großer. Im zentralistischen Frankreich hätte es eine solche Gruppe nicht geben können, den Schilderungen einer intimen Gemeinschaft zum Trotz, die Jean-Jacques Rousseau in der «Neuen Heloïse» und in den «Confessions» geliefert hatte. Goethe hätte in den Pariser Salons kaum überlebt, seiner «Steifigkeit» oder besser: eines Mangels an gebildeter Leichtigkeit wegen. Gleiches gilt für Wien oder sogar für Berlin. In Weimar beeindruckte er hingegen, wie der englische Lyriker Michael Hofmann meint, als großer Fisch (ein Hecht?, ein Karpfen?) in einem nicht allzu großen Teich.[22] Wo anders als im Herzogtum Weimar hätte er für die «Farbenlehre», ein Projekt der Naturforschung wider den Geist der Zeit wie gegen den damaligen Stand der Wissenschaft, die Unterstützung eines Herrscherhauses erlangen können?
Die Bildung des Zirkels war darüber hinaus nur zu einer gewissen Zeit möglich. «Ein Jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein», erklärte Goethe in «Dichtung und Wahrheit».[23] Die Brüder Humboldt, ein paar Jahre jünger als Goethe, ihm in gegenseitiger Zuneigung verbunden, und halbe – aber eben nur halbe! oder nur zu zweien ein ganzer! – Universalgelehrte auch sie, der eine vor allem Philosoph und politischer Beamter, der andere vor allem Naturforscher und Entdecker, waren in ihren Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten bereits an die Metropolen und an modernisierte Techniken von Verkehr und Kommunikation gebunden.
Als Goethe zur Campagne in Frankreich aufbrach, schrieb er dem Freund Friedrich Heinrich Jacobi nach Düsseldorf, ihm sei «weder am Todte der Aristocratischen noch Democratischen Sünder im mindesten etwas gelegen».[24] Seine Erinnerungen, aufgezeichnet zwischen den Jahren 1819 und 1822, sind unpatriotisch, was die Loyalität zu seinem Herzog nicht berührt. Das Denken in den großen Kategorien der Geschichte war ihm fremd: Wenn ihm auch über längere Perioden seines Lebens zwei Pioniere des historischen Denkens zur Seite standen, nämlich Johann Gottfried Herder und Friedrich Schiller, so erschien ihm Geschichte doch nie als eine Macht, die den Lauf der Dinge in eine bestimmte Richtung vorantrieb. Eher bildete sie für ihn eine Art Kaleidoskop, eine Mischung von ähnlichen Elementen, die fortlaufend ihre Konstellationen veränderten und sich doch gleich blieben. «Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer» sei die Geschichte, spottet Faust im ersten Teil des Dramas.[25]
Goethe verwendete das Wort «Epoche» häufig. Fast neunhundert Einträge verzeichnet das Wörterbuch, in dem der gesamte Wortschatz Goethes festgehalten und sortiert ist. Aber er benutzt es in wechselnden Bedeutungen, manchmal im alten, griechischen Sinn, in dem epoché einen Halte- oder Fixpunkt, ein Innehalten bezeichnet, manchmal in einem neuen, geschichtsphilosophischen Sinn, in dem «Epoche» ungefähr dasselbe wie «Ära» meint. Die Unsicherheit der Bedeutung ist das Signum einer Zeit, in dem sich ein historisches Bewusstsein überhaupt erst bildet. So gilt der Ausspruch von der «neuen Epoche» zwar einem Bruch der Lebensverhältnisse, wie er damals ganz Europa und auch den amerikanischen Kontinent erschütterte: «Es ist irgendwo gesagt: daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, und wann war wohl eine Epoche, die dies so notwendig machte, als die gegenwärtige», schrieb Goethe im Februar 1811 – was bedeutet: regelmäßig unregelmäßig sei die Geschichte.[26] Aber in einem Brief an Schiller, geschrieben am Vorabend des 14. Juli 1796, heißt es: «Heute erlebe ich auch eine eigne Epoche, mein Ehstand ist eben 8 Jahre und die französische Revolution 7 Jahre alt» (geheiratet wurde Christiane Vulpius allerdings erst zehn Jahre später).[27]
Historisches Bewusstsein bedeutet, das Andersartige als solches zu erkennen, und Goethe wusste, dass die neue Zeit historisch denken würde. Aber er suchte sich diesem Denken zu entziehen und das Geschichtliche an die Stelle der Geschichte zu setzen: ein Bewusstsein davon, dass jeder Mensch in jedem Augenblick seines Lebens etwas tun oder lassen kann (oder auch: muss), ein Bewusstsein auch davon, dass er dabei scheitern kann, während er zugleich nie allein ist. Wenn er immer wieder den Begriff «Epoche» benutzte, in changierenden Bedeutungen, so tat er es in einem Bemühen, das historisch Neue zu etwas Altem zu machen und das geschichtliche Denken zu bannen. Später, in seinen letzten Jahren, steigerte sich der Vorbehalt zur offenen Ablehnung: «Ich bin nicht so alt geworden, um mich um die Weltgeschichte zu kümmern», soll er zu Friedrich von Müller gesagt haben, der in Goethes späten Jahren Kanzler des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach war. Sie sei «das Absurdeste, was es gibt; ob dieser oder jener stirbt, dieses oder jenes Volk untergeht, ist mir einerlei, ich wäre ein Tor, mich darum zu kümmern.»[28] Aus solchen Sätzen spricht nicht nur die Verweigerung der Zeitgenossenschaft, des «ich bin dabeigewesen». Es verbirgt sich darin auch ein kritischer Gedanke, der seitdem entglitten ist: dass nämlich in allem historischen Denken eine aufgeschobene Sehnsucht wirksam ist. Es gibt kein historisches Denken ohne die Hoffnung, dass sich Geschichte irgendwann erfüllen möge (mit dem Historismus ist es anders, er sucht das Register des Gewesenen).
Einen berühmten Dichter hatten die preußischen Offiziere nach der Kanonade von Valmy gefragt, und als berühmter Dichter hatte ihnen Goethe geantwortet. Er hätte ihnen indessen auch als ein anderer antworten können: als Jurist, Höfling oder Diplomat, als Fachmann für die Verwaltung eines feudalen Staates von mittlerer Größe, als Naturforscher oder Kulturpolitiker. Schon unter seinen Zeitgenossen waren Menschen, die bei ihm weder Vielfalt noch Wandel zur Kenntnis nehmen und an ihrer Vorstellung vom «Poeten» festhalten wollten. Die Nachwelt tat es mit noch größerer Entschlossenheit. Er hingegen nahm sich, auch wenn er als Dichter berühmt geworden war, seit den späten siebziger Jahren nicht mehr nur als solcher wahr. «Seit länger als einem halben Jahrhundert kennt man mich, im Vaterlande und auch wohl auswärts, als Dichter und lässt mich allenfalls für einen solchen gelten», schrieb Goethe im ersten Heft seiner Zeitschrift «Zur Naturwissenschaft überhaupt», in der er zwischen den Jahren 1817 und 1824 einen großen Teil seiner Arbeiten zur Naturforschung veröffentlichte. «Dass ich aber mit großer Aufmerksamkeit mich um die Natur in ihren allgemeinen physischen und ihren organischen Phänomenen, emsig bemüht und ernstlich angestellte Betrachtungen stetig und leidenschaftlich im stillen verfolgt, dieses ist nicht so allgemein bekannt noch weniger mit Aufmerksamkeit bedacht worden.»[29] Er hätte auch von seinen amtlichen Tätigkeiten reden können. Doch diese erschienen ihm vermutlich als gesetzt und als zu gering in ihrer allgemeinen Bedeutung.
Da sind die Dramen, vom «Götz von Berlichingen» aus dem Jahr 1773 bis zum zweiten Teil des «Faust», den Goethe, als er starb, angeblich versiegelt zurückließ. Da sind die Romane, von den «Leiden des jungen Werthers» aus dem Jahr 1774 über «Wilhelm Meisters Lehrjahre» aus dem Jahr 1796 bis zu den «Wahlverwandtschaften», veröffentlicht 1809. Da sind Gedichte in großer Zahl, Traktate, Rezensionen, da sind die Tagebücher und die Briefe. Mit der Naturforschung beginnt Goethe sich wenige Monate nach seiner Ankunft in Weimar zu befassen, zuerst mit der Geologie unter besonderer Berücksichtigung der Kristalle, später mit der Entstehung und Entwicklung der Pflanzen, mit der Physiologie des Sehens und der Physik der Farben sowie mit der Meteorologie. Daneben gibt es noch etliche andere Arbeitsgebiete, die Goethe sich wählt oder die sich ihm als etwas Notwendiges aufdrängen, die Anatomie oder die Chemie zum Beispiel. Das Interesse des Naturforschers verschiebt sich dabei vom Festen zum Weichen und von dort aus ins Luftige oder gar Immaterielle, von Gesteinen über organische Materialien bis hin zu den Wolken und zum Licht. Dem (zumeist) «fleißigsten Menschen in einer Zeitgenossenschaft von Fleißigen» sind offenbar keine Grenzen gesetzt.[30]
Die «Leiden des jungen Werthers» scheinen von der Liebe zu handeln. Hinter der traurigen Geschichte erhebt sich indessen die Frage, was Liebe eigentlich sei. Die Antwort fällt nicht liebevoll aus. Das Bildungsprogramm, das Goethe im Roman «Wilhelm Meisters Lehrjahre» entfaltet, mündet in einen offenen Widerspruch, in dem sich das Ziel aller Bildung, die Selbstgestaltung des Individuums, als von außen geplante Veranstaltung entpuppt. Der «Faust», das Lebenswerk schlechthin, hat weniger einen Schluss, als dass sich das Ende in mehreren Auflösungen verliert. Die Kristalle, mit denen sich Goethe zu Beginn seiner Naturforschungen beschäftigte, scheinen im Übergang des Toten zum Lebendigen entstanden zu sein. Beim Anblick des Granits stellte sich die Frage nach dem Anfang der Welt. In der Idee der Urpflanze verbarg sich die Frage nach der Entstehung des Lebens. Die Wolken, deren Erforschung er sich in späten Jahren zuwandte, sind eher Erscheinungen als Substanzen, und ihrem eigentlichen Wesen ist kaum auf die Spur zu kommen. Immer wieder bewegt sich Goethe auf der Grenze zwischen dem, was man weiß, und dem, was man nicht wissen kann – und manchmal auch zwischen dem, was man weiß, und dem, was man lieber nicht wissen möchte. Und immer wieder suchte er den Widerspruch zu etablierten Lehren, zu Petrus Camper in der Anatomie, zu Carl von Linné in der Naturlehre, zu Isaac Newton in der Physik des Lichts und der Farben: überall Widerspruch, so viel, dass man ihn für prinzipiell halten könnte, und nicht nur Gegenrede, sondern offensichtlich auch Konkurrenz – bis hin zu Mozart, dessen Librettisten er mit einer «Zauberflöte zweiter Teil» überbieten wollte.[31]
Es war ihm nicht genug. Sein Leben lang, von den frühen Weimarer Jahren bis zu seinem Tod, trug er sich mit Plänen, die, wären sie verwirklicht worden, zu noch weit größeren Werken geführt hätten als zu den Bergen von Schriften, die er tatsächlich hinterließ. Unablässig entwarf er Bücher, die nie oder nur in Fragmenten geschrieben wurden. In den frühen achtziger Jahren, vor der italienischen Reise, wollte er einen «Roman über das Weltall» schreiben, in dem sich Beobachtungen zur Geologie mit Naturpoesie gemischt hätten. In den neunziger Jahren trug er Material für ein Werk zusammen, das vielleicht eine Schrift über Italien hätte werden sollen, tatsächlich aber ein Buch über einen italienischen Kosmos hätte werden müssen: Kulturgeographie und Sozialanthropologie, Kunstgeschichte und Reisebuch in einem. Wenig später spielte er mit dem Gedanken, seiner Zeit mit einer Fundamentalkritik entgegenzutreten. Sie sollte dem Dilettantismus und den Dilettanten gewidmet sein. Letztere verglich er mit «Ameisen», über die sich eine «gewaltige Sündflut» ergießen sollte.[32] Und in den letzten Jahren, bei der Arbeit an «Wilhelm Meisters Wanderjahren» und am zweiten Teil des «Faust», scheint der von allen Seiten hereindrängende Stoff die Form gesprengt zu haben, sodass die Lektüre für die Leser zu einer Zumutung und das Drama beinahe unspielbar wurde. In diesen Werken spiegelt sich der Wille zu einer Gesamtschau aller denkbaren und undenkbaren Dinge: das «Archiv unserer Weltkenntnis», wie es gegen Ende der «Lehrjahre» heißt.[33]
Zugleich zieht sich ein mephistophelischer Zweifel durch das gesamte Werk. In seiner Grundfassung lautet er so: «Denn alles was entsteht, / Ist wert daß es zu Grunde geht. / Drum besser wär’s daß nichts entstünde.»[34] Dieser Zweifel prägte das Werk wie das Leben. Er gehört zur Literatur einer Zeit, in der Jean-Jacques Rousseau, ein weithin bewunderter Autor, die Frage der Akademie von Dijon aus dem Jahr 1749, ob denn der Wiederaufstieg der Wissenschaften und der Künste zu Läuterung der Sitten beigetragen hätte, schlichtweg verneinte. Goethe trieb dieses Misstrauen – oder besser: diesen Enthusiasmus, der jederzeit in ein Misstrauen umschlagen konnte, und umgekehrt – indessen weiter: Als er einen Roman der Liebe schrieb, entpuppte sich das schönste aller Gefühle als höchst fragwürdiges Unternehmen. Als er einen Bildungsroman verfasste, schilderte er zugleich den Totalitarismus des dazugehörigen Programms. Als er in den Adel aufgestiegen war, machte er eine Putzmacherin zu seiner Lebensgefährtin. Und wenn er erzählte, verhielt er sich als kritischer Arrangeur von Versuchen zum Sinn und zu den Formen des Erzählens: Mit den «Leiden des jungen Werthers» schrieb er einen Briefroman, «Wilhelm Meisters theatralische Sendung» wäre ein Gesellschaftsroman geworden, in den «Lehrjahren» versammelte er mehrere zeitgenössische Genres, die pietistische Autobiographie, die Heiligenlegende, die frühe Psychologie und den Geheimbundroman.[35] Es ist, als ob alle Genres, alle Formen der literarischen Darstellung hätten probiert werden müssen, bis in Techniken hinein, die, wie in den «Wanderjahren», in ihrem scheinbar nur lose zusammengefügten Charakter den Roman des 20. Jahrhunderts vorausnehmen. Und jedes Mal ist es ernst, und oft entsteht etwas Großes. Doch im Schatten wächst der Zweifel. Unangefochten bleibt vielleicht nur die Lyrik.
In diesem Dichter steckte ein Geist, der vielleicht nicht stets, aber oft verneinte. Von einer «bis zur Destruktion gehenden Skepsis» spricht der Schriftsteller Martin Mosebach.[36] Goethe ging dabei selten analytisch vor, sondern meist in Gestalt der «wiederholten Spiegelungen», als die er alle seine intellektuellen Arbeiten bezeichnete.[37] Von einer «Negations-Neigung» und einer «ungläubigen Neutralität» sprach Friedrich von Müller.[38] Der Geist der Negation gab sich nicht immer zu erkennen. Er wahrte die Etikette. Dennoch war er da.
Dieser verneinende Geist bildet eines der wiederkehrenden Motive in Thomas Manns Auseinandersetzung mit Goethe, überdeutlich etwa in seinem Roman «Lotte in Weimar», in dem er den Sekretär Riemer zum Sachwalter des Gedankens macht. Er ist es, der Goethe eine «umfassende Ironie» zuschreibt.[39] Nun unterhielt Thomas Mann sicherlich ein enges Verhältnis zur Ironie, und auch Goethe war dieses Darstellungsprinzip nicht fremd. Doch ist Goethes bis zur Destruktion gehende Skepsis nicht ironisch. Sie ist größer, dunkler, vernichtender, als es Ironie je sein kann. Denn alle Ironie zielt auf die Schaffung einer Distanz. Der Ironiker will Abstand halten und seine Überlegenheit behaupten, weshalb er sich den Rest der Welt als etwas Verfehltes, vergeblich sich Mühendes, zumindest in Teilen Irriges oder Lächerliches zurechtlegt. Goethe aber ist zutiefst affiziert von der Vorstellung einer alles durchdringenden Vergeblichkeit oder, philosophisch gewendet, vom tiefen Nihilismus der zeitlich verfassten Welt (den Mephistopheles am Ende des «Faust», des zweiten Teils, in aller Deutlichkeit formuliert – «Vorbei und reines Nicht, vollkommnes Einerlei» –, der aber weit früher einsetzt). Er lässt ihn schaudern, und er ist eng verbunden mit dem Entsetzen vor dem Tod, das ihn sein Leben lang begleitete. Aber er hält diesen Schrecken zurück, er delegiert ihn, er behandelt ihn diskret.
In der deutschen Literatur und ihrer Kritik, und nicht nur dort, gibt es eine weitverbreitete Ansicht, die in Außenseitertum und Dissidenz, in Dunkelheit, Leid und Zerstörung das eigentliche Medium der Wahrheit zu erkennen meint. Erst wenn alle Illusionen vernichtet sind und das Leben in seiner unendlichen Dürftigkeit vor dem Leser liegt, lasse sich echte Einsicht erreichen. Erst im Scheitern, wenn möglich im großen Stil, soll wahre Kunst zu finden sein.[40] Mit einem solchen Moralismus der Negativität hatte Goethe nichts im Sinn. Vermutlich wäre er stets gern positiv, erbaulich und der Welt freundlich zugewandt gewesen. Und er wusste um seinen «bösen Genius», der bei sich bietender Gelegenheit nicht anders konnte, als alles Vorkommende «widersprechend, dialektisch und problematisch» zu behandeln.[41] Die Negativität war ihm kein Anliegen. Der «Genius» scheint ihm vielmehr begegnet oder widerfahren zu sein, als etwas Unausweichliches und Verhängnisvolles, woraufhin Goethe den bösen Geist dadurch zu zähmen trachtete, dass er ihn in Bilder und Figuren fasste.
Einen unbekannten Goethe wollten schon viele Biographen finden, ein jeder zu seiner Zeit. Im Lauf der Jahre scheint es immer mehr dieser Unbekannten gegeben zu haben, im selben Maß, wie die Suche nach vermeintlich verborgenen Seiten des Dichters an die Stelle der Lektüre des literarischen Werks trat: Wie hielt er es mit den Frauen, insbesondere mit Charlotte von Stein und Christiane Vulpius? War er für ein Todesurteil gegen eine Kindsmörderin verantwortlich? Welche Schuld trug er am Unglück und frühen Tod seines Sohnes? Diente er als Spion wider die Freimaurer? Verriet er die Jenenser Studenten an die Staatsmacht? War er der erste Ökologe der Weltgeschichte? Erfand er gar den politischen Liberalismus? Der Anspruch, etwas bislang versteckt Gebliebenes zu entdecken, verbindet sich dabei meist mit dem Wunsch, in Goethes Leben und Werk einen möglichst dramatischen Stoff zu finden, der für die jeweils eigene Gegenwart besonders interessant ist.
Goethe machte es solchen Interessenten leicht und schwer zugleich. Leicht machte er es ihnen, weil er dafür sorgte, dass es der Nachwelt an Auskünften über seine Tage und Taten nicht mangelte. Zugleich verlieh er in seinen autobiographischen Schriften seinem Leben einen festen Zusammenhang und eine Deutung, sodass man ihm ohne große Mühe folgen oder sich bequem dagegen auflehnen konnte. Schwer machte es Goethe den Biographen, weil er so vieles gleichzeitig tat, und alles mit gleicher Intensität. Den Zeitgenossen wurde er darüber fremd und fremder. Lange schon vor den zuerst im Jahr 1821 erschienenen «Wanderjahren» stand er mit dem Rücken zum Publikum, in voller Absicht. Ein Biograph hat diese Fremdheit auszumessen, im Wissen darum, dass, wenn sich nichts Verbindendes mehr findet, die Gestalt für die Nachwelt verstummt. Und im Wissen auch darum, dass vieles an Goethes Werk – die Lyrik vor allem, eine Gattung, die überhaupt nur noch wenig gilt, aber auch Dramen, in denen es um Ritter oder Prinzessinnen geht, sowie Romane, in denen auf vielen Seiten wenig geschieht – einem heutigen Publikum als wenig reizvoll erscheint.
Es schreibt sich einfacher über unerkannt gebliebene Genies, über große, aber gescheiterte, verratene und verfolgte Künstler. Es ist eine Genugtuung, sie vor dem Vergessen zu retten, sich auf einen eingebildeten Richterstuhl der Geschichte zu setzen und nachträglich Gerechtigkeit walten zu lassen. Goethes Leben zu erzählen, ist eine schwierigere Aufgabe: Zwar behauptete Goethe, seine «Sachen» könnten «nicht popular werden».[42] Aber wenn die Selbstauskunft für seine späteren Werke galt, so nicht für sein Leben und für seine öffentliche Geltung. Tatsächlich folgt man dem Lauf eines überwältigend Erfolgreichen. Man erzählt von einem Menschen in der Mitte, von einem, dem viel gelang und der, nach heutigen Begriffen, kaum je existenziell herausgefordert wurde. «Niemals», schreibt Hans Blumenberg, «hat jemand sich die äußere Realität, in der zu leben ist, derart auf den Leib zuschneiden können.»[43] Ein Opportunismus gegenüber Ruhm und Erfolg eines Mannes, der sein Leben als Kunstwerk zu gestalten vermochte, prägt eine ganze Literatur über Goethe.
Ihm selber indessen wurde, nachdem er im Frühjahr 1813 im dritten Teil seiner Autobiographie «Dichtung und Wahrheit» beim Abschluss seines Studiums, also im Sommer 1771, angekommen war, die Lebensgeschichte zu einer fragwürdigen Angelegenheit: «Es sind wenig Biographieen, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreifliche Weise aus Freiheit und Notwendigkeit zusammengesetzt.»[44] Das Buch erschien im Mai 1814. Danach ließ Goethe die Arbeit am vierten Teil seiner Lebensgeschichte, der den letzten Jahren in Frankfurt bis zum Umzug nach Weimar im November 1775 gilt, sieben Jahre ruhen und schloss ihn dann, sich nur noch langsam voranarbeitend, bis zu seinem Tod nicht mehr ab. «Die Lebenswerke», schrieb er, doppeldeutig, ungefähr zur selben Zeit an einen guten Freund, «haben mir nie recht gelingen wollen.»[45] Gescheitert aber ist er damit nicht. Eher schon wurde die Fragwürdigkeit zum Werk.
1. KapitelEine neue Welt in alter Zeit: Goethes Kindheit und Jugend
In der Frankfurter Innenstadt, nicht weit von der Hauptwache und in einer Straße gelegen, die heute noch von historischen, aber auch von einigen funktionalen Bauten aus den fünfziger Jahren gesäumt ist, steht ein Haus, das offenbar deutlich älter ist als seine Umgebung. Das Erdgeschoss ist aus dem roten Sandstein gefügt, der früher überall am unteren Main als Baumaterial verwendet wurde. Geschwungene eiserne Gitter schützen die Fenster. Die Stockwerke darüber kragen aus, so wie man es häufig bei Fachwerkhäusern machte, um die umbaute Fläche zu vergrößern. Hinter der verputzten Fassade ahnt man das Gebälk. Hier stand, als noch große Teile der Frankfurter Innenstadt aussahen wie dieses Gebäude, ein prächtiges Bürgerhaus. Es ist das Haus, in dem Goethe aufwuchs. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und danach wiederaufgebaut, in der alten Form und mit der alten Technik.
Wie das alte Frankfurt ausgesehen haben muss, schildert Mephistopheles im zweiten Teil des «Faust». Er schätzt den Anblick nicht:
Ich suchte mir so eine Hauptstadt aus,
Im Kerne Bürger-Nahrungs-Graus,
Krummenge Gäßchen, spitze Giebeln,
Beschränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln;
Fleischbänke wo die Schmeißen hausen
Die fetten Braten anzuschmausen;
Da findest du zu jeder Zeit
Gewiß Gestank und Tätigkeit.
Dann weite Plätze, breite Straßen,
Vornehmen Schein sich anzumaßen;
Und endlich, wo kein Tor beschränkt,
Vorstädte grenzenlos verlängt.[46]
In den Lebenserinnerungen sprach Goethe in ähnlichen Formulierungen vom schmutzigen «beschränkten Markt», von den «Fleischbänken» und von den «Vorstädten» seiner Vaterstadt.[47] Die meisten freien Reichsstädte, von denen es in Deutschland Ende des 18. Jahrhunderts noch mehrere Dutzend gab, waren zu jener Zeit nicht mehr so reich und frei, wie sie es gegen Ende des Mittelalters gewesen waren. Auch ist es ein modernes Missverständnis, sie in einem politischen oder kulturellen Sinn für fortschrittlich zu halten. Vielmehr waren sie durch die Herrschaft der Zünfte und der Patrizier geprägt. Gegen die Macht, wie sie sich zunehmend in den größeren Territorialstaaten konzentrierte, konnten sie sich nur schlecht behaupten, und den Niedergang sah man ihnen an. Das galt auch für Frankfurt. Zwar waren die Handwerksbetriebe da, die hundert Geld- und Handelshäuser, der Hafen und der Zugang zu den großen Wasserstraßen Rhein und Main, das Ineinander von ständischer Ordnung, Tradition und neuem Wohlstand, und auch an Wirtshäusern fehlte es nicht, vor allem der Messe wegen. Aber es bedurfte schon eines sehr entwickelten Bürgerstolzes zu glauben, Frankfurt könne sich in seiner Bedeutung mit den großen Residenzstädten messen.
Ungefähr 36000 Einwohner hatte Frankfurt zu jener Zeit. Eine steinerne, zuerst vermutlich im frühen 13. Jahrhundert entstandene und oft wiedererrichtete Brücke überspannte in vierzehn Bögen den Main. Sie war neben dem Kaiserdom das wichtigste und auch architektonisch bedeutendste Gebäude der Stadt. Umschlossen war das Gemeinwesen von einem Mauerring, dem alle paar hundert Meter mächtige, aber im Kriegsfall eher nutzlose Bastionen vorgelagert waren. Wie bei den meisten Städten jener Zeit wuchs das innere Frankfurt kaum noch: Der Kern der Stadt war in seiner Befestigung erstarrt wie ein Insekt in seinem Chitinpanzer, während sich außerhalb der Mauern Vorstädte bildeten. Mittelalterlich gedrückt und beengt waren die Verhältnisse im Zentrum, die meisten Häuser kaum mehr als fünf Meter breit, und an vielen Tagen wird man erst in einigem Abstand von der Stadt, auf dem Weg zu den Obstwiesen an den Hängen des Taunus vielleicht, frei geatmet haben können (zum «Osterspaziergang» im «Faust» gehört ein Stoßseufzer, endlich dieser Enge entronnen zu sein). In dieser Umgebung habe er nicht bleiben können, erklärte Goethe später seiner Mutter, «das Unverhältnis des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreises, zu der Weite und Geschwindigkeit» seines Wesens hätten ihn «rasend gemacht».[48]
Johann Wolfgang Goethes Großvater war ein Schneider aus Thüringen gewesen. Er hatte in Paris und Lyon gearbeitet, bevor er mit Ranzen und Knotenstock nach Frankfurt gekommen war. Dort wurde er zum beliebtesten Kleidermacher der besseren Leute. Er setzte sich über die Regeln seiner Zunft hinweg, beschäftigte mehr Gesellen als erlaubt und wurde wohlhabend. Dies umso mehr, als er die Wirtin des «Weidenhofs» heiratete, eines der besten Gasthöfe der Stadt. Ein florierender Weinhandel gehörte dazu. So erfolgreich war Friedrich Georg Goethe (bis 1767 «Göthe»), dass er seinen Söhnen Immobilien, Wertpapiere sowie etliche Säcke mit Geld hinterließ (buchstäblich, und in verschiedenen Währungen). Sein Sohn Johann Caspar Goethe, der Vater Johann Wolfgangs, setzte den sozialen Aufstieg der Familie fort, indem er die Universität Leipzig besuchte und in Jura promovierte. Eine Bildungsreise nach Italien, die ein ganzes Jahr währte, sorgte für Weltläufigkeit, bestätigte die Zugehörigkeit zum führenden Stand der Stadt und schuf die Voraussetzungen für den Umgang mit Diplomaten und Aristokraten.
Johann Caspar Goethe hatte wahrscheinlich, wie damals unter Rechtsgelehrten verbreitet, eine Existenz als «freiberuflicher Geschäftsträger» angestrebt, als Jurist mithin, der die Interessen kleinerer Herrscher oder Korporationen innerhalb der politischen und administrativen Strukturen des Reichs vertrat. In einer freien Stadt wie Frankfurt, deren Elite sich dem Reichsgedanken besonders nahe wusste, wäre eine solche Tätigkeit ebenso geachtet wie einträglich gewesen. Entsprechend war sein Werdegang angelegt. Er führte ihn noch während des Studiums ans Reichskammergericht in Wetzlar, nach der Promotion zum Immerwährenden Reichstag in Regensburg, der Versammlung der Reichsstände, und danach zum Reichshofrat in Wien. Damit waren ihm die drei zentralen juristischen Einrichtungen des alten Reichs vertraut. Dann ließ er sich gegen Zahlung von dreihundert Gulden zum «wirklichen kaiserlichen Rat» ernennen, ging also unmittelbar auf die Seite des Reichs über.[49] Die offizielle Funktion machte eine weitere Tätigkeit als Anwalt unmöglich. Doch zerschlugen sich Johann Caspar Goethes Pläne, in den Dienst Kaiser Karls VII. zu treten: Der Wittelsbacher versuchte zwar, noch einmal eine über den einzelnen Fürstenhöfen stehende Reichsherrlichkeit aufzubauen, scheiterte aber. Als er im Jahr 1745 starb, kehrten die Habsburger mit Franz I. Stephan zur Kaiserwürde zurück – Vater Goethe hatte auf die falsche Partei gesetzt. Und weil ein Halbbruder, ein Zinngießer, schon im Rat der Stadt saß, war dem Juristen zugleich ein kommunales Amt verwehrt.
Johann Caspar Goethe blieb zu Hause. Er schrieb die Erinnerungen an seine Italienreise nieder, in Gestalt eines konventionellen, die Stationen der Reise in allseits vertrauten Bildern schildernden «Viaggio per l’Italia» auf Italienisch. Gelegentlich beschäftigte er sich mit der Zucht von Seidenraupen. Er widmete sich seinen Sammlungen, seinen Gemälden, die meist von Frankfurter Malern stammten, seinem Naturalienkabinett und seinen Büchern. Und er kümmerte sich um den Unterricht seiner beiden Kinder, des jungen Johann Wolfgang und seiner Schwester Cornelia. Mit dem Besitz der Bethmanns etwa, die so wohlhabend waren, dass ihr Reichtum die ständische Ordnung sprengte, ließ sich der Hausstand der Goethes nicht vergleichen. Aber er genügte für einen Platz unter den Vornehmen, zumal Catharina Elisabeth, Johann Caspars Frau, aus der Familie Textor stammte. Diese war zwar weniger vermögend, zählte aber zu den alten Familien Frankfurts. Catharinas Vater Johann Wolfgang Textor, nach Auskunft seines Enkels ein ruhiger, konservativer Mann, der im sonnenbeschienenen, windstillen Hof seines burgartigen Anwesens im Norden der Altstadt Nelken und Pfirsiche züchtete, war im Jahr 1747 zum Stadtschultheiß ernannt worden und hatte das höchste Amt im Justizwesen der Stadt bis zu seinem Tod im Februar 1771 inne.
In den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts ließ Johann Caspar Goethe zwei Häuser im Großen Frankfurter Hirschgraben, in denen er nach 1733 zunächst mit seiner Mutter gewohnt hatte, zusammenlegen und zu einem großen Stadthaus «umbauen». So hatte man es der Bauaufsicht mitgeteilt. Tatsächlich handelte es sich um einen großzügigen Neubau mit zwanzig Zimmern – einen allerdings, der mit seinen vorspringenden oberen Stockwerken noch im Stil der älteren, gotischen Bebauung gehalten wurde, während in der Nachbarschaft, bei den Brentanos etwa, schon klassizistisch gebaut worden war.[50] Das neue Haus war repräsentativ, ausgestattet mit einem prächtigen Treppenhaus, das jenem im Römer nachgebildet war, und mit großen Spiegelscheiben versehen, die für Helligkeit im Haus sorgten.[51] In der Roten Stube gab es Gefäße aus China zu bewundern. Das Haus verfügte über ein Musikzimmer, eine Bibliothek, die ungefähr zweitausend Bände barg, und ein Gemäldekabinett. Es bot Platz für die Bewirtung von Gästen, die offenbar gern und zahlreich kamen. Es war mit Sorgfalt ausgestattet, von den Stoffen über das silberne Besteck bis zu den Küchengeräten. Es war ein «ganzes» Haus, für alle nur denkbaren Zwecke eingerichtet.
«Da findest du zu jeder Zeit / Gewiß Gestank und Tätigkeit.» Der Frankfurter Römerberg im 18. Jahrhundert.
Wer in Frankfurt zu den Patriziern zähle, stehe hinter einem Adligen nicht weit zurück, behauptete Goethe, den Ansichten seines Vaters folgend. «Wir Frankfurter Patrizier hielten uns immer dem Adel gleich, und als ich das Diplom in Händen hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was ich längst besessen», soll er zu Eckermann gesagt haben. Doch war Goethe kein Patrizier.[52] Die Zugehörigkeit zum Frankfurter Patriziat, sei es in Gestalt der aristokratischen Gesellschaften «Alten Limpurg» und «Zum Frauenstein», sei es in Gestalt des «dritten Patriziats», der bürgerlichen Ratsfamilien, war förmlich geregelt, und die Familie Goethe gehörte keiner dieser Traditionslinien an.[53] Dass sie so rasch in die gesellschaftlich führende Schicht aufgestiegen war, zeugte bereits von neuen Zeiten, in denen weniger Rücksicht auf das überkommene Gefüge der Stände genommen wurde. «Geburt, Rang, Gestalt, was sind sie alle gegen das Geld?», fragt der Marquis im «Groß-Cophta», einem Lustspiel über den Untergang des Ancien Régime, das Goethe im Jahr 1791 schrieb.[54] Vollständig durchgesetzt hatten sich die neuen Gedanken allerdings noch lange nicht.
Der Dichter und, nicht minder, der Gelehrte des 18. Jahrhunderts war gewöhnlich ein Mann von geringen Mitteln. Der Vater war oft ein protestantischer Geistlicher gewesen, die Söhne wurden Hofmeister, Hauslehrer oder wiederum Pfarrer. Johann Gottfried Herder war der Sohn eines Kantors in einer ostpreußischen Kleinstadt. Auch Jakob Michael Reinhold Lenz stammte aus der Familie eines evangelischen Geistlichen: Der Dichter schlug sich als Hauslehrer durch, zuletzt ging nichts mehr. Johann Heinrich Voß übertrug die Epen Homers ins Deutsche, mit durchschlagendem Erfolg. Aber er kam auch als Professor nie über die Armut hinweg, in die er als Sohn eines Gastwirts und Enkel eines freigelassenen Leibeigenen hineingeboren worden war. Das Geld reichte bei keinem, nicht einmal bei Herder, dem Oberhaupt der evangelischen Landeskirche in Sachsen-Weimar, und noch viel weniger bei Schiller, der erst in den letzten Jahren seines Lebens ein halbwegs geregeltes finanzielles Auskommen hatte. Goethe hingegen war abgesichert, und so blieb es ein Leben lang. Wo er war, gab es Fleisch, Wein und oft auch Champagner.
Am unsichtbaren Faden der Zeit: Ein Dichter wird geboren
Geboren wurde Johann Wolfgang Goethe am 28. August 1749, an einem Donnerstag, «mittags zwischen 12 und 1 Uhr», wie es im Kirchenbuch heißt. Die Geburt muss schwierig gewesen sein. Zu Beginn von «Dichtung und Wahrheit» – der erste Teil der Lebenserinnerungen erschien 1811 – berichtet Goethe, die Wehen hätten sich über drei Tage hingezogen. Als das Kind endlich den Mutterleib verlassen hatte, war es blauschwarz angelaufen und schien nicht zu atmen. Erst als die Hebamme auf das Brustbein drückte, begann sich der Säugling zu rühren: «Durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand (…) gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelfer angestellt, und der Hebammen-Unterricht eingeführt oder erneuert wurde.»[55] So spricht der alte Goethe über den jungen: in Form einer Kosten- und Nutzenrechnung, wie er sie als Vorsteher eines großen Haushalts und als Berater des Herzogs von Sachsen-Weimar oft hatte aufstellen müssen. Nichts Schlechtes konnte geschehen, woraus nicht etwas Gutes erwuchs.
Wenn Goethe über seine Eltern schrieb, heißt es oft «der Vater», im Unterschied zu: «meine Mutter». Der Artikel ist bestimmt, das Possessivpronomen zeigt eine vertrauliche Gemeinschaft an. Es sind nicht viele Dokumente erhalten, die vom Verhältnis Goethes zu seinen Eltern künden könnten. Das meiste, was man von den Eltern weiß, berichtet der Sohn:
Vom Vater hab’ ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen;
Von Mütterchen die Frohnatur,
Und Lust zu fabuliren.[56]
Ein Altersunterschied von mehr als zwanzig Jahren lag zwischen Johann Caspar Goethe und seiner Frau, und die Differenz bezeichnet in diesem Fall nicht nur eine große Zeitspanne, sondern zugleich eine Verschiedenheit der Lebenswelten. Ein Umbruch auch hier: Der Vater, auf das eigene Haus als hauptsächliches Betätigungsfeld verwiesen, war eine barocke Gestalt, in seinen Interessen ein Universalist, in seinen Anschauungen der Tradition verpflichtet, dabei aber gesellig und vermutlich in Aussehen und Gehabe eher ausladend. Die Mutter hingegen war empfindsam, freigebig, von einer pietistisch geprägten Religiosität geleitet, aber weltoffen, freundlich und, nach einhelligem Urteil der Beteiligten, meistens vergnügt. Johann Wolfgang war das erste Kind. Eineinhalb Jahre später folgte die Schwester Cornelia, mit der er bis zu ihrem frühen Tod eng verbunden war (sie starb 1777, nach der Geburt ihres zweiten Kindes). Vier weitere Geschwister wurden geboren, von denen nur eines über das Kleinkindalter hinauskam. Es wurde sechs Jahre alt.
Johann Caspar Goethe übernahm die intellektuelle Bildung seiner beiden überlebenden Kinder. Dabei war er fordernd, was dem Sohn nicht viel ausgemacht zu haben scheint, auch wenn dieser manchmal unter den despotischen Anwandlungen des Vaters litt. Jenseits des Unterrichts soll Johann Caspar wohlwollend und weitherzig gewesen sein. Zu den Anekdoten aus der frühen Zeit, die Goethe in «Dichtung und Wahrheit» erzählt, gehört die Geschichte, wie der junge Goethe einmal aus kindlichem Vergnügen an der Zerstörung große Mengen Geschirr auf die Straße warf.[57] Sigmund Freud widmete ihr eine Deutung, der zufolge Goethe damit einen Groll gegen die Eltern auslebte.[58] Von einer Bestrafung ist nicht die Rede. Goethe kam mit dieser Erziehung zurecht; seine Schwester, deren Ausbildung weit über das damals für ein Mädchen gewöhnliche Maß hinausging, scheint über diese Art der Fürsorge unglücklich geworden zu sein.
Zwischen 1752 und 1755, drei Jahre lang, schickten die Eltern den jungen Goethe in eine Spielschule. Vermutlich lernte er schon dort lesen. Später ging er in die Grundschule Johann Tobias Schellhaffers, wo das Schreiben und das Rechnen hinzukamen. Das war es dann in puncto Schule, mit einer kurzfristigen Ausnahme. Über neun Jahre hinweg kam, neben einer bunten Schar von Hauslehrern, ein «Schreibmeister» ins Haus, dem der junge Goethe vermutlich den größten Teil seiner weiten Sprachkenntnisse verdankte, die das Griechische und Lateinische, das Französische und das Englische umfassten, wobei es wohl vor allem um das Lesevermögen ging. Der Vater gab sein Italienisch hinzu. Auf eigenen Wunsch erhielt der Junge auch Unterricht im Hebräischen, und als wäre das alles nicht genug, fasste er den Vorsatz, einen Briefroman in sechs Sprachen zu schreiben. Die Lehrstunden in Mathematik übernahm ein Jurist, gelegentliche Besucher der Familie führten den Heranwachsenden hierhin und dorthin und erzählten ihm unter anderem von Elektrisiermaschinen. Er lernte Zeichnen, er erhielt Unterricht am Klavier und am Cello, er übte sich im Reiten und Fechten. Auch das Tanzen wurde ihm beigebracht, zusammen mit seiner Schwester, und der Vater spielte dazu die Flöte.
Acht Jahre war Goethe alt, als er ein Heft mit Schularbeiten anlegte, das hauptsächlich Übersetzungen aus dem Lateinischen und Griechischen gewidmet war und daneben Wissenswertes zu Natur und Moral enthielt. Es ist erhalten. Im ersten «Colloquium» zwischen Vater und Sohn kann man nachlesen, dass der Grundstein des neuen Hauses und die Weinvorräte besichtigt wurden. Zum sechsten «Exercitium privatum» gehörte der Satz: «Da ich reich war, warest du mein bester Freund, dann wo ich war, da warest du auch. Jetzund aber, nachdem ich bin arm worden, sagst du nicht mehr: wir sind die besten Freunde; sondern, wir sind Freunde gewesen. O du unbestendiges Glück.» Und in den «Stechschriften», den Wettbewerbsarbeiten des Schülers, lässt sich studieren, wie dem jungen Goethe die Goldene Regel der antiken Literatur (und des Neuen Testaments) vermittelt wurde: «Alles, das ihr wollet, das euch die Leute tun sollen, das thut ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten.» Bei Beherzigung der Regel sollte als Lohn das Bürgerrecht winken, aber das war wohl eher abstrakt gedacht (es ist kaum vorstellbar, dass arme Menschen das Frankfurter Bürgerrecht erwerben konnten, auch wenn sie sich als anständig erwiesen).[59]
Goethe lernte in hohem Maße selbständig. Das väterliche Haus bot ihm dazu die Voraussetzungen, mit seinen Bildern, seinen Kabinetten und der Bibliothek. Letztere umfasste neben der Jurisprudenz und der Geschichte, den Bibelausgaben und Reisebüchern auch literarische Werke in größerer Zahl, alte und neue, deutsche und fremdsprachliche. Der Sohn durfte sich darin frei bewegen, wie überhaupt, das rigorose Lernprogramm ausgenommen, die intellektuelle Atmosphäre im väterlichen Haus allem Anschein nach auf Gewährenlassen beruhte: Die Mutter hielt ihre pietistischen Zusammenkünfte ab, der Vater steckte in seinen Sammlungen, und der junge Goethe nahm sich aus allem, was er wollte. Die Schule war noch nicht zur Zentralstelle für Kulturisation geworden.[60] Wissen, Fähigkeiten, Benehmen, Fertigkeiten wurden in Gruppen weitergegeben, die das Selberlernen nicht nur voraussetzten, sondern auch förderten. Ein solches Programm, in dem die Standesunterschiede zunehmend verschwimmen, nennt man seit jener Zeit Bildung.[61]
In Frankfurt gab es um die Mitte des 18. Jahrhunderts über zwanzig Schulen, davon sechs mit jeweils hundert Schülern oder mehr.[62] Doch nur für kurze Zeit, während der Umbauten im väterlichen Haus, besuchten Goethe und seine Schwester eine solche Schule. Die Ausnahme blieb in schlechter Erinnerung. Dort seien sie «unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen» geraten, schreibt Goethe später. Unter dem «Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen» hätten sie «unerwartet alles zu leiden» gehabt, weil sie «aller Waffen und aller Fähigkeiten ermangelten, sich dagegen zu schützen».[63] Auf diesen Satz folgt in «Dichtung und Wahrheit» eine längere Beschreibung der Orte, an denen man in Frankfurt nicht nur ausgewählte Kreise, sondern die ganze Gesellschaft zu sehen bekam. Das waren etwa die Brücke über den Main, der Weinmarkt, der Römerberg und auch die Stadtmauer, von deren Wehrgang man in die Gärten, Höfe und Hinterhäuser der Bürger blicken konnte: «Man sieht mehreren tausend Menschen in ihre häuslichen, kleinen, abgeschlossenen, verborgenen Zustände.»[64] Der Blick ins Allgemeine musste erworben werden. Er setzte ein Bewusstsein für Unterschiede voraus, die sich von höherer Warte betrachten lassen.
Zu Weihnachten 1753 schenkte die Großmutter – so heißt es in «Dichtung und Wahrheit», in Wirklichkeit wird es der Vater gewesen sein[65] – ihren Enkeln ein Spielzeugtheater und schuf damit «in einem alten Hause eine neue Welt». Zu Beginn sei den Kindern «die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal» nur vorgezeigt worden; danach aber habe man ihnen das Theater «zu eigner Übung und dramatischer Belebung» übergeben: «Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große, langdauernde Wirkung nachklang.»[66] Der Nachsatz ist keine Übertreibung: Immer wieder, in den Werken wie im Leben Goethes, taucht das Puppenspiel auf, weshalb diese Passage gewöhnlich als eine Art Urszene für die Bildung zum Dichter verstanden wird.
Auf den Gedanken, ein Schauspiel über «Faust» zu schreiben, will Goethe gekommen sein, als er um das Jahr 1770 die «bedeutende Puppenspielfabel» auf der Bühne gesehen hatte. Daraufhin «klang und summte» es «gar vieltönig» in seinem Inneren.[67] Als Goethe im Oktober 1771 im Elternhaus vor seinen Freunden die Rede «Zum Shakespears Tag» hielt, eine programmatische Erklärung, die als zentrales Dokument für die Entstehung einer literarischen Bewegung namens «Sturm und Drang» gilt, sprach er von den Guck- oder «Raritätenkasten», die zu jener Zeit auf Jahrmärkten gezeigt wurden. Dort könne man sehen, wie «die Geschichte der Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt».[68] «Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten, die Bilder gaukeln vorüber und verschwinden», heißt es in einem Prosahymnus mit dem Titel «Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775», der dem Straßburger Münster und dessen Baumeister Erwin von Steinbach gewidmet ist.[69] Und in «Wilhelm Meisters Lehrjahren», dem Roman aus den Jahren 1795 und 1796, wird das Puppenspiel zur Schule einer gesteigerten Einbildungskraft, deren Intensität der Held vergeblich nachspürt, als er selbst auf der Bühne steht.
Puppen haben kein Mienenspiel; wenn ihre Glieder sich bewegen, bleibt das Gesicht starr. Werden sie bewegt, zappeln sie eine Weile an ihren dünnen Fäden, bevor sie wieder einrücken in die statische Szene, die den «Guckkasten» ausmacht. Zwar bewegen sich einzelne Puppen, doch tendiert ihr Auftritt zum «Tableau». Zugleich fordern die Marionetten die Phantasie des Zuschauers heraus, wie es kein Schauspiel mit lebendigen Darstellern tut. Die meisten Dramen Goethes – in extremer Form: der zweite Teil des «Faust» – bilden eine Reihe von Szenen, die vor den Augen des Publikums am unsichtbaren Faden der Zeit vorbeigezogen werden, oft ohne eindeutiges Ende. Ein paar große Ereignisse, wenn man die Szenen einzeln betrachtet, aber ein jedes Bild auch still, geschlossen und sich nur langsam zum nächsten Bild öffnend.
Im Weimarer Nationalmuseum wird ein Puppentheater verwahrt, oder besser: was davon übrig ist. Es war vermutlich ein Geschenk Goethes an seinen im Jahr 1789 geborenen Sohn August. Die Puppen sind verloren. Erhalten sind aber mehrere Kulissen, darunter ein feuerspeiender Berg, ein ägyptisches Zimmer und eine italienische Stadt.
Da wird der Geist euch wohl dressiert: Das Studium in Leipzig und die Folgen
Goethe wäre vielleicht gern, wie er Jahre später erzählte, nach Göttingen gegangen, an die damals fortschrittlichste Universität in den deutschen Ländern. Vor allem hätte er alte Sprachen und Geschichte