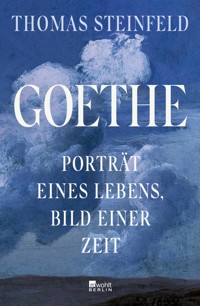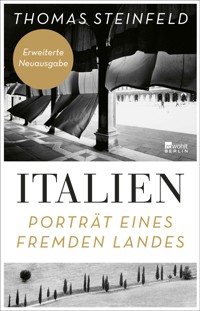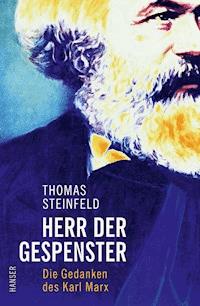
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte, könnte man meinen, hat Karl Marx widerlegt. Kaum jemand träumt noch wie im 19. Jahrhundert von der Revolution, aber wir wollen wissen, wie jene Kraft entsteht, die unsere Gesellschaft immer tiefer spaltet. Thomas Steinfeld hat Karl Marx kurz vor dessen 200. Geburtstag noch einmal gelesen und bestechende Analysen unserer Wirtschaft gefunden: zur Gewalt, die das Geld auf den Menschen ausübt, zur Macht, die in Waren verborgen ist, oder zur Krise als einem Normalfall unserer Wirtschaftsform. Befreit von einer weltgeschichtlichen Mission, öffnet Marx’ Philosophie uns die Augen für jene Effekte des Kapitalismus, die unser Leben bestimmen, heute mehr denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte, könnte man meinen, hat Karl Marx widerlegt. Kaum jemand träumt noch von der Revolution, und doch ist in jüngster Zeit ein Unbehagen gewachsen: Wir wollen wissen, wie jene Kraft entsteht, die unsere Welt immer tiefer spaltet. Thomas Steinfeld hat Karl Marx noch einmal gelesen und einen Intellektuellen gefunden, der selbst dort, wo er offensichtlich irrt, klüger ist als viele seiner Kritiker. Eine Weltanschauung wird man bei ihm nicht mehr suchen, dafür findet man bestechende Analysen zur Gewalt, die das Geld auf den Menschen ausübt, zur Macht, die in Waren verborgen ist, oder zur Krise als einem Normalfall unserer Wirtschaftsform. Befreit von einer weltgeschichtlichen Mission, öffnet sein Werk die Augen für jene Effekte des Kapitalismus, die unser Leben bestimmen, mehr denn je. Thomas Steinfeld zeigt, dass Karl Marx auch heute lesen muss, wer die Gegenwart verstehen will.
Hanser E-Book
Thomas Steinfeld
HERR DER GESPENSTER
Die Gedanken des Karl Marx
Carl Hanser Verlag
INHALT
Vorwort
Ein Bild des Philosophen
Eine Aufforderung zum Denken
Eine Frage des Rechthabens
Der Ruhm
Der Theoretiker und der Revolutionär
Die Ökonomie und der Rest der Welt
Die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters
Die Aufhebung der Politik
Das billige Brot
Das Manifest
Die Brüder des Trostes
Das Gespenst des Kommunismus
Die Kunst der Masse
Ein Dokument des Umbruchs
Der Entwurf einer Weltgeschichte
Die Botschaft der Geschichte
Mängel und Schwächen
Die Verschwörung
Die Notwendigkeit der Geschichte
Die Guten dieser Erde
Das Ende von allem
Das Geld
Das Maß der Dinge
Die Zauberkraft des Geldes
Das Universum des Tausches
Die Gewalt der Verfügung
Die Macht des Unbekannten
Das Mehr
Forschungen eines Hundes
Gewinner und Verlierer
Arbeitszeit und Bezahlung
Sinnliches und Übersinnliches
Hoffnung und Weltuntergang
Das Kapital
Der Held der Geschichte
Glaube und Krise
Die Gesellschaft der Spekulanten
Kapital und Zukunft
Die Bändigung des Zufalls
Das Gold und die Deckung
Das Reale und das Fiktive
Das Eigentum
Kommunismus ist Diebstahl
Die Welt ist Eigentum
Das Eigentum ist Person
Arbeitsmittel sind Privateigentum
Der Einzige ist sein Eigentumn
Eigentum ist Entfremdung
Das Haus bin ich
Die Sprache
Das Kapital und der Vampir
Die Bilder der Lehre
Metapher und Wahrnehmung
Der Effekt des Wirklichen
Die Geschichte des Zombies
Die Arbeit
Die Grabenden und die Schlagenden
Die Sichtbarkeit der Mühsal
Der Verein der Arbeit
Die Gegenwart der Klassen
Das Schwinden der Arbeiterklasse
Das Ende der Arbeit
Die Gleichheit
Ungleichheit ist eine Bedrohung
Die Macht ist die Bank
Der Tausch verlangt Gleichheit
Die Gleichheit widerspricht der Freiheit
Gleichheit ist eine junge Errungenschaft
Ungleichheit verlangt nach Empirie
Die Gleichheit sucht ihren Rhythmus
Die Krise
Die Möglichkeiten des Verstandes
Das Wissen der Krise
Die Fortschritte des Kapitals
Die Lehre vom Exzess
Der Fall der Profitrate
Das Neue und das Alte
Das Ende des Wachstums
Die Revolution
Der Umsturz und seine Richtung
Der Aufstand und sein Publikum
Das Gefühl und seine Helden
Die Revolution und ihr Rahmen
Die Revolte und ihr Preis
Der Griff zur Notbremse
Die Wissenschaft
Ein Leben in der Bibliothek
Die Wissenschaft im Singular
Ein Einsiedler in einem Riesennest
Die Unendlichkeit der Exzerpte
Ein Einzelner in der Wissenschaft
Ein Übermaß an Arbeit
Ein Dialektiker in der Naturgeschichte
Die Zeitung
Der Großteil des Werks
Die Bedeutung des Journals
Die Gunst des Augenblicks
Die Gemeinsamkeit der Bildung
Die Aufgabe der Öffentlichkeit
Der Fetisch
Die Seele der Ware
Der Tisch und die Grillen
Ware und Schaufenster
Der Name der Sache
Kreativität und Reklame
Entfremdung für Dinge
Das Scheitern
Die Tragik des Ruhms
Eine Sache ohne Ende
Welt ohne Ketten
Abschied von der Theorie
Der Protest und die Kunst
Wissen, woran man ist
Ein Dank
Anmerkungen
VORWORT
Ein Bild des Philosophen
Auf den meisten Porträts, die man von Karl Marx kennt, ist ein mächtiger Kopf zu sehen, eine gewaltige Stirn, ein Paar entschlossener Brauen, eine wüste Mähne. Karl Marx: Das ist ein Bart, so groß, dass man ihn raumgreifend nennen könnte, und ein beseelter, konzentrierter Blick, der über den Betrachter hinweg in eine unendliche Tiefe zielt. In Chemnitz steht ein solcher Kopf auf einem öffentlichen Platz im Zentrum, in Bronze gegossen und mehr als sieben Meter hoch, den Sockel nicht gerechnet. Die DDR ging unter, die Bürger entschieden, die Stadt solle nicht mehr Karl-Marx-Stadt, sondern wieder Chemnitz heißen. Aber das Denkmal wollten sie behalten. Namen schaffen mehr Verpflichtung als Skulpturen.
Ein Visionär mag so aussehen in den Augen seiner Anhänger, ein Dämon oder ein Religionsstifter. Denker hingegen eignen sich nicht für heroische Darstellungen. Denn sie erobern ihre Gedanken nicht, sondern bringen sie meistens in mühevoller Kleinarbeit hervor. Manchmal begegnen sie ihnen auch wie zufällig, aber auch darin liegt keine heldenhafte Tat. Oft sind Denker unsicher, ob man, was sie sagen wollen, tatsächlich so sagen kann. Und wenn sich endlich ein Ergebnis eingestellt hat, wird es, kaum dass es vorhanden ist, einer Prüfung unterzogen und dann noch einer Prüfung und noch einer. Denken bedarf der Ruhe, der Dauer, des nagenden Zweifels und der immer wieder neu ansetzenden Anstrengung. Wer vermöchte dann, mit tiefen Ringen unter den Augen und zerwühltem Schopf, von seinem Schreibtisch so aufzuschauen, als ob er die Welten jenseits des Horizonts mit seinem Blick bezwingen könnte?
Von Karl Marx ist ein Bild geblieben. Nicht das Bild eines Denkers, sondern das eines Kämpfers und Moralisten, der die Ausbeutung des Menschen in kapitalistischen Verhältnissen geißelt, für Gleichheit und Gerechtigkeit eintritt und zur Revolution auffordert. An diesem Bild ist nicht viel Wahres, und dennoch wird es weitergetragen. Diese Beständigkeit geht weniger auf Marx’ Theorien als vielmehr auf seine Radikalität zurück. Zum einen scheinen er und seine Lehren das Extrem dessen zu bilden, was man sich als Einwand gegen die herrschenden Verhältnisse vorstellen kann, unter der Voraussetzung, dass man diesen Extremismus nicht teilen muss. Zum anderen genügt es den meisten zu wissen, dass seine Werke eine wie auch immer geartete, jedenfalls entschiedene Position gegen »das Kapital« beziehen. Stellt nicht der Volksglaube, das große Geld habe sich gegen die kleinen Leute verschworen, nach wie vor die beliebteste Rechtfertigung dar, sich als angebliches Opfer der Verhältnisse in ebendiesen Verhältnissen einzurichten? Zum dritten verbindet sich mit dem Namen Karl Marx eine Erinnerung an aufrührerische Bewegungen, Revolutionen und Aufstände, an rote Fahnen, Barrikaden und Schwaden von Tränengas. Und auch wenn diese Ereignisse schon Jahrzehnte zurückliegen, so ist deren Bild doch gegenwärtig, genau wie der Chemnitzer Kopf.
Es besteht kein Grund zu der Annahme, es gäbe viele Menschen, jüngere gar, die das »Kapital« tatsächlich gelesen hätten – und seien es nur die ersten vier Kapitel. Dennoch lebt eine Vorstellung von diesem Werk fort. Im selben Maße, wie sich der Kapitalismus als einzige, unausweichliche Form der Gesellschaft darstellt, behauptet sich die Idee, in Karl Marx konzentriere sich, über die Jahrzehnte, ja schon über weit mehr als ein Jahrhundert hinweg, der Widerstand gegen die Herrschaft des Kapitals. Diese Vorstellung hat weit mehr mit dem gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft zu tun als mit einem Erbe oder gar einem Wissen, das aus dem 19. Jahrhundert übernommen worden wäre.
Eine Aufforderung zum Denken
Versuche, wenn schon nicht die Welt, doch wenigstens Karl Marx und dessen Werk zu retten, gibt es viele, darunter auch solche, die einer solchen Rettung wegen den Mann und seine Bücher ins Reich der Erfindungen umsiedeln wollen. »Das erste große modernistische Kunstwerk«, sagt der amerikanische Politologe Marshall Berman, sei diese Hinterlassenschaft.1 Doch wem wäre geholfen, wenn dieses Werk für die Kunst geborgen würde? Ähnliches gilt für die beliebte Idee, Karl Marx und Friedrich Engels hätten zwar das Richtige gewollt, sie seien von Leninisten, Stalinisten, Maoisten aber falsch ausgelegt oder gar verraten worden. Was sollte denn »das« Richtige sein an einem Werk, das ebenso groß wie unvollendet ist und zudem in durchaus verschiedene Richtungen weist? Manch einer unter Marx’ modernen Verteidigern geht sogar so weit, ihn zu einem Anwalt der »Mittelklasse« und ihrer »großen revolutionären Werte: Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstentfaltung« zu erklären.2 »Pfäffisches Getue« hätte man im 19. Jahrhundert den Versuch genannt, selbst die brutalsten Interessenkonflikte in Verfehlungen gegenüber einem gemeinsamen, grundsätzlich guten Anliegen umzudeuten.
Es gibt in Karl Marx’ Werk nichts, was unter allen Umständen gerettet werden müsste, und sei es durch eine Verwandlung in Kunst oder Moral. Das Werk ist auch keine Bibel, die man, weil sie in Bildern spricht, nach Belieben auslegen kann, worauf dann die Theologen einander mehr bekämpfen, als sie es je mit einem Heiden täten. Es gibt bei Karl Marx allenfalls etwas zu verstehen. Es finden sich Gedanken in diesen Büchern, die man prüfen, zurückweisen oder sich zu eigen machen kann. Und wenn die Argumente nicht zufriedenstellend ausfallen, liegt darin kein Scheitern. Denn zum Scheitern gehört ein Idealismus: der Wille, mit einer Idee auf die Welt loszugehen, damit diese sich dem Konzept füge. Dergleichen fertige Ideen finden sich gelegentlich bei Karl Marx, aber sie stehen nicht für seine Arbeit im Ganzen. Anderenfalls gäbe es bei ihm nicht so unendlich viele Revisionen der Gedanken, die er bereits gefasst und niedergeschrieben hatte. Und mit Scheitern hat Revidieren nichts zu tun: Ein mangelhaftes Ergebnis mag darauf zurückgehen, dass die Aufgaben, die man sich gestellt hatte, so außerordentlich schwierig waren, dass man sie nicht bewältigen konnte. Oder darauf, dass man auf eine falsche Spur geriet und erst spät bemerkte, dass sie in die Irre führte. Auch deswegen werden sich auf den folgenden Seiten einige Gewissheiten über die Forderungen und Visionen auflösen, die Karl Marx angeblich in die Welt trug: das Verlangen nach »Gleichheit« zum Beispiel, oder auch die Vorstellung, jenseits der Revolution würde den befreiten Menschen das Leben eines faulenzenden Großgrundbesitzers erwarten, wenn nicht gar ewige Ferien. Wie gesagt: Es gibt die entsprechenden Sätze in Karl Marx’ Schriften. Aber sie blieben nicht unwidersprochen, und das geschieht oft noch in derselben Arbeit.
Zum Vorschein kommt stattdessen die Mühe eines rastlosen Intellektuellen. Seinen Gegenständen widmet sich Karl Marx in unendlich oft neu ansetzenden, immer wieder weit ausholenden, immer wieder sich verirrenden Überlegungen. Sie gilt es ernst zu nehmen, um den Preis, dass man auch mit dem eigenen Denken noch einmal von vorn anfangen muss. In den hundertfünfzig Jahren, die seit Erscheinen des ersten Bands des »Kapitals« vergangen sind, entstanden zwar unzählige Interpretationen dieses Werks. Keine aber fand allgemeine Anerkennung. Eher als ein Denkmal, das von den Nachfolgenden zu bewundern wäre, oder als ein System, in dem jedem Ereignis ein fester Platz zugewiesen ist, erscheint Karl Marx’ Werk als ein Feld fortlaufender, zuweilen disparater Bewegungen.
In diesem Buch wird es darum gehen, einige der Bewegungen nachzuvollziehen, aus einer persönlichen Perspektive, so knapp wie möglich und stets mit einem Blick auf die Gegenwart – einem Blick, der nicht nur um den Abstand weiß, der zwischen Marx und der Gegenwart liegt, sondern auch, dass er ein gegenwärtiges Interesse in die Vergangenheit trägt. Ein Studium der Schriften von Karl Marx kann dadurch in keiner Weise ersetzt werden, und gegen das Übermaß an Sekundärliteratur hilft vermutlich ohnehin nur der Versuch, zu den originalen Schriften zurückzugehen und selbst zu denken. Dieses Buch soll deswegen von der Art sein, die man im Englischen »a book of ideas« nennt. Die »ideas« kommen dabei oft aus der Literatur und aus der Kulturgeschichte, was nicht nur am Verfasser dieses Buches, sondern auch an Karl Marx liegt, der in jedem seiner Werke die historische und literarische Bildung eines liberalen Bürgers seiner Zeit mobilisiert. Zudem findet sich in der sogenannten schönen Literatur häufig ein zumindest diffuses Bewusstsein davon, was für eine gespenstische Angelegenheit eine entfaltete Warenwirtschaft eigentlich ist.
Karl Marx schrieb das »Kapital«, sein wichtigstes Werk, in der Form einer philosophischen Ableitung, ausgehend von der Monade der kapitalistischen Produktionsweise, der Ware, und dann allmählich zur gesellschaftlichen Form aufsteigend, zum »Kapital im Allgemeinen«, bis zu dem Punkt, an dem sich das »Wertgesetz der Konkurrenz« durchsetzt. Jenseits dieser Theorie beginnt die »wirkliche Bewegung der Konkurrenz« und damit das Reich des Zufälligen und Willkürlichen, der individuellen Interessen und Kollisionen.3 Ein großer Teil der Literatur zu Marx ist ebenfalls in Gestalt von Ableitungen geschrieben, sei es in unterstützender und kommentierender Weise, sei es kritisch, etwa um der Arbeitswertlehre oder dem Eigentumsbegriff endlich und endgültig einen jeweils grundlegenden logischen Mangel nachzuweisen. Das vorliegende Buch ist keine Ableitung, sondern besteht aus einer Folge von Essays, die um die Gegenstände der Marx’schen Theorie kreisen. Für die Wahl dieser Form gibt es eine Reihe von Gründen, von denen Lesbarkeit nur einer ist. Dass der Essay Unsicherheiten und Unvollständiges erlaubt, ist ein anderer: Manche Passagen des »Kapitals« sind nicht nur gedanklich schwierig, sondern mehrdeutig und dem Verständnis etwa durch den extensiven Gebrauch von Metaphern geradezu verstellt. An solchen Stellen muss man sich entscheiden. Oft geht das nicht ohne Zweifel.
Die essayistische Form erlaubt, einen Mangel oder gar einen Irrtum in Marx’ Lehre hinzunehmen, ohne dass deswegen deren Bedeutung geschmälert würde. Das gilt zumal im Hinblick darauf, dass seine Gedanken selbst Phänomene erhellen, die erst hundert Jahre nach seinem Tod scharf hervortraten, in Bezug auf den Fetischcharakter der Ware etwa. Und auch dem Verhängnis der Biographie entkommt man in Gestalt des Essays, der in Lebensgeschichten unvermeidlichen Gefahr, ihn und seine Lehre zu historisieren und damit die Frage nach der Wahrheit außer Kraft zu setzen. Es gibt etwas Drittes zwischen Ableitung und Biographie. Wenn es gelänge, einen Essay zu schreiben, der diesem Dritten gerecht würde, wäre tatsächlich etwas geschafft: die Vorstellung von einem Geist entstehen lassen, der zu seiner Zeit etwas schuf, das weit über diese Zeit hinausweist und für das es in der Gegenwart keine Entsprechung gibt – eine substantielle Kritik der ökonomischen Form, in der sich die Gesellschaft bewegt. Der Denker ist keine heroische Figur, der Essay ist kein heroisches Genre, so soll beides zusammenfinden.
Eine Frage des Rechthabens
In den meisten Schriften von Karl Marx wird man einen Gedanken finden, der es lohnt, darüber innezuhalten, ihn nachzuvollziehen und zu reflektieren. Das gilt auch für die kleinen, journalistischen Arbeiten und für viele der Briefe. Vor allem aber stößt man in diesen Schriften auf Analysen im Großen, deren Ergebnisse ihre erklärende Kraft nicht einbüßen, auch wenn seit ihrer Formulierung hundertfünfzig Jahre vergangen sind: zum Beispiel, dass die Arbeitskraft in einer unternehmerischen Kalkulation in Gestalt von Kosten neben anderen erscheint (und solche sind möglichst gering zu halten). Oder dass der Zweck, weshalb im Kapitalismus gearbeitet wird, nicht die Versorgung der Menschen mit nützlichen und guten Dingen ist, sondern die Vermehrung des Kapitals. Oder dass der technische Fortschritt kaum stattfindet, um die Menschheit mit Wohlstand und Bequemlichkeit zu beglücken, sondern um zu rationalisieren, vor allem beim Einsatz menschlicher Arbeitskraft – und also wiederum die Kosten zu verringern und dadurch die Rendite zu steigern. Oder dass mit der Herstellung von Waren im Überfluss zugleich Armut geschaffen wird. Das alles gehört zu einer ökonomischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, die nicht vergangen ist und offenbar auch nicht vergeht.
Die häufig gestellte Frage, ob Karl Marx denn nun »doch recht hatte«, ist deswegen in den meisten Fällen nicht sonderlich erleuchtet, geschweige denn, dass sie zu brauchbaren Resultaten führte.Denn es wäre doch viel wichtiger zu wissen, ob man mit diesem oder jenem Gedanken etwas anfangen kann, ob und warum man ihn falsch oder richtig findet – wichtiger jedenfalls, als gleichsam offiziell anerkannt zu bekommen, dass man sich guten Gewissens zu Karl Marx bekennen dürfe. Zwei Motive scheinen sich in dieser Frage zu verbergen: Zum einen macht sich darin ein Bedürfnis nach Orientierung und Wegweisung geltend. Beim Versuch, selber zu denken, führt die Anrufung einer Autorität jedoch nicht weit. Deswegen ist die Frage, ob Karl Marx recht hatte oder nicht, oft auch nur eine Verkleidung, ein Vorwand, hinter dem sich eine ganz andere Frage verbirgt: ob »wir« (wer immer das sein mag) richtig leben oder nicht. Nicht wissenschaftliche Werke, sondern heilige Schriften werden in dieser Art befragt.
Zum anderen verlangt die Frage, ob Marx »doch recht hatte«, in vielen Fällen gar nicht nach einer Antwort: Es gibt sie überhaupt nur, weil sie den Schein einer Radikalität verbürgt, während die Dinge ihren Lauf nehmen, den sie auch ohne diese Frage gegangen wären. Die Frage dient dann als Signal, das auf den vorgeblich aufrührerischen Geist des Fragenden verweist und darin seine Bestätigung findet. Sie ist deswegen verwandt mit einer anderen rhetorischen Figur, die sich gegenwärtig oft mit dem Namen »Karl Marx« verbindet: mit der Feststellung nämlich, er sei »aktuell« – weil er die Gesellschaft beschreibe, in der wir heute leben, weil er die Finanzkrise vorausgesehen habe, weil er beschrieben habe, dass sich der Kapitalismus – weil er alle natürlichen Ressourcen aufzehre – am Ende selber vernichten werde, oder aus ähnlichen Gründen. »Vergesst die Marxisten, lest Marx!«, hieß es neulich in einer großen deutschen Wochenzeitung. »Denn der ist modern. Studenten der Wirtschaft und der Politik debattieren über ihn, eingefleischte Liberale bewundern seine Prognose-Fähigkeiten. Das liegt an den Problemen der Gegenwart, die 150 Jahre nach Erscheinen seines Buchs ›Das Kapital‹genau seine Themen sind. Es ging ihm um die Ungleichheit, die der Kapitalismus erzeugen kann, um die Ausbeutung ganz unten in der Gesellschaft und die Exzesse ganz oben.«4 Vernünftig beantworten ließe sich die Frage, ob Karl Marx nun recht habe oder nicht, nur in einer Weise, und diese ist mit Arbeit verbunden: in einer Auseinandersetzung mit dem Werk, und zwar nicht im Hinblick auf ein allgemeines »Rechthaben«, sondern in der Prüfung einzelner Behauptungen und Argumente. Dann würden sich auch Vereinnahmungen wie die, es sei ihm um die »Ungleichheit« gegangen, die der Kapitalismus »erzeugen könne«, schnell erledigen.
Warum überhaupt sollte es für das Denken eines toten Philosophen sprechen, wenn sich die Gegenwart darin vereinnahmend wiedererkennen kann? Verbirgt sich in dieser Vorstellung nicht eine Überschätzung der Gegenwart, auf Kosten einer Vergangenheit, die sich offenbar glücklich schätzen soll, wenn sie heute überhaupt noch vorkommt? Es wäre ja immerhin möglich, dass der technische und wissenschaftliche Fortschritt der vergangenen hundertfünfzig Jahre kein Äquivalent im Denken besitzt oder dass sich der Fortschritt nur in einigen Bereichen einstellte und in anderen nicht, so dass man sich die Geistesgeschichte nicht zwangsläufig als eine Entwicklung zu immer höherem Erkenntnisgewinn und immer klarerem Durchblick vorzustellen hat – der französische Philosoph Jacques Derrida hat im Jahr 1993, in einer Schrift mit dem Titel »Marx’ Gespenster«, versucht, einer solchen Teleologie zu widersprechen und damit einem geschichtslosen Kapitalismus, der sich als endgültige neue Weltordnung versteht.5 Marx’ Gespenster dienen ihm bei diesem Versuch als Statthalter einer lebendigen Vergangenheit.
Es mag sogar sein, dass in früheren Epochen Gedanken gefasst wurden, hinter die das Denken unserer Gegenwart zurückfällt. Das gilt umso mehr, als man nicht den Eindruck gewinnen kann, dass jüngere Vorbehalte gegen den entfesselten Kapitalismus – in Gestalt von Reflexionen über Gerechtigkeit vor allem, bei John Rawls, Jürgen Habermas oder Axel Honneth etwa – dem Lauf der Dinge tatsächlich etwas entgegenzusetzen hätten. Die alten Gedanken zu suchen und neu zu entwickeln: das wäre etwas anderes, Sinnvolleres, als einem toten Philosophen eine Aktualität zu attestieren, die ihn zum Lieferanten von »Denkanstößen« für eine vermeintlich überlegene Gegenwart degradiert.
Eine Idee schließlich findet sich in Karl Marx’ Analysen des Ökonomischen, die allen Gedanken an das Geld und den Mehrwert, an das Kapital und die Ausbeutung innewohnt und sie zugleich übersteigt: die Idee nämlich, dass in der Mitte dieser Ökonomie etwas ganz und gar Metaphysisches herrsche. Der Tauschwert, der Preis, das Eigentum, die Ware, die Marke, all diese Elemente des Ökonomischen sind geronnene, allgegenwärtige Abstraktionen – wobei man sie nicht als Abstraktionen wahrnimmt, weil sie sich im Denken aller Menschen festgesetzt haben. Sie sind Gespenster, die ins sinnliche Dasein getreten sind. »Ich schlage nur die Zeitungen auf, und ich sehe die Gespenster zwischen den Zeilen. Unser Land ist voller Gespenster. Gespenster überall wie Sand am Meer«, heißt es in Henrik Ibsens Drama »Gespenster« aus dem Jahr 1881.6 Ibsens Gespenster sind mit Marx’ Gespenstern vermutlich nur weitläufig verwandt. Sinnlich-übersinnliche Wesen, in denen ein Weltzustand Gestalt annimmt, sind sie indessen in beiden Varianten. Tageslicht kann diese Gespenster nicht verscheuchen. Aber dem Licht der Aufklärung, im weitesten Wortsinn, sollte man sie aussetzen.
DER RUHM
Der Theoretiker und der Revolutionär
Es klafft eine weite Lücke zwischen dem Ruf, den Karl Marx und sein Werk noch Jahrzehnte nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus besitzen, und der Kenntnis seiner Schriften. Eine Vorstellung von diesem Werk lebt indessen fort, und wenn sie auch in großen Teilen auf Hörensagen beruht, so ist sie doch von erstaunlicher Kraft und Beständigkeit. Anhänger und Nacheiferer, im theoretischen und vor allem im praktischen Sinne, hat der Autor indessen kaum mehr, mit einigen prägnanten Ausnahmen, im Akademischen wie unter Privatgelehrten. Für die Öffentlichkeit ist Karl Marx daher wie der Geist in einer Flasche, die weithin sichtbar und verschlossen im obersten Regalfach steht: Man schaut ihn an, mit Bewunderung oder mit Befremden. Man lässt sich zuweilen sogar darauf hinweisen, um was für eine Art Geist es sich handeln könnte. Aber die Frage, ob man die Flasche holen und das Gespenst herauslassen solle, wird nicht einmal hypothetisch gestellt.I
Diese Zurückhaltung beruht nicht zuletzt darauf, dass sich in seinem Werk wie in seiner Person zwei Gestalten irritierend mischen, nämlich die des Theoretikers und die des Revolutionärs – und letzteres war Karl Marx mindestens bis zum Fall der Pariser Kommune im Frühjahr 1871 und bis zum faktischen Ende der »Ersten Internationale« ein Jahr später. Nun würde einer der wenigen verbliebenen standhaften Marxisten zwar sagen, es handle sich hier keineswegs um eine Mischung, weil das theoretische Wissen den Übergang in die Praxis stets schon in sich trage: Das richtige Denken sei vom richtigen Handeln nicht zu trennen; andernfalls könne von Erkenntnis nicht die Rede sein. Doch ist es durchaus vorstellbar, dass man etwas weiß und keine Konsequenzen daraus zieht – oder gar wider besseres Wissen handelt. Ganz abgesehen davon, dass es taktische oder strategische Gründe geben kann, hier einen Kompromiss einzugehen und dort einen Gedanken zu verschweigen, auch wenn das bessere Wissen etwas anderes sagt.
Der Theoretiker und der Revolutionär, der Mann für das Grundsätzliche und der Mann der politischen Aktionen, der Allianzen und Fraktionskämpfe – sie gehen nicht ineinander auf. Der eine begreift die Revolution als notwendige Folge geschichtlicher Entwicklungen, der andere meint, man müsse die Revolution gewaltsam durchsetzen, wenn möglich sofort. Der eine analysiert, der andere ruft zur Handlung auf. Und bei Karl Marx drängt sich in dieses Gegenüber von Theoretiker und Revolutionär noch eine dritte Gestalt. Sie trägt Züge beider und dient gelegentlich als Vermittler der einen Figur mit der anderen sowie beider mit der Außenwelt: der Journalist nämlich, der Autor aus gegebenem Anlass, so wie er sich im Durcheinander der Nachrichten und in der Gemengelage der öffentlichen Meinung behaupten muss. Der Journalist ist zudem, weil er aus dem Tag und für den Tag schreibt, ein Mann der schnell entstandenen Irrtümer.
Für den Ruf, der Karl Marx in der Nachwelt anhaftet, ist die Doppelrolle des Theoretikers und des Revolutionärs von großer Bedeutung, zumal seit es fast keine Staaten mehr gibt, Nordkorea ausgeschlossen, in denen substantielle Einwände gegen das Privateigentum laut würden. Die Geschichte ging über den Revolutionär in einer ganz anderen Weise hinweg, als es dem Theoretiker je hätte geschehen können. Selten macht man sich in demokratischen Verhältnissen die Mühe, Theoretiker zu widerlegen. Sie sinken irgendwann zur Seite, sie werden unwichtig und dann vergessen. Revolutionäre hingegen werden geächtet oder verachtet, wenn sie auf der falschen Seite standen. Nie kam es zu der im »Manifest der Kommunistischen Partei« als unausweichlich angekündigten Revolution der Arbeiterklasse. Ihr Ausbleiben dient nicht nur als substantieller Einwand gegen den Revolutionär, sondern auch als Widerlegung des Theoretikers.II
Das Verhältnis zwischen Revolutionär und Theoretiker wird nicht einfacher dadurch, dass der Theoretiker eine bewegliche Gestalt ist. »Marx ist der letzte große Systematiker und zugleich der Erste, bei dem die Bruchstücke so wichtig sind wie das ausgearbeitete System.«1 Das gilt auch für den berühmten ersten Band des »Kapitals«, einmal abgesehen davon, dass beinahe zwei Drittel dieses Buches aus der Darlegung empirischer Befunde bestehen, die zwar bezeugen, wie viel Aufmerksamkeit Marx darauf verwandte, das Prägnante vom Beiläufigen zu scheiden, die das Buch aber auch an einen bestimmten historischen Moment und sogar an ein bestimmtes Land binden: Man gewinnt den Eindruck, die Veröffentlichung verdanke sich mehr einer Entscheidung für den passenden Moment als dem Abschluss der Arbeiten. Angesichts derart unsicherer Verhältnisse ist oft darauf hingewiesen worden, dass Karl Marx’ Verwandlung in einen Klassiker im Wesentlichen die Leistung seines Weggefährten Friedrich Engels gewesen sei, die mit der Schrift »Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft« (kurz: »Anti-Dühring«) aus dem Jahr 1877 begann und in einer ersten Generation von »Marxisten« fortgesetzt wurde.2
Dem Vorläufigen entgeht man bei Marx nicht, auch nicht in den zu Lebzeiten veröffentlichten Schriften. Alles Wichtige ging in die Revision, während das Überwundene zurückgelassen wurde. Das gilt auch für das »Manifest der Kommunistischen Partei«, dieses kleine Werk eines jungen Revolutionärs, das der Theoretiker in seinen späteren Jahren kaum noch ernst nimmt. Zwar ist das »Manifest«, genauer: dessen erstes Kapitel (»Bourgeois und Proletarier«), die Schrift, die bis heute das Bild auch des Theoretikers bestimmt, ihrer Kürze und agitatorischen Form wegen. Doch ist gerade dieses Werk voller Widersprüche, und einige der zentralen Gedanken nehmen sich in späteren Werken deutlich anders aus.III
Die Ökonomie und der Rest der Welt
In den späten sechziger und frühen siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts war die Beschäftigung mit den klassischen Werken der marxistischen Theorie weit verbreitet, zumindest in den Geisteswissenschaften der gerade reformierten Universitäten, und wenn nicht in Gestalt von Lektüre, so doch in der Behauptung, man habe diese Bücher gelesen. An den Hochschulen ist davon wenig geblieben, abgesehen von einer politisch inspirierten und hochspezialisierten Philologie3 – und von zumindest tendenziell ins verschärfte Privatgelehrtentum übergehenden Versuchen, den Marx’schen Ableitungen mit neuen, verbesserten Ableitungen gegenüberzutreten.4 Was ansonsten den Einfluss marxistischer Theorie erkennen ließ, geriet in die Nachbarschaft des Abgelebten und Erledigten: Man war darüber hinweg.IV Es wurde zudem immer schwieriger, die Eigenschaften und das Wirken des Kapitals gleichsam von außen zu betrachten – sich dem Kapital also zu nähern, als wäre es etwas Fremdes und Unbekanntes, als wäre seine Allgegenwart nicht längst selbstverständlich, als hätte man nicht in vielerlei Hinsicht selbst Anteil an seinem Wirken (und ein entsprechendes Interesse). Der Name »Marx« ist insofern Zeichen eines ungelösten Problems.
Der Untertitel des »Kapitals« lautet »Kritik der politischen Ökonomie«, und das Buch ist auch so gemeint: als grundsätzliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen, die durch die Ökonomie bestimmt werden. »Politische Ökonomie« bedeutet, dass die Wirtschaft als etwas Gewolltes und mit staatlicher Macht Durchgesetztes zu begreifen sei. Diese Sichtweise ist das Gegenteil einer Wirtschaftswissenschaft, die sich vor allem mit der Beschreibung und Analyse vorhandener Verhältnisse beschäftigt, ohne nach Ursachen und Zusammenhängen zu fragen, und so als »Glaubenslehre unserer Tage« erscheint.5 Sie ist auch das Gegenteil einer Berichterstattung über wirtschaftliche Vorgänge, die diese zuvörderst nach gegebenen, wahrgenommenen oder versäumten Chancen beurteilt und sich mit dem Erfolgsstreben der dahinter Agierenden so selbstverständlich gemein macht, als sei es ihr eigenes Anliegen. »Die Ökonomen erklären uns, wie man unter den … gegebenen Verhältnissen produziert«, schrieb Karl Marx. »Was sie uns aber nicht erklären, ist, wie diese Verhältnisse selbst produziert werden.«6 Das Urteil gilt nach wie vor: »Geld ist eine Art Schmiermittel, das den Waren- und Dienstleistungsaustausch erleichtert«, heißt es lapidar in der »Volkswirtschaftslehre« des amerikanischen Nobelpreisträgers Paul A. Samuelson.7 Darüber hinaus präsentieren sich die Wirtschaftswissenschaften seit Jahrzehnten als mathematisch vorgehende Disziplin. Dabei erheben sie zugleich den Anspruch, weder eine historische Wissenschaft zu sein noch einen historischen Gegenstand zu haben. Vielmehr möchte sich die Disziplin als zeitloses, weil nach den Kriterien der formalen Exaktheit operierendes und also den Naturwissenschaften zugehöriges Fach darstellen.
Wie es »der Wirtschaft« geht, einem Kollektivsubjekt, das keiner je gesehen hat, dessen Wirken aber alle täglich erfahren – diese Frage hat in den vergangenen Jahren bedrohliche Züge angenommen. Zwar gewann sie auch früher mit jedem Niedergang der Konjunktur an Dringlichkeit, um dann wieder in den hinteren Reihen der Nachrichten zu versinken. Doch seit der jüngsten, offenbar immer noch nicht ausgestandenen Krise, deren Nachfolgerin sich schon am Horizont abzeichnet, scheint daraus eine Schicksalsfrage geworden zu sein. Sosehr aber Unbehagen und Zukunftsskepsis auch wachsen: Etwas anderes als ein Leben mit dieser »Wirtschaft«, in ihrer seit etwa einem Vierteljahrhundert weltbestimmenden Form, scheint sich kaum mehr jemand vorstellen zu können. Je schlechter es dem Kapitalismus zu gehen scheint, desto größer werden die Sorgen eines jeden, ob man davonkommt.
Das Wort »Kapitalismus« selbst war in Deutschland lange Zeit Ausdruck für das zu Überwindende gewesen, wenn die Attacke auch aus unterschiedlichen Richtungen kam: Wilhelm Liebknecht sprach vom Kapitalismus, Max Weber und Joseph Goebbels taten es auch. Doch änderte sich der Umgang mit dem Wort nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Bundesrepublik Deutschland setzte sich die Formel von der »freien Marktwirtschaft« durch, ein Euphemismus, in dem die Geschichte des Widerstands gegen diese Variante der Ökonomie verschwunden war. Das Ausweichen vor dem einzig angemessenen Namen war umso auffälliger, als es sich bei der »Marktwirtschaft« um eine alte Angelegenheit handelt: Denn eine Markwirtschaft gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Offenbar konnten oder wollten die Politiker und Ökonomen der Bundesrepublik das Spezifische jenes Systems nicht bezeichnen – mit dem Zwang zur Innovation jedenfalls, der ein Kennzeichen des Kapitalismus ist, nicht aber eines der Marktwirtschaft schlechthin, hätten die alten Römer gewiss nichts anfangen können.
Als man im Deutschland der neunziger Jahre das Schönreden aufgab und die Sache wieder bei ihrem wahren Namen nannte, markierte der Wechsel im Vokabular das Ende des Systemvergleichs. Kapitalismus galt einst als Gegensatz zum Kommunismus, und insofern der Kapitalismus einen Feind hatte, besaß er auch eine Grenze. Seitdem gilt der Kapitalismus nicht nur als das Unausweichliche, sondern auch als das ausnahmslos Gewollte. Der Umstand, dass er nicht nur Gewinner produziert, sondern auch Verlierer – und notwendig weitaus mehr Verlierer als Gewinner –, gehört dabei zu den Dingen, die sich erst unbefangen aussprechen lassen, seit es zum Kapitalismus angeblich keine Alternative mehr gibt, und sei es auch nur in Form eines strauchelnden Experiments.
Die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters
Biographien zu Marx sind zahlreich, und es kommen immer neue, umfänglichere hinzu. Die jüngsten von ihnen, die maßgeblichen darunter angelsächsisch, haben epische Ausmaße angenommen. Die Gestalt des Karl Marx, wie sie von den kommunistischen Parteien des späten 19. und dann des 20. Jahrhunderts zur überlebensgroß heroischen Figur aufgebläht wurde, sagen die Autoren, habe wenig mit dem realen Menschen, seinem Leben und seiner Arbeit zu tun.8 Darin haben sie sicher recht, auch wenn die Feststellung, Karl Marx gehöre in eine vergangene Epoche, nur von bedingtem Erklärungswert ist. Mit seinen Theorien jedoch müsste man anders verfahren, als sie ins 19. Jahrhundert zu verbannen und darin einzuschließen: Schon der Nachweis, es handle sich dabei um rein »historisches« Gedankengut, wäre nur mit Argumenten aus der Gegenwart zu führen. Und je größer dabei der Eifer wird, ihn in seine Zeit zu bannen, desto lebendiger scheint er zu werden.
Nun gut, lautet ein verbreiteter Einwand, man wolle ja gern glauben, dass Karl Marx nicht für den Kommunismus verantwortlich sei, wie er von Wladimir Iljitsch Lenin, Mao Zedong oder Erich Honecker betrieben wurde. Aber was er stattdessen gewollt habe, möchte man doch gern wissen.
Karl Marx selbst hinterließ einige Andeutungen dazu, was er sich unter einer künftigen, besseren Welt vorstelle. Überzeugend sind sie nicht, auch wenn (oder gerade weil) sie ein Erbe der Hegel’schen Philosophie darstellen, an deren Ende die Geschichte aufhört.9
Alle diese Andeutungen klingen nach einer Wiederkehr des Goldenen Zeitalters, also nach der Vision eines säkularen Paradieses, das im 19. Jahrhundert (und erst recht bei einem Altphilologen wie Karl Marx) zum Bildungsinventar gehörte. Auch darin erweist sich Karl Marx als Angehöriger eines liberalen Bürgertums, der mit der Lektüre von Hesiod und Ovid aufwuchs. Wenn Marx davon redet, in der glücklichen Welt jenseits der Revolution werde es möglich sein, »heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe«, dann ist das der Traum vom schönen Leben, der zum bürgerlichen Alltag gehört – ein Leben, wie es etwa der von Philippe Noiret gespielte Bauer Alexander in der Filmkomödie »Alexandre le bienheureux« (1968) des Regisseurs Yves Robert führt.10 Der Kommunismus ist in diesem Ideal nicht nur eine bäuerliche, sondern eine aus der Geschichte entlassene Gesellschaft, der Held eine Art Großgrundbesitzer. Es bleibt ungeklärt, wie das Vieh darauf reagiert, wenn es nur abends versorgt wird.
Es ist indessen keine gute Idee, aus solchen Visionen ein komplettes Gedankengebäude herleiten zu wollen. Das liegt nicht nur daran, dass Bilder schlechte Argumente sind. Es liegt vor allem daran, dass es unredlich ist, von Kritik zu verlangen, sie habe mit einer besseren Alternative aufzuwarten:11 Wer ein solches Bild des Besseren verlangt, in Erinnerung vielleicht an Thomas Morus’ »Utopia« (1516) oder an Tommaso Campanellas »La città del Sole« (1602), will davon absehen, was gegen die Gegenwart einzuwenden wäre. Er will nicht wissen, ob es für eine Kritik Gründe gibt, die so gravierend sind, dass man die Gegenwart dringend ändern müsste. Die Forderung tut so, als wäre ein Mangel nur dann ein Mangel, wenn sich ein von diesem Mangel nicht behafteter Zustand ausmalen ließe. Oder, schlimmer noch: als wäre Gewalt nur dann Gewalt, wenn man zugleich auf ein Idyll des Friedens und der Gewaltlosigkeit verweisen könnte. Zuallererst, und über den größten Teil des Werks hinweg, besteht Marx’ Œuvre aus Kritik, im selben Sinne, wie Kants »Kritik der reinen Vernunft« eine Klärung des Begriffs der reinen Vernunft ist. Die »Kritik der politischen Ökonomie« ist auf ein Jenseits außerhalb ihres Gegenstands nicht angewiesen.
Dennoch mag es sein, dass sich in den Bildern eines säkularen Paradieses der letzte und womöglich wichtigste Beweggrund dafür zeigt, warum Karl Marx und sein Werk ihre Geltung für die Gegenwart nicht verloren haben – auch und gerade weil man so wenig darüber weiß, worum es dabei konkret gehen soll. Denn an diesen Bildern ist zumindest so viel zutreffend, dass jenes Werk nach dem Tod seines Autors zur letzten großen Rettungsidee wurde, zur letzten wirkmächtigen Vorstellung davon, wie die Welt nach dem Ende der Geschichte aussehen sollte. »Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats«, hatte Karl Marx geschrieben, »das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie.«12 Zu diesem Zweck wurden eine praktische und eine geistige Kraft zusammengeführt, in einer genialen Umgestaltung der Hegel’schen Philosophie und in einer kühnen Wiederverwendung eines Grundgedankens aus dem Alten Testament, der Lehre vom auserwählten Volk, an dessen Stelle die Arbeiterklasse rücken sollte.V13
Die Aufhebung der Politik
Der Staat, wie wir ihn kennen, ist etwas Zuverlässiges: Einen Bruch des Gewaltmonopols wird er nicht dulden, am Hindukusch verteidigt er den Frieden, säumigen Steuerzahlern schickt er den Gerichtsvollzieher ins Haus, und die Schulpflicht setzt er genauso durch wie die Erschließung der Republik durch Verkehrswege. Er passt auf, dass die Alten und die Armen nicht verhungern, und zwischen den Interessen der Kranken und denen der pharmazeutischen Industrie vermittelt er auch.
So zuverlässig war der Staat in der jüngsten Vergangenheit, dass er seit den siebziger Jahren, seit dem Abschied von Anarchisten und radikalen Sozialisten aus der Öffentlichkeit, nicht mehr in Zweifel gezogen wurde. Alle Kritik war konstruktiv. Seit dem Beginn der jüngsten Finanzkrise im Herbst 2007 scheint diese Regel indessen nur noch bedingt zu gelten. »Eine Demokratie, die sich darauf beschränkt, Rauchverbote in Gaststätten zu erlassen oder die Helmpflicht von Radfahrern zu diskutieren, also dem gegenseitigen Gängelungsverhalten der Bürger nachzugeben«, hieß es im Herbst 2011 in einer großen deutschen Wochenzeitung, »aber die eine große Macht, die alle gängelt, nicht beherrschen kann, ist das Papier nicht wert, auf dem ihre Verfassung gedruckt ist.«14 Die eine große Macht: Das sind selbstverständlich die Wirtschaft, das Kapital, die Ökonomie, das sind der Finanzmarkt und die Spekulation.
Der Ruhm, der seit einigen Jahren Karl Marx zuteilwird, hat etwas mit der Vorstellung zu tun, man könne sich auf den Staat nicht mehr verlassen, weil er seine Souveränität an das Kapital abgegeben habe. Das gilt in einem doppelten Sinn: Zum einen weiß man von Marx, dass er ein Kritiker des Kapitals war. In dieses Wissen eingeschlossen ist die (nicht falsche) Vorstellung, er habe das Kapital als die gesellschaftliche Macht erkannt, an der sich das politische Handeln ausrichte. Zum anderen gilt Marx als ein Gegner des Kapitals, der es mit dessen Bekämpfung ernst meint und die Wirtschaft dem politischen Willen unterwerfen will. In der Praxis lautet ein Vorschlag der Rückgewinnung des Politischen dann so: Die »Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Verfügung und einer Regulierung der Lebensgrundlagen (liegt) auf der Hand«, sagt eine sozialistische Politikerin, »und die Diskussionen der Zukunft werden sich darum drehen, welche Art der Kontrolle, aber auch welche Art gesellschaftlichen Eigentums effektiv und durchsetzbar erscheint«.15
Hinter dem Vorwurf, der Staat agiere als Büttel des Großkapitals und der Finanzwirtschaft, verbirgt sich die Vorstellung, der Staat sei zuallererst seinen Bürgern verpflichtet. Dieser weitverbreitete Glaube sieht sich, seitdem ganze Bruttoinlandsprodukte dazu verwendet wurden, die Banken zu sichern, einigen Enttäuschungen ausgesetzt. Er setzt aber ein gehöriges Maß an Idealismus voraus. Das ist nicht nur so, weil Rang und Durchsetzungsfähigkeit eines Staates unmittelbar von dem Reichtum abhängen, der innerhalb seiner Grenzen akkumuliert wird. Sondern vor allem, weil die Staatsschulden in die Welt kamen, um die Leistungsfähigkeit und damit auch die Macht des Staates zu erhöhen: Der Staat als der größte Kreditnehmer beförderte, ja schuf mit seinen Schulden auch die Finanzwirtschaft, und wenn diese in den vergangenen vierzig Jahren zum mächtigsten Wirtschaftszweig überhaupt wurde, dann geschah das mit dem Willen und auch zum Vorteil des Staates.VI
Denn es trifft ja nicht zu, dass Schulden einen Staat lähmen, ihn schwach und handlungsunfähig werden lassen. Es ist vielmehr umgekehrt: Die Leistungsfähigkeit und damit die Macht eines Staates bemisst sich auch daran, wie viel Schulden er auf sich ziehen kann, ohne darüber in die Knie zu gehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind dafür das beste Beispiel: Ihr Kredit scheint unendlich zu sein, weil ihr Geld, gestützt auf eine Macht, die keinen Konkurrenten mehr kennt, das universale Zahlungsmittel ist. Bei den Krediten des Kapitals und mehr noch bei den Schulden des Staates kommt es darauf an, die Schulden bedienen zu können – nicht darauf, sie zurückzuzahlen (und wenn sie zurückgezahlt werden, dann nur, um neue aufzunehmen).
Dem Verdacht, der Staat habe die Interessen seiner Bürger an die Finanzwirtschaft verraten, liegt eine anachronistische Sicht der Dinge zugrunde. In Deutschland hätte man zuletzt in den späten sechziger Jahren so argumentieren können – wenn es denn so gewesen wäre. Der Bürger aber will sich den Verdacht nicht ausreden lassen. Beim Thema Schulden fallen ihm seine privaten Kredite ein. Er hält sie für eine Angelegenheit, von der man sich befreien müsse, und er verlangt den Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft. Deswegen wäre ihm die Wahrung des Bestehenden am liebsten – was eigentlich keine politische Haltung ist, sondern eine ganz und gar unpolitische Einstellung zur Politik –, aber er traut der Sache nicht. Deswegen schaut er manchmal nach rechts und manchmal nach links, auf der einen Seite stößt er auf Rechtsnationalisten, auf der anderen auf Sozialisten.
Trifft er auf Sozialisten, wird der Bürger an Karl Marx erinnert. Die kapitalistische Akkumulation, hatte Marx gesagt, »untergräbt die Springquellen alles Reichtums: die Erde und den Arbeiter«.16 Solcher Sätze wegen wurde er zum Zeugen der Anklage gegen den Staat, dieser habe den Interessen des Kapitals nichts entgegenzusetzen. Und selbstverständlich verkörpert dieser Zeuge auch die Drohung, politische Interessen ließen sich, wider die Allianz von Staat und Kapital, unter Umständen auch mit Gewalt befördern – wenngleich solche Drohungen selten ernst gemeint sind.
Das billige Brot
An Wünschen, das Treiben des Kapitals möge beschränkt werden, aus allgemeinen Rücksichten, mangelt es nicht. Sie gelten der Armut bei uns wie in fernen Ländern und der Lage der Alten, sie gelten der Anpassung von Architektur und Landschaft an die Interessen der Produktion, sie gelten der Krankenfürsorge und den Machenschaften der pharmazeutischen Industrie, der Situation der Frauen und dem Umgang mit Minderheiten. Die Liste ist damit bei weitem nicht zu Ende. Zwei elementare Anliegen ragen heraus, weil sie jeden Bürger angehen: die Erhaltung der Umwelt und die Gerechtigkeit. Und während erstere noch im langfristigen Interesse des Kapitals selbst liegen mag, ist es mit der Gerechtigkeit schwieriger. Das Kapital soll sich vermehren. Einen moralischen Maßstab kennt es nicht.
Von Niklas Luhmann, dem Systemtheoretiker, gibt es eine kurze Kritik der Marx’schen Lehre. Sie ist das Dokument eines zwiespältigen Verhältnisses: Der Gegensatz von Kapital und Arbeit, so Luhmann, stelle eine Vereinfachung der tatsächlichen Verhältnisse dar, die unter gewissen Bedingungen und in einer bestimmten historischen Situation sehr erfolgreich war, vor allem im Hinblick auf die begriffliche Erschließung gesellschaftlicher »Dynamik« – ohne doch je die Gesamtheit aller Ereignisse in Wirtschaft und Politik abgedeckt zu haben: »Gegenwartserfahrungen« könne man heute »mit der Unterscheidung von Kapital und Arbeit – geschweige denn von einer daran angeschlossenen Klassentheorie – nicht mehr angemessen aufarbeiten«.17 Dennoch, meint Luhmann, sei es nach der »Selbstauflösung« der Marx’schen Lehre keiner Theorie mehr gelungen, »so genau am Problem zu operieren«: »Statt dieser Lösung haben wir nun keine mehr.«18
Die Gerechtigkeit aber, heißt es bei Luhmann, bleibe zurück, wenn sich die Gesellschaft, vom Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit getrieben, in Bewegung setze – und mit ihr werde die Theorie der Gesellschaft dynamisiert. Denn Gerechtigkeit sei ein »moralischer Appell, offenbar ohne Kontakt mit der eigentümlichen Dynamik der modernen Geldwirtschaft«, stillstehend und unfähig, auf Veränderungen zu reagieren.19 Sie scheint nach Luhmann ein eigenes System zu bilden, neben dem System der Wirtschaft, aber weder mit Personal noch mit Macht, weder mit einer eigenen Sprache noch mit einem eigenen Wirkungsbereich ausgestattet. Marx hätte das Anliegen der Gerechtigkeit ähnlich grundsätzlich betrachtet, mit einem ersten Zusatz, dass das Verlangen nach Gerechtigkeit keine Kritik des Verhältnisses von Kapital und Arbeit darstellt, sondern eine idealistische Überhöhung seiner gesellschaftlichen Grundlagen, nämlich Freiheit und Gleichheit – und einem zweiten Zusatz, der die »Moral« darüber hinaus den Verlogenheiten der Bourgeoisie zuwies. Womöglich hätte er noch spottend hinzugesetzt, es sei kein guter Einfall, die Ideale der kapitalistischen Produktionsweise ausgerechnet gegen die Menschen geltend zu machen, die, als Repräsentanten der Wirtschaft oder der Politik, ebendiese Produktionsweise durchsetzen.
Weil Niklas Luhmann in Systemen und nicht in Interessen denkt, nimmt er indessen nicht wahr – oder will nicht wahrnehmen –, in welchem Maß bei Marx die Analyse des Verhältnisses von Arbeit und Kapital mit dessen Kritik ineinanderfällt: in welchem Maß das »ganze Reflexionsmanöver«20 also selbst einem moralischen Antrieb gehorcht. Dieser Beweggrund wird umso deutlicher, je weiter man sich von der Marx’schen Überzeugung befreit, die Geschichte nehme einen notwendigen Verlauf und werde in ihre Aufhebung durch einen Sieg der Arbeiterklasse münden (oder anders gesagt: je mehr man sich auf den späten Marx gegen den jungen einlässt). Immer ist da etwas Moralisches, was nicht in der behaupteten Logik der Dinge aufgeht. Gibt es auch nur eine Revolution (und also ein Moment von außerordentlicher historischer Dynamik), die nicht von einem Bewusstsein verletzter Gerechtigkeit begleitet worden wäre? So illusionär und staatsbürgerlich das Bewusstsein auch jeweils sein mochte.
In einer »Rede über den Freihandel«, die Marx im Jahr 1848 hielt, erklärte er, Zollschranken liefen dem Interesse des Kapitals zuwider, weshalb der Arbeiter nicht hoffen möge, auch seinen Vorteil aus dem Freihandel zu ziehen in Gestalt von billigerem Brot: »Man begreift, dass die ganze Heuchelei nicht dazu angetan war, den Arbeitern das billige Brot schmackhaft zu machen.«21 Trotzdem plädierte Marx für Freihandel, denn dieser verschärfe längerfristig den Klassengegensatz und treibe also die mit Sicherheit zu erwartende Revolution voran. Was aber entsteht, wenn man die historische Notwendigkeit aus dieser Argumentation nimmt? Ein moralisches Dilemma.
Ein Inhalt sei »gerecht«, sagt Marx im dritten Band des »Kapitals«, »sobald er der Produktionsweise entspricht, ihr adäquat ist«. Er sei »ungerecht, sobald er ihr widerspricht. Sklaverei, auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise, ist ungerecht; ebenso der Betrug auf die Qualität der Ware.«22 So spricht das System. Wenn es träumt, redet es anders. Wenn der bürgerliche Rechtshorizont überschritten sei, erklärt Marx in der »Kritik des Gothaer Programms« aus dem Jahr 1875, heiße es: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen!«23 Von verschiedenen Dingen ist so die Rede, aber in beiden Fällen geht es um Gerechtigkeit. Systematisch betrachtet, lautet die Forderung der Gerechtigkeit: Allen das Gleiche. Ohne System betrachtet, lautet sie: Jedem das Seine. Beide Vorstellungen von Gerechtigkeit gibt es bei Karl Marx.
Der Ruhm, den Marx heute genießt, gilt dem Anwalt der Gleichheit. Darin liegt zumindest ein halbes Missverständnis. Zugleich ist da etwas anderes, schwieriger zu Fassendes: ein Bewusstsein von Gerechtigkeit als Moment der persönlichen Freiheit und des sozialen Zusammenhalts. Niklas Luhmann will davon nichts wissen. In dieser Ignoranz liegt eine Schwäche, auch gegenüber Marx.VII
__________
I Versuche, Marx neu zu lesen, gibt es unterdessen viele, angefangen mit dem Band »Lire le capitale« (»Das Kapital lesen«, Münster 2014), einem im Jahr 1965 von Louis Althusser initiierten Gemeinschaftswerk, bis hin zu William Clare Roberts’ Monographie »Marx’s Inferno. The Political Theory of Capital« (Princeton 2017). Auch das hier vorliegende Werk gehört in diese Tradition.
II Diese Gemengelage bildet die Grundlage der »Marx-Saga«, eines zuerst im Jahr 1993 veröffentlichten Romans des spanischen Schriftstellers Juan Goytisolo. Er stellt eine Reaktion auf den Untergang des sowjetischen Imperiums dar und einen Versuch, Marx’ Gedanken über dieses Ende hinweg zu bewahren.
III Zur vielgelesenen Schrift der Arbeiterbewegung wurde das »Manifest der Kommunistischen Partei« erst, nachdem es im Leipziger Hochverratsprozess von 1872 gegen die führenden Köpfe der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) von der Staatsanwaltschaft als belastendes Material angeführt worden war, darüber neue Publizität erhielt und aus diesem Anlass neu veröffentlicht wurde. Massenauflagen des »Manifests« gibt es dann erst im 20. Jahrhundert.
IV So erging es auch den Kategorien, die im Zentrum der marxistischen Ökonomie stehen, also Begriffen wie Klasse, Ausbeutung, Mehrwert, Lohnarbeit, Produktionsmittel oder Akkumulation von Reichtum. Dadurch, dass Marx diese Kategorien verwendete, sahen sie aus, als kämen sie von ihm, obwohl sie von seinen Vorgängern in der klassischen ökonomischen Theorie stammen – von David Ricardo oder Henri de Saint-Simon zum Beispiel. Nach Marx’ großer synthetischer Arbeit erschien es nicht nur als unnötig, sondern vielmehr als kaum noch vorstellbar, sich direkt mit seinen Vorgängern auseinanderzusetzen.
V Eine gesellschaftliche Klasse, die sich selbst als Proletariat verstünde, gibt es in den westlichen Industrieländern nicht mehr. Damit fällt nicht nur die historische Dringlichkeit der Revolution fort. Vielmehr wird dadurch auch ein Problem erkennbar, das bereits im »Manifest der Kommunistischen Partei« verborgen war und sich auch durch spätere Werke zieht: Denn die Entscheidung für eine auserwählte Klasse verlangt eine Abgrenzung von anderen unterlegenen Klassen, dem Lumpenproletariat (»dieser passiven Verfaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft«, wie es im »Manifest« heißt) und den Parzellenbauern vor allem, denen Marx kein revolutionäres Potential zumisst.
VI Der Soziologe Wolfgang Streeck erkennt in der Staatsverschuldung vor allem ein Mittel, den sozialen Frieden in Zeiten geringen Wirtschaftswachstums zu wahren. So betrachtet, veräußerte der Staat einen Teil seiner Souveränität, um damit seine Stabilität zu wahren. Streeck empfiehlt dagegen eine Stärkung des Nationalstaats. Siehe dazu Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise der Kapitalismus. Berlin 2015. S. 62 ff.
VII Der Versuch einer theoretischen Rückgewinnung des Politischen war das Lebenswerk von Hannah Arendt. Ihr Versuch geht einher mit einer beständigen Auseinandersetzung mit Marx. Zentral ist dafür die Kategorienlehre der »Vita activa«, in der »Arbeit«, »Herstellen« und »Handeln« unterschieden wird. Siehe dazu Hannah Arendt: Vita activa oder vom tätigen Leben, 1958/1960. München 2007.
DAS MANIFEST
Die Brüder des Trostes
In den ersten Wochen des Jahres 1848, zur selben Zeit, als Karl Marx im Brüsseler Exil in allergrößter Eile und ohne die geringste Ahnung, dass eine Revolution unmittelbar bevorstand, das Manuskript zum »Manifest der Kommunistischen Partei« niederschrieb, schloss in Paris der Schriftsteller Honoré de Balzac die Arbeit an einem Roman ab. Er hatte ihm einen ungewöhnlichen Titel gegeben: »Kehrseite der Geschichte unserer Zeit« (»L’envers de l’histoire contemporaine«). Es gibt etliche Bücher im großen Werk Balzacs, die programmatische Titel tragen. Sie heißen zum Beispiel »Verlorene Illusionen« oder »Kleine Nöte des Ehelebens«. Aber kein Titel greift so weit hinaus ins Intellektuelle, ja Philosophische. Das Buch sollte sein letzter Roman werden, aber das ahnte Balzac nicht.
Honoré de Balzac lässt den Roman aus zwei Büchern bestehen. Sie gelten den Lehr- und den Gesellenjahren eines verwilderten ehemaligen Journalisten namens Godefroy. Im ersten Buch gerät er in die Kreise einer wohltätigen Geheimgesellschaft, der »frères de la consolation« (»Brüder des Trostes«), und wird nach einigen Prüfungen zu deren Mitglied. Das zweite Buch beginnt mit einem Gespräch mit Alain, seinem Lehrmeister unter den selbsternannten Rittern vom Geiste. Dieser muss sich für längere Zeit von seinem Schüler verabschieden, denn er hat einen Auftrag erhalten: »Ich soll Werkmeister in einer großen Fabrik werden, deren sämtliche Arbeiter von den Lehren der Kommunisten angesteckt sind und eine soziale Umwälzung planen, die Vernichtung ihrer Leiter, ohne zu bedenken, dass das den Tod der Industrie, des Handels, der Fabriken bedeutet …«1 Es gibt keinen Zweifel daran, dass Alain seinen Auftrag erfüllen wird.
Die »frères de la consolation« sind eine Verschwörung wider eine Verschwörung. Ihrem Zusammenschluss scheint eine Idee von natürlicher menschlicher Güte und asketischem Sozialismus zugrunde zu liegen, wie sie von Jean-Jacques Rousseau entwickelt und von den französischen Utopisten jener Zeit übernommen wurde. Im Zweifelsfall sind solche unsichtbaren Kirchen die Erfindungen von Schriftstellern.2 Die Verschwörung der Kommunisten ist es nicht. Fürst Metternich, der österreichische Staatskanzler, sprach von einer Bedrohung des Staates durch die Kommunisten genauso wie der preußische König Friedrich Wilhelm IV., und überhaupt hatte das Wort in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine große Karriere durchlaufen, weil es eine weit ausgreifende, aber kaum fassbare Bedrohung beschwor: eine Allianz zwischen den radikalen Republikanern, die an den Idealen der französischen Revolution festhielten, und den »Elenden«, die zu jener Zeit einen immer größeren Teil der Bevölkerung in den großen Städten ausmachten – den Arbeitern und Tagelöhnern, Landflüchtigen, Bettlern, Dieben, Prostituierten, den »gefährlichen Klassen«, kurz, dem ganzen sozialen Register von den Belegschaften der neuen Fabriken bis hinunter ins tiefste Lumpenproletariat.3
Das Gespenst des Kommunismus
Karl Marx schätzte den französischen Romanautor Honoré de Balzac. Dieser sei »überhaupt ausgezeichnet durch die tiefe Auffassung der realen Verhältnisse«, schreibt er im dritten Band des »Kapitals«.4 Man kann sich vorstellen, worauf sich dieses Urteil bezieht: Auf die Schilderung einer Aristokratie, die unaufhaltsam ihrem Untergang als herrschende Klasse entgegengeht, auf die Beschreibung eines Bürgertums, das gleichermaßen unerbittlich nach oben strebt, und eines Bauerntums, das nichts als seinen Ruin zu gewärtigen hat – denn Arbeiter kommen in den vielen Romanen, die zur »menschlichen Komödie« gehören, nur im »Souterrain« der Gesellschaft vor, als anonyme und gesichtslose Masse ohne intellektuelles Potential.5 Zueinander in Beziehung gesetzt werden diese Klassen durch die Geschichte in der Notwendigkeit ihres Verlaufs.
Marx, zu jener Zeit noch kaum etwas anderes als ein verwilderter ehemaliger Journalist, beginnt das »Manifest der Kommunistischen Partei« mit dem Satz: »Ein Gespenst geht um in Europa – es ist das Gespenst des Kommunismus«.VIII