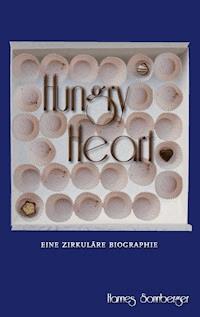Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Wirtschafts-Coach Hannes Sonnberger ist viel auf Reisen. Während der langweiligen Stehzeiten auf Flughäfen schreibt er kleine Geschichten und Betrachtungen: Miniaturen, die er dann auf Facebook veröffentlicht. In den letzten vier Jahren hat sich eine kleine sehr loyale Lesergemeinde gebildet. Für sie und potenzielle neue Fans wurden nun die besten Miniaturen aus den Jahren 2016 und 2017 zusammengestellt. Der Bogen spannt sich von sehr sensiblen Erinnerungen bis zu schräg-ironischen Beobachtungen aus dem Alltagsleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Lisa, Paul und Hannah.
In Liebe
Euer Scheps
Warum? Facebook ist im Lauf der letzten drei bis vier Jahre für mich zu einem sehr speziellen Medium geworden. Am ehesten trifft der Begriff „Appetenz/Aversions-Konflikt“ auf unser kompliziertes Verhältnis zu. Die Lust auf und die Abneigung gegen Facebook stehen in einer so delikaten Balance, dass das Bedürfnis, dort eine Buchstaben-Spur zu ziehen, immer wieder einmal um Haaresbreite gewinnt.
Als ich einmal glaubte, es wäre „alles gesagt“ und ich demgemäß eine mehrwöchige Schreib-Abstinenz einhielt, haben mich einige meiner Facebook-Freunde angeschrieben und mein „Ausscheiden“ bedauert, obwohl wir einander niemals persönlich begegnet sind.
Umgekehrt hat mich mein Leben auf Facebook mit einigen großartigen menschlichen Gewinnen belohnt, ohne deren Existenz in 3D ich mir mein echtes soziales Leben gar nicht mehr vorstellen will. Aus dieser Ecke habe ich liebevolle Fragen erhalten, ob es wieder ein Büchlein von mir geben würde. Und hier trafen Freundschaft und Eitelkeit aufeinander.
Eine Durchforstung meiner textlichen Absonderungen der letzten beiden Jahre ergab zumindest ein so ausreichendes Volumen, dass sich wieder ein kleiner Band mit Miniaturen herstellen ließ.
Als Titel habe ich mir eine Wortspende ausgesucht, die ich vorzugsweise für meine Antworten auf Kommentare benütze: Ja. Eh.
Wenn wir das Mitgefühl ignorieren,
hat die Vernunft ihr Recht verloren.
Zu den schönsten Erinnerungen an meinen Vater gehört der Sommer 1975. Ich hatte den ganzen Juli in Grenoble bei einer französischen Gastfamilie verbracht, um endlich ordentlich Französisch zu lernen. Vormittags Schule, Nachmittags Sport und andere Lustbarkeiten. Der Erfolg war überwältigend. Ich hatte mich sprachlich aus der Hoffnungslosigkeit ins beinahe akzentfreie Parlieren bewegt. (Heute fast alles verschütt gegangen). Am Ende der vier Wochen holte mich mein Vater mit dem Auto ab (ein dunkelgrüner Volvo 144). Und wir starteten auf eine zweiwöchige Tour kreuz und quer durch Frankreich. Zuerst in die Camargue, wo ich mich lebenslang mit einer Sehnsucht nach dieser einzigartigen Landschaft infizierte. Und dann hinauf ins Zentralplateau, in eine Gegend, die man Larzac nennt. Dort – im Kalkgebirge – gedeiht nur der Roggen. Die Leute züchten Schafe und machen den wunderbaren Roquefort-Käse. Einer der wenigen bekannten Orte dort hat dieser Köstlichkeit seinen Namen gegeben. Wir erreichten ein kleines Dorf namens La Cavalerie. In diesem Nest war Vati ein Jahr lang in französischer Kriegsgefangenschaft gewesen. 1975 war das Lager als Kaserne weiter in Betrieb. Vati war 1945 bis 1946 zur Arbeit bei den Bauern abkommandiert und außerdem wegen seiner Französisch-Kenntnisse Chauffeur beim örtlichen Baron. Unser erster Weg führte uns zu dem Bauernhof, wo Vati gearbeitet hatte. Und der nunmehr alte Bauer erkannte ihn sofort. In Windeseile hatte er seine ganze Familie zusammengetrommelt. Dazu gehörte sein Sohn (etwa in Vatis Alter) plus Ehefrau und deren Kinder (etwa in meinem Alter). Das Grab der leider schon verstorbenen Frau des Bauern wurde aufgesucht. Und dann inszenierte die Familie ein Fest, das seinesgleichen suchte. Im Hof des Gebäudes wurde eine Tafel aufgebaut, an der alle Platz nahmen. Dann wurde aufgetischt. Gemüsesuppe, ein Lammbraten zum ohnmächtig werden, ofenwarmer Kirschkuchen und eine Sensation eines Roqueforts, für dessen angeblich mangelnde Reife sich der Bauer ununterbrochen entschuldigte, während die unglaubliche Würze des Käses unsere Gaumen in den Wahnsinn trieb. All das begleitet von purpurrotem Landwein, den die Bauern während der Feldarbeit tranken – ein Lebenselixier! Während der gesamten Feier hatte es meinem Vater die Sprache verschlagen. Er, der sich bis dahin noch immer sehr gewandt ausgedrückt hatte, bat mich alle paar Minuten um sprachliche Übersetzung seiner Emotionen. Und dann kam der Sohn des Bauern mit einem staubigen Relikt vom Dachboden herunter. Eine feuerrote Ziehharmonika. Mit Tasten, nicht mit den in Frankreich üblichen Knöpfen. Auf DIESEM Instrument hatte mein Vater 30 Jahre zuvor gespielt. Und er hat sie sich umgeschnallt und gespielt. All die Schlager von damals. La Paloma, Lili Marlen, ... Und während dessen sind ihm die Tränen das Gesicht heruntergekullert und allen um ihn herum auch.
Nein. Als Lebenselement mindestens so wichtig, wie das Ja. Die meisten von uns sprechen als erstes Wort nicht Mama oder Papa aus, sondern Nein. Weil wir es andauernd hören. „Nein, nicht da raufklettern! Nein, nicht da runterspringen! Nein, nicht in den Mund nehmen! Nein, nicht anfassen!“ Und kaum haben wir das Nein drauf, ist es auch schon wieder schlecht. „Nein, ich will die Suppe nicht essen! – Dann gehen wir aber nicht ins Kino!“ „Nein, ich will die blöde Hose nicht anziehen! – Dann gehen wir aber nicht zum Spielplatz!“ „Nein, ich will Oma kein Bussi geben! – Dann gibt‘s aber kein Taschengeld!“ So verlernen wir das Nein. Und wenn wir es dann dringend brauchen, ist es nicht mehr da. Das Nein ist die wichtigste Schutzimpfung gegen Burn Out und gegen den Verlust der persönlichen Würde. Nein, ich kann die zusätzliche Schicht nicht übernehmen. Nein, ich möchte das Wochenende endlich wieder mal mit meinen Kindern verbringen. Nein, ich kann und will die Gesetze der Physik nicht aufheben. Das Nein ist eine Pflichtvokabel für Führende und Geführte gleichermaßen. Es schützt vor überhobenen Erwartungen und unerreichbaren Anforderungen. Es ist auch ein elementar wichtiges Tool für alle Dienstleister. So wie es unübertroffen in einer Eigenanzeige von Y&R aus den 60er Jahren formuliert worden ist. Sinngemäß: Ja sagen, wenn wir es können und Nein sagen, wenn wir es müssen. Zitat: „It (our backbone) makes us deliver service instead of servility.“ Voraussetzung: Rückgrat – ein beinahe schon in Vergessenheit geratener Körperteil.
Absoluuutes Sprechverbot! Im Gymnasium hatten wir einen recht schrulligen Professor für „Bildnerische Erziehung“. Er hatte schon einige Jahrzehnte Schuldienst auf dem Buckel und seine Lust, sich immer wieder auf die gleichen schülerisch-schwierigen Entwicklungs-Stufen einzulassen, war bereits sehr dezimiert. Unsere Anwesenheit war ein bereits vollkommen ausreichender Störfaktor. Das Wort zu erheben – worst case: zu schwätzen! – war definitiv außerhalb jeder Toleranz. Der Beginn der 2-stündigen Exerzitien war deshalb vom Eintreten des Professors in den Zeichensaal geprägt. Unter dem Arm das Klassenbuch („Klabu“) erschien Lothar Fink und verkündete: „Absoluuuutes Sprechverbooot! Sonst: Klabu!“ Wer sich daran nicht halten konnte oder wollte, musste mit einer Strafaufgabe in eskalierendem Ausmaß rechnen. Eine „Leier“, die im milden Ersttäter-Fall 1x, im Wiederholungsfall 10x und im notorischen Gewohnheitsverbrecher-Fall 100x mit Rhedis-Feder Nr.3 in Großbuchstaben geschrieben werden musste. Der Wortlaut dieser Leier: „Ohne Erlaubnis habe ich nicht zu sprechen. Glaube ich, trotzdem etwas für den Unterricht ungemein Förderliches beitragen zu müssen, so hebe ich – bescheiden, wie ich nun einmal bin – von meinem Sitze aus die Hand. Ich spreche jedoch nur dann, wenn ich eigens dazu aufgefordert worden sein sollte. Ansonsten halte ich den Mund. Ich bin ein Oberschwätzer.“ Am Umstand, wie gut ich noch heute den Originaltext abrufen kann, ist gut erkennbar, dass der Leitgedanke „Der Mensch lernt durch Wiederholung“ wirklich stimmt. Für jene kriminellen Elemente, deren Strafregister auf 100 Wiederholungen angeschwollen war, hatte ein Mitschüler ein „Schreibbüro“ eingerichtet. Der Gute hatte 3 ältere Schwestern, die ihn doch recht nachhaltig unterdrückt hatten. (Vielleicht ist er deswegen Sexualtherapeut geworden. Aber das ist eine andere Geschichte.) Aber im Fall ökonomischer Freiheit hatte Herwig sich eine Nische erkämpft. Man konnte bei unserem Jung – Unternehmer beliebig viele Fassungen der Leier bestellen, solange man imstande war, 1 Schilling pro Leier auszugeben. Und die Schwestern schrieben mit zarter Hand wie am Fließband.
Das Geschäft florierte bis zu unserer Matura.
Meine Omi. 1911-1994. Eines von vier Kindern eines aus dem damaligen Stuhlweißenburg nach Steyr eingewanderten ungarischen Installateurs namens Franz Kriszan. Der hatte aus allerkleinsten Anfängen ein unbedeutendes Handwerksunternehmen gegründet, das meine Omi zum ersten Haus der Stadt mit über 70 Mitarbeitern hochzog. Sie war eine herbe Schönheit, übertroffen von ihrer jüngsten Schwester, die jungverheiratet an Lungenentzündung starb. Es verblieben die zweite Schwester und der Nachzügler-Bruder, der im Krieg gefallen ist. Meine Großeltern waren an Unterschiedlichkeit nicht zu überbieten. Opi als 1 Meter 95 Kerl mit 140 Kilo, als Landwirtschaftsinspektor sehr dem Rustikalen zugetan. Omi als mondäne Dame, die Schlendrian und Gemütlichkeit hasste. Gleich nach dem „Anschluss“ ließ sie sich scheiden. (Das war im vorherigen klerikalen Österreich nicht möglich.) Nach dem Krieg ist sie mit dem Lastwagen durch die russische Zone gefahren und hat Rohre und Klomuscheln ausgeliefert. Ihre Schwester hatte noch in den 30er Jahren den Installateur-Gesellenbrief gemacht – eine Sensation für die damalige Zeit. Als Anfang der 50er Jahre der Bauboom einsetzte, florierte das Unternehmen ganz gewaltig. Omis Schwester zog sich ganz aus der Firma zurück und wollte in Ruhe ihre 50% des Gewinns genießen. Bis sie draufkam, dass sie von ihrer Schwester ganz gehörig beschissen worden war. Ab Mitte der 60er Jahre haben die beiden Frauen bis zum Tod nichts mehr miteinander geredet und saßen beim Friseur schweigend nebeneinander unter den Trockenhauben.
Omi führte ein für die damaligen Verhältnisse geradezu liderliches Leben. Mindestens ein Dutzend Ehen gingen in Steyr und Umgebung zu Bruch, nachdem die Gute die jeweiligen Ehemänner vernascht hatte. Wenn sie gut drauf war, schmierte sie die Gasthausgeiger mit ein paar Hundertern und tanzte zu später Stunde auf den Wirtshaustischen Csardas. Als Omi war sie eine Vollkatastrophe, als Freundin der reine Genuss. Als wir diese Option füreinander entdeckt hatten, war der Weg frei für einige sehr unterhaltsame Jahre. Sie hatte eine sehr lange Affaire mit einem leitenden Mitarbeiter in ihrer Firma. Der war verheiratet – was sonst – und jeden Montag Abend stand sein Auto vor Omis Haus. Die Ehefrau ließ sich ihr Schweigen gebührend abgelten. Dann fing der Liebhaber ein weiteres Verhältnis an und die junge Dame wurde schwanger. Von drei Frauen unter Druck gesetzt, warf er sich vor einen Zug. Omi wurde Taufpatin seines Kindes. Omi war sehr vertrauensselig, obwohl ihr Wahlspruch „Die Welt betrügt, also betrüge sie“ gewesen war. Ein Wahlneffe führte ihre Buchhaltung. Er hatte ein Verhältnis mit ihrer Sekretärin. Die beiden zockten die Firma in den Konkurs. Dem Wirtschaftsmagazin „Trend“ war das eine Geschichte mit dem Titel „Dynasty in Steyr“ wert. Omi hatte noch ein bisschen Schwarzgeld gerettet und starb im Altersheim. Sie war eine herrliche Frau.
Gedanken in der Reha-Klinik. Selten hat man die Gelegenheit, sich 24 Stunden lang, mehrere Wochen hindurch in einem so gut durchmischten Biotop aufhalten zu können. Alle sozialen Schichten, viele Nationalitäten und auch – sichtbar – mehrere Religionen. Viel hören, viel schauen, viel nachdenken.
These 1. Könnte es sein, dass die sogenannte aufgeklärte Zivilgesellschaft, zu der auch ich mich selbstbewusst rechne, in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten übersehen hat, dass all die großen Werte wie Toleranz, Respekt, Gendern, Gleichberechtigung, Wertschätzung, Emanzipation, Geschichtsunterricht, Entnazifizierung usw. (Liste nicht vollständig) bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung nicht angekommen sind?
These 2. Könnte es sein, dass all diese Errungenschaften der Aufklärung und des modernen Zusammenlebens nicht nur nicht angekommen sind, sondern einem großen Teil der Bevölkerung ordentlich auf die Nerven gehen? Weil deren Alltag von ganz anderen Themen gesteuert wird. Weil der blanke Überlebenskampf all diese scheinbaren und gefühlten Orchideenthemen brutal überlagert.
These 3. Könnte es sein, dass alle Bemühungen um Integration der bisher nicht aus Kriegsgebieten Zugewanderten über weite Strecken gescheitert sind? Weil diese Bemühungen entweder gar nicht oder nicht passend gesetzt wurden. Weil die Zugewanderten nicht passend in ihrem Status abgeholt wurden. Weil die Zugewanderten auch zu einem nicht unerheblichen Teil gar keine Lust hatten, unsere Gebräuche anzunehmen. Weil „wir“ auch keine Lust hatten, uns für deren Gebräuche zu interessieren.
These 4. Könnte es sein, dass sich der über sehr viele Jahre aufgestaute Frust über eine Themen-Herrschaft, die am Leben eines großen Teils der Bevölkerung einfach drübergefahren ist, sich nun durch den besonders leichten Zugang zu sozialen Medien einfach Bahn bricht? Und in seinem brachialen Zorn auch gleich das fundamentale Scheitern der Bildungspolitik offenlegt. Und seitens der aufgeklärten Bildungsbilder nur Hohn und Verachtung über katastrophale Orthographie, Syntax und auch sonstige Schrecklichkeiten übrigbleibt, anstatt nachdenklich zu werden, wie weit sich die „Schichten“ schon in großer Unversöhnlichkeit voneinander entfernt haben.
These 5. Könnte es sein, dass mittlerweile der jahrelang glosende Hut lichterloh brennt und wir alle – während wir noch ratlos mit dem Thema der Migration umgehen – zugleich die fundamentalsten Hausaufgaben erledigen müssten? Wie man miteinander umgeht. Wie man zuhört, ohne zustimmen zu müssen. Wie man Kompromisse schließt. Wie man den Verdacht zulassen kann, der andere Mensch könnte recht haben. Wie man sich aus den Schützengräben der festgefahrenen Meinungen herausbewegt.
Als Coach habe ich solche Grundsatzfragen jeden Tag im zwischenmenschlichen Bereich am Schirm. Und ich weiß, wie unendlich anstrengend es für alle Beteiligten ist, aus den Betonschuhen herauszusteigen. Aber auch: Wie wunderbar erleichternd und befriedigend es ist, auf der Basis eines ordentlich durchdachten Referenzrahmens der eigenen Bedürfnisse Platz freizumachen für die des anderen Menschen. Irgendwann werden wir sonst alle mit unseren Betonschuhen über die Hafenmauer hüpfen und jämmerlich untergehen. Im Bewusstsein, immer nur recht gehabt zu haben, wird uns allen die Luft ausgehen.
Und außerdem. Wenn Menschen lange (auf dem Rücken) liegen und nach dem Aufstehen nicht auf ihre Optik achten, dann haben sie einen recht zerstrobelten Hinterkopf.
Flache Frisur, die Haare schopfartig nach oben gedrückt, die Fläche darunter in unregelmäßigen Bahnen zerteilt. Da fühlt man sich als beherzter Glatzenträger irgendwie tiefenentspannt. (The same applies to etepetete Business Reisenden, die im Flugzeug einpennen) Was anderes: Schon seltsam, wie unglaublich dick manche Menschen werden können und trotzdem von Ärzten neue Gelenke eingeschraubt kriegen, bevor sie abgenommen haben. Oder auch irgendwie eigenartig, was sich jemand denkt, der auf Kur geht und um 10.00 in der Kur-Konditorei ein Bier haben will. (Ja, ich hab mir zwischen zwei Anwendungen dort einen schnellen Espresso reingezogen). Und: Faszinierend, was mittlerweile fast 3 Wochen Reha bewirken. Kilos: Minus 5. Bauchumfang: minus 5. Schmerzen: 0 (in Worten: Null) Freu mich. :-)
Dialog zwischen zwei Patienten. Oder: Die Grenzen des Dialekts.
A: Hüfts nix, so schodts nix.
B: Wos host gsogt?
A: Hüft es nix, so schodt es nix.
B: Eh.
Jeder Mensch tut gut daran, mit den eigenen Ansätzen zur Niedertracht achtsam umzugehen. Wer sich diese Arbeit nicht antun will, ist darauf angewiesen, die Angst vor der vermeintlichen Niedertracht der „anderen“ zu schüren.
Meine Freundin Olive. Neulich hat ein lieber Freund, der mein Buch gelesen hat, festgestellt, dass ich ein Freundes-Räuber bin. Ich reisse mir Freunde von Freunden unter den Nagel. Genauso ist es mit Olive und mir gelaufen. Sie gehört zum inner cercle meiner Frau. Aber bereits beim ersten Kennenlernen sind Olive und ich in großer Zuneigung füreinander entbrannt. Im absolut korrekten Sinn: Ich liebe sie. So vieles verbindet uns. Die Leidenschaft für Frauen. Für Politik (auch wenn wir da trefflich streiten können). Die eine oder andere Allergie (auch wenn es nicht die selben sind). Das Talent für die Wahl nicht passender Partner (da bin ich durch den Altersunterschied meiner Olive wohltuend davongeeilt). Das „Empathische“. (Olive hat ein Platzerl für unsere Lilli-Katze gefunden/siehe oben – Stichwort „Allergie“). Vielleicht waren wir in einem anderen Leben einmal Bruder und Schwester. Jetzt – in diesem Leben – bin ich einfach nur froh, dass es sie gibt. „Meine“ Olive.
Wennst freihändig aufm rechten Bein in der Dusche stehst. Und in der rechten Hand hast den Duschkopf. Und aus dem strahlt ganz weich lauwarmes Wasser. Und dann hebst das linke Bein. Sodass der linke Fuß so auf Kniehöhe vom rechten Bein ist. Und dann lasst des schöne lauwarme Wasser ausm Duschkopf über die Fußsohle vom linken Fuß rinnen. Dann – ja dann – hat die Reha wirklich was gnutzt.
Ich muss nicht in der Nazi-Zeit gelebt haben, um zu wissen, dass der Holocaust das grauenhafteste Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist. Oder dass „Unsere Ehre heißt Treue“ der Wahlspruch der SS war. Oder dass das Schüren von Feindbildern und Rassismus der Anfang einer bestialischen Politik gewesen ist. All das kann man – muss man – wissen. Ein bisschen Schulunterricht gepaart mit Anstand reichen vollkommen. Und ich muss nicht im Morast in Griechenland campen, um zu wissen und zu spüren, dass es sich dabei um das Resultat einer zutiefst beschämenden Politik handelt. Ich muss nur Mensch sein, um kein Nazi zu werden. Und um mich für all das, was die damaligen und die heutigen Nazis tun, zu schämen.
Grüabal im Kinn. Ich habe ein Grübchen im Kinn. In das pflegte meine innig geliebte Schwiegermama ihren Finger zu legen und zu sagen: „Du weißt schon, warum ich Dich so lieb hab.“ (Ach Mama, ich vermisse Dich!) Bei meiner Geburt war dieses Grübchen eine tiefe Kerbe, die sich erst langsam zusammenzog. Auch sonst dürfte ich kein sehr erbaulicher Anblick gewesen sein. Mein Körper war von einer durchgehenden Flaumschicht überzogen und – man würde es heute nicht für möglich halten – auf meinem Kopf hatte sich dichter schwarzer Haarwuchs bis in die Stirn ausgebreitet. Mein Vater hat in seiner Verzweiflung angeblich gesagt: „Na ja, Hauptsache gsund is er.“ (Was sich später auch als Irrtum herausstellen sollte.)
Mit der Zeit wichen die optischen Irritationen und es wurde ein einigermaßen herzeigbares Kerlchen aus mir. Wie auch heute noch bei vielen Verwandten und Eltern-Freunden kleiner Kinder üblich, blieb auch ich nicht vor Bemerkungen wie „Na Du bist aber gewachsen!“ oder „Freust Dich schon auf die Schule?“ verschont. Am meisten geärgert hab ich mich aber über all jene, die manisch auf mein Grübchen im Kinn fixiert waren und bei jeder Begegnung fragten „Na, wo hast Du denn das siaße Grüaberl (oberösterreichisch!) her?“ In Ermangelung einer passenden Antwort und schon recht angefressen wegen der dauernden Fragerei habe ich meinen Opi um Rat gebeten. Der war der ehemalige Bürgermeister seiner Heimatgemeinde und immer noch recht stolz auf diesen Titel. Und: Auch er hatte ein Grübchen im Kinn (und ein Loch in der rechten Handwurzel nach einem Bajonettstich im Ersten Weltkrieg).
So empfahl mir mein Opi: „Wennst wieder gfragt wirst, von wem Du das Grüaberl hast, dann sagst: Vom Herrn Bürgermeister!“ Erleichtert über diese doch recht simple und merkfähige Antwort zog ich von dannen und harrte der nächsten Gelegenheit, die sich planmäßig und bald einstellte. Eine mit gnadenloser Dauerwelle bewaffnete Wahltante steuerte zielsicher auf mich zu, hatte den Zeigefinger schon im Anschlag und fragte: „Na Hansi (ich hasste es, wenn man mich Hansi nannte), wo hast Du denn das siaße Grüaberl her?“ Und wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort: „Vom Herrn Bürgermeister!“ Entsetzen in der Runde und insbesondere meine Mutter wurde bleich: Der damals amtierende und der Weiblichkeit nicht abholde Linzer Bürgermeister hatte auch ein markantes Grüaberl im Kinn ...
Der eine und der andere. Der eine ist nach dem Krieg und einem Jahr Gefangenschaft zurückgekommen. Mit einer Trachtenjoppe und einer kurzen Lederhose. Sonst nichts. Hat seine Heimat erst 20 Jahre später wiedergesehen und Rotz und Wasser geheult, als im finsteren Kommunismus ein Baby getauft wurde. Eingewickelt in eine speckige Autodecke in der verwahrlosten Kirche, in der er selbst getauft worden war. Damals. Der andere hat sich wegen seiner Kurzsichtigkeit irgendwie durch den Krieg manövrieren können. Sein Humor war flächendeckend. Keine Pointe wurde ausgelassen. Zu keinem Preis. Er entsprach keinem männlichen Schönheitsideal, das zu irgendeiner Zeit gegolten haben mag. Aber die Frauen liebten seinen Schmäh. Reihenweise. Der eine und der andere waren beste Freunde. Und so verschieden. Der eine hatte seine liebe Not mit den Frauen. Vielleicht hätte er viel lieber schwul gelebt. War damals strafbar. Und das hätte ihn um seine Familie gebracht, die er auf seine Art so liebte. So war er halt irgendwie anders. Elegant. Schüchtern. Hut niemals ohne Handschuhe. Und umgekehrt. Der andere wusste nicht so recht, wie man liebt. Eher, wie man Liebe macht, ohne sich fortzupflanzen. Aber er war loyal. Sehr sogar. Er war der beste vorstellbare Freund. Und ein elender Vater. So ähnlich, wie sein Freund und doch irgendwie anders. Von Politik hatten sie die Schnauze voll. Hat ja doch nur in den Krieg geführt und nachher. Ja, nachher gab es wenigstens Autos mit Automatik. Und Farbfernseher. Und Stereogeräte. Radio, Plattenspieler und Cassettendeck in einem. Da wetteiferten sie, die beiden. Wer früher das modernere Kastl hatte.
Als der Eiserne Vorhang fiel, freuten sie sich.
Weil sie es dem Scheiß-Kommunismus endlich gezeigt hatten. Und als die Tschechen – blass und in schlechter Kleidung – über die offene Grenze kamen, war ihnen das nicht recht. Erst recht nicht, als die großen Handelsketten von den Lastwagen herab die Südfrüchte verschenkten. Wäre nicht nötig gewesen, meinten sie. Schon wieder die Politik, von der sie eh immer schon nichts gehalten hatten. Da wollte der andere dann bei der nächsten Wahl ein gebrauchtes Häuslpapier in die Urne schmeißen. Der eine war 9 Jahre später tot. Alkohol. Der andere war ihm ein Jahr vorher vorausgegangen. Darmkrebs. Ihre Söhne sind so verschieden, wie ihre Väter. Nur verkehrt herum. Der eine hat Jahrzehnte gebraucht, bis er zu seiner Mitte gefunden hatte. Der andere hat seine Tanzschulpartnerin geheiratet. Und langsam finden sie zusammen.
Ich will mein Europa zurück. 5 Minuten vor dem Boarding nach München informiert eine mäßig gut gelaunte Dame des Bodenpersonals der Fluglinie meines Vertrauens, dass bei Reisen nach München das Schengen-Abkommen außer Kraft ist. Ohne gültiges Reisedokument keine Einreise. 1 x alle 127 Flüge nach Deutschland hab ich meinen Pass nicht mit. Heute. Ich frage nach: Geht Führerschein auch? Und es geht noch ein bissi unfreundlicher – ist ja schließlich Bodenpersonal. So wie Bodenplatte. „Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Führerschein kein amtliches Reisedokument ist. Wenn Sie fliegen, tun Sie das auf eigenes Risiko und Sie müssen auch die Strafe selbst bezahlen.“ Jetzt versteh ich zwar, dass die Münchner seit fast 100 Jahren Bedenken gegen einreisende Oesis haben, aber meine Landsleute könnten sich doch wenigstens ein bissi freuen, wenn ich ausreise.
Nachdem schriftlich festgehalten wurde, dass das gesamte Risiko dieses Himmelfahrtskommandos ganz allein bei mir liegt, darf ich ins Flugzeug. In München standen dann zwar recht schwer bewaffnete Grenzer beim Eingang, meinen Führerschein wollte aber doch keiner sehen. Und raus lassen werden sie mich schon wieder. Wie gesagt: Ich will mein Europa zurück. Dann klappt das auch mit dem Bodenpersonal.
Jack & Ivy Wonfor.