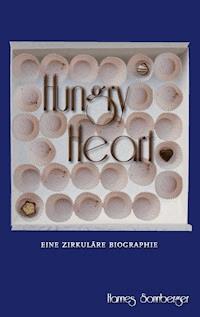Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in gefährlichen Zeiten. Und wir brauchen eine Allianz der Menschlichkeit und das Ende der Betulichkeit, mit der sich die Demokratie seit Jahren um die drängenden Themen des Zusammenlebens herumdrückt. Wir müssen uns aufraffen und eine klare Kante ziehen gegen alle Formen des heraufdräuenden Faschismus. Das wird uns so lange nicht gelingen, solange wir uns in sprachpolizeilichen Manierismen verheddern, anstatt der mittlerweile nicht mehr nur verbalen Gewalt der Faschisten robust entgegenzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet meiner großen und großartigen Familie, in der die Liebe wohnt.
Inhaltsverzeichnis
Das erste Vorwort
Das zweite Vorwort
Aufklärung
Kant-Essenzen – als Ermutigung mit zeitloser Gültigkeit
Die Kraft systemischer Arbeit
Gruß aus der Küche: Eine Kostprobe der aktuellen kantischen Relevanz
Links =/ woke. Susan Neiman
Wokeness. Oder: Die Dosis macht das Gift
„woke capitalism“
Woke Kommunikation
Wokes Konflikt-Management
„Weiße Privilegien“
Konflikt-Management/“Aufgeklärt streiten“
Die „Ich-Botschaft“
Regression und Change. Gleichzeitig
Der Schattensprung
Wer das Ziel nicht kennt, der kann den Weg nicht finden
Hin-Zu statt Weg-Von. Erreichen statt Vermeiden
Ein Ziel ist keine Zahl. Ziele sind Lösungen. Zahlen sind Ergebnisse
Führung
Team-Arbeit. Aufgeklärt zusammenarbeiten
Die „4-Fragen-Probe“
Entfremdung
Schlussbetrachtung
Das erste Vorwort.
Ich bin ein Boomer. Jahrgang 1958.
Aufgewachsen in der damals provinziellsten Provinz von Österreich – in Linz an der Donau.
Wohl wissend, wie gotteslästerlich mein Ansinnen ist: Als ich mit 15 Jahren merkte, wie der original Rock´n´Roll der 50er und 60er-Jahre an meinen Gliedmaßen rüttelte, habe ich es so sehr bedauert, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis oder Buddy Holy nicht in ihren Glanzzeiten auf der Bühne erlebt zu haben.
Auch wenn das bedeutet hätte, Anfang der 40er-Jahre geboren worden zu sein – und wer will das schon?
Anfang der 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts bereitete sich mein Vater darauf vor, zur Wehrmacht einberufen zu werden und meine Mutter – mitten in eine Nazi-Familie geboren – weigerte sich, dem BdM (Bund deutscher Mädchen) beizutreten.
Die beiden – in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vielfach gebrochen und vollkommen verwirrt – haben meinen Bruder und mich erzogen.
Und als ich dann selbst Vater wurde, hatte ich kaum eine Blaupause, an der ich mich meinen Kindern gegenüber orientieren konnte. Ich wusste nur eines: So, wie meine Eltern mit mir umgegangen waren, wollte ich auf keinen Fall mit meinen Kindern umgehen …
Neulich haben mir meine Kinder in unsere WhatsApp-Gruppe – ich liebe diese gemeinsame Plattform, die nur uns gehört – einen Link geschickt, wo sich eine junge Frau, die in den späten 90er-Jahren ein Kind gewesen ist, darüber beklagte, dass sie ein Kindheits-Trauma erlitten hat. Sie hatte als Kind den vielfach preisgekrönten Zeichentrickfilm von Steven Spielberg „In einem Land vor unserer Zeit“ gesehen.
Und da gibt es eine Szene, in der die Mutter des kleinen Sauriers „Little Foot“ stirbt und der kleine Held – eben Little Foot – herzzerreißend über diesen Verlust trauert.
Ich habe diesen Film dutzende Male mit meinen Kindern gesehen und weiß noch, wie sie sich bei dieser Szene an mich kuschelten und wir uns gegenseitig Trost spendeten. Es wäre mir aber in meinen schrecklichsten Albträumen nicht eingefallen, dass diese Szene ein „Trauma“(!) bei meinen Kindern angerichtet haben könnte.
Achtung, jetzt kommt die ganz schreckliche Boomer-Relativierung: Ich bekam als kleiner Bub noch den Struwwelpeter vorgelesen und weiß noch, wie schrecklich ich die Szene fand, als der Schneider mit seiner großen Schere dem Daumenlutscher den Daumen abschnitt.
So verschieben sich die Parameter der Grausamkeiten und wahrscheinlich haben sich meine kriegsgeschüttelten Eltern gefragt, was an der Daumenabschneiderei gar so fürchterlich sein soll, während mein Vater an von Granaten zerfetzte Gliedmaßen denken musste.
Und im Jahr 2023 beobachtete ich einen florierenden Betrieb im kriegsverschonten Westeuropa, wo die recht jungen Mitarbeitenden nach den Strapazen der Pandemie mit dem Umstand, dass Krieg ist in der Ukraine nicht mehr zurechtkommen und bei der Geschäftsführung deponieren, dass sie aufgrund dieser psychischen Stressoren nun nicht mehr arbeiten können.
Und ich habe mich gefragt: Wie kommen denn nun die jungen Mütter in der Ukraine damit zurecht, dass sie mit ihren Kindern in die Bunker flüchten müssen oder dass sie hochgradig gefährdet sind, von den russischen Aggressoren vergewaltigt zu werden. Oder gar die älteren Mütter, deren erwachsene Kinder in Uniformen stecken und an der Front die Invasion ihrer Heimat abwehren. Wenn also eine durchaus traurige Szene in einem Zeichentrickfilm für Angehörige einer bestimmten Generation bereits ein „Trauma“ darstellt, wie wollen wir alle denn nun mit dieser verbalen Eskalationsspirale umgehen, die sich – aus meiner Sicht – so unreflektiert und unkontrolliert nach oben schraubt? Was ist die Steigerung von „Trauma“, wenn sie einen Zustand beschreiben soll, der mit brutal-realen körperlich/seelische Verwundungen stattfindet?
Während all das geschieht, rütteln Umfragedaten in Österreich jemanden wie mich aus der vermeintlichen Beschaulichkeit: Mehr als 40 Prozent meiner Landsleute finden, die Ukraine sollte halt endlich ihre östlichen Landesteile den Russen überlassen, denn dann wäre endlich Ruhe und „wir“ könnten aufhören, die ukrainische Bevölkerung vor Ort und die Geflüchteten bei uns zu unterstützen.
Und die Rechtspopulisten – ich habe in diesem Augenblick diese Vokabel zum letzten Mal in diesem Buch geschrieben, denn dieser Euphemismus verbirgt eine präzise Wahrheit: es sind astreine Faschisten (auch keine Proto- oder Neo-Faschisten, sondern ganz eindeutig Faschisten) – diese Faschisten eben nützen die Instrumente der Demokratie, um diese wertvollste Errungenschaft der Menschheitsgeschichte aus dem Weg zu räumen.
Während all das geschieht, ereifern sich beflissene Tugendwächter*innen, um sich für die alltägliche Verankerung von mittlerweile mehr als 60 verschiedenen Geschlechtsidentitäten ins Zeug zu legen, N-Wörter aus historischen Texten zu eliminieren, westliche Menschen mit Rasta-Frisuren zu canceln und einen subtilen bis manifesten Druck gegen alle aufzubauen, denen die Verfolgung dieser Ideale kein tägliches Anliegen ist. Da wird dann von persönlichen Werten gesprochen, die nicht verunglimpft werden dürfen und beim geringsten Widerwort fließen die Tränen und die emotionale Erpressungs-Wäschewalze wird angeworfen.
Und so ein Boomer wie ich fragt sich dann:
Was habe ich falsch gemacht? Wo sind die alle falsch abgebogen? Wo habe ich den richtigen Exit versäumt? Wer wird den Wettlauf der Intoleranz gewinnen – die Faschisten oder die Woken – denn das ist die Schnittmenge dieser beiden Ideologien: Die unerträgliche Intoleranz und die penetrante Opfer-Mentalität.
Beides völlig deplatziert in einem liberalen aufgeklärten Biotop.
Das Biotop der Aufklärung, das sich seit Jahrhunderten gegen den Partikularismus oder – jetzt neu – gegen den Tribalismus wehrt und sich einem universellen Menschenbild verschrieben hat, das vom Diskurs lebt und nicht von der Diskriminierung des Andersartigen. Das Gerechtigkeit anstrebt und nicht Rache.
Das Demokratie will und nicht die Hysterie wechselnder Minderheiten.
Darüber will ich schreiben. Leidenschaftlich. Zornig. Mit einer Streitschrift für die Werte der Aufklärung.
Nicht wissenschaftlich. Ohne Fußnoten.
Aber aus der Tiefe eines bebenden Herzens, das sich seit mehr als vier Jahrzehnten den Werten der Aufklärung verschrieben hat und sich dieses Fundament nicht nehmen lassen will.
Das ist nun also mein erstes Vorwort.
Es soll Einblick geben in die Untiefen meiner Emotionen, die ich mir in diesem Buch erlauben möchte.
Das zweite Vorwort.
2016. Ich sitze gegenüber meiner wunderbaren Frau auf der Terrasse eines Hauses bei Volterra in der Toskana und wir schreiben beide an unseren Büchern.
Sie am ersten Wurf ihrer böhmischen Familien-Trilogie. Ich an meinem Buch „Tool Box“, dem beinahe ultimativen Universalhandbuch für Führungskräfte.
In der Zwischenzeit ist die Familien-Trilogie sehr erfolgreich erschienen. Und aus meiner „Tool Box“ ist ein „Longseller“ geworden, wie meine mich liebende Frau charmant anmerkt. Weil die „Tool Box“ ist zwar kein Chart-Stürmer geworden, verkauft sich aber nach wie vor als sehr geschätztes Vademecum für viele, die im hartnäckig anspruchsvollen Führungsalltag einen handlichen Souffleur wollen.
In den Jahren seit 2016 hat sich enorm viel verändert.
Die wohl markantesten und dramatischsten Zäsuren, denen sich niemand entziehen konnte, waren und sind die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine.
Beide Einflussfaktoren zeigen uns auf gnadenlose Weise, wie sehr wir alle – weltweit – miteinander verbunden und im doppelten Wortsinn betroffen sind (als Opfer und/oder als Mitfühlende). Beide Markierungspunkte haben nach kurzer Zeit unauslöschliche Spuren bei den einzelnen Individuen und in den großen Gesellschaften hinterlassen. Mehr noch: Sie haben unser aller Kommunikationsverhalten mit einer Duftmarke bestäubt, die wir – und unsere Nachfahren – wohl so schnell nicht mehr loswerden (können).
Corona und der Krieg haben den Tod auf eine Weise in unser Leben gekippt, die wir in dieser Form im scheinbar friedlichen Alltag unserer Komfortzone nicht kannten oder nicht wahrhaben wollten.
Aber nicht nur Abertausende Menschen sind mittlerweile qualvoll aus ihren Existenzen gerissen worden, auch unhinterfragte und nicht servicierte Gewohnheiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation haben Ihre Selbstverständlichkeit verloren und wurden durch manchmal erschreckende und tatsächlich von mir als Rückschritte empfundene Grobheiten ersetzt.
So vieles ist anders geworden. Anders im Sinne von ungewohnt, irritierend, herausfordernd, verstörend, ablösend, neues Lernen erfordernd.
Das Arbeitsleben hat sich unwiderruflich geändert. Noch vor ein paar Jahren schien es, als wäre der größte „Change“ im Arbeitsleben mit den agilen Formen der Kollaboration verbunden. Mittlerweile haben uns die pandemiebedingten Lockdowns auf die harte und schnelle Tour beigebracht, wie man sich von Vorurteilen gegenüber dem Homeworking löst. Und kaum haben wir gelernt, wie man mit dieser neuen Realität umgeht, bläst uns schon der nächste „wind of change“ ins Gesicht: Viele Menschen haben sich mittlerweile organisatorisch, infrastrukturell und ergonomisch zuhause besser eingerichtet, als in den Firmen und wollen gar nicht zurück an die betrieblichen Arbeitsplätze. Dort werden die nicht nur positiven Effekte des remote workings spürbar: Allen ambitionierten Hoffnungen zum Trotz lässt sich die zwischenmenschliche Chemie, die Spontaneität und die spielerische Leichtigkeit des ungeplant aufeinander Zugehens in der 3D-Wirklichkeit eben nicht durch noch so intuitive elektronische Tools ersetzen.
Als Wirtschafts-Coach kann ich das alles hautnah beobachten und bin gleichzeitig selbst massiv betroffen. Ein Computer-Bildschirm egal welcher Größe und Brillanz kann einfach nicht die Nervosität, die Anspannung, das Beben, die Aufregung, den Geruch und die Aura eines Menschen vermitteln, der einem irgendwo virtuell gegenübersitzt und sich bemüht, gut über den Schirm rüberzukommen.
Trotz all dem gibt es eine erhebliche Anzahl von Menschen, die die Rückkehr in die Büro-Räumlichkeiten als Rückschritt und Nachteil empfinden und die Klage darüber führen, dass dadurch eine Menge eingespielter Rituale aufgehoben werden, die eine angenehme Balance zwischen Privat- und Berufsleben ermöglichten.
Von hier zum Thema der sogenannten „work/life-balance“ ist es nur noch ein kleiner Schritt.
Ich erlaube mir an dieser Stelle eine Anmerkung: Ich persönlich finde den Begriff „work/life-balance“ im höchsten Maß irreführend, weil er aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen der „Arbeit“ und dem „Leben“ generiert. Wohl wissend, dass mit „life“ das Privatleben gemeint ist, glaube ich trotzdem, dass die „Arbeit“ ein natürlicher normaler Teil des gesamten Lebens sein könnte/sollte und nicht ein Störfaktor, der uns vom „wirklichen Leben“ abhält. Selbstverständlich weiß ich, wie dröge Führungskräfte und/oder uninspirierte Mitarbeitende jegliche Faszination aus der Arbeitswelt ausradieren können. Das ändert aber nichts an meiner realen Fantasie eines lustvollen Broterwerbs …
In einer meiner zahlreichen Team-Analysen habe ich kürzlich ein Team-Mitglied gefragt, wie „sinnstiftend“ die eigene Arbeit und die des Teams wäre.
Die Antwort: „Sinnstiftend? Nein! Den Sinn hole ich mir von wo anders, den kann die Arbeit nicht liefern. Wenn ich Sinn suche, finde ich den in meinem privaten Leben.“
Ich konnte nicht umhin, still und tief in mir drin so etwas wie Trauer zu empfinden, dass der Broterwerb eine so hohle Rolle im Leben einer Repräsentant*in der sogenannten „Generation Z“ spielt.
Diese Generation der um die Jahrtausendwende Geborenen tickt fundamental anders, als die Generationen davor – auch, als die vordergründig ähnliche der „68er“.
Sie hat die Last einer selbst empfundenen „Letzten Generation“ geschultert und reklamiert mit großer Intensität das Umdenken und vor allem ein neues Verhalten gegenüber allen Aspekten, die mit dem von Menschen geschaffenen Klimawandel zu tun haben. Dabei werden aktionistische Formen der Aufmerksamkeits-Beschaffung gewählt, die es wert sind, diskutiert zu werden.
Der Unmut erstreckt sich aber nicht nur auf Fragen des meteorologischen Klimas, sondern auch auf Aspekte des Klimas der Kommunikation – Stichwort „Wokeness“.
In diesem Szenario bin ich als Mitglied meiner Generation immer häufiger mit Etikettierungen als „Boomer“ oder „Alter Weißer Mann“ konfrontiert. Eine Zuordnung, die mich durchaus provoziert und manchmal auch verärgert.
Besonders „aufregend“ dabei: Die kritische Infragestellung von regelrechten Mantren, die mich in den letzten 40 Jahren meines Berufslebens als „Werber“ und als Wirtschafts-Coach begleitet und geleitet haben. Diese Leitgedanken, die sich so lange als hilfreich und krampflösend erwiesen und sich trotz dieser Wirksamkeiten nicht einmal bis jetzt noch allgemein durchgesetzt haben, stehen nun zur Disposition. Sie werden bedrängt und sogar angegriffen von „neuen“ Ansätzen, die sich so unerbittlich artikulieren, dass ich sie ohne Zurückhaltung als Dogmen bezeichnen möchte. So soll dieses Buch gleich mehrere Ziele verfolgen:
Einerseits der manchmal vielleicht sogar als wehmütig interpretierbare Rekurs auf meiner Meinung nach hochwirksame und gleichzeitig in Zweifel geratene Tools und Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Andererseits eine Streitschrift gegen die ausufernden Grandiositäten der aktuell „angesagten“ Leuchttürme der „Wokeness“.