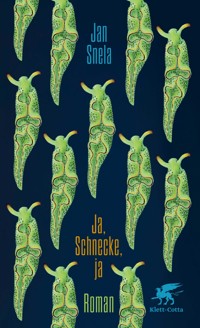
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
100 Beste Bücher des Jahres der ZEIT SWR-Bestenliste März 2025 Nominiert für den Franz-Tumler-Literaturpreis 2025 »Wie lange es noch diesem Wahnsinn standhält, das an und für sich ja wohl standhafte Haus?« Jan Snela erzählt in seinem Roman von dem großen Durcheinander, in dem wir stecken: wir Menschen, wir Tiere, wir Pflanzen. Davon, wie wir einander begegnen können. Und von der Liebe in ihren mannigfaltigen Spielarten: zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen Robotern, Menschen und anderen Lebewesen, zwischen östlicher und westlicher Tradition. »Jan Snelas eigentliches Thema ist die Sprache, die er wählt – oder die ihn wählt – für diese Geschichte aus der fantastischen Welt eines einsam in seinem Zimmer zurückgelassenen Dichters epischer Kurznachrichten. Kaum ein anderer Autor seiner Generation schafft es, Poesie und Komik so miteinander zu verquicken, dass sie auch noch identisch sind.« Katja Lange-Müller Dass es Amanda an die japanische Frauenuniversität nach Nara zieht, um eine außergewöhnliche Schneckenart zu untersuchen, ist ihrem Freund Hannes suspekt. Die Elysia Marginata kann sich von ihrem Körper trennen, und auch Hannes fühlt sich, alleingelassen mit Amandas Mäusen Isidor und Isadora, wie ein abgeworfenes Schneckenglied. Flieht Amanda vielleicht gar vor ihrer gemeinsamen Zukunft? Lieber nicht zu viel darüber nachdenken. Stattdessen: Überlange Textnachrichten an Amanda, die Mäuse ignorieren, das Haus nicht verlassen. Die verfahrene Situation ändert sich erst, als Hajo in Hannes' Leben tritt, dessen Zuneigung aber eigentlich dem Mäusepaar gilt ... Mit einem glänzenden Sinn für Humor entlockt Jan Snela der Sprache – mal in fluffiger Haibun-Prosa, mal in betörenden Haiku-Miniaturen – die ihr innewohnende Fantasie und erkundet, welche bemerkenswerten Antworten auf die großen Fragen unserer Gegenwart sich hinter dem Geheimnis von Augenblick und Vergänglichkeit verbergen. »Hier will einer partout nicht akzeptieren, dass der Alltag grau ist.« Jan Wiele, FAZ zu »Milchgesicht« »Eine kleine Revolte gegen die Festgefahrenheit des Lebens« Leo Schwarz, Die Zeit zu »Milchgesicht«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jan Snela
Ja, Schnecke, ja
Roman
Klett-Cotta
Die Arbeit an diesem Roman wurde gefördert durch das Grenzgänger-Programm der Robert Bosch-Stiftung, das Baldreit-Stipendium der Stadt Baden-Baden, sowie Stipendien auf Schloss Wiepersdorf und im Künstlerhaus Edenkoben.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: © Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Illustration von © Julia Beery Art and Illustration
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96240-6
E-Book ISBN 978-3-608-12401-9
Meinem Vater
Wenn er in einen Beutel gesteckt wird, sieht er aus wie ein Hase oder eine Kartoffel.
Ursula K. Le Guin
Mäuse und Mond
Inventur
Nanu. Wer fühlt denn da so herum im Zimmer-Innern? Befühlt die Dinge mit Samthandschuhen, die silbern im Dunkel gleißen.
Ein Spediteur?
Aha. Der Mond.
Und was erfühlt er?
Die Maserung eines Tischs. Die Ringe von Tellern, Vasen und Gläsern. Einige Rotweinflecken. Vereinzelte Krümel – von einer Tiefkühlpizza. Ein Glas, das den Staub der Tage sammelt. Zwei Fetzen Küchenrolle, ein wenig feucht und zerknüllt.
Er tastet sich vorwärts, ganz ohne Hast, der ungerufene Gast, dem nur wer schlafen könnte kein Alibi zu geben wüsste: schwimmend in einem der Seen. Über Wipfeln der Ruh die A8 lang joggend. Dann wieder, Arm in Arm mit Betrunkenen, aus Spelunken schunkelnd.
Von wem, bitte schön, wäre er nicht gesichtet worden im Licht seiner Taschenlampe? An welchem Ort?
Trotzdem hat er im Augenblick nirgendwo anders irgendwas anderes zu schaffen als gerade dies genau hier.
Honk oder Hinterwäldler, wer denkt, seine Finger zittern. Der macht diesen Job doch jetzt schon seit Jahren …
Wenn es trotzdem so aussieht, als ob er zittern würde, dann weil die Dinge bibbern, während er sie, ohne die Spur eines Nervenflatterns, ganz ruhig, gekonnt, berührt. Ist ihnen kalt? Fürchten sie sich vor Verschickung ins All? Oder ist es, dass sie das Schluchzen einer uralten Trauer schüttelt, wie sie in solchen Nächten erwacht? Kaum beachtet herumzustehen, tagein tagaus niemandem als dem Unhold Verschleiß ins Aug’ zu sehen, das nimmt ja wohl schon ziemlich mit …
Dem alten Alias, Fingeur seiner selbst auf Erden, sind solche Spekulationen egal. Nicht mal der winzigsten Regung seiner perfekt runden Schulter würdig. Der schleicht nur weiter. Fast inkognito schleicht er. Wie nur zum Schein.
Streichelt das Skelett des seiner Matratze beraubten Bettes. Tastet die Wand lang. Folgt einem sich wie ein Blitz verästelnden Riss in der Tapete, bis er beim Käfig ankommt, in dem zwei Angehörige der Gattung mus musculus, gemäß der Betagtheit ihres Jahrtausende alten Geschlechts schamhaargrau schimmern und nah beieinander kauern.
Sehr nah beieinander kauern, ineinander verkrallt.
Die beiden vibrieren.
Sollte es sich bei ihrem Sichschütteln in Schaudern der Lust um das Epizentrum des die Dinge erschütternden Bebens handeln? Um das bewegtebewegerleinfeine Bizepsmucken allen Geschehens?
Silbernes Achselzucken. (Nun also doch.) Das Dingfestmachen im Dunkel liegender Sachverhalte ist nicht enthalten im Mond-Portfolio.
Der Schleicher wendet sich ab.
Macht ein paar weitere lautlose Schritte.
Bleibt wieder stehen.
Befühlt die seit längerem nicht geschnittenen Zehennägel, die aus den Shorts mit dem Katzentatzenmuster quellenden molligen Beine, den sich hebenden, senkenden Bauch, die haarumsprießten gezitzten Brüste, die schweißnasse Stirn eines mit weit geöffneten Augen auf seiner Matratze liegenden, etwa vierzigjährigen Mannes.
Der heißt schlicht Hannes.
Und Hannes seufzt.
Als Erstes, Mond,
stiehl diesen Mäusekäfig.
Dann hab ich Ruhe!
Mäuse
Auch die Mondmaus schiebt ihre Silberschnauze ins Menschenzimmer und schnuppert darin herum.
Alles ist käsig fahl.
Das klappernd Flügelschlagende, vor dem der Essensbringling manchmal sein Fell auswechselt. Das klobig Glatte, auf dem er die Riesenpfote ablegt, wenn er das Gitter aufhakt, um in der jetzt so leuchtenden Streu das Runde abzusetzen, mit dem er ihn bringt, den die Vernunft jeder Maus wegschmausenden, leckeren Speck.
Isadora schließt ihre Augen, und ihre Krällchen klammern sich an den Rand ihrer Welt.
Von hinten her spürt sie Isidors dunkelgraues, samtraues Wollen. Seinen bibbernden Drang, über sich selbst hinauszukommen, tief in ihr drin. Sie spürt die Reibung seines elektrischen Fells an ihrem, das sich mit diesem herrlichen Prickeln auflädt. Isidors schnurhaarfeines, schnutenspitzzierliches Gellen fädelt sich immer fadenzarter durchs Öhr ihres Öhrchens. Aus einer immer ferner her, immer inniger empfundenen Nähe kommend, bis tief in ihr Herz.
Oder kommt es doch aus ihr selbst?
Nicht auszumachen.
Aber schön ist das. Oh, so schön!
Isidor weiß nicht, dass alle Mauser der Erde sich in seiner Gestalt zusammendrängen. Er klammert sich an Isadora, wie um sich davor zu bewahren, sich in ihr aufzulösen. Findet Halt nur an ihr.
Isadora verspürt Universalgelüste. Sie ist Mäusin nicht länger mehr denn das Meer. Sie verliert sich im Dunkeln von etwas Vertrautem, Unbekanntem.
Sie seufzt. Sie schreit.
Jählings beschließt etwas in ihr, sich umzudrehen, um doch noch einmal nach ihrem Isidor zu spähen. Oh, dieser herzige Kerl! Nun ist sie sich sicher, dass sie ihn liebt. Wenn sie ihn jetzt so sieht, wie sich seine Züge so süß verziehen, geradezu als sei es im Schmerz, und wie er sich im Entzücken so hinfällig müht, dann kann sie sich noch manchen mit ihm verbrachten Mausemonat denken. Durchaus.
Aber während sie solcherlei sowas wie überlegt, wird sie auch schon wieder ins hellste Dunkel fortgezogen. Und für einen Augenblick, der länger dauert als der Herzschlag der Zeit, gibt es da jetzt weithin wirklich nichts mehr als ganz und gar und zutiefst dieses alldurchdringende, zarte Zittern und Beben und süße Ziehen.
Im Menschenzimmer. –
Was dich und mich klein macht,
maust heute der Mond
Geräusch
Woher kommt jetzt nur wieder dieses Geräusch?
Dieses gellende Fiepen, das, seit einigen Wochen nun schon, alles durchdringt.
Mal ist es hörbar. Mal wieder eher verschwunden. Aber nie ganz und gar …
Selbst wenn es still wird, hallt es, erstaunlich lautstark, dafür, dass es völlig verklungen zu sein behauptet, noch lange nach. Als feines Sirren, das in den Dingen schlummert. Und sowas wie … schnarcht?
Hinzu kommt das Zittern, das zyklisch die Gegenstände schüttelt. In manchen Momenten – und im Augenblick ist so einer – sogar vehement!
Der Tisch. Die Vase. Der Stuhl. Die Lampe. Das Bettgestell. Die Kommode. Der Käfig. Das Glas. Der Bücherstapel, der neben Hannes als Mahnmal für die Gefahr, dass alles in sich zusammenstürzen könnte, aufragt. Der Stuhl und der Stuhl und der Stuhl.
Sie alle tanzen, ohne sich dabei von dem Fleck zu regen, an dem sie offiziell stehen. Sie tänzeln an Ort und Stelle. Es ist ein in seiner Rasanz beinah schon unwahrnehmbarer Highspeedboogiewoogie. Stuhlbeine, Bettfüße, Käfighüfte swingen like twist and shout.
Hannes’ Rücken drückt sich ein wenig fester in die vor Wochen vom Lattenrost gezerrte, wandaufwärts geknickte Matratze, auf der er sitzt und sinniert.
Als knatterten Ratten …
So groß – die Mäuseschatten
an der rissigen Wand
kigo
Hannes sieht, wie im Käfig die Streu aufwirbelt. Er sieht die Mäuse, wie sie sich ineinander verkrallen, wie ihre riesigen Schatten grell an der Wand anprallen, an der fahlen Wand mit dem Riss, der sich immer weiter verzweigt. Gleich einem sich über Wochen entladenden Blitz, der jetzt erheblich zittert, in all seinen Bifurkationen.
Entrieselt dem Riss nicht auch schon der Putz?
Wie lange es noch diesem Wahnsinn standhält, das an und für sich ja wohl standhafte Haus?
Hannes sieht schon sein in eine Sessellehne verkeiltes Bein aus dem Schutt der Wohnungen über ihm in den Himmel ragen. Der ist unberührt blau. Ein Liedchen summend, durchfliegt ihn eine gutaussehende Frau auf einem Hexenbesen in Begleitung eines streitenden Krähenpärchens.
Seltsames Bild …
Hannes, der mal wieder kein Auge zukriegt im Mondlichtschimmer, senkt seinen Blick zurück in das Buch. Seine Hände klammern sich daran fest, als gelte es vor allem, irgendwo Halt zu finden.
»Ja, Schnecke, ja! Kobayashi Issa: Vom Bauernbengel zum Haiku-Dichter«
So heißt der Schinken. Von Udo Makura. Hannes hat ihn vom Bücherstapel, der ihn um einen Kopf überragt.
Issa ist der Underdog unter den »großen Vier« der japanischen Haikudichtung.
Liest Hannes, und Hannes liest:
Das Haiku ist die kürzeste Form, die die Weltliteratur je hervorgebracht hat. In siebzehn Silben lässt es den Augenblick erzittern. Ein Blütenblatt, das vom Ast eines Kirschbaums trudelt. Eine von einer Kiefer auffliegende Krähe. Ein Mädchenlächeln. Die Vergänglichkeit ist sein Hauch.
Hannes liest, dass ein Haiku der Tradition zufolge meistens ein Wort enthalte, das als Erkennungsmerkmal für den Frühling, den Sommer, den Herbst oder Winter stehe: das sogenannte kigo.
Pah! Als hätte Hannes das nicht längst schon gewusst!
Wird man den ewigen
Sommer noch ›Sommer‹ nennen?
Herbst, bitte komm …
Issa
(…)
Von Kennern ein wenig weniger hochgeschätzt als: Bashō, Buson und Shiki – die drei Edelmänner des knappen Stils –, gilt Issa dennoch als wichtiger Erneuerer des Haikus um eine rustikal-humoristische Dimension.
(…)
Als vierzehnjährigen pubertierenden Delinquenten schickten ihn seine Stiefmutter und sein Vater nach Edo – die Hauptstadt des von den Tokugawa vereinigten Reichs, in welcher in den Zeiten des Shogunats die entmachteten Samurai nutzlos geworden auf der Suche nach Beef durch die Straßen ritten, statt dass sie noch im Dienst ihrer Fürsten um verfeindete Einzelreiche stritten.
(…)
In Edo hat Issa sich zuerst jahrelang als Obdachloser durchgeschlagen, um später, zunächst als Diener im Haus eines Haikumeisters der Katsushika-Schule, dann in eigener meisterlicher Manier, in der lyrischen Szene Fuß zu fassen.
(…)
Eigentlich hieß Issa ›Kobayashi Yatarō‹, signierte seine Haikus aber ab einem gewissen Zeitpunkt mit ›Issa‹, was soviel wie ›nur ein Schluck Tee‹ bedeutet. Man könnte meinen, entsprechend dem Ideal des ›Haijin‹, das neben Belesenheit und notorischem Sinisieren die Mittellosigkeit als Muss für den Dichter vorsah.
(…)
Im Gegensatz zu Leuten wie Bashō, die sich wohl leisten konnten, die Armut als hippen Anmutsspender anzusehen, hat Issa sie wirklich erlebt. Trotzdem gab Issa sich seinen Namen vor allem als einen Bescheidenheitsreminder in Zeiten seines wachsenden Ruhms.
(…)
Mit dem Mond
als Taschenlampe liest man
doch sehr von fern …
Flieg, Eule, flieg!
Mit beiden Händen hält Hannes sich fest an dem ihm in den Schoß zurückgesunkenen Buch. Er würde zu gern weiter darin herumstudieren.
Aber mit diesem Gepfeif im Ohr und der Erregung der Möbel in den Knochen ist es partout nicht drin.
Augenblicklich kann Hannes nicht einmal mehr dafür garantieren, dass die Buchstaben sich noch zu den wirklichen Wörtern und die Wörter sich zu den wirklichen Sätzen zusammenfinden, die da einmal tatsächlich gestanden haben mögen.
Sie irren umher.
Ameisen, die den geschriebenen Sinn wie Essensreste durch die Wüste eines mondgewobenen Tischtuchs zerren. Wirr durcheinander, als versuchten sie dafür einen Ort zu finden, der nicht existiert. Sie bekrabbeln die Wände und Hannesschen Hände und alle Gegenstände, als gelte es, sie ins Schweigen unaussprechlicher Namen einzuhüllen.
Namen, die neu sind.
Namen, die es noch nicht einmal gibt.
Äh, aber Issa gibt es, richtig?
Hannes versucht zu rekapitulieren, wovon der zuletzt gelesene Absatz gehandelt haben könnte.
Ach ja, genau ….
Wenn er nicht nur halluziniert, dann unterhielt dieser Issa ein inniges Verhältnis zu kleinen Tieren und nahm damit nicht nur Menschen mit Hang zum Franziskushaften hübsch für sich ein – nein, nein. Er zog auch das Interesse der Tiere auf sich. Indem er, der Außenseiter, sie als seinesgleichen ansah, weckte er ihr Begehren, wie es sonst nur ein Jean Genet mit seinen outlaws und Unterweltlern schaffte. Souveränitätsgewinn by means of Verfemtheitsaffirmierung und einer Feier des Grinds.
Wenn Hannes nicht halluziniert, ging es nebenbei auch um Issas immenses Mitgefühl.
Um seine humorvolle Art.
Um seinen Animismus zum Spaß.
Animismus zum Spaß?
Hannes will gerade im Buch nachschauen, ob es sich lohnt, der Erinnerung zu trauen, da entwindet sich das bisher nur bibbernde Buch seinem Griff.
Es beginnt ein Gerangel. Hannes spürt, wie es desto mehr zerrt, je mehr er versucht, es festzuhalten.
Schließlich entkommt’s.
Durchs Mondlicht trudelnd, mit seinen hunderten Flügeln flatternd, raschelnd und Salti schlagend, fliegt es auf und davon.
Heh! Kamikaze-Käuzchen!
Minervas Mondscheineule!
Wo flatterst du hin?
Coitus interruptus
Im Käfig geht es dem Höhepunkt entgegen.
Oho, und wie!
Beachtlich, wie vergessen jeder Gefahr, gemessen an ihrer Stellung im Ranggefüge der Nahrungskette, Isidor und Isadora ihrer zweisamen Wollust frönen.
Sie bemerken nicht, in seinem raschen Herangerausche, den Feind.
Ob sie sich in ihrem Käfig so sicher wähnen, dass die Instinkte hinken? Oder sind sie schlicht allzu eingenommen von ihrem Tun?
»Isidor!«, piepst Isadora Isidor über die Schulter hinweg in sein Ohr. »Isadora!«, fiept Isidor Isadora von hinten her in ihre ihm zugestreckten rosigen Lauscher. Und keiner der beiden versteht des anderen Wort.
Erst als der Flügelschatten sie in sein Dunkel einhüllt, was in freier Wildbahn hieße: zu spät, lassen sie voneinander ab und flüchten sich in ihre hölzerne Höhle in der hinteren Käfigecke.
Isidor zieht gerade noch seinen Schwanz hinter sich her ins Bunkerinnere. Da erschreckt die beiden der lauteste Wumms, den sie in ihrem Winzlings-Leben bisher vernommen haben.
Und für eine Weile, die in der mausischen Zeit einige Stunden dauert, sind sie mucksmäuschenstill.
Trauern um was wir
hatten im Flügelschatten –
die Erotik der Maus
Stille
Nanu.
Ist es jetzt wirklich so still im Zimmer?
Wie kann das sein?
Vom Fiepen fehlt jeder Laut. Das Glas auf dem Tisch schweigt sein Klirren. Der Käfig regt sich zu keinem Rattern erschütterter Gitterstäbe. Die Stühle knurren nicht das leiseste Knarren. Keine Kommode poltert. Das Bettskelett ächzt keinen Ton.
Wenn der Ventilator nicht seinen Sermon von sich gäbe, wäre im Zimmer nicht einmal sein Gesumm zu hören.
Es wäre absolut still.
Aber der Ventilator brummelt einen seiner endlosen Fachvorträge über planetarische Zirkulation, die Windstrukturen des Mars, zyklostrophische, geostrophische, synoptische Winde und all die anderen Dinge, um die die Nacht lang seine Gedanken kreisen.
Niemand fällt ihm ins Wort.
Die dreizehn Bücher, die, übers Parkett verstreut, in der Zimmermitte liegen, rascheln jetzt mit den Seiten. Jedoch nur, um ihm beizupflichten.
Sie applaudieren.
Und Hannes? Sieht allem stumm zu und staunt.
Flusen huschen über den Boden, als ob sie der bisher seltsamerweise ausgebliebene Mäusenachwuchs wären. Von überallher müssten einen dann allerdings winzige Piepser triezen. Und Hannes hat noch nichts dergleichen bemerkt.
Hört nur ins beharrliche Surren und Schnurren die Bücher wispern.
Ihm ist jetzt, als ob er dem Ventilator noch lange lauschen könnte.
Aber da schläft er schon ein.
Der Ventilator brummelt
sein einziges
Wort
M-hm
Stille.
Nur leis’ ein Surren, das einem Murren ähnelt.
Der Ventilator macht Wind, in dem die Biografie eines Haikudichters mit ihren Seiten flattert. Der Mond, Monokel im Aug’ seiner selbst, braucht keinen seiner silbernen Finger zu rühren, um ein wenig darin herumzuschmökern.
Er schmökert darin herum.
Ganz langsam.
Er hat ja Zeit.
(…)
Einmal hat Issa an einer Party teilgenommen, in Kyōto, mit Adeligen auf einer Burg.
(…)
Er, das Landei, der Außenseiter!
(…)
Er ließ sich den silbrig funkelnden Sake in wasserfalllanger Bahn aus seiner Trinkschale in die Kehle rinnen.
(…)
Und wem hat er das zu verdanken?
(…)
Dem von den Japanern ungeachtet aller sozialen Unterschiede verehrten Mond.
(…)
Aha.
Und weiter rascheln die Seiten und liest der Mond.
Hm, denkt der Mond.
M-hm.
Und liest und lässt blättern und liest etwas weiter.
Bis sein Augenlicht sich in der Morgenröte aushaucht und er verblasst.
Mond-sein-Monokel …
Der Ventilator blättert
im schlaflosen Buch
Unsere Träume sind Erinnerungen an die Zukunft
Durchs Fenster fällt schräg das Licht ins Zimmer. Wirft stäubchendurchtänzelte Spots auf verwunschene Muskelmänner, Monster-Trucks, Astronauten, die Burg, durch deren Zinnen ein Motorradfahrer, ein Koch und ein Ritter lugen, auf die mit einer Kalaschnikow bewaffnete Fee, auf den Inhalt des Zauberkastens, das Taschenmesser aus Holz, den Kuschel-Truthahn, das elektrische Krokodil, dessen Fernbedienung, die am Mundstück zernagte Plastikflöte, das wimpernklimpernde Baby im seidenen Kleid, weit und breit nur kein Mäusekäfig – mag der Wunsch danach auch noch so krakeelend in den Ohren der Wände weiterhallen.
Wir sind im Kinderzimmer von Nathan und Wim.
Hannes steht im Rahmen der Tür.
In der Küche – seinem duftenden, dünstenden Reich – brutzeln fleischlose Chicken Nuggets, räkeln geriffelte Pommes sich auf dem im Wind der Umlufthitze flatternden Backpapier im Ofen, steht die Ketchup-Flasche schon kopfüber bereit auf dem Tisch.
»Auf Jungs, hopphopp, es gibt Abendessen«, sagt Hannes mit der bewährten Strenge in der schon beim ersten Aufruf keinerlei Widerrede duldenden Stimme – und: »Jetzt aber Händewaschen. Los los! Zackzack.«
Obwohl sich Tyrannosaurus rex noch im Gefecht mit einem von Schlumpf und Schlumpfine gelenkten Düsenjet befindet, lassen die beiden zartblondhäutig seidenhaarsanften Kerle in ihrem Sterne gebärenden Chaos sich heute nicht zweimal bitten. Plastik plumpst auf den Teppich, und sockige Schritte pumpern, vorbei an Hannes – »Hehheh!« – ins Bad.
Am Tisch in der Küche sitzen: Hannes, Nathan und Wim.
Amanda kommt sicher bald auch, muss ja nur noch schnell die Statistik zur letzten Studie über die Entwicklung der Nachwuchsdauer abgeworfener Echsenschwänze prüfen. Während kleinweiße Zähnchen schon an den Knuspersachen aus biologischem Anbau nagen, zu nah an den Zinken gegriffene Gabeln sich durch die Panadepanzer ins Seitan-Geflügel bohren und in von Lippen gekippelten Gläsern gluckernd die Schlucke mucken, flucht sie im Arbeitszimmer leis’ vor sich hin.
Draußen zwitschert ein Vogel (der klingt wie in Eden heimisch), und einen Augenblick lang noch erscheint Hannes das alles, als wäre es wahr.
Hüter des Schlafs.
Durchs Kinderzimmer donnert
ein Jet, grau behaart
Heißen
»Da liegen sie in ihren Betten und träumen an ihren Träumen in falscher Sprach’. Fingieren Ruhe in diesen Ewigkeitsmassiven gepressten Staubs, die die, die drin schlafen, ›Häuser‹ nennen. Häuser? Ha ha, wie alles hier heißt.«
Der, der das murmelt, berührt die Klingelknöpfe, die sich ins Mondlicht wölben. Mit dieser hier, äh, ja genau, dieser Hand, die neulich ausgewechselt wurde.
Die andere: eingeöst in die Schlaufen am Schlund eines Tüte-Heißens aus beflecktem Papier, das »Dem Vitrin’-Entlockten, Gelöcherten, Duftgebrockten eine Empfängnis bieten!« raschelt, als Befehl an sich selbst.
»Recht so! Und du mal das Maul gehalten, nach deiner Rede vom ›Käse‹ beim Käsekaufen, du Meineid heischender Mund!«
Brüllt’s, flüsternd, aus besagtem, murmelnden Mund.
Überraschendes Klargeh’n der Klingelknöpfe im Mondlichtwispern.
Der Fingerzeiger an der gewechselten Hand fühlt ihre Fühlung, bei seiner Fahrt dran entlang.
Namjanczyk
Otremba
Mayer
Yildirim/Doder
Dorst
Schmidt
Smith
Müller
Hong
…
Namen, die sich ins Aug’ gravieren … Ins hiesige, das sieht, was es sieht. Nicht ins anders-ortige, das blindlings mit Bildern flimmert. Im Augenblick: Strohsandalen, die über von Schnecken beglitschte Felsen hüpfen …
Wie schrill die STIMME still ist, die – bedrückte wer die Klaviatur dieser Messinghubbel – euch ins kreißende Heißen schreckte, aus lauem Schlaf.
Nur dasteh’nd lauscht der, der nicht heißen möchte, den Blessuren im Leib des Namenlosen. Brachialer Nennung, nomineller Gravur.
Metallbefühlung.
Beim vorletzten Hubbel angekommen verharrend.
Gingelhuber.
Vorname: Hannes.
Einen Teufel wird er tun, ihn ins Geheiß zu kreischen.
Sich losreißen! Gehen!
Gingelhuber
Mit dem Fingerzeiger kost er
der Namen Schlaf
Maus, nicht als Maus
So durch die Nacht zu hasten, fort von der Maus …
Fortgeschnellt vom Ort, wo sie weilt. In der Behausung, die dich ins Heißen gängelt! In rotblondes Hajo-Heißen bei geicetem Kaffee.
Hajo also!
Ha ha!
So stampft er die Straße runter, verlacht von der Nomenklatur seiner selbst.
Um ihn her – Häuser. Und um die Häuser: Hecken, die ›Hecken‹ heißen.
Er denkt an die Maus. Ohne an sie als die ›Maus‹ zu denken, auch wenn es Kräfte kostet. Ach mit ihr – Hajo, der heißt wie er heißt, stellt sie sich genauestens vor – einfach nur dazusitzen …
Das von den Mündern Modellierte in die gepiepste Stille schnuten …
Zusammen mit …
Bald, Hajo, bald!
Ha ha ha! Hajo!
Hajo! Hö hö hö! Hajo!
Netter Versuch …
Durch den Monsun
Wach
Soll der Rest des Planeten doch weiter im Dunkeln dümpeln, in Nara bewegt sich schon flink jedes Glied. Amaterasu-ō-mi-kami, die am Himmel erscheinende Göttin, hat sich aus ihrer schmollenden Felsenhöhle ins Licht ihrer selbst geschwungen. Jetzt spielt sie mit ihrem Spiegel, in dem jedes Tier, jeder Mensch, jedes Ding, jede Pflanze aufblitzt – für den Augenblick ihres Weilens in dieser flüchtigen Welt. Vorüberfliegend, wie sich ein Kranich en passant in einem Tautropfen auf einem schwankenden Grashalm spiegelt – so gebärdet sich, was sich zeigt.
Eine Studentin joggt durch den Park.
Mit Bewegungen, die doch sehr dem Kraulen ähneln, schwimmt sie mehr, als dass sie laufen würde, durchs Schwitzen der Luft.
Ein älterer Herr summt ein Kinderlied und dünstet den in Streifen geschnittenen Lachs in einem nachtblauen Topf, wo er zusammen mit der Brühe von getrocknetem Fisch, der Misopaste, gehackten Frühlingszwiebeln und Tofu-Würfeln, den Wakame- und Kombu-Algen, ein paar Enoki-Pilzen und einigen Fitzeln vom in Essig eingelegt-herben Takuan-Rettich ein geduldiges Weilchen zu köcheln haben dürfte.
Aber was ist die Garzeit noch der geduldigsten Suppe gegen den Lauf der Zeit.
In einem mit Qi-Technologie ausgestatteten Körbchen öffnet ein Roboter-Hund sein Maul, ein Gähnen simulierend, sich unter Schauern schüttelnd, mit denen die Updates durch sein elektrisches Innenleben zucken.
Eine Fliege reibt sich mit ihren Frottee-Beinchen die Frottee-Beinchen trocken.
Auch Amanda ist wach.
Seit einer geplätscherten Stunde, auf die ihr von hier bekannte, grünteeherbsanfte Art. Wach in der Weise, in der sich nach und nach eine Blüte öffnet, unbändig-smooth.
Wach wie noch schlafend. Wach wie ein Fisch unter Wasser. Wach wie eine flimmerfeine Figur in jemandes Traums nicht müd wird, sich wach zu zeigen. Wach nicht zuletzt, wie ein Taifun jäh aufschreckt aus der Resignation einer Regenwoche.
Wach, wach, wach, wach, wach, wach, wach!
Das Morgenupdate.
Aus meiner Grünteeschale
steigt neues Ki
Termin
Nara.
Was Amanda hier tut?
Sie forscht! Staatlich gefördert. Auf ihrem Gebiet. An erstaunlichen Ausgeburten der Autotomie – der Fähigkeit eines Lebewesens, sich von einem Teil seiner selbst zu trennen. Zur Optimierung der Flucht.
Am Nachmittag wird sich Amanda im Meeresbiologischen Institut mit Sakaya treffen. Drei Tage, von morgen an, soll sie eigenständig die dort residierenden Meeresschnecken checken.
Das heißt, ihren Beitrag leisten zur Erforschung einer der bedeutsamsten Entdeckungen des Jahrzehnts.
Einmal am Tag wird sie das Wachstum der sich regenerierenden Leiber, die Temperatur des Wassers messen. Dann den lumineszierenden Grünlinginnen etwas zum Snacken in die wabernden Schlundsackmäulchen stecken.
Dafür wird sie heute gebrieft.
Manchmal fühlt es sich immer noch an wie ein Traum.
Dass sie tatsächlich hier ist.
Allein.
In ihrem Zimmer (Kategorie Single Researcher, Monatsmiete: 7500 Yen) im International House der Frauen-Uni in Nara, Nara, das es tatsächlich gibt, kniet Amanda im Fersensitz auf einer Tatamimatte und nippt an einer brutalistisch getöpferten Schale voll grünen Tees, die aussieht, als ginge einer daran der Mund in Fetzen.
An der Kante eines niedrigen Tisches lehnend, gestützt auf die Oberschenkel, leuchtet ein Tablet, auf das sie tippt.
Bevor sie gleich rausgeht, sich treiben lässt, entlang der die Stadt durchädernden, aus Wolken wie Windeln von Sumoringern gestürzten Bäche – plätschernder Saum der Montur des Monsuns –, hat sie hier drinnen noch was zu tun.
Schlundsackschnecken –
Mit feuchten Fingerspitzen reicht dir
die Stadt ihre Brut
Einkauf
Amanda dragt & dropt eine türkisblaue Packung Hafermilch von ganz rechts oben im Regal mit den veganen Milchprodukten im virtual space des Online-Händlers bioniamnio in ihren Einkaufswagen. Und nochmal, und nochmal.
Dann swipt sie sich zum nächsten Regal.
In den Einkaufswagen fällt mit dem fidelen Sound eines vom Pfeifen des Flugwinds begleiteten Schepperns eine Kilotüte Espresso. Dann, merklich leiser eine Packung Kitty Kekse, bei deren Anblick Amanda ein so noch nie empfundenes Wirbeln und Wühlen und forsches Flimmern in ihren Eingeweiden wahrnimmt. Ein wenig so, als ob ihr Körper sich von innen nach außen stülpte. Ein flaues Erinnern an etwas, das sie wie eine Angst vor der Zukunft anhaucht.
Amanda klickt sich zu den Lebensmitteln aus aller Welt, swipt sich vorbei an Guatemala, Honduras, Polen … zu den japanischen Lebensmitteln.
Ein Glas Edamame-Schoten, ein Gläschen Nattō, ein Schächtelchen Shiso-Kresse, ein Tübchen Wasabi-Paste, ein Döschen Panko-Pulver … landen boing boing boing boing im Einkaufswagen. Dem amerikanischen Regal entnimmt sie eine Packung American Toast.
Genug.
Sie swipt sich zur Kasse.
Die App, Amanda kennt es schon, schaltet von nutzerinnenfreundlich-gameifiziert zu seriös-kompliziert. Sie befüllt die Textfelder für den Namen des Adressaten Herr/Frau Hannes Gingelhuber, für die Adresse Jakob-von-Uexküll-Straße 81, die Kreditkartennummer xxxxxxxxxxxx9999, drückt dann den Button Einkauf an diese Adresse senden und schließlich Kostenpflichtig bestellen.
Sie nennt’s ›den Dämon ihres Hierseins füttern‹. Die Alimentation der Distanz.
Schlechtes Gewissen?
Japanische Lebensmittel für
einen hungrigen Geist
Meister Fisch
Amanda erhebt sich von der Tatami-Matte. Von ihren vom Darauf-Sitzen flauen Fersen und Zehen. Sie wartet, bis anstelle der entschlafenen Extremitäten eines okzidentalen Gespensts wieder der Transportationsfunktion gewachsene Füße spürbar werden und begibt sich, vorsichtig tappend, als könnte unter jedem Schritt der elastische Boden sich jäh in sich selbst verlieren, in ihr winziges Bad.
Kuraokami, der Herr der Niederschläge, ächzt einmal auf zum Protest, als Amanda den Drehknauf der Dusche nach links dreht. Als wolle er anmerken, dass er draußen zurzeit genug zu regnen habe. Dann schluchzt er los.
Seine gebirgsgewitterschaudernden Tränen laufen Amanda über die Schultern, die Brüste, die Arme und Beine runter.
Ah. Das tut gut.
Sie könnte den ganzen Tag lang hier stehen bleiben. Bezüglich ihres Zerfieseltwerdens durch die Finger der Feuchte draußen ist schließlich kein Unterschied bemerkbar.
In Sachen Kühle allerdings schon.
Amanda schließt die Augen und sieht, nanu, den Kaiserschnapper aus dem Kaiyūkan in Ōsaka wieder.
Was war das doch nur für ein Ah- und Oh-Geraune, vor den Aquariumfenstern … Erstaunter Tauchgang der Unbekiemten in diesem zehnstöckigen Imitat eines Meers …
Mit der Eindringlichkeit eines Zen-Mönchs sah der Kaiserschnapper sie an.
Öffnete und schloss seine Lippen. Erzählte ihr, wie es sich so verhält mit der diese Insel umtosenden Ozeanweite.
Nämlich unendlich still.
»Meister Fisch, Meister Fisch. So kommst du also zu mir zurück.«
Denkt Amanda, die Augen öffnend, am Drehknauf drehend.
Der Kaiserschnapper verschwindet wieder. An seiner statt schwimmen das Duschgel, der Cleansing-Schaum, das an einer feinen Schnur an einem Haken hängende Konjac-Schwämmchen zur Jeweiligkeit ihrer Gestalt zusammen.
Der Duschstrahl versiegt.
Fließende Keller
schäumende Dachgeschosse
Architektur des Meers
Pling Pling
Amanda trocknet sich gar nicht erst ab, bevor sie in einen Slip schlüpft, sich in den malvenfarbenen BH aus Naturholzfasern, ihre luftigste Hose, ihre atmendste Bluse heddert.
Sie holt ihr Smartphone aus seiner Plastiktüte und klickt auf den Flugzeugbutton.
Sofort macht es Pling.
Pling, Pling, Pling, Pling, Pling, Pling, Pling.
Und Pling.
Hannes lässt seine Weisheit tröpfeln.
Die Worte Issa, Haiku und Kashiwabara haben Amanda schon angesprungen, bevor ihr gelungen ist, den Blick von den grauen Blasen abzuwenden, die aus dem Maul des Messengers in ihr Hiersein ploppen.
Amanda zögert – und öffnet den Thread.
In einer Nachricht referiert Hannes über die Furcht- und Fruchtbarkeit des japanischen Klimas. Amanda erfährt, dass der Monsun – der etymologisch übrigens von einem arabischen Wort für »Wetter« stamme – dem Wort mausim – die darin lebenden Menschen zu Gelassenheitsadepten mache. Er stimme sie passiv und resignativ. Zugleich aber in eine Bejahung des Unverfügbaren, Ereignishaften. Von Gewächs und Geburt.
In der nächsten Nachricht lässt sich Hannes aus über die darauf zurückzuführende ausgeprägte Kinderliebe der Japaner, die nachgewiesenermaßen mindestens bis ins achtzehnte Jahrhundert zurückreicht. Er erörtert die Verhätschelung als Prinzip und Ursache der den japanischen Charakter konstituierenden adulten Infantilität.
Ob Amanda wisse, dass man in Japan nichtverheiratete, kinderlose, die fünfundzwanzig (!) überschreitende Frauen als von der Feier übriggebliebene christmas cakes bezeichne?
Hannes’ Ton an dieser Stelle liest sich demonstrativ empört. Aber ist da nicht auch eine Spur von Triumph?
Ein Referat über Haiku und kleine Tiere mündet in eine vorsichtige Analyse ihrer wirklichen Hierseinsgründe.
Ihr Forschungsaufenthalt könnte sich bei näherer Betrachtung als Flucht vor ihrer menschlichen Zukunft ins animalische Jetzt erweisen.
Wie bitte? Was?
Amanda scrollt sich kopfschüttelnd-flüchtig durch den gesamten, mit Ideogrammen und ihren Definitionen, Beschreibungen kultureller Phänomene, Interpretationen, Liebesschwüren gespickten, Hannesschen Lebenszeichen-Meter.
Sie überfliegt ihn, wie ein Kranich über ein weit unter ihm liegendes Land dahinfliegt.
Und klickt ihn weg.
Still ist’s in Nara.
Nur Herr Regen plappert.
Trägt die Dächer als Hut
fuyū suru
Eine SMS von Sakaya präzisiert die Verabredung im Labor auf vier Uhr. Amanda bestätigt, wurschtelt das Smartphone in seine Plastiktüte, zieht den Zip-Verschluss zu und legt es an seinen Platz.
Ihre Füße federn nackt über Reisstrohmatten zum kleinen Haufen der Dinge, die im Sessel schon beieinander liegen, bereit für den Tag in der Stadt.
Der Apfel, die Flasche, der Menstruations-Cup, der Schlüsselbund, das Japanischlehrbuch, der kleine Beutel fürs Geld und das um siebzehn Scherben geschlagene und zugebundene Tuch, mit dem beim Anheben leisen Klirren darin, verabschieden sich in den wohlweislich wasserdichten, in einem der Kaufhäuser Tokios erstandenen ryukkusakku.
Bei der Wohnungstür hakt sich Wagasa-san, Mister Schirm, bei Amanda unter, und schon hüpfen fußbeschlüpfte, flitzflinke Slipper aus Neopren mit – wie Geisha-Holzsandalen – mit hohen Plateaus versehenen Sohlen in den Flur hinaus und die Treppe runter und tragen sie tick-tock-tack plitsch-platsch-plitsch außer Haus.
Das mit der Fortbewegung ist hier so eine Sache. Es ist ein den Sohlen mit den stelzenartig hohen Plateaus geschuldetes Stolpern übers Geschwapp des ins Fließen versetzten Asphalts, das zusammen mit dem Gefuchtel der Arme zur Verhinderung eines Sturzes in die reißende Gosse mehr einem Schwimmen ähnelt als gewöhnlichem Gehen.
Die Leute hier nennen es ›fuyū suru‹, wofür das Deutsche nur die Verben ›schweben‹, ›schwimmen‹ und ›treiben‹ hergibt.
Und wirklich ist diese Fortbewegungsform dem Schweben und Schwimmen der Meeresschnecken durch ihre Aufzuchtbecken näher als dem aufrechten Gang.
Mit sieben Sachen
im ryukkusakku fuyūsurut
eine los
Japan sinks
Ein Mofa tuckert ein geknattertes Stück weit die Straße runter.
Bei der kleinen Konditorei, in der die Verkäuferin mit der piepsigen Stimme ihre Zimtschnecken, Tartes au citron, Rhabarberstrudelstücke ordnet, biegt es rechts ab.
Amanda fuyūsurut hinterher.
Eine Krähe schüttelt sich auf einem der Masten, die den Wirrwarr der Kabel ins Grau des Himmels stemmen. Sie startet und trudelt durch die Häuserflucht dorthin, wo das wie ein Riesentausendfüßer die Stadt durchkriechende Viadukt auf die Nähe des Bahnhofs hinweist.
Amanda folgt ihrem Flug, vorbei an den kauernden Häusern, aus denen immer mehr Menschen schießen, die gleichmütig kraulend und trippelnd durchs Plätschern schweben.
Schwupp schwipp schwapp schwupp.
Inzwischen dauert es selten länger als ein paar die Luft durchtänzelte Meter, bis Amanda sich ins hiesige Floaten eingegroovet hat.
Der Regen zerdröselt sie in ihre Einzelfasern und webt sie einen Schritt weiter wieder zusammen.
So vibet sie voran.
Plitsch platsch, platsch plitsch.
Durch die sich öffnende Schiebeglastür dort des Kombinis kommt jetzt mit emsigen Flossenschlägen ein Fisch geschwommen.
Er schwimmt auf Amanda zu. Nanu! Es ist ja der Kaiserschnapper! Sein Mund geht auf und zu, auf und zu.
Was sagt er? »Nippon chinbotsu«?
»Japan sinks. Japan sinks«?
Der Kaiserschnapper dreht bei.
Amanda sieht ihn in Richtung des klobigen Amtsgebäudes schwimmen, in dessen Rücken die Statue der allgütigen Kannon in ihrem erbärmlichen Gold gegen das größere Grau anschimmert.
Er hält sich geradeaus, um bei der Kreuzung mit einer schwanzflossenschlenkernden Wendung links abzutauchen, ihr aus der Sicht.
Amanda spürt wieder das Wogen und Wühlen in sich. Es strudelt durch ihre sich verflüssigenden Eingeweide. Ein Blubbern und Brodeln, in dem sich Wirbel bilden.
Als müsste sie einen Taifun gebären.
Bitte nicht jetzt.
Mit seinen Nieselfingern tätschelt der Regen Amandas Nacken. Die Innenseite ihres zu Boden gesunkenen Schirms. Den ins Wanken geratenden Ampelpfosten, an dem sie sich festhält, um nicht aus dem Gleichgewicht zu fallen.
Amanda atmet drei Mal vorsichtig tiefer ein, lässt die Luft langsam vom Zwerchfell her wieder nach draußen strömen.
Geht’s wieder?
Müsste gehen.
Was hat der Kaiserschnapper
beim Regal mit den Thunfischdosen
gesucht?
Hirsche
Unsicher, schlingernd fuyūsurut Amanda weiter drauflos. In Richtung des aus Einkaufsstraßen gewobenen Zentrums – oder was Europäer:innen so nennen.
Gute Idee? – Immer enger reiht sich Geschäft an Geschäft.
Junge Paare, versonnene Frauen, adult infantile Herren spähen nach den durch beschlagene Scheiben schimmernden Waren.
In einem Schaufenster stehen ergonomisch geformte Zahnbürsten in pastellenen Tönen je und je auf einem kleinen Podest. Ein Buddha aus weißer Fensterfarbe präsentiert seine Zahnbürste wie ein Gewehr.
In einem anderen Schaufenster parken Matchbox-Autos. Eine beachtliche Herde Filly Unicorns tummelt sich in einer Plastikkiste. Im Ladeninneren schweben Pokémons aus Plüsch, die an Nylonschnüren baumeln.
Und überall Menschen, die’s interessiert.
Amanda navigiert irgendwie da hindurch.
Taumelt vorbei an Schreibwaren-, Fächer- und Süßigkeitenläden, ramschigen Souvenirgeschäften, Kimono-Boutiquen und Buch-, Stoff- und Sakehandlungen.
Am Ende des trubeligen Spaliers findet sie sich plötzlich in einer beinah ländlich wirkenden Gasse wieder.
Ah, besser. Gut.
Die Häuser sind niedrig, aus Holz.
Sogar hier strahlen die bunten Getränkeautomaten, wie von ihrem Date versetzte, tattrige Sugar-Daddys mit von Geschenken überquellenden Jackentaschen, von denen nur niemand je etwas will.
Drei Hirsche kommen aus einem der Höfe, die sich hier manchmal zwischen den Häusern auftun.
Amanda findet, sie sehen aus wie eine nichts Gutes im Schilde führende, kleine Gang.
Sie stellen sich breitbeinig auf, wollen ihr offenbar den Weg versperren.
Statt weiter geradeaus zu rudern, biegt Amanda also rechts ab.
Durchs Schaufenster
sehen sich tief in die Augen
ein Mensch und ein Ding
Puppe
Amanda passiert ein Autohaus, ein Love-Hostel, eine Waschanlage. Ein Haus mit hässlicher Hochzeitsmode, einen umgestürzten Rollator im Straßengraben.
Vor einem Parkhaus steht ein Mann mit einem Plastiklichtschwert. Sein Job ist es, das Hereinfahren und Herausfahren der Autos gestisch zu untermalen, als Kalligraph.
Amanda fuyūsurut vorbei an komplizierten Fabriken, die viele Rohre und Streben filigran ineinanderflechten.
An einer Schule, die aussieht wie eine Schule.
Aber in sehr grau und sehr groß.
Das Wohngebiet, in das sie ihr Floaten transportierte, unterscheidet sich in keiner Hinsicht von anderen Wohngebieten dieser zwischen Hügeln kauernden Stadt.
Die meisten Häuser hier sind Latte-macchiato-farben und kein bisschen schön. Aber es bewohnen sie, davon ist auszugehen, einander mögende Menschen und darum halten sie es gut darin aus.
Denkt Amanda und bleibt vor einem von ihnen stehen.
Im Fenster sitzt eine Puppe und sieht sie an.
Vom Innern trennt sie ein hübscher, bedruckter Vorhang – Blätter an Ästen, die das impressionistische Flirren der türkis-weiß getüpfelten Luft durchranken.
Ganz allein sitzt die Puppe da.
Die Augen sind rund und groß, gemäß Kindchenschema. Aber sie wirken eher wie im Entsetzen aufgerissen, wie weirdes Starren.
Warum läuft der Kopf so spitz zu?
Mit beiden Händen hält die Puppe ein rotes Herz.
Im Fenster spiegelt sich gewellt von den Vorhangfalten die Landschaft. In der Ferne bewaldete Hügel. Näher ein Kabelpfosten. Ein paar niedrige Häuser.
Was noch?
Amanda!
Ja, auch Amanda spiegelt sich in dem Puppenfenster.
So dass es aussieht, als befinde die Puppe sich in ihr drin.
Gestrandet am Rande
Naras – Was diese Puppe
wohl von mir will?
Flucht
Oha.
Das ungute Brodeln legt sich wieder ins Zeug, Amanda inwendig aufzumischen.
Aus tiefsten Tiefen, ihrem innersten Innen, rumorts empor.
Als werde Amanda von innen gekocht.
Oder als seien Prozesse losgebrochen, wie sie sonst der Zersetzung dienen.
Ein Ungeheuer, bereit, mit Gewalt hervorzubrechen, randaliert im Gemach ihres Leibs.
Hügel und Häuser, der Kabelpfosten, Automobile, die Puppe! die Puppe! die Puppe! umkreisen Amanda in schlingernden Umlaufbahnen.
Drehen sich schneller.
Amanda im Aug des Taifuns!
Hastig ergreift sie die Flucht.
Rudert die Straße runter, Reißaus zu nehmen, vor dem inwendig-derben Geschehen und dem sie umtrudelnden Plastikbaby.
Landet in einer Pfütze. Auf ihren Knien.
Spürt, wie der Regen ihr wieder den Nacken tätschelt.
Merkt, wie ihr Hemd sich mit Wasser vollsaugt.
Stellt fest, dass sie kotzt.
Behutsames Land.
Sogar der Regen fragt dich,
wie es dir geht
Die Erschaffung Hajos
Gingelhuber! O Wehgeschrei der Tortur – genannt zu werden, so und nicht so, sondern so!
Der Hajo-Heißende, aufs Neue am Ort jener Türe angekommen, spürt die Kuppe der Klingel an der Kuppe des Fingerzeigers fühlen.
Vernimmt den Andrang des Ansangs aus hehrer Höh’.
Wie bei der Avance des Bärtigen, vor ein paar Jahren in Rom …
Man möchte schier wieder zusammenzucken im Nachhall des barschen Befehls.
»HAJO! SO TÖNT
WIE HINNIEDEN DU HEISST!
PRÄG ES DIR EIN!
WENN DU EIN SCHWEIN
SICHTEST,
NENN ES EIN SCHWEIN!
UND JEDE BLUME
SEI EINE BLUME
DURCH DIE KUND
DEINES MUNDS!
SEI FÜRDERHIN HEIMISCH
IM HAUS DER SPRACH!«
Schrie der Bärtige, der sich als Hajos Vater ausgab.
Nein!
Nein, nein, nein, nein!
Und noch einmal. –
Nein!
Ein Teufel wird hier gleich getan, durch das Geschrei-seiner-Klingelei irgendwem irgendwen einzuprägen.
Das wird nicht geschehen.
Obwohl die Knöpfchenwölbung sich jetzt wie ein Mauseschnäuzchen anfühlt, das durch ein Gitter hindurch nach der käsigen Fingerzeigerkuppe schnuppert.
Neugierig, zart.
Die ganze Mondnacht
um dieses Haus gewandert,
in dem sie wohnt
Beinah
Hajo!
Donnert’s.
Hinein in den Hohlraum des Hajo-Heißens, in dem Satelliten kreisen, die Venus um ihre Achse wirbelt, der Pluto und wie sie alle nicht heißen mögen.
Der alte Mond …
Der Fingerzeiger zuckt zurück von der Klingelkuppe.
Fast wär’s geschehen!
Beinah hätte der, der hier steht, die Gingelhuberklingel schellen lassen, als stünd es ihm zu.
Gerade noch einmal nicht!
Puh!
Pfuh!
Vermies dir doch nicht deinen Plan!
Nur noch ein paar wenige Stündchen, Jüngchen, dann wirst du im Auftrag die Tür durchschreiten, wirst Treppen steigen, hinauf ins gingelhubersche Habitat.
Noch ein einziges, letztes Mal …
Willst du jetzt alles vermasseln, Hajo?
So schallt die Schelte weithin durchs All.
Sphärenklänge in
voller Namenslänge – kosmische
Kakophonie!
Rennen
Am Hajo reißt’s.
Huiuiuiui, wird der den Bürgersteig hinaufgeworfen, vorbei an Heißeinheiten, die drob verblurren.
Ach, wenn er doch immer so rennen dürfte!





























