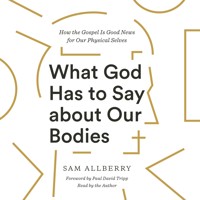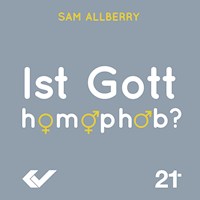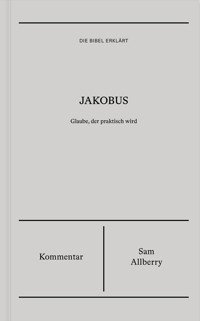
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Bibel erklärt
- Sprache: Deutsch
Der Jakobusbrief enthält viele praktische und lebensverändernde Ratschläge, die uns im Alltag helfen, Jesus nachzufolgen. Es geht um Fragen wie »Was ist der Unterschied zwischen echtem und falschem Glauben?« oder »Wie können wir Freude inmitten von Anfechtung erfahren?« In diesem Kommentar der Reihe Die Bibel erklärt hilft Sam Allberry Christen auf anschauliche Weise, die Botschaft des Jakobusbriefes zu verstehen und im Alltag praktisch anzuwenden. Neben dem Buch sind ein Arbeitsheft sowie eine Arbeitshilfe für Gruppenleiter erhältlich, die das gemeinsame Studium in Kleingruppen unterstützen. • Vom bekannten Pastor und Autor Sam Allberry • Tiefgründig und zugänglich geschrieben • Hilft, knifflige Passagen zu verstehen • Teil der Serie Die Bibel erklärt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
DIE BIBEL ERKLÄRT
JAKOBUS
Glaube, der praktisch wird
Kommentar
Sam Allberry
INHALT
Vorwort zur Reihe
Einleitung
1.Freude in Anfechtungen
2.Stolz und Selbsttäuschung
3.Hören, aber nicht nur hören
4.Kein Ansehen der Person
5.Glaube zeigt sich in Werken
6.Die Macht der Zunge
7.Zurück zu Gott
8.Von Terminkalendern und Bankguthaben
9.Geduld im Leiden
10. Gebet, das wirklich etwas verändert
Literaturhinweise
VORWORT ZUR REIHE
Jeder Band dieser Reihe bietet dir einen Zugang zu einem Buch der Bibel. Jeder Band verfolgt dabei vier Ziele:
Die Bibel ins Zentrum stellen
Christus verherrlichen
Relevante Anwendungen für das Leben bieten
Leicht lesbar sein
Wie kannst du dieses Buch verwenden?
Für deine Lektüre. Du kannst das Buch einfach von vorne bis hinten lesen. Dieser Band beschäftigt sich mit den Aussagen eines bestimmten biblischen Buches und will dich dadurch ermutigen und herausfordern.
Für deine Stille Zeit. Du kannst dieses Buch in deiner persönlichen Stillen Zeit durcharbeiten oder zur Vorbereitung auf eine Predigt oder Predigtserie in deiner Gemeinde verwenden. Jedes Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt, die jeweils am Ende Fragen zum Nachdenken enthalten.
Für deinen Hauskreis. Du kannst dieses Buch als Hilfsmittel verwenden, um Gottes Wort in einer Kleingruppe oder in der Gemeinde zu lehren. Schwierige Verse oder theologische Konzepte werden hier einfach erklärt. Du findest in dem Buch außerdem hilfreiche Illustrationen und Vorschläge für die Anwendung auf unser Leben.
Die Bücher dieser Reihe sind keine wissenschaftlichen Kommentare. Sie setzen weder ein Verständnis der Originalsprachen der Bibel noch ein hohes Maß an biblischem Wissen voraus.
Neben dem Kommentar liegt ein Arbeitsheft vor, das von Kleingruppen oder zum Selbststudium genutzt werden kann. Gruppenleiter können kostenlos eine passende Arbeitshilfe auf unserer Webseite herunterladen. Die Arbeitshilfe für Gruppenleiter bietet historische Hintergrundinformationen, Erläuterungen der zu behandelnden Bibeltexte, Ideen für Extra-Aktivitäten und Hilfen, wie man Menschen am besten dabei unterstützen kann, die Wahrheiten des Wortes Gottes zu entdecken.
Wir beten, dass du letztlich nicht vom Inhalt dieses Buches, sondern vom Inhalt der Bibel beeindruckt sein wirst. Unser Lob gebührt nicht dem Autor dieses Buches, sondern dem Autor der Bibel.
EINLEITUNG
Sehr beliebt, zugleich aber stark hinterfragt – auf den Jakobusbrief trifft das wahrscheinlich mehr zu als auf jedes andere neutestamentliche Buch. Schon allein deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Dieser Brief wird uns bestimmt nicht kaltlassen! Christen haben im Laufe der Zeit heftig über ihn diskutiert. In der Alten Kirche stellte man teils sogar seine Aufnahme ins Neue Testament infrage. Der Reformator Martin Luther bezeichnete ihn Jahrhunderte später noch als »eine rechte stroherne Epistel« (»Vorrede zum Neuen Testament 1522«, S. 42).
Bereits ein kurzer Blick auf den Brief lässt uns ahnen, warum manche Christen ihn so problematisch fanden: Wenn du andere Briefe im Neuen Testament durchblätterst, entdeckst du wahrscheinlich mehrfach auf jeder Seite die Wörter »Christus« und »Jesus«. Jakobus scheint dagegen kaum etwas über Jesus zu sagen. Nur zweimal wird Jesus ausdrücklich erwähnt. Eines dieser Vorkommen befindet sich noch dazu direkt am Anfang des Briefes, wo Jakobus sich als »Knecht … des Herrn Jesus Christus« vorstellt. Abgesehen davon wird Jesus im gesamten Brief nur noch ein einziges Mal genannt. Daher wird auch über den Tod und die Auferstehung Jesu wenig gesagt – über diese beiden zentralen Ereignisse, die für den Glauben und das Leben von Christen so grundlegend sind. Somit liegt die Befürchtung nahe, dass es sich wohl um keinen besonders evangeliumszentrierten Brief handelt. (Und es wird uns auch wenig beruhigen, dass der Dalai Lama diesen Brief besonders schätzt, weil er meint, sein Inhalt sei im Einklang mit der Lehre des Buddhismus!)
Abgesehen davon wurde bemängelt, der Jakobusbrief sei inhaltlich zusammenhanglos. Der Brief springe von einem Thema zum anderen, ohne dass eine übergeordnete Struktur oder ein Konzept zu erkennen sei – anders als beispielsweise bei Paulus, dessen Gedanken sinnvoll aufeinander aufbauen. Man lehnte den Jakobusbrief also mit der Begründung ab, er bestehe nur aus einem Sammelsurium von einzelnen Anweisungen ohne ersichtlichen roten Faden.
Die wohl bekannteste Kritik an Jakobus lautet aber, er widerspreche Paulus. Man könnte sogar meinen, dass Jakobus das absichtlich tut. Immerhin greift er eine von Paulus hochgeschätzte Lehre auf – die Rechtfertigung allein aus Glauben – und stellt sie dann scheinbar auf den Kopf, indem er schreibt: »So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein« (2,24). Das reichte, um Luther schimpfen zu lassen: Jakobus »zerreißt die Schrift und widersteht damit Paulus und aller Schrift« (»Vorrede zum Jakobus- und Judasbrief 1522«, S. 64). Harte Worte! Für Menschen, die beweisen wollen, dass die Bibel nicht das inspirierte Wort Gottes ist, ist dieser Vers natürlich ein gefundenes Fressen.
Wir sollten den Brief aber nicht vorschnell abtun. Allen Diskussionen zum Trotz hat er im Laufe der Jahrhunderte seinen Weg in die Herzen unzähliger Christen gefunden, und er gehört nach wie vor zu den beliebtesten Bibelbüchern. Wer ihn aufmerksam und erwartungsvoll liest, wird schnell erkennen, warum das so ist.
Jakobus formuliert sehr prägnant und direkt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und neigt nicht dazu, sich in langatmigen und theoretischen theologischen Ausführungen zu verlieren. Wir haben hier (im Großen und Ganzen) keinen Brief, bei dem man sich intensiv den Kopf zerbrechen oder ständig komplizierte Wörter nachschlagen muss. Im Gegenteil – er ist sehr praktisch. Jakobus spricht darin ganz alltägliche Themen an: unser Reden, unsere Einstellung zu Reichtum und Armut, unseren Umgang mit Konflikten, mit Krankheit und Leid. Der Brief ist herrlich lebensnah.
Außerdem schreibt Jakobus sehr anschaulich. Sein Text ist reich an Bildern und Illustrationen, weit mehr als jeder andere Brief. Man wird einfach mitgerissen, wenn Jakobus uns einen brennenden Wald, große Schiffe, einen geduldigen Bauern und die Blumen auf dem Feld vor Augen malt. Dies alles trägt zur Unmittelbarkeit und Lebendigkeit des Jakobusbriefes bei. Zudem verbirgt sich darin ein Hinweis, weshalb dieser Brief so besonders kostbar ist.
Mit seiner häufigen Verwendung von Veranschaulichungen aus dem Alltagsleben erinnert uns Jakobus an jemanden, der das ebenfalls tat. Eben darin liegt ein Fingerzeig, warum der Brief für Christen aller Zeiten so wertvoll war.
Jakobus war nämlich der Halbbruder von Jesus. Die biologische Verwandtschaft brachte Jakobus aber keinen natürlichen Vorsprung oder Pluspunkt. So ziemlich das Erste, was wir über Jesu Brüder erfahren, ist, dass sie nicht an ihn glaubten (vgl. Joh 7,5). Zu Beginn der Apostelgeschichte werden sie aber (wie auch Maria) als Teil der Gruppe genannt, die sich gemeinsam mit Jesu Jüngern zum Gebet versammelte. Wie kam es zu dieser dramatischen Veränderung? Die Erklärung finden wir bei Paulus: Nach der Auferstehung gab es eine persönliche Begegnung zwischen Jesus und Jakobus (vgl. 1 Kor 15,7). Schon kurze Zeit später gehörte Jakobus zu den Führungspersönlichkeiten der Jerusalemer Gemeinde (vgl. z. B. Apg 21,17–18).
Wenn wir uns nun also diesem Brief zuwenden, werden wir schnell merken, warum er so unerschütterlich beliebt ist. Der Brief ist durchdrungen von dem Denken und den Worten des großen Bruders von Jakobus. Auch wenn Jesus nicht oft genannt wird, ist seine Anwesenheit überall zu spüren. Wie wir sehen werden, teilt Jakobus uneingeschränkt das Anliegen des Paulus: Unser Leben als Christ steht unter dem Vorzeichen, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt sind. Zweifellos deckt der Brief ein breites Spektrum an Themen ab, und die Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten ist nicht immer so offensichtlich wie bei anderen neutestamentlichen Briefen. Aber es gehört nun mal zum Reichtum der Bibel, dass der Heilige Geist weder den Charakter noch den Schreibstil der menschlichen Verfasser von biblischen Büchern überging, sondern beides gebrauchte, um Gottes Wort »auszuhauchen«.
Ob wir die Besonderheiten des Jakobusbriefes nun interessant oder irritierend finden, wir sollten uns aus einem sehr wichtigen Grund mit ihm befassen: Letztlich geht es darin um die Frage, was es wirklich bedeutet, Jesus Christus, dem »Herrn der Herrlichkeit« nachzufolgen (2,1). Der Brief wird uns zeigen, wie wahrer Glaube im echten Leben aussieht – und er wird uns herausfordern, diesen Glauben durch harte Arbeit und ein klar von der Welt unterscheidbares Leben praktisch werden zu lassen. Jakobus wollte, dass seine Leser Jesus noch radikaler und von ganzem Herzen dienen. Das muss auch unser Ziel sein. Ich bete dafür, dass dieses Buch dir hilft, Jakobus’ Bruder – unserem Herrn – mit noch mehr Begeisterung nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden.
JAKOBUS 1,1–8
1. FREUDE IN ANFECHTUNGEN
TEIL 1
Jakobus hatte es offenbar ziemlich eilig beim Schreiben. Jedenfalls hält er sich am Briefanfang nicht lange damit auf, seine Leser fürsorglich abzuholen. Er beginnt mit einem knappen Gruß und kommt dann gleich zur Sache. Ganz oben auf seiner Tagesordnung steht das Thema »Anfechtungen« und die Frage, wie wir mit ihnen umgehen. Schon hier wird der Charakter des Briefes deutlich: praktisch, prägnant und sehr direkt. Bevor wir jedoch mit Jakobus über Anfechtungen nachdenken, wollen wir noch einen Blick darauf werfen, wie er sich selbst und seine Leser beschreibt.
DARF ICH VORSTELLEN …?
In der Antike war es üblich, sich zu Beginn eines Briefes vorzustellen, und Jakobus tut dies, indem er sich als »Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus« bezeichnet (1,1). Denn das ist es, was wirklich zählt. Durch Jesu Wirken hat er Gott kennengelernt und lebt nun ganz für seinen Gott und Herrn. Jakobus ist zwar der jüngere Bruder von Jesus, aber viel wichtiger als diese biologische Verwandtschaft ist die geistliche Verbindung mit ihm. Auch wenn er der kleine Bruder von Jesus ist – bedeutsamer ist, dass er zu seinem Volk gehört. Eine solche Zugehörigkeit zu Jesu Volk zeigt sich daran, dass wir uns ihm als Knechte (d. h. als seine Diener) zur Verfügung stellen.
Wer die Empfänger des Jakobusbriefes sind – »die zwölf Stämme in der Zerstreuung« (V. 1) –, ist dagegen nicht ganz so leicht ersichtlich. Als »zwölf Stämme« wurde im Alten Testament das Volk Gottes bezeichnet. Da Jakobus seine Leser darüber hinaus die zwölf Stämme »in der Zerstreuung« nennt, können wir die Empfänger noch weiter eingrenzen. Viele Juden lebten damals außerhalb von Israel, sie waren über die gesamte römische Welt verstreut. »In der Zerstreuung« entsprach ihrer Selbstwahrnehmung. Wahrscheinlich schreibt Jakobus also an Judenchristen außerhalb Israels, und das passt auch zu seiner Position als Leiter der überwiegend jüdischen Gemeinde in Jerusalem.
Damals im ersten Jahrhundert waren also gewisse Judenchristen die Empfänger des Jakobusbriefes. Trotzdem ist er nicht ausschließlich an sie gerichtet. Der Brief ist als Teil der Bibel überliefert worden, um für Christen aller Zeiten und an allen Orten zum Segen zu werden und sie zu stärken. Wenn wir verstehen, was Jakobus den damaligen Gläubigen zu sagen hatte, erkennen wir schnell, was das für uns heute bedeutet. In diesem weiteren Sinne gilt der Brief also auch uns.
Nach der ultrakurzen Begrüßung kommt Jakobus direkt auf sein Thema zu sprechen: Anfechtungen. »Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt« (1,2).
Entscheidend ist, dass Jakobus hier sagt: »wenn«. Nicht falls, sondern wenn. Anfechtungen sind normal. Sie sind nichts Seltsames, das uns gegen alle Wahrscheinlichkeit trifft. Vielmehr sind sie ein fester Bestandteil des normalen Lebens als Christ.
Sie sind sicherlich nichts, was wir uns wünschen. Mancher von uns hat Zeiten erlebt, in denen er dachte, es könne nicht mehr schlimmer kommen – aber die Schrecken nahmen kein Ende. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Leser gerade jetzt so. Du bist am Ende deiner Kräfte. Egal, ob deine Anfechtungen eher körperlich, sozial, beziehungsmäßig oder geistlich sind: Du fragst dich, ob du das weiter aushalten kannst.
Wie auch immer unsere Situation gerade aussehen mag – Jakobus ruft uns auf, unseren Glauben unter dem Druck solcher Zeiten nicht an den Nagel zu hängen. Nur wenige Verse später eröffnet er sogar die Perspektive, dass wir Anfechtungen nicht nur durchstehen, sondern in ihnen wachsen können: »Selig ist, wer Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben« (V. 12). Was für eine Aussicht: Wer durchhält, wird von Gott am Ende eine herrliche Belohnung empfangen! Natürlich wollen wir gern ein Mensch sein, der die »Anfechtung erduldet« und »bewährt ist«.
Manchmal haben wir aber das Gefühl, dass das nahezu unerreichbar ist. Wir wären ja gern diese Sorte Christ, aber wir fürchten, wir sind es einfach nicht. Wie können wir zu jemandem werden, der ausharrt, der in schweren Zeiten fest im Glauben steht, und der den Segen Gottes in der leidvollen Gegenwart wie auch in der ewigen Zukunft erlebt? Genau das zeigt uns Jakobus in diesen ersten Versen.
ERACHTET ES FÜR LAUTER FREUDE
Die erste Anweisung lautet: »Erachtet es für lauter Freude« (V. 2).
Wieder ist die Wortwahl wichtig: »Erachtet …«. Jakobus sagt uns nicht, was wir fühlen, sondern wie wir denken sollen. Er fordert nicht: »Tut so, als wäre es ein Vergnügen.« Er verlangt auch nicht, dass wir stets ein künstliches Lächeln im Gesicht haben und – komme, was da wolle – Haltung bewahren. Die Theologen Craig Blomberg und Mariam Kamell schreiben:
»Jakobus fordert uns nicht auf, jene fröhliche Miene zur Schau zu tragen, von der so viele meinen, sie sei in der Gemeinde und in christlichen Kreisen erforderlich.« (James, S. 59)
Nein, Jakobus erklärt, wie wir über unsere Anfechtungen denken sollen. Wir müssen sie aus einer bestimmten Perspektive betrachten, um sie richtig einordnen zu können.
Beachte auch, dass Jakobus von »mancherlei« Anfechtungen spricht. Er denkt an ganz unterschiedliche Bedrängnisse. Beim Lesen des Briefes bekommen wir eine Idee davon, mit welchen Anfechtungen die damaligen Empfänger zu kämpfen hatten: Armut, Ungerechtigkeit, Streit, Krankheit und Trauer. Jakobus formuliert aber absichtlich ganz allgemein, und das ist auch gut so. In Schwierigkeiten denken wir leicht, dass niemand etwas Vergleichbares durchmachen muss, dass bei uns die normalen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr funktionieren und wir die große Ausnahme sind. Durch seine allgemein gehaltenen Aussagen zeigt Jakobus aber, dass das, was jetzt kommt, für uns alle gilt. Hätte er eine bestimmte Anfechtung herausgegriffen, dann würden wir, die wir an anderer Stelle kämpfen, uns wahrscheinlich damit herausreden, dass das so nicht auf uns zutrifft. Jakobus’ Hinweise gelten aber nicht nur für zwei oder drei spezielle Situationen, sondern für »mancherlei« Anfechtungen. Was auch immer du gerade durchmachst, diese Worte sind für dich. Laut Jakobus können wir Anfechtungen aus einer solchen Perspektive betrachten, dass sie uns zur Freude verhelfen. Wir werden diese Freude verpassen, wenn wir ignorieren, was er uns zu sagen hat.
VOLLKOMMEN UND UNVERSEHRT
Jakobus erklärt diese Perspektive in den Versen 3–4. In gewissem Sinne ist seine Aussage ziemlich einfach: Anfechtungen lehren uns geduldiges Ausharren (V. 3). Sie konfrontieren uns mit Herausforderungen, die wir nur mit Mühe und Entschlossenheit bewältigen können. Dann bringt uns das geduldige Ausharren zu einem herrlichen Ziel: »damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt« (V. 4). Wir werden als Christen geschliffen und geformt, sodass wir immer mehr zu dem Menschen werden, den Gott schon bei unserer Erschaffung und Errettung im Sinn hatte.
Wenn wir innehalten, wird uns bewusst, dass wir uns vor allem danach sehnen, Christus ähnlicher zu werden, ihn besser und inniger zu kennen (oder zumindest sollten wir uns danach sehnen). Gerade durch Anfechtungen hat unser Glaube die Chance, dieser Vollkommenheit näherzukommen. Ohne Anfechtungen ist das tatsächlich gar nicht möglich. Sie sind für uns wie eine Art geistliches Gewächshaus.
Das Leben als Christ funktioniert nun mal so: Unser Glaube wächst, wenn wir lernen, in Nöten und Schwierigkeiten geduldig und standhaft zu bleiben. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus etwas Ähnliches: »Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung« (Röm 5,3–4).
Durch Bedrängnisse wird unser Glaube geprüft, gestärkt und vertieft. Der Glaube funktioniert also ähnlich wie die Muskeln in unserem Körper: Er wächst, wenn er zum Einsatz kommt. Dafür benötigt er Widerstand. Auch körperliches Training ist ein mühsamer und schweißtreibender Prozess. Ein Hollywood-Schauspieler, der sich auf eine Rolle als Superheld vorbereiten will, darf keine ruhige Kugel schieben. Wenn ein Muskel wachsen soll, muss es ungemütlich werden. So muss auch unser Glaube durch Anfechtungen Widerstand erfahren, damit wir geistlich wachsen können. Bedrängnisse und Schwierigkeiten haben zur Folge, dass wir uns fester an Gottes Verheißungen klammern.
Das ist eine demütigende Lektion für uns. Schließlich erinnert uns das daran, dass wir in unserem Leben als Christ noch längst nicht vollkommen sind. Wir alle haben es nötig, in unserem Christsein weiterzuwachsen und voranzukommen. Für Selbstzufriedenheit bleibt da kein Platz. Gott will nicht nur ein bisschen Veränderung in unserem Leben. Wenn wir es einfach nur bequem haben wollen, wird unser Glaube niemals »vollkommen und unversehrt« sein.
DIE WERTVOLLSTE SACHE DER WELT
Das alles macht uns nicht nur demütig, sondern es bedeutet auch eine große Ermutigung für uns. Wir dürfen gewiss sein, dass unsere Anfechtungen einen Sinn haben. Sie sind nicht umsonst, sie sind auch keine verschwendete Lebenszeit. Warum? Weil Gott in uns wirkt, während wir geduldig darin ausharren. Er investiert in unseren Glauben. Der britische Pastor F. B. Meyer (ein Freund von D. L. Moody) meinte einmal, dass Anfechtungen ein Vertrauensbeweis Gottes an uns sind. Das heißt jedoch nicht, dass wir nicht unter ihnen leiden. Wir müssen nicht so tun, als würden uns Anfechtungen und Trauer nichts ausmachen. Es ist ganz natürlich und normal, dass solche Dinge schmerzlich für uns sind. Es wäre unmenschlich, zu fordern, dass unsere eigenen Nöte und auch die Not anderer Menschen an uns abprallen sollen. Schmerz zu empfinden ist eine reflexartige Reaktion auf Anfechtungen, und Schmerz ist völlig legitim. Jakobus will auch nicht sagen, dass wir uns nach Schwierigkeiten ausstrecken oder womöglich sogar absichtlich leidvolle Situationen herbeiführen sollen. Keineswegs – an und für sich ist Leid nichts Gutes. Vielmehr meint Jakobus, dass das, was Gott durch unser Leid bewirken kann, gut ist – nicht das Leid als solches. Wir haben dadurch die Chance, die wertvollste Sache der Welt zu erlangen: eine Unversehrtheit im Glauben, die durch keinen Mangel beeinträchtigt wird, eine vollkommene und tiefe Beziehung zu Gott.
Es gibt viele verschiedene Anfechtungen, die einen Christen treffen können. In jeder normalen Gemeinde wird man Leute finden, die gerade einen lieben Menschen verloren haben, und andere, die unter einer zerbrochenen Beziehung leiden, und wieder andere, die mit Einsamkeit kämpfen. Es gibt kaputte Familien, ernsthafte und langwierige gesundheitliche Probleme sowie den Kampf gegen Depressionen und Versuchungen. Manches Leid geht auf Dinge zurück, die in der Vergangenheit geschehen sind – wenn Menschen etwas angetan wurde, das tiefe und bleibende Narben hinterlassen hat, oder wenn jemand von seiner eigenen Schuld unablässig verfolgt wird. So sieht das reale Leben in dieser Welt aus, und so sah es auch für die ersten Leser des Jakobusbriefes aus.
Dennoch fordert uns Jakobus auf, diese Schwierigkeiten für lauter Freude zu erachten. Als Christen sollten wir Anfechtungen im Lichte dessen sehen, was Gott dadurch in uns bewirken kann. Wir sollten darin die Chance erkennen, in unserer Beziehung zum Herrn zu wachsen. Die Aussicht auf einen tieferen und ganzheitlicheren Glauben darf uns froh machen.
Das ist eine wunderbare Wahrheit. Anfechtungen haben oft die Eigenschaft, uns stark zu vereinnahmen. Wir können dann kaum noch an etwas anderes denken. Was wir gerade durchmachen, beschäftigt uns dermaßen, dass es unmöglich scheint, etwas anderes als den akuten Schmerz zu sehen. Vielleicht lassen uns sogar die Nöte von Menschen in unserem Umfeld kalt. Leiderfahrungen können leicht dazu führen, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen.
Deshalb ist das ein Kampf, der in unserem Willen stattfindet. Jakobus behauptet nicht, dass Christen automatisch Freude im Leid erleben werden. Die Aufforderung lautet: »Erachtet« Anfechtungen als Freude. Wir müssen darum kämpfen, sie richtig einzuordnen – bewusst über das gegenwärtige Leid hinauszublicken und uns auf das Gute zu freuen, das Gott irgendwann dadurch hervorbringen wird. Dann beginnen wir, hinter dem tiefen Schmerz die Gegenwart und Güte Gottes zu erahnen. In uns wächst die Gewissheit, dass wir in seiner Hand sind und er an uns handelt.
Vor allem darf uns aber die faszinierende Verheißung ermutigen, dass Gott solche Anfechtungen gebraucht, um uns Jesus Christus ähnlicher zu machen.
ZUM NACHDENKEN
Wie denkst du normalerweise über Anfechtungen? Wie realistisch fandest du Vers 2, als du ihn zum ersten Mal gelesen hast?
Denkst du jetzt anders darüber?
»Das ist ein Kampf, der in unserem Willen stattfindet.« Auf welche Weise musst du kämpfen, um eine Anfechtung für Freude zu erachten? Wie können dir die Verse 3–4 dabei helfen?
TEIL 2
WAS SOLL ICH NUR TUN?
Anfechtungen helfen uns, geistlich zu wachsen, aber das heißt nicht, dass wir immer wissen, was jetzt zu tun ist. Wir benötigen Weisheit, um zu erkennen, was Gott uns durch solche Bedrängnisse lehren will – wie wir uns verhalten und wie wir am besten damit umgehen sollen.
Wenn wir intensives Leid durchmachen, haben wir oft das Gefühl, die Orientierung zu verlieren. Ein Freund, der durch großes Leid ging, sagte zu mir, er wisse nicht mehr, wo oben und unten ist. Er fühlte sich wie gelähmt und hatte keine Ahnung, was er jetzt machen sollte. Ein anderer Freund, der ebenfalls in großen Schwierigkeiten steckte, schrieb mir in einer E-Mail: »Ich weiß einfach nicht, was jetzt von Gott her das Richtige ist.« Anfechtungen und Verwirrung gehen oft Hand in Hand.
Dieses Zusammenspiel sehen wir in der Bibel immer wieder. In Psalm 25 ringt David mit dem übermächtigen Widerstand seiner Feinde sowie mit seiner eigenen tiefen Schuld und Sünde. Inmitten dieser Anfechtungen bittet er inbrünstig um Gottes Führung: »HERR, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!« (Ps 25,4–5). Ähnlich schreibt Paulus, als er über unser Leiden in diesem Leben nachdenkt: »Wir wissen nicht, was wir beten sollen« (Röm 8,26).
So ist es nicht verwunderlich, dass Jakobus nach seiner ersten Aufforderung (»Erachtet es für lauter Freude«, Jak 1,2) nun unsere fehlende Weisheit anspricht: »Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden« (V. 5).
Jakobus weiß: Oft fehlt es uns gerade dann an Weisheit, wenn wir sie am dringendsten nötig hätten. Deshalb sollen wir zu Gott kommen. So einfach ist das. Wir dürfen nicht meinen, dass in Bedrängnissen eine Art Leistungsnachweis von uns gefordert wird – als müssten wir Gott jetzt beweisen, dass wir Musterschüler sind, die alles verstanden haben. Es ist in Ordnung, Gottes Führung zu brauchen.
In der Anfechtung wird keineswegs von einem Christen erwartet, dass er nun genau wissen sollte, was zu tun ist – dass er die Dinge, die ihm zuvor beigebracht wurden, jetzt richtig anwendet. Jakobus geht davon aus, dass wir Weisheit nötig haben, aber es uns an Weisheit mangelt. Deshalb rät er uns, Gott darum zu bitten. Wir sollen fühlen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. In solchen Zeiten ist es heilsam, sich bewusst zu machen, wie viel wir nicht wissen. Es ist keine Schande, das zuzugeben. Wenn es um das Gebet geht, zeigt sich immer wieder, dass Gott viel schneller bereit ist, unsere Bitten zu erhören, als wir bereit sind, zu beten.
WIE GOTT GIBT
Als Ermutigung für unsere Bitte um Weisheit lenkt Jakobus unseren Blick auf etwas Großartiges: Theologie. Er ruft uns ins Gedächtnis, wie Gott ist. Und er erklärt, wie entgegenkommend Gott auf unseren Hilferuf reagiert. Wir werden an das erinnert, was der große Bruder von Jakobus, Jesus, über das Gebet lehrte: »Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!« (Mt 7,11).
So ist es, wenn man Gott zum Vater hat. Er ist immer bereit, uns zu helfen. Wenn wir Gott um etwas bitten, ist es wichtig, ihn zu kennen. Freu dich also daran, auf welche Weise Gott denen Weisheit schenkt, die ihn darum bitten:
Er gibt »gern«
(Jak 1,5). Gott geizt nicht mit seiner Weisheit. Vor einiger Zeit stand ich an einem Buffet, an dem die Kellner – gemessen an dem Preis, den das Essen kostete – ziemlich mickrige Portionen ausgaben. Wir bekamen einen Klacks Reis mit einem Hauch Curry. Etliche Gäste beschwerten sich. Gott knausert jedoch nicht mit seiner Weisheit. Wer ihn darum bittet, wird nicht nur mit einem winzigen Happen abgespeist. Nein, Gott gibt von Herzen gern. Wir dürfen ihn nicht für jemanden halten, der seine Gaben nur sparsam zugesteht. Tatsächlich freut er sich, uns damit zu überhäufen.
Er gibt jedermann
(V. 5). Gottes Weisheit ist nicht nur auf einige wenige, privilegierte Christen beschränkt. Gott will, dass sein ganzes Volk sich an ihr erfreut und auf sie zurückgreift. Das christliche Leben ist nicht wie eines dieser Vielfliegerprogramme von Fluggesellschaften, bei denen es auf deinen Status ankommt und nur Platin-Mitglieder eine Chance auf einen guten Sitzplatz haben, während der Rest das Nachsehen hat. Wenn du zu Gott gehörst, steht dir seine Weisheit – und zwar seine ganze Weisheit – zur Verfügung.
Er gibt »ohne Vorwurf«
(V. 5). Wenn wir mitten im Chaos unseren Vater um Weisheit bitten, verdreht er nicht die Augen und sagt: »Na, diesmal hast du es ja wirklich verbockt … Sag bloß, du weißt immer noch nicht, wie du das in den Griff bekommen sollst?« Er führt und leitet uns, ohne uns von oben herab zu behandeln.
Beachte, was Jakobus hier tut. Er erinnert uns an das, was wir bereits über Gott wissen. Das ist der Schlüssel. Wenn wir in Zeiten der Not und Verwirrung zu Gott kommen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, wer dieser Gott ist und wie er sich uns bereits gezeigt hat.
Wir haben diese Wahrheiten schon damals entdeckt, als wir das Evangelium hörten und zum Glauben kamen. Damals erkannten wir, wie gern Gott gibt. Wir verstanden, dass er uns nichts Geringeres als seinen einzigen Sohn gegeben hat (vgl. Joh 3,16). Deshalb dürfen wir auch weiterhin mit großer Zuversicht zu Gott kommen und ihm unsere Anliegen bringen. »Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?« (Röm 8,32). Gottes Freigiebigkeit versiegt nicht in dem Moment, in dem wir Christ werden. Sie fließt auch jetzt noch unaufhörlich in unser Leben.
Als wir zum Glauben kamen, entdeckten wir auch, dass er wirklich allen gibt. Uns wurden die Augen für den wahren Zustand unseres Herzens geöffnet und wir erkannten, wie weit wir uns von Gott entfernt hatten. Dennoch war er bereit, seine Gaben reichlich zu schenken – selbst Menschen wie uns, die wir so verdorben und verbogen waren. Seine Gnade kennt wirklich keine Grenzen. Uns dämmerte die Erkenntnis: »Wenn er jemandem wie mir gnädig sein kann, dann ist wirklich niemand außerhalb der Reichweite seiner Gnade.«
Wir verstanden damals außerdem, dass Gott gibt, ohne Vorwürfe zu machen. Denn darin besteht das Evangelium, die Gute Nachricht: Wir bekommen etwas, das wir nicht verdient haben, und zugleich werden unsere Mängel und Verfehlungen, die dem eigentlich im Wege stehen, ausgelöscht. Durch Christus werden wir makellos und untadelig vor Gottes Angesicht gestellt (vgl. Kol 1,22).
Das ist der Gott, den wir damals entdeckt haben, als wir zu Christus kamen. Was brachte uns nur auf die Idee, er könnte sich mit der Zeit verändert haben? Er liebt doch seine Kinder. Er freut sich, uns zu helfen. Er möchte uns von Herzen gern seine Weisheit schenken. Seine Großzügigkeit ist über die Jahre nicht weniger geworden. Wir dürfen zu ihm kommen! Im 16. Jahrhundert stellte der Reformator Johannes Calvin treffend fest:
»So sehen wir den Herrn nicht anders als in der vollen Bereitschaft seiner Hilfe solche unsre Kraft überschreitenden Anforderungen stellen: nur müssen wir eben um seine Hilfe bitten. Aus jedem Gebot also, das Gott aufstellt, mögen wir sogleich die Anweisung entnehmen, ihn um das Vermögen des Gehorsams zu bitten.« (Ebräerbrief und katholische Briefe, S. 412)
WIE WIR BITTEN SOLLEN
Nachdem wir verstanden haben, wie gern Gott gibt, wird uns die nächste Aussage von Jakobus vielleicht etwas schockieren. Wer um Weisheit bittet, tue dies »im Glauben, ohne irgend zu zweifeln« (Jak 1,6 ELB). Das ist nicht gerade eine kleine Bedingung, die Jakobus da nennt – wie gemacht dafür, uns zu verunsichern. Welcher Christ hat nicht schon gezweifelt? Dürfen also Christen, die schon mal irgendetwas in Zweifel gezogen haben, Gott nicht mehr zuversichtlich um Weisheit bitten?
Gegen Ende des Films Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gibt es eine denkwürdige Szene, in der Indy den Heiligen Gral finden muss, um das Leben seines Vaters zu retten. Er weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist, wird dann aber von einer tiefen Schlucht am Weitergehen gehindert. Obwohl ihm klar ist, dass es sich um eine Prüfung handelt, schreckt er zurück. Er muss daran glauben, dass es irgendeinen Weg auf die andere Seite gibt. Genau das ruft ihm auch sein verletzter Vater aus der Ferne zu: »Du musst glauben, mein Junge! Glaube ganz fest!« Indy nimmt all seinen Mut zusammen und wagt den Schritt hinaus ins Nichts. Wider Erwarten stürzt er nicht ins Bodenlose, sondern sein Fuß landet auf einer Brücke, die zuvor nicht zu erkennen war.
Wenn wir diese Worte im Jakobusbrief lesen, fürchten wir, wir müssten etwas Ähnliches schaffen – irgendwie einen Zustand vollkommenen Glaubens in uns hervorrufen. Glücklicherweise hat Jakobus das aber nicht im Sinn. Er verwendet das Wort »zweifeln«