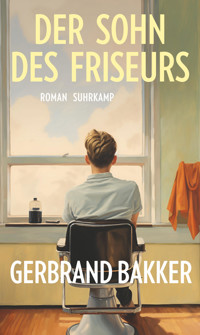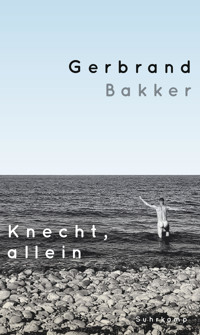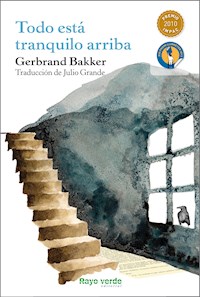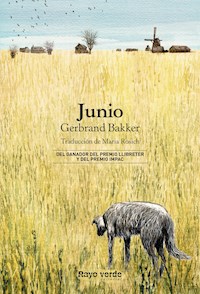12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Entschleunigend und weise, ohne zu belehren: Gerbrand Bakker schreibt über ein Jahr in der Eifel, über ein Jahr im Leben eines Mannes, der in Romanen wie Oben ist es still die Seelen der Menschen auslotet und sich nun einen Blick ins eigene innere Erleben erlaubt – mit packender Ehrlichkeit und unschlagbar trockenem Humor.
Ein altes Haus in der Eifel, ein eigenwilliger Hund, Nachbarn mit Charakter: Das ist der Alltag des Romanautors Gerbrand Bakker. Unterbrochen wird er von Reisen und Preisverleihungen, einem Lunch bei der niederländischen Königin – und immer wieder der Frage, wie es sich lebt als Mensch, der nur mit einer komplexen Bedienungsanleitung zu verstehen ist.
Warum einen das alles so in den Bann zieht, dass man nicht mehr aufhören möchte zu lesen? Weil Gerbrand Bakker seine Aufzeichnungen subtil verknüpft mit den Erinnerungen an früher, an Opa Bakker und den Bauernhof der Eltern, berufliche Wege und Irrwege. Und weil er ein Meister im Einfangen von Stimmungsnuancen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gerbrand Bakker
Jasper und sein Knecht
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Jasper und sein Knecht
3. Dezember 2014 [Schwarzbach]
In drei Tagen hätte mein Großvater Geburtstag. Wenn Sinterklaas wieder fortgezogen war, hatten wir immer noch etwas in Reserve, das dieses Gefühl von Leere und Verlassenheit vertrieb. Meine Großmutter hatte am 7. August Geburtstag. Ich weiß sogar, in welchen Jahren die beiden geboren wurden: 1898 und 1904. Sie sind die Großeltern väterlicherseits, sie wohnten auf dem alten Land, in Barsingerhorn. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wann Opa und Oma Keppel Geburtstag hatten, und an ihre Geburtsjahre erinnere ich mich erst recht nicht. Sie wohnten auf dem neuen Land, an einer schnurgeraden, leeren Straße auf dem Wieringermeer-Polder. Oma Keppel ist eine Stiefoma, die aber schon längst da war, als ich geboren wurde. Für mich gehört sie einfach dazu. Meine richtige Oma war mit einem anderen Mann davongelaufen, einem niederländischen Nazi. Was in jener Zeit ziemlich ungewöhnlich war. Nicht das Nazi-Sein, das Davonlaufen. Sie ist nicht alt geworden. Krebs. Meine Stiefoma lebt – das ist doch etwas Besonderes, wenn ein Mann von zweiundfünfzig Jahren sagen kann, dass er noch eine Stiefoma hat. Wir haben aber keinen Kontakt mehr mit ihr, irgendwann muss etwas vorgefallen sein, das zum Bruch geführt hat. Manchmal, wenn ich an unsere Familie denke, habe ich ein wenig Mitleid mit meiner Mutter. Immer hat sich alles nur um die Bakkers gedreht, die Keppels wurden vergessen, zählten nicht wirklich.
Gerade bin ich mit Jasper die große Runde gegangen, im Schnee. Dem ersten Schnee dieses Winters, einer sehr dünnen Schicht, nicht viel mehr als hauchzarter Gardinenstoff in einer von Sonnenlicht durchfluteten Wohnung. Besonders kalt war es nicht, in diesem Teil der Eifel ist es selten windig. Im Wald haben wir einen Fuchskadaver gefunden, den Jasper vorsichtig beschnüffelte. Angenagt hat er ihn nicht, und als ich ihn so schnüffeln sah, fiel mir ein, dass der Fuchs ja auch zu den Hundeartigen gehört und dass Jasper vielleicht deshalb nicht davon fressen will. Neulich hatte er nämlich den Kopf in den Bauch eines toten Rehs gesteckt. Zwei Öfen brennen, in der Küche und im Schreibzimmer, es schneit nicht mehr.
Ich träume regelmäßig von Opa Bakker. Ich glaube, ich habe ihn sehr liebgehabt. In meinen Träumen nehme ich deutlich seinen Geruch wahr, einen typischen Altmännergeruch, der bei einem fremden alten Mann unangenehm oder sogar widerlich wäre. Bei Opa Bakker fand ich ihn angenehm, ich nahm Opa gern in den Arm. Nachdem Oma gestorben war, wollte auch er eigentlich nicht mehr, hat aber schließlich noch etwa sieben Jahre durchgehalten. Er aß sehr oft Bratkartoffeln und ging wieder zu dem Friseur, zu dem Oma ihn nicht hatte gehen lassen. Wenigstens langweilte er sich nicht und wohnte bis zu dem Tag, an dem er starb, in seinem eigenen Haus. Bestimmte Nachrichtensprecher hasste er, weil er sie nicht verstehen konnte. Manche Sprecherinnen verstand er leidlich bis ausgezeichnet, es waren vor allem die Murmelmänner, die er nicht ausstehen konnte. Er freute sich immer, wenn man ihn besuchte, und ich habe ihn nie klagen hören. Nein, das stimmt nicht ganz, manchmal sprach er davon, wie schrecklich es ist, wenn die vertrauten Menschen verschwinden, wenn die Frau, die Verwandten, die Freunde allesamt sterben. Er löste Kreuzworträtsel und kramte den ganzen Tag vor sich hin. Als er zu meiner Studienabschlussfeier kam – 1992, da war er dreiundneunzig –, hatte er am Vortag nicht den Rasen gemäht, um besonders frisch zu sein. Ich glaube, er war zufrieden. Eine schöne Seinsweise, die Zufriedenheit. Bis zum Schluss hatte er volles Haar. Ein hübscher Mann.
Je älter er wurde, desto stärker prägte sich sein Schwimmbeckengang aus. Ich weiß, dass mancher versucht hat, diesen Schwimmbeckengang nachzuahmen oder herauszufinden, was genau ihn ausmachte, aber mein Großvater ging ganz automatisch so. Die Schultern leicht nach vorn, das Kreuz ein wenig hohl und dann mit den Armen weit nach hinten ausholen und mit den Händen die Luft wegschieben, als wäre sie Wasser. Das hat ihm bis ins hohe Alter eine sehr energische Ausstrahlung verliehen; er schien immer zielstrebig irgendwohin unterwegs zu sein. Mein Vater hat diesen Schwimmbeckengang zur Hälfte: die Schultern nach vorn gezogen und das Kreuz hohl, aber er wedelt nicht mit den Armen und schiebt erst recht nicht mit den Händen die Luft weg. Streng genommen hat er also gar keinen Schwimmbeckengang. Ich werfe manchmal einen Blick auf mein Spiegelbild, wenn ich an einer großen Scheibe vorbeigehe. Noch längst nicht die Haltung von Opa oder Vater.
Ich fürchte, ich habe viel mehr Ähnlichkeit mit meiner Oma als mit meinem Opa. Oma war zum Beispiel imstande, einen Pullover, den sie für mich strickte, sofort aufzuräufeln, als sie hörte, dass ich mit meiner Freundin Joke für ein Wochenende nach Paris fahren würde. Ihn aufzuräufeln und dann einen anderen Pullover zu stricken, mit einem anderen Muster, für einen meiner Brüder. Nach Paris, was denn noch? Für wen hielt ich mich eigentlich? Einen neuen Pullover hatte ich jedenfalls nicht verdient. Trotzdem liegen in meinem Kleiderschrank noch mindestens fünf von meiner Oma gestrickte Pullover. Sie sind unverwüstlich, modemäßig aber auch untragbar. Freitags mittags bereitete sie eine besonders große Portion Milchreis mit roter Grütze zu, damit ich den Rest aufessen konnte, wenn ich auf dem Heimweg von der Schule mit dem Rad bei ihnen vorbeikam. Ich aß, sie strickte, Opa redete. Sie war streng. So streng, dass Opa ein paar Wochen nach ihrem Tod glaubte sagen zu müssen: »Ihr habt sie im Grunde schlecht gekannt, wir haben immer so viel zusammen gelacht.« Man durfte auch nicht etwa erwähnen, dass man sich in Schagen Süßigkeiten gekauft hatte, das kostete einen mindestens ein Paar warme Socken. Ihr Butterkuchen schmeckte ganz anders als der meiner Mutter, was am Ingwer lag, mit dem sie ihn würzte. Und wenn man ein wenig zu früh kam, war ihr Mittagsschläfchen noch nicht beendet, und sie verließ das Schlafzimmer mit offenem Haar wie ein junges Mädchen. Meine Oma musste ihr Haar zweimal am Tag zu einem Knoten hochstecken. Ziemlich viel Arbeit, dachte ich damals.
Sie war sehr stolz. In der Zeit, als ich das Haus des Metzgers in Barsingerhorn anstrich, aß ich mittags mein Butterbrot bei meinen Großeltern. Ich hatte gedacht, es wäre doch nett, meiner Oma an meinem letzten Arbeitstag eine Schachtel Pralinen zu schenken. Es fehlte nicht viel, und sie hätte die Schachtel nach dem Auswickeln quer durchs Zimmer geworfen. Wie ich nur auf so eine Idee kommen könne. Sie befahl mir, die Pralinen wieder mitzunehmen und selbst zu essen oder sie jemand anderem zu schenken. Als sie starb, hatten wir gerade Streit. Sie wusste, dass ich Zopfmuster nicht mag, trotzdem strickte sie mir einen Pullover mit Zopfmuster. »So gefällt er mir aber nicht«, sagte ich. Sie wurde wütend. Räufelte den Pullover zwar nicht auf, strickte aber auch nicht weiter und bekam wenig später einen Herzinfarkt. Im Krankenhaus wollte sie niemanden mehr sehen. »Ich liege hier gut«, soll sie gesagt haben. Bei der Beerdigung habe ich heftig geweint. Wegen des Streits, wegen dieses Pullovers mit Zopfmuster und natürlich, weil sie nicht mehr da war. Ihre Schwester, Großtante Jans, ist im vergangenen Jahr gestorben. Hundertfünf ist sie geworden. Und sie war genauso streng (»scharf« sagt man in Westfriesland) wie meine Oma. Boven is het stil war ihrer Ansicht nach ein schlechtes Buch, weil ich alles erlogen hätte.
4. Dezember [Schwarzbach]
Wegen Opa Keppel ist mein Vater schon einmal gestorben. Ich wohnte damals in Leeuwarden, in einem alten Haus über einem Secondhandladen, ohne Telefon. In dem geräumigen Keller unter dem Laden lagen in einer Schicht Wasser große Haufen ausgemusterter Klamotten aus wer-weiß-wievielter Hand. Meine Mutter hatte für den Notfall eine Telefonnummer, vom Studentenklub Wolwêze, in dem ich alle zwei Wochen hinter der Theke stand. Eines Tages klingelte jemand bei mir, den ich flüchtig von der Akademie kannte.
»Dein Vater ist tot«, sagte er.
»Was?«, sagte ich.
»Dein Vater ist tot«, wiederholte er.
»Wie ist das möglich?«, fragte ich. Glaube ich. Kann sein, dass ich sogar »Warum?« gefragt habe.
Er wusste es nicht. Ob ich zum Klub mitkommen könne, fragte er, und meine Mutter zurückrufen. Er sah unglücklich und gehetzt aus und konnte mir im Grunde nichts weiter sagen. Ich wollte eigentlich nicht mitkommen, ich wollte auf der Treppe sitzen bleiben. Schließlich bin ich doch hinter ihm hergetrottet und habe meine Mutter angerufen. »Wie ist das denn möglich?«, fragte ich. Während meine Mutter ihre Antwort formulierte, wurde mir klar, dass sie von ihrem Vater sprach und auch gegenüber dem jungen Mann das Wort »Vater« gebraucht hatte, daher das Missverständnis. »Gott sei Dank!«, rief ich. Das überhörte sie, aber später wurde mir ganz warm, wenn ich daran dachte. Zu seiner Mutter »Gott sei Dank« zu sagen, wenn ihr Vater gestorben ist – unverzeihlich. Jedenfalls war mein Vater nicht tot. Trotzdem weiß ich, wie es sich anfühlen wird, sollte es jemals so weit sein.
Als ich das Haus von Opa und Oma Keppel an der langen, leeren Straße zum letzten Mal betrat, kam ich, um Opa in seinem Sarg zu sehen. Es war ein Bauernhaus mit rotem Ziegeldach, genau wie das in einem halben Kilometer Entfernung. Überall auf dem Polder standen und stehen diese völlig gleichen Bauernhäuser. Von der Trauerfeier vor der Einäscherung ist mir kaum etwas im Gedächtnis geblieben. Gänse, an die glaube ich mich zu erinnern, eine riesige Schar schwarzweißer Gänse landete auf der Wiese, die man durch das große Fenster sah, das heißt, wenn man einmal nicht den Sarg anschaute. Es war Anfang der achtziger Jahre, und ich war todunglücklich in Leeuwarden, einer Stadt, die ich bis heute am liebsten meide.
Seine Enkel bedeuteten Opa Keppel nicht besonders viel. Wahrscheinlich reichten ihm schon seine drei Kinder aus erster Ehe, von der davongelaufenen Frau. Ich erinnere mich, dass ich ihn ein paarmal nach Den Helder zu Versammlungen der Heilsarmee begleitet habe, der mein Onkel Piet angehörte. Wenn dann Humtata-Musik gespielt wurde – ohne Humtata keine Heilsarmee –, blieben Opa und ich stur sitzen, während ringsum alle aufstanden. Ansonsten gab es kaum ein Gefühl der Verbundenheit. Er rauchte knochentrockenen Shag aus einer großen Dose und trank Jonge Jenever und blickte durch ein großes Fenster auf das quälend leere Land des Wieringermeer-Polders. Er hatte einen Mischbetrieb, riesige Schweine standen in einem kleinen Stall.
Ich weiß nicht, was für ein Leben Opa und Oma Keppel miteinander hatten. Oma Keppel schimpfte uns aus, wenn wir löchrige Hosen trugen – was sollten die Leute von unserer Mutter denken? Nachdem der Kontakt abgebrochen war, bin ich ihr noch einmal in Amsterdam begegnet, bei einer Ballettaufführung von einer meiner Cousinen. Oma Keppel fragte, wie es mir ging, weil sich das so gehört. »Gut«, antwortete ich, »Studium abgeschlossen und jetzt Sozialhilfe.« Sie brummte irgendetwas in sich hinein und sagte dann, ich sollte besser mal arbeiten, denn irgendwann käme nach der Sozialhilfe die Rente, und dann wäre ich bald tot, das ginge schneller, als man denkt. Sie gab sich die größte Mühe, nicht auf meine Kleidung zu achten. Eine mürrische Frau, groß und grobgliedrig, wahrscheinlich hat sie es mit sich selbst schwer genug. Sie muss inzwischen fast Mitte neunzig sein – sie war erheblich jünger als mein Opa –, ich weiß, dass sie ein neues Hüftgelenk hat. Und das Witzige ist, dass auch ich nicht gerade ein besonders heiterer Mensch bin; wenn man nicht wüsste, dass sie nur meine Stiefoma ist, könnte man glauben, ich hätte meine mürrische, abweisende Art von ihr geerbt. Ich weiß, dass Opa sich für seine Trauerfeier Drehorgelmusik gewünscht hatte, aber etwas anderes bekam, weil Oma keine Drehorgelmusik hören wollte. Irgendwann habe ich geschrieben, meiner Erinnerung nach sei We'll meet again von Vera Lynn gespielt worden. Dass ich mich jetzt auf diese Behauptung stützen muss, macht ihren Wahrheitsgehalt noch fragwürdiger. Sie hatten eine Zeitlang einen Deutschen Schäferhund, der in den Hinterläufen einknickte, wie bei dieser Rasse üblich, und so angestrengt ich auch nachdenke, einen Namen kann ich dem Tier nicht mehr geben. Einem Gerücht zufolge pflegte Oma Keppel verwaiste Küken zwischen ihren Brüsten zu wärmen, und einmal soll ein Probenehmer sie so gesehen haben. Aber das ist eben nur ein Gerücht.
»Probenehmer« – dies für die Nichtlandwirte unter den Lesern – waren meist männliche, nur selten weibliche Behördenmitarbeiter, die milchproduzierende Höfe aufsuchten und die Menge und vor allem Qualität der Milch prüften. Noch heute tun sie das, allerdings nur bei den Landwirten, die nicht mit einem Melkroboter melken, denn der Roboter nimmt selbst Proben. Ein Landwirtschaftsberuf, der wirklich ausgestorben ist, ist der des »Zeichners«. Der kam, wenn ein Kalb geboren worden war, und hatte ein Buch, das für jedes Kalb drei vorgedruckte Umrisse enthielt: beide Seiten und den Kopf. Er zeichnete das (schwarz- oder rotbunte) Kalb so genau wie möglich, damit auch die ausgewachsene Kuh jederzeit identifiziert werden konnte. Der Zeichner stand im Dienst des Zuchtverbands, er zeichnete also nur Herdbuchvieh. Nichtherdbuchvieh konnte, ohne je irgendwo verbucht worden zu sein, verkauft werden oder geschlachtet oder was auch immer. Der Zeichner ist durch große, hässliche Marken in den Kälberohren ersetzt worden. Wäre ich fünfzig Jahre früher zur Welt gekommen, hätte ich sicher gedacht: Was für eine wunderbare Arbeit, das Kälberzeichnen.
5. Dezember [Schwarzbach]
Letztes Jahr habe ich am 6. Dezember in der Filiale der Volksbank in Bitburg einen Nikolaus gesehen, wie Sinterklaas hier heißt. Ganz seltsam kam mir das vor, wie Schnee im August oder ein Kaktus am Südpol. Gestern sagte mir mein Nachbar Klaus, dass natürlich auch in Deutschland Nikolaus gefeiert werde. »Mit Zwarte Pieten?«, fragte ich. Er schaute mich groß an und sagte: »Nein, mit Knecht Ruprecht.« Ob der denn auch schwarz sei, wollte ich wissen. »Manchmal ja«, sagte Klaus. »In den Niederlanden bekämpft man sich gerade bis aufs Blut wegen Zwarte Piet«, erklärte ich. »Schwarze als Knechte, so was geht nicht mehr, meinen viele, das ist rassistisch. Ist das hier kein Thema?« Ist es nicht. Nachbar Klaus fügte aber noch verschmitzt hinzu: »Nur wenn Knecht Ruprecht Jude wäre, dann wär was los.« Klaus spottet gern über den Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit. Im letzten Sommer fand ich im Wald einen Umschlag mit Passfotos. Ein älterer Mann, der sich offensichtlich groß in Szene gesetzt hatte. Ich zeigte Klaus die Fotos und die Telefonnummer auf dem Umschlag. »Düsseldorf«, sagte er und schaute sich die Fotos noch einmal genauer an. »Er hat all seine Nazi-Orden angelegt.«
Ich fragte, ob Knecht Ruprecht von den Schornsteinen schwarz wird.
Klar.
Außerdem wollte ich wissen, wo der Nikolaus wohnt.
Darüber musste Klaus erst einmal nachdenken. »Am Nordpol«, sagte er schließlich.
»Ach was«, sagte ich, »in Spanien.«
»Spanien? Was hat er denn da verloren?«
»Na ja«, sagte ich, »ein bisschen Urlaub machen, auftanken fürs nächste Jahr.«
»Nein«, entschied Klaus, »der Nikolaus wohnt am Nordpol.«
»Aber da wohnt doch schon der Weihnachtsmann!«, sagte ich.
»Ja, aber Nikolaus und Weihnachtsmann, ist das denn nicht dasselbe?«
Deutsche. Die lassen sich keine Gelegenheit entgehen, etwas zu feiern und frei zu haben. Regelmäßig sind die Geschäfte hier wegen irgendeines mir völlig unbekannten katholischen Feiertags geschlossen. Ich brach mein Verhör ab, fragte Klaus nicht, ob er glaubt, dass Sinterklaas zum Nordpol zurückkehrt, sich umzieht und drei Wochen später wiederkommt, um noch einmal alle mit Geschenken zu überhäufen.
Heute Abend läuft in den Niederlanden Boven is het stil im Fernsehen. Ich habe hier eine Schüssel, mit der ich nicht weniger als tausendachthundert Sender völlig umsonst empfange. Der einzige niederländische ist BVN, und so bestimmt BVN, was ich als Expat zu sehen bekomme. Ziemlich viele für mich unverständliche flämische Sendungen und fast nie einen Film. Aber ich habe aus Amsterdam die DVD mitgebracht, und so werde auch ich heute den Film sehen, aber nicht erst um 23:55 Uhr wie auf NPO 2. Da dürfte wohl so mancher vor dem Fernseher einnicken.
Ich habe mich in nichts eingemischt. Irgendwann habe ich eine Version des Drehbuchs gelesen, weil Regisseurin Nanouk Leopold mich darum bat. Dazu geäußert habe ich mich kaum. Ich sehe die Sache so: Ich habe ein Buch geschrieben, und jetzt macht eine Filmemacherin einen Film, der auf dem Buch beruht. Ich verstehe nichts vom Filmemachen, kann kaum ein Drehbuch lesen, das heißt nicht die Bilder dahinter sehen. Bei Lesungen antworte ich auf Fragen zum Film (es wird gern nach meiner Einstellung dazu gefragt), dass ein Buchautor bei einer Verfilmung nie verlieren kann. Ist der Film gut und hat Erfolg in den Kinos, bedeutet das noch mehr Interesse am Buch, also vielleicht noch mehr verkaufte Exemplare, und der Autor ist glücklich. Ist der Film kein kommerzieller Erfolg und in den Augen von Kritikern und Kinobesuchern misslungen, steht also in allen Kritiken, das Buch sei viel besser, ist der Autor ebenfalls glücklich. Ich begreife wirklich nicht, warum Tommy Wieringa vor ein paar Jahren wegen des Drehbuchs nach Joe Speedboat einen solchen Aufstand gemacht und sogar gegen die Verfilmung geklagt hat. Das Ergebnis war: kein Film. Ich kann mir gut vorstellen, dass Filmproduzenten in Zukunft lieber die Finger von seinen Büchern lassen. Er hat sich ins eigene Fleisch geschnitten.
Als dann tatsächlich die Dreharbeiten begannen, in Seeländisch-Flandern, dachte ich: So etwas passiert mir wahrscheinlich kein zweites Mal. Muss ich diese Gelegenheit nicht beim Schopf packen? Und so schickte ich Nanouk, die ich inzwischen etwas näher kennengelernt hatte, eine Mail mit der Bitte, eine kleine Rolle spielen zu dürfen. Ohne Text. Ihr gefiel die Idee, und als wir beide unabhängig voneinander die gleiche Rolle vorschlugen, war die Entscheidung gefallen. Ein paar Stunden habe ich mich deshalb als Bettenlieferant betätigt und bin dabei ziemlich ins Schwitzen gekommen, denn Nanouk hält nicht viel von Proben, so dass Marc van Uchelen, der Hauptbettenlieferant (mit Text), und ich, ohne jemals ein Auping-Bett zusammengebaut zu haben, ein Auping-Bett zusammenbauen mussten. Nanouk hält nämlich viel von der Lass-die-Kamera-laufen-ich-kann-immer-noch-Cut-rufen-Methode. Im fertigen Film sind von alldem vielleicht zehn Sekunden übrig. Und natürlich habe ich auch nicht moniert, dass es sich um ein Auping-Bett handelte, während im Buch von einem noch teureren Bett die Rede ist, einer skandinavischen Marke mit einem ä darin. Es war ein unwirklich schöner Märztag, um die fünfzehn Grad, Sonne, wenig bis kein Wind und grelles Licht. So grell wie nur im März, wenn die Bäume noch ohne Blätter sind und nichts das Sonnenlicht schluckt. Das Catering-Essen war sehr lecker. Jeroen Willems trat sich die Gummistiefel von den Füßen und legte sich in dem Raum, in dem sämtliche Schauspieler und die Crew-Mitglieder redeten und aßen, aufs Sofa, um ein Nickerchen zu machen. Manche Menschen können das: so tun, als wären alle anderen gar nicht da, und sich vollkommen entspannen.
Im Oktober 2012 sah ich den Film zum ersten Mal, in einem kleinen Saal irgendwo in Amsterdam. Eine Rohfassung, mit Musik von Philip Glass (auf die man später aus Kostengründen verzichten musste), blassen Farben und französischen Untertiteln, weil er kurz zuvor einem französischen Verleiher vorgeführt worden war. Jeroen Willems saß schräg hinter mir und verhielt sich reichlich ablenkend. Er seufzte und räusperte sich, lachte in den seltsamsten Momenten, manchmal stöhnte er auch, und er konnte nicht stillsitzen. Ich schaute und las – das kann ich nicht lassen – die für mich unverständlichen französischen Untertitel. In der Anfangsszene war ein paarmal der Ruf eines Fasans zu hören gewesen, und ab da war ich zuversichtlich, dass alles gut werden würde. Allmählich wurde mir klar, dass es für einen Hauptdarsteller eine schwere Prüfung sein muss, die erste Fassung des fertigen Films zu sehen. Er sieht weniger das, was er sieht, als das, was er nicht sieht, er denkt an all die wunderbaren Szenen, die geopfert wurden, er spürt, wie viel Arbeit ganz umsonst investiert wurde. Er kann den Film einfach nicht so sehen, wie er ist; was er sieht, kann sogar wehtun. Wenn ein Verlagslektor ein Romanmanuskript völlig umarbeiten, ganze Kapitel streichen, dafür neue schreiben, Personen eliminieren und andere einführen, den Schauplatz der Handlung ändern würde – einen Autor könnte das in den Wahnsinn treiben.
»So etwas passiert mir wahrscheinlich kein zweites Mal«, das ist schon überholt. Im Augenblick schreibt jemand die zweite Version einer Drehbuchfassung von De omweg, gefördert vom Filmfonds. Ich mische mich wieder nicht ein und weiß auch, dass vielleicht am Ende gar kein Film gedreht wird. Wenn doch, hätte ich aber wieder Lust auf eine kleine Rolle, mit etwas weiterer Anreise als nach Seeländisch-Flandern. »Und diesmal mit Text«, wie Els Vandevorst, eine der Produzentinnen, gedroht hat.
Anlässlich des Nederlands Film Festival in Utrecht 2013 sollte ich etwas über Jeroen Willems schreiben, für eine Gedenkveranstaltung. Ich sträubte mich mit dem Argument, dass ich ihn kaum gekannt habe. Man drängte mich, und ich ließ mich überreden. Im Fernsehen wird jedes Jahr der Abschlussabend übertragen, an dem die Goldenen Kälber überreicht werden. Ich saß vor dem Fernseher und sah und hörte alles Mögliche, aber was nicht kam, war mein Text:
Wir aßen an langen Tischen auf der Bühne des Rabo-Saals in der Stadsschouwburg Amsterdam. Auf einem behelfsmäßigen Podium sang Jeroen Willems, begleitet von fünf Musikern. Orfeo von Monteverdi, aber nach Willems-Art. Hinterher sagte eine gemeinsame Freundin: »Ich stelle dich ihm mal vor.« »Nein!«, rief ich, »ich bin überhaupt nicht interessant für ihn.« Ich war interessant für ihn. Er kam mir sehr nah und fragte: »Wie fandest du's?« Gespielt nervös, glaube ich. »Ich fand's gut«, antwortete ich, wirklich nervös.
Ein paar Monate später verkörperte er Helmer. Groß, gebräunt, selbstbewusst stolzierte er in Siebenmeilenstiefeln herum. »Hat man dich so gut geschminkt?«, fragte ich. Es war März. Er lächelte schief, ohne zu antworten. Ich spielte eine winzige Nebenrolle, und mir war speiübel vor Nervosität. Wieder kam er mir sehr nah, obwohl er gar nicht in meiner Nähe war. Nach dem Mittagessen schwätzten alle munter drauflos, und er legte sich auf das einzige Sofa im Raum. Ohne Stiefel, aber in den Helmer-Sachen. Er war ein Schauspieler. Groß war er. Ruhen wollte er.
Wieder ein paar Wochen später wurde eine Abendszene mit Kunstschnee aufgenommen, außerdem eine Making-of-Szene. Von mir verlangte man ohne Vorankündigung, ihn zu interviewen. »Davon hat mir keiner ein Wort gesagt!«, protestierte ich. Nie zuvor kamen wir uns so nah. Diesmal auch physisch, ich hatte das Gefühl, dass er sich auf Fußballen und Zehen mir zuneigte. Jeroen Willems konnte in einen hineinkriechen. Dem musste man dann einfach etwas gegenüberstellen. Vielleicht – ich bin ja kein Schauspieler – war es das, was ihn so gut machte. Nie zuvor habe ich mich selbst jemanden so anschauen sehen, wie ich ihn anschaute, als ich einen Bettenlieferanten spielte. Und vor ihm stand. Es war einfach unglaublich. Weil er das natürlich bei jedem bewirken konnte: Ganz gleich, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin vor ihm stand, sie mussten seiner Präsenz etwas gegenüberstellen.
10. Dezember [Schwarzbach]
Ich habe Besuch. Wenn ich Besuch habe, kann ich nichts mehr. Ich muss irgendwann lernen, einfach mein eigenes Leben weiterzuleben. Jetzt kann ich mich nicht rasieren, nicht wie gewohnt duschen, telefonieren ist unmöglich, weil ich mich ständig mit meinen Besuchern beschäftige, ganz konkret, aber auch geistig. Es gelingt mir nicht, mich innerlich abzugrenzen. In diesem Moment fahren meine Besucher mit dem Auto nach Trier (»Unternehmt doch mal was Schönes zu zweit!«, hatte ich gesagt). Gerade war ich anderthalb Stunden mit Jasper unterwegs, und jetzt tippe ich. Dummerweise kann ich Geschehenes nur allein verarbeiten, und wenn ich Besuch habe, geschieht natürlich ständig etwas, das ich verarbeiten will und muss, aber nicht kann, weil ich Besuch habe. Mich zu entspannen ist gar nicht oder bestenfalls ab etwa fünf Uhr möglich, wenn Alkoholisches auf den Tisch kommt. Und eine Nacht zu schlafen reicht nicht, vor allem, wenn beim Frühstück wieder nett geplaudert wird. Nach vier Tagen stehe ich dann manchmal kurz davor zu platzen: So vieles kommt herein, so viele Reize, und alles häuft sich unverarbeitet an. Das habe ich eben wieder an meinem Verhalten gegenüber dem Hund gemerkt. Ich habe geschimpft und geflucht, ihn vorwärtsgezerrt, ihm sogar einen Klaps auf den Hintern gegeben, weil er in der Nähe des Hauses hinter zwei Rehen her wollte, während ich genau das nicht wollte. Manchmal stelle ich mir vor, was es bedeutet, verheiratet zu sein, für jemanden wie mich, meine ich. Eine Katastrophe wäre das, Tag und Nacht auf Tuchfühlung. Niemals Ruhe, immer reden müssen. Ich glaube ein ähnliches Problem auch bei Maarten Koning aus Voskuils Romanzyklus Das Büro zu erkennen. Koning muss fortwährend psychologisieren, durchschaut fast immer, was er tut und warum, aber dass er allein sein muss, um Erlebtes zu verarbeiten, das begreift er dann wieder nicht. Ich lese zum vierten Mal Band vier, weil ich Band drei gelesen habe, um ein Nachwort für die deutsche Ausgabe schreiben zu können. Das ist das Schlimme an einem Romanzyklus, ist man einmal drin, muss man irgendwie wieder raus, und in meinem Fall bedeutet das schlicht und einfach, bis zum Schluss von Band sieben weiterzulesen. Der Hund wird übrigens ein bisschen mager. Da er normal frisst und anscheinend nicht krank ist, vermute ich, dass er Würmer hat. In zwei Tagen bin ich wieder in Amsterdam, dann besorge ich Wurmmittel. Heute ist trübes Wetter, Nieselregen, fast kein Wind, um die vier Grad. Das ungünstigste Wetter überhaupt für Holzöfen, die ziehen dann nämlich sehr schlecht.
15. Dezember [Schwarzbach]
Wieder in der Eifel nach ein paar Tagen Amsterdam und Wieringerwaard. Jasper hat inzwischen zwei Wurmtabletten bekommen (und bekommt am 1. Januar zwei weitere, damit auch die Eier der jetzt getöteten Würmer absterben), und ich habe fünf Exemplare der Jubiläumsausgabe von Boven is het stil abgeholt. Es ist die fündundzwanzigste Auflage, das steht zumindest im Impressum. In Wirklichkeit ist es schon die siebenundzwanzigste, aber damit braucht man die Leser ja nicht zu verwirren. Gestern hat meine Mutter, obwohl sie das Lebensjahr erst am 17. vollendet, ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert. Mit einem Brunch bei Van der Valk in Wieringerwerf. Alles ging gut, niemand trank zu viel, niemand musste sich übergeben, es gab keinen Streit. Die beiden Labradorwelpen meines ältesten Bruders zerkratzten mir den Kopf, was aber meine eigene Schuld war. Nach dem Brunch sind mein »deutscher« Bruder, sein Sohn und ich noch zu unserem ältesten Bruder gefahren, damit Jasper (der im Haus meiner Eltern geblieben war) Romeo und Julia kennenlernte, so heißen die Welpen. Tatsächlich wollte mein Bruder zwei und nicht einen Labrador haben, um sie Romeo und Julia nennen zu können. Das Zusammentreffen war ein Erfolg, wenn man Jasper auch anmerkte, dass ihm zwei von diesen schwarzen Hündchen im engen Raum der Garage ein bisschen viel waren. Draußen fühlte er sich wohler mit ihnen. Mein Hund muss lernen, mit Labradoren umzugehen, denn er hasst sie aus tiefstem Herzen. Was zur Folge hat, dass ich selbst sie plötzlich viel weniger mag als früher. Um ehrlich zu sein, finde ich sie einfach blöd und ihre Herrchen und Frauchen vielleicht noch blöder, vor allem, wenn sie meinen, dass ihre Hunde mitten in der Stadt »doch auch mal frei laufen können müssen«. Peter und Maria aus Nimshuscheider Mühle, dem Dorf jenseits der Brücke, haben einen schwarzen Labrador, Ben, der mindestens 45 Kilo wiegt. Peter will einfach nicht wahrhaben, dass Ben und Jasper sich nicht vertragen, deshalb versucht er es immer wieder. Wenn er uns von weitem sieht, kommt er mit Ben auf uns zu, ohne ihn anzuleinen. Irgendwann werde ich noch sehr laut »Scheiße!« schreien und Peter sagen, dass er zwar wirklich ein netter Kerl ist, aber hiermit aufhören muss, weil es mich richtig wütend macht. Nimshuscheider Mühle besteht aus zwei Straßen, der Bergstraße und der Talstraße. Das nenne ich übersichtlich.
Ich bin mit meinem deutschen Bruder zurückgefahren, für ihn ein Umweg von gut zwei Stunden. Ungefähr bei Utrecht wurde es schnell dunkel; Jasper und ich dösten auf dem Rücksitz ein und wachten erst kurz hinter der belgisch-deutschen Grenze auf, wo der Wagen von zwei Polizeibeamten angehalten wurde. Als mein Neffe, der am Steuer saß, sagte, dass wir aus Holland kamen, mussten die beiden das Auto verlassen. Auch mein Rucksack musste es verlassen, aber als ich selbst mit Jasper ausstieg (ich dachte, ich könnte die Gelegenheit zum Rauchen nutzen und den Hund pinkeln lassen), wurde ich von einem der Polizisten angeschnauzt. »Einsteigen, aber schnell«, sagte er. »Den Hund hier auf der Autobahn pinkeln lassen wollen!« Vorher hatte er schon erklärt, er werde Jasper die Kehle durchschneiden, wenn der ihn beiße. Mein Neffe hielt neben dem Wagen meinen Rucksack auf, während der freundliche Polizist (er hatte wenigstens gefragt: »Kann ich ihn streicheln?«, als Jasper ihn anbellte) alles herausholte und auf dem nassen Asphalt ablegte. Ich beobachtete den Vorgang genau und verstand überhaupt nichts. Das war doch mein Rucksack, wieso musste ich dann im Wagen bleiben? Als sie fertig waren, öffnete ich doch noch kurz die hintere Tür und fragte vorwurfsvoll: »Wo ist mein Ausweis, bitte?!« Mein deutscher Bruder hatte zwölf Laibe Edamer im Kofferraum und ich zehn Päckchen Van Nelle Stevige Shag im Rucksack, aber dafür interessierten sich die Beamten nicht. »Sag bloß nie wieder, dass wir aus Holland kommen!«, ermahnte mein Bruder seinen Sohn.
Um richtig anzukommen, habe ich heute eine Maschine Wäsche gewaschen, ein Brot gebacken und den Briefkasten, den mein Vater für mich gebaut hat, an die Wand geschraubt. Ganz gerade dank Wasserwaage. Trübes Wetter, Nieselschnee. Aus den Niederlanden habe ich sechs Exemplare Komische Vögel mitgebracht, die kann ich hier gut als Weihnachtsgeschenke verteilen. Das Original hat den Titel Ezel, schaap en tureluur, was übersetzt Esel, Schaf und Rotschenkel heißt, aber das fand mein Übersetzer Andreas Ecke wohl klanglich nicht so ansprechend.
17. Dezember [Schwarzbach]
Offenbar habe ich in diesem Buch schon jetzt gelogen. Da ich am Samstag vor der Geburtstagsfeier meiner Mutter in Wieringerwaard übernachtet habe, konnte ich sie nach dem zweiten Mann ihrer Mutter fragen. So erfuhr ich, dass gar nicht er, sondern der Vater der Mutter meiner Mutter NSB-Mann gewesen ist. Meine Mutter ist also die Enkelin eines Nazis. Davon habe ich nie etwas gemerkt, und es spielt auch gar keine Rolle, weil niemand eine liebere Mutter hat als ich. Das erwähnte schwarze Schaf ist schon das einzig Besondere an meiner Familie, ansonsten findet man, egal, wie weit man zurückgeht, nur ganz gewöhnliche, hart arbeitende Menschen. Keine Urgroßmütter, die aus Estland oder Tschetschenien geflohen wären, keine Großonkel, die an der Côte d'Azur ein Bordell betrieben hätten, keine Tanten mit drei unehelichen Kindern. Sondern Bauern, Bäcker, Zimmerleute. Wenn man es sich recht überlegt, bin ich das schwarze Schaf, the odd one out. Aber auch wieder nicht wirklich, seit sich gezeigt hat, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Mit Schreiben, meine ich.
Seit kurzem schreibe ich wieder für den Groene Amsterdammer. Alle drei Wochen einen Artikel für die Website. Dafür zahlt man mir genauso viel wie vor ein paar Jahren für meine wöchentliche Kolumne in der Printausgabe. Kein großzügiges Honorar, bei De Groene ist man weiterhin der Ansicht, dass es eine große Ehre sei, für diese Wochenzeitschrift schreiben zu dürfen. Sie war, ist und bleibt ein elitär-linkes Blatt. Ich leiste mir schon seit langem eine eigene Meinung. Vor zwei Wochen habe ich einen Artikel über die Musical-Version von Billy Elliot geschrieben und heute Vormittag über zwei Eisschnellläufer, deren Verhalten mich oft ärgert. Artikel, die wiederum so manchen ärgern werden.
Warum ich das tue (mir eine Meinung leisten), ist mir noch nicht ganz klar. Seit ich mich vor mir selbst ekle, vor meinem Selbst ungefähr seit dem Jahr 2007 – besonders, wenn ich die alten Texte aus meinem Blog lese –, wollte ich eigentlich keine Meinung mehr haben. Nein, so ist es natürlich nicht, eine Meinung hat man immer, aber die äußere ich beispielsweise bei einem Essen mit Freunden, manchmal fluchend und tobend. Ich meine eine Meinung in der Öffentlichkeit. Nach wie vor habe ich Meinungen ziemlich satt, was natürlich nicht zuletzt an Facebook und Twitter liegt, den virtuellen Orten, an denen Leute ihre Meinungen öffentlich äußern können. Und das tun dann auch fast alle. Ich mache sehr oft »pfff«, wenn ich am Computer sitze. Bei Dingen, die ich selbst schreibe, möchte ich nicht »pfff« machen müssen, deshalb.
Zu dem ersten Artikel twitterte gleich jemand »Jetzt schon eine phantastische Rezension von Billy Elliot« (der Artikel erschien am Premierentag). Sieh an, dachte ich, so ist das: Kaum macht man den Mund auf, bekommt man schon Zustimmung. Ich meine: Wenn jemand ein großes Maul hat und eine deutliche, am besten verquere Meinung äußert, folgt man ihm auf Twitter, wenn er aber dann den Mut findet, seine Äußerung in einer Fernsehtalkrunde zu relativieren oder gar zurückzunehmen (obwohl er doch wegen des Provokanten daran eingeladen wurde), war das sein letzter Auftritt. »Den wollen wir nicht.«
Neulich war ich bei Jacobine Geel in ihrer Sendung Het hoogste word, »Das große Wort«, zu Gast. Wie dabei üblich musste ich einen Bibeltext als Gesprächsthema auswählen. Ich schwitzte Blut und Wasser, weil ich doch nicht gläubig bin. Schließlich kam ich mit ein wenig Unterstützung auf »Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.« Ich hoffe, habe immer schon gehofft, dass es wahr ist. Dass es wirklich dazu kommen kann. Ich durfte es sogar noch auf Englisch sagen: »Blessed are the meek, for they shall inherit the Earth.« Das klingt schöner, man hört gleich eine dieser dunkelbraunen Stimmen im Trailer eines amerikanischen Films.
18. Dezember [Schwarzbach]
BVN hat netterweise auch das Groot Dictee ausgestrahlt, das jährlich veranstaltete große Rechtschreibturnier des niederländischen Sprachgebiets. Das verstehe ich: Niederländer in der Diaspora haben Heimweh, das mit den Jahren zunimmt. Angeblich gibt es in Australien oder Kanada Alzheimerpatienten, die irgendwann nur noch Niederländisch sprechen können, selbst wenn sie schon vor sechs Jahrzehnten ausgewandert sind und nicht geahnt haben, dass all die seltsamen Wörter und Sätze noch irgendwo in ihrem Hinterkopf hausen. Wie immer machte ich viel mehr Fehler als der Durchschnitt, angefangen mit dem Wort dictee, das großgeschrieben werden musste. Verrückt. Es war ein Jubiläumsdiktat, das fünfundzwanzigste. In diesem ganzen Vierteljahrhundert wird es von dem Nachrichtenmoderator Philip Freriks präsentiert, und seit ich es sehe und entweder mitmache oder nicht, frage ich mich, warum das so ist. Freriks kann es zum Beispiel nicht lassen, mindestens ein Wort absichtlich falsch auszusprechen. Außerdem macht er beim Vorlesen völlig überflüssige Bemerkungen, so dass man leicht den Faden verliert. »Halt doch die Schnauze!«, rufe ich dann dem Fernseher zu. Ich habe, vorsichtig ausgedrückt, nicht sehr viel für Freriks übrig. Und das hat seinen Grund: Ich bin jemand, der bestimmte Dinge niemals vergisst. Niemals. Jacobine Geel stellte die unvermeidliche Frage: »Wie sanftmütig bist du selbst?« Ich dachte kurz nach und konnte nur antworten: »Ich gebe mir Mühe, mehr kann man nicht tun.«
De omweg stand 2011 auf der Shortlist des Libris-Literaturpreises. Ich freute mich irrsinnig darüber und wartete ganz aufgeregt im Hotel Krasnapolsky darauf, mit den anderen Nominierten zur offiziellen Vorstellung der Shortlist in der Nieuwe Kerk abgeholt zu werden. Dafür ist immer René Appel zuständig, der ist der sanftmütigste Abholer der Welt. Peter Buwalda schaute mich fassungslos an. Warum so froh, fast erleichtert, warum so gerührt? »Ach Mann«, sagte ich, »von dir ist gerade mal ein Buch erschienen.« Der Vorsitzende der Jury war in dem Jahr Philip Freriks. Nach dem offiziellen Teil der Vorstellung gab es noch einen kleinen Umtrunk und Imbiss. Irgendwann landete ich an einem Stehtisch, an dem auch Freriks stand. Oder er kam zu uns an den Tisch, da bin ich mir nicht sicher. Zuerst erkannte er mich nicht (wohlgemerkt nach der Vorstellung, die mindestens eine halbe Stunde gedauert hatte), und als er dann wusste, wer ich war, verpasste er mir gleich den ersten Schlag. De omweg gefiel ihm nicht. »Ich bin da auf allerlei seltsame Wörter gestoßen«, sagte er. »Kissing gate, stile, ich habe nur Bahnhof verstanden und nicht weitergelesen.« Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, was danach noch so alles gesagt wurde, nur dass die Wörter frankophil (Freriks) und anglophil (Bakker) vorkamen. Und das war nun der Vorsitzende der Jury, die darüber entscheidet, welches Buch einen der wichtigsten niederländischen Literaturpreise erhält! Vielleicht hätte ich damals schon alle Hoffnung fahren lassen sollen. Jedenfalls habe ich dieses Gespräch nicht vergessen und muss immer, wenn ich ihn sehe, daran denken. Wie er einen eiskalt so herabwürdigen kann, dass einem der Schweiß ausbricht, dass man sich wie ein kleiner Möchtegernautor fühlt und sich fast an seinem trockenen Weißwein verschluckt. Kurz darauf bin ich ihm beim Eröffnungsball der Boekenweek, der Buchwoche, über den Weg gelaufen. Trotz allem sagte ich: »He, hallo!« Er starrte mich an, schüttelte leicht den Kopf, wie um eine Erinnerung wachzurütteln, ein Erkennen, wenn auch vielleicht ohne einen Namen. Aber es kam nichts, er erwiderte meinen Gruß nicht und ging weiter.
21. Dezember [Schwarzbach]
Auf einem Feldweg, etwa drei Kilometer von meinem Haus entfernt, steht ein Grill. Ein roter Räuchergrill mit Klappe. Eine Zeitlang hat noch eine große Sonnenbrille darauf gelegen, aber die ist jetzt weg. Mit irgendjemandem kommuniziere ich über diesen Grill. Steht die Klappe offen, wenn Jasper und ich vorbeikommen, schließe ich sie. Ist sie geschlossen, öffne ich sie. Es muss jemanden geben, der immer das Gegenteil tut, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer das sein könnte. Gestern habe ich im Wald eine leere Flasche Asbach Uralt gefunden, nicht weit davon entfernt eine schwarze Campinggaskartusche. Zu den Dingen, die ich sonst so finde, gehören Babywannen, WC-Schüsseln, Umschläge mit Passfotos, Red-Bull-Dosen, Bitburger-Pils-Flaschen, sehr viele Papiertücher, vor allem die aus Spenderkartons, wie sie bei Therapeuten auf dem Tisch stehen, leere Deoroller, Farbeimer; hoch oben in einer Baumkrone flattert eine Plastiktüte.
Vorgestern Abend klopfte Hirschjäger Ewald an meiner Tür. Er kam mit einem durchsichtigen Plastikbeutel herein, in dem ich eine blutige Masse sah. »Ha, Hirsch!«, sagte ich, weil ich dachte, er brächte mir ein paar Hirschsteaks. Fehlanzeige: Pansen und Herz für Jasper. Wir machten gleich einen Versuch, und noch nie habe ich Jasper etwas so gierig verschlingen sehen. Ohne zu kauen natürlich. »Du musst größere Stücke schneiden«, sagte Ewald. Beinahe würgend schnitt ich ein riesiges Stück Pansen ab, doch sogar das schluckte der Hund einfach hinunter. Unglaublich widerliches Zeug, ich ekelte mich so, dass ich später selbst fast nichts essen konnte. Ewald trank in null Komma nichts zwei Gläser süßen Dornfelder. Fast alle hier trinken möglichst süßen Wein, richtiger Wein ist für sie Essig. Ewald ist sehr groß, und wenn große Leute in meine Küche kommen, fällt mir auf, dass ich eine Miniküche habe. Er ist der erste Mann der Tochter meiner Nachbarin Frau Trappen. Seine Stirn ist ein Schlachtfeld, er hatte einmal einen schlimmen Autounfall. Ich hängte den Beutel mit den Innereien an eine Wäscheleine im Hauswirtschaftsraum. Gestern habe ich Jasper wieder ein paar Stücke Pansen gegeben, und ich überlege, wie lange ich anstandshalber abwarten muss, bis ich den Rest irgendwo im Wald deponieren kann. Überall riecht es jetzt nach Pansen.
23. Dezember [Schwarzbach]
Schon seit Wochen trübes Wetter. Viel Regen, Dauerregen. Es ist warm. Das Wetter macht mich allmählich etwas kribbelig. Der letzte Tag mit Sonne, an den ich mich erinnern kann, war der Sonntag, an dem meine Mutter ihren Geburtstag gefeiert hat.
Trotzdem bin ich jedes Mal, wenn ich mit Jasper losziehe, froh, dass ich ein Haus in der Eifel und nicht in Nordholland habe. Die Hügel und Wälder hier erinnern mich in nichts an früher. Ich habe einen Mann gekannt, der auf dem Wogmeer-Polder zur Welt gekommen war, in einem der typischen, annähernd quadratischen Eindachhöfe, die bei uns stolp, in Deutschland meistens Haubarg heißen. Er war fortgezogen, als Landwirtschaftsattaché weit gereist, hatte in Spanien, Deutschland, der Türkei gelebt. Er fand Freunde, einen Mann, lebte schließlich eine Weile im Iran. Irgendwann kam er auf die Idee, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Der geeignete Ort dafür war der Hof seines Vaters, der die Landwirtschaft aufgegeben hatte. Der Hof wurde umgebaut, in kleine Einheiten aufgeteilt; für die Flächen ringsum entwarf ein Landschaftsarchitekt einen Bepflanzungsplan. In diesem Stadium stieß ich dazu, dachte mit über die Bepflanzung nach, lernte die Leute kennen. Sogenannte Grüntage wurden veranstaltet: Wer einen Tag beim Fällen, Beschneiden und Pflanzen half, bekam dafür ein Mittag- und Abendessen und Getränke. Die Wohngemeinschaft stand kurz vor der Verwirklichung. Dann kam ein Grüntag im Juni, es war brütend heiß. Alle außer mir sagten ab, und auch ich hatte nach dem Vormittag genug. Selten habe ich einen einsameren Tag erlebt. Einen leeren, heißen Tag in einer Landschaft, die ich in- und auswendig kenne, seit ich sehen, riechen und hören kann. Der Mann stand spät auf, setzte sich draußen an einen Tisch und drehte sich eine Zigarette. Er fühlte sich nicht gut, ich glaube, er hatte am Vorabend zu viel getrunken. Wir unterhielten uns ein wenig, auch ich rauchte. Nach meiner Erinnerung war sonst niemand da. Er hatte gesehen, wie sich das Bauernhaus und seine direkte Umgebung in relativ kurzer Zeit verwandelten. Trotzdem war und blieb es sein Geburtshaus, und das Land ringsum – viel Land, in Nordholland reicht die Aussicht bis dahin, wo man die Erdkrümmung sehen kann – blieb das gleiche. Die gleichen hohen Bäume und Wolkenhimmel und dunstigen Tage, und jede Art von Licht erinnerte ihn an bestimmte Tage in früherer Zeit, jeder Geruch brachte die Vergangenheit zurück. Ich stieg aufs Rad und fuhr zum Bahnhof in Hoorn. Es war das letzte Mal, dass ich den Mann sah. Noch in jenem Sommer verschwand er, sein Motorrad stand nicht mehr in der Scheune. Erst einen Monat später wurde er gefunden, an einem Baum in einem Wald. Das Motorrad war in der Nähe abgestellt.
Vielleicht ist es so, dass man nicht fort gewesen sein darf, um bleiben zu können. Ich meine, wenn man bleibt, verändert alles und jeder um einen herum und man selbst sich im gleichen Tempo; so wie die Eltern nie wesentlich älter zu werden scheinen, wenn man sie sehr oft sieht, erst ein Foto von früher macht einem klar, wie sie gealtert sind. Wenn man fort gewesen ist und zurückkommt, ist die Gefahr, von Melancholie überschwemmt zu werden, größer, gerade wegen der Lücke im gemeinsamen Sich-Verändern. Für empfindsame Seelen können Wehmut und Melancholie tödlich sein. Ich konnte den Mann gut verstehen, es ihm genau nachfühlen.
Schon lange wollte ich fort aus der Stadt, wieder auf dem Land leben. Aber ich wusste auch, dass ich nicht in meine Heimatgegend zurückkehren durfte. Dort würde ich es nicht aushalten. Deshalb bin ich so zufrieden mit den Hügeln und Tälern, Buchen- und Fichtenwäldern, Bächen und Flüssen, Schwarzstörchen, Ringelnattern und Blindschleichen (ich möchte Koos van Zomeren, der ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch Biologe und Umweltschützer ist, und seine Frau einmal einladen), den Tausenden von Kranichen auf dem Zug, im März nach Norden, im November nach Süden, einer Sprache, die für mich Fremdsprache bleibt.
Jasper weiß inzwischen, wo der Beutel mit Pansen und Herz hängt. Wenn wir in den Hauswirtschaftsraum im Anbau gehen, dreht er durch. Heute Abend bekommt er das letzte Drittel Herz in sein Trockenfutter gemengt, zwischendurch noch ein paar Lappen Pansen, dann ist auch der weg. Und ich muss nicht mehr würgen und kann zu Weihnachten ohne Ekel von dem Roastbeef essen, das ich schon vor Wochen gekauft habe und das seitdem wie ein Stein im Gefrierschrank liegt. Laut meiner Wetter-App wird es ab Donnerstag, dem ersten Weihnachtstag, kalt, aber auch sonnig, später soll es Schnee geben. Die Wetter-App heißt Weatherpro und hat 4,99 gekostet, dürfte sich also nicht so leicht irren. Roastbeef soll es sein, weil wir früher, zu Hause, an Weihnachten auch Roastbeef gegessen haben. Für mich war und ist es das allerleckerste Rindfleisch. Dabei pflegte meine Mutter es durch und durch gar zu braten, wie überhaupt alles, sie ließ das Fleisch einfach so lange im Backofen, wie die Kartoffeln kochten. Ja, ich bin mit Roastbeef aufgewachsen, das ist der Vorteil, wenn man Bauernsohn ist. Roastbeef und Butter und Edamer.
24. Dezember [Schwarzbach]
Vor genau zwei Jahren und vierundzwanzig Tagen habe ich die Schlüssel zu diesem Haus bekommen. Der erste Winter war ein richtiger Winter; Schnee bis in den April hinein, und es fror Stein und Bein, was ohne das Heizband um die Wasserleitung herum zu Problemen geführt hätte. Die Wasserleitung verlief durch den alten Anbau, der halb eingestürzt war, Schnee lag darin, und eine dicke Schicht Moos bedeckte ein Sofa im Obergeschoss. Eigentlich sehr schön, dieses Sofa, so nahtlos bemoost vom Fußboden bis zum Sitzpolster. Das Obergeschoss zu begehen war wegen durchgefaulter Balken und großer Glasscherben lebensgefährlich. Bei den ersten Besichtigungen lag dort noch kein Glas. Eines Tages versuchte mein ältester Bruder, der mit den Hündchen Romeo und Julia, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. »Lass das!«, rief ich noch. Aber er zerrte so lange, bis die Scheibe zerbrach. Zwei der sechs Eigentümer waren anwesend. »Vielen Dank auch«, sagte ich. »Jetzt muss ich das Haus ja kaufen.« In den Augen der beiden Damen war er ein Berserker, ein grober Klotz. Er hätte auch tot sein können, das Glas war ihm in großen Dreiecken entgegengesprungen.
Zum ersten Mal sah ich das Haus, als ich mit meinem Gärtnerkumpel Han im Nachbardorf im Garten der Eigentümer der Bloemendaaler Buchhandlung Bloemendaal arbeitete. Das war im Juli 2012. Danach habe ich es mir noch einmal von außen angeschaut, und wieder etwas später bin ich mit einer Maklerin durch die Gegend gefahren, um weitere Häuser zu sehen, meistens Häuser auf Hügeln. Jedes Mal kehrte ich wieder zu diesem Haus in einem kleinen Tal zurück. Es gab mir ein Gefühl von Schutz und Sicherheit. An der Straße stand ein Zu-verkaufen-Schild. Eine Ausnahme, denn inzwischen weiß ich, dass hier unglaublich viel zum Verkauf steht, aber nirgendwo solche Schilder zu sehen sind. Fast alle Häuser werden unter der Hand verkauft, von Maklern hält man hier nicht viel.
Zur letzten Besichtigung kamen drei meiner vier Brüder mit. Der älteste machte also gleich etwas kaputt und lachte sich schlapp, als er sah, wie dünn die Heizungsrohre waren, mein jüngster Bruder schnalzte beim Anblick der Dachrinnen bedenklich mit der Zunge, und mein zweitjüngster Bruder merkte an, das Haus sei reichlich dunkel und feucht. Als wir dann in Kais Schlemmerstube in Schönecken aßen, fragte ich: »Und?« Alle drei rieten mir entschieden ab, außerdem sagten sie: »Erst den Führerschein machen, dann ein Haus kaufen.« Deshalb beschloss ich, es zu kaufen. Das Inventar war im Preis inbegriffen.
Ich hoffte, dass man den Anbau renovieren könnte. Ich wurde ausgelacht. Mit meinem Freund Guus Bauer brach ich an einem schönen Sommertag die Sauna heraus, die Bretter bewahrte ich auf, ein Schrotthändler holte kostenlos jede Menge Metall ab, einschließlich Fässern voll übler Flüssigkeiten, Fässern mit Totenköpfen darauf. Außerdem nahmen sie das wunderschöne eiserne Balkongeländer mit, was ich später sehr bereut habe, es war mir in der Hektik entgangen. Ein Architekt arbeitete einen Entwurf für einen neuen Anbau aus, den ich mir erst genehmigen lassen musste, weil der alte nicht im Grundbuch stand, und über meinen Nachbarn Klaus beauftragte ich eine Baufirma. Sie schickte einen riesigen Bagger, der innerhalb eines Tages den alten Anbau und sehr viel Erde ringsum beseitigte. Der Fahrer (Bagger-Peter) schaltete aus irgendeinem Grund bei Arbeitsbeginn sein Gehirn ab und hob ein Loch aus, das dreimal so groß und tief wie geplant war. Als er wieder zur Besinnung kam, stieg er von der Maschine und begann laut zu schimpfen und zu toben, weil schon vierzehn Lastwagenladungen Schutt, Erde und Schiefer abtransportiert worden waren, und die würden nicht zurückgebracht werden. Die Sache hat Klaus einen Teil seines Gartens gekostet: Von irgendwoher musste schließlich Erde kommen, um das Loch nach der Fertigstellung des neuen Anbaus wieder halbwegs zu füllen.
Bis dahin bekam das Haus schon wesentlich mehr Licht, weil Gartenkumpel Han und ich gleich im Dezember 2012 eine Reihe dunkler Fichten, eine Zierkirsche und einen alten Apfelbaum im Vorgarten gefällt hatten. Danach sah es draußen schön aufgeräumt aus. Im Lauf der Zeit habe ich noch viel mehr aufgeräumt; ich heize in diesem Winter – zwei Jahre später, alles konnte also ausreichend trocknen – mit meinem eigenen Holz, hauptsächlich Pflaume. Der Anbau ist fertig, er hat, was bei Umbauten anscheinend normal ist, anderthalbmal so viel gekostet wie das alte Haus. Ich bin jemand, der auf der einen Seite das Geld mit vollen Händen ausgibt (der muss Geld wie Heu haben, sagt man hier), andererseits aber nervös wird, wenn es um kleine Anschaffungen, unbedeutende laufende Kosten oder eine Flasche Wein geht, die ich zu teuer finde. Der Anbau ist der einzige Raum mit Fenstern auf zwei Seiten. Eine Entscheidung im letzten Augenblick, wegen der teilweisen Abtragung des Gartens hinterm Haus, der auf dem Niveau der Dachrinne lag, denn das Haus steht an einem Hang. Ursprünglich sollte das Dach des Anbaus mit Gras bepflanzt werden, jetzt hat das Schreibzimmer im Obergeschoss auf ganzer Länge eine Reihe von kleinen Fenstern nach Norden.
Die Heizkörper und die zu dünnen Rohre habe ich entfernt, sie waren nie angeschlossen gewesen; auch die Rohrverkleidungen habe ich herausgebrochen, an der Rückseite hat das Haus eine neue Dachrinne (die sehr leicht sauberzuhalten ist, ich muss mich sogar ein bisschen dabei bücken), die Rinne vorn ist repariert, und ich schalte oft das Licht ein, damit es nicht so dunkel ist. Einkäufe erledige ich mit dem Rad im acht Kilometer entfernten Schönecken. Die Straße folgt der Nims, auf dem Hinweg leicht ansteigend, auf dem Rückweg – wenn das Rad bepackt ist – also leicht abfallend. Wenn Besucher mit dem Auto kommen, nutze ich die Gelegenheit, mich mit ein paar Kästen Bier und vielen Flaschen Wein einzudecken. Ich backe mein eigenes Brot, esse Mangold, Zuckerhut und Stangenbohnen aus dem Garten.
Ein Haus, ein Jahr später ein Hund aus Griechenland, und nach Jahren lähmender Flugangst fliege ich wieder. Jetzt müsste ich noch den Führerschein machen, aber wenn meine Brüder danach fragen, sage ich: »Mal langsam, ich hab schon das mit dem Fliegen geschafft, ich hab das Haus und den Hund, und ich bin depressiv, also immer mit der Ruhe. Man kann Menschen nicht zu viel auf einmal zumuten.«
27. Dezember [Schwarzbach]
Letzte Nacht sind gut zwanzig Zentimeter Schnee gefallen. Ich war sehr gespannt, wie Jasper darauf reagieren würde. Schließlich stammt er von der griechischen Insel Thasos und hat, abgesehen von der hauchdünnen Schicht vom 3. Dezember, noch niemals Schnee erlebt. Aber er tat, was alle Hunde tun: sich wie verrückt freuen, große Sprünge machen und wie rasend im Kreis rennen. Gegen eins lief im Schnee vor dem Haus ein fremder Hund herum, ein Hund in einer knallgelben Weste mit einem großen Hundepfotenabdruck auf beiden Flanken. Ich habe ihn ins Haus geholt, wo ich einen Moment brauchte, um Jasper zu beruhigen. Es war ein junger Flat Coated Retriever. Er schien ausgehungert zu sein und fraß so schnell eine Handvoll Trockenfutter, dass er sich übergab. Auf dem Halsband stand eine Telefonnummer. Ich rief an. »Ja, hallo«, sagte der Deutsche am anderen Ende der Leitung in einem Ton, als hätte er schon eine ganze Weile sehr gelassen auf Nachricht gewartet. »Ich habe hier einen Hund«, sagte ich. »Vermissen Sie einen?« Eine Viertelstunde später war der Mann da, er fuhr in einem großen grünen Geländewagen vor und trug eine Weste in knalligem Orange. Ein Jäger. Der Hund hieß Nicky und war erst sieben Monate alt. Ein ganz lieber Hund, der vor Jasper Schutz suchte, indem er sich von hinten an meine Beine schmiegte. Der Mann war erleichtert, Nicky war schon vor zwei Stunden weggelaufen, nachdem er ein Reh gewittert hatte. Was er mir schuldig sei? Nichts, natürlich. Später, auf unserer großen Runde, dachte ich, dass ich durchaus hätte sagen können: »Ein Viertel Hirsch, bitte.«
In letzter Zeit bestand Aussicht auf einen Mann. Am 14. Dezember bekam ich eine Mail von einer ehemaligen Buchhändlerin aus Hoorn, die jetzt in Frankreich lebt. Sie habe dort einen netten Nachbarn, und immer wenn sie ihn sehe oder mit ihm spreche, müsse sie an mich denken. Er sei Deutscher, habe zwanzig Jahre in England gelebt und seinen Ehemann vor die Tür gesetzt. »Er ist wirklich ein großartiger Typ, und ich habe das Gefühl, dass ihr beide euch mal treffen solltet.«
Am 17. Dezember schickte ich ihr eine Antwortmail mit ein paar wichtigen Fragen über meinen Zukünftigen: 1) Wie alt ist er? 2) Ist er auch nicht dick (sondern sogar ein bisschen mager)? 3) Hat er im Unterschied zu mir einen Führerschein? 4) Wie soll das denn gehen, er in Frankreich und ich in Deutschland? 5) Hast du ein Foto von ihm (und er von mir)?
Noch am gleichen Tag bekam ich neun Antworten auf meine fünf Fragen: 1) Er ist Anfang fünfzig, 2) er ist wunderbar schlank, ein toller Körper, stark, 3) er hat einen Führerschein, fährt einen Land Rover, 4) er ist regelmäßig in D. Seine Eltern wohnen in der Nähe von Hamburg (du musst nicht gleich zu ihm ziehen), 5) das Foto muss ich noch organisieren, 6) er baut sein Haus ganz allein um, er ist sehr geschickt, 7) er kann großartig mit Hunden umgehen, unser schwieriger Hund ist verrückt nach ihm, was ungewöhnlich ist. Wenn er sein Haus fertig hat, will er auch wieder einen, 8) er ist auch sehr lieb, aber nicht zu soft, 9) er kann sehr gut kochen.
Ich mailte zurück, dass ich das Gefühl hätte, sie würde mich beschreiben, und erinnerte sie daran, dass ich »ein nicht unkomplizierter Mensch« sei. Das habe sie nicht vergessen, sie habe ihrem Nachbarn schon gesagt, ich könne »grumpy« sein, aber das sei kein Problem, denn auch der Nachbar sei manchmal ziemlich brummig. Und dann kam, was sie vielleicht von Anfang an im Sinn gehabt hatte: Er werde Weihnachten zu seinen Eltern fahren. »Vielleicht besucht er dich unterwegs, wenn er sich traut, oder wie wär's, wenn ich ihm deine E-Mail-Adresse gebe?«
Am 18. Dezember mailte ich ihr, sie dürfe ihm ruhig meine Mail-Adresse geben, und auf ihre Frage, was ich zurzeit so treibe, teilte ich ihr mit, dass ich an einem autobiographischen Buch arbeite. Worauf sie mir umgehend gratulierte und beiläufig erwähnte, der Nachbar werde zum Abendessen zu ihr kommen. Er wisse schon, dass sie »Postillon d'Amour« gespielt habe. Sie entpuppte sich mehr und mehr als Kupplerin, vielleicht erweckte das Nahen der dunklen Feiertage in ihr zärtliche Gefühle.
Am selben Abend schickte mir ihr Nachbar von ihrer Adresse aus eine Mail:
Hi Mr. G.
Sorry for writing in English, after 20 years amongst the island apes, my mind still works in their ways. I am sitting with ** and ** over a glass of the local red and the usual »Saveur de Soir«, the tea of choice in the evening to bring you down after a long exciting day in very rural and quiet […]. By the way, I am making this up as I go along, so please forgive my ramblings. I guess part of me feels a bit awkward, part embarrassed, but what the heck? Eh? Nothing ventured nothing gained … actually I have a gun to my head as I am writing this … **! Is there any stopping this woman?
But seriously, what to write? What were those questions again? Did ** answer them already? I am 53, Nivea did help to preserve the good looks … did you ask sporty? I guess. I love my outdoors, walking, used to teach skiing and paragliding, played handball for years and years, dance too … I did want to become a dancer when I was a wee lad, but I wasn't the intellectual giant you see before you now – my dad stopped a wonderful career cold! :-) Anyhoooow, the wine is getting warm and the tea cold, so I better stop. Here's my email and mobile number, I would very much love to hear from you: […]
Look after yourself
R
Einen Tag später beantwortete ich seine Mail:
Hi R,
I don't mind writing in English, I will make much less mistakes than I would in German. ** has also recommended you to me. She said – and I hadn't heard from her in years – that every time she saw you, she thought of me. Which might mean that we are very much alike, but that I do not know.
I have this house here in the Eifel since December 2012. And, just like you, been working on it, but I'm mostly busy to create a garden. I have never had a real relationship, and the other day with my therapist, I said that that is, or has become, a deliberate decision: I'm quite depressed by nature, with every now and then a real deep, and this causes feelings of guilt and shame and what have you. I am you could say somebody with a manual, and I understand that men do not wish to live with a manual in their hands all the time.
On the other hand: I'm doing fine, started taking pills two years ago, and they keep me content. That is what I'm striving for: contentness, I do not have to be happy. I have this fine house, a sweet but also difficult dog, a garden, and I even started writing again. I used to be a speed skater, doing competition and all. I'm 52, and this Nivea-stuff (is it Q10?) is something I used to use, but my acné marked face didn't have much use for it. People always say I have a ›markant gezicht‹, which means something like a distinctive face, but not really, maybe the English expression is ›a head‹. I'm thin, and I keep my body in shape by working in the garden and by making furniture, something I took up since I've got this house, and of course by walking 7 miles a day with Jasper, my dog.
Please don't be put off by what I wrote about being depressed, I'm fine and I like to eat and drink and smoke, and even to laugh, with the right person. I also like sex quite a bit. In a way I have always felt that people communicate more deeply in a physical way than by talking, but that is probably because talking is a bit hard for me. Maybe we should meet. I do not have a car, I don't even have a driver's license. I do my shopping in Schönecken, 8 kilometers by bike.
All best from […], right between Bitburg and Prüm,
Gerbrand
Darauf er:
Hi Gerbrand,
thank you so much for your lovely email. I am actually driving by your place tomorrow, I guess around 3pm or so, maybe a bit earlier, it will depend on traffic along the way.
I will set off quite early from here to drive to my brother who lives in Dusseldorf just over 1000 km. If you have a cup of coffee and time for a break, I'd be happy to swing by. It seems it's only a few kilometres detour.
My number is […] and I have a hands-free in the car. It'd be lovely to hear from you tomorrow.
I am attaching some pictures of me.
Have a wonderful evening, and maybe until soon.
Best
R
Darauf ich:
Hi R, two photos back. I'm here tomorrow, so please drop by. What an enormous ride you have to make!
All best, safe journey!
Here's my mobile: **
Gerbrand
Unserem Postillon d'Amour teilte ich mit, dass ihr Nachbar um drei herum bei mir auftauchen würde. »Wow«, schrieb sie. Tja, dachte ich, ist das nun das richtige Wort? Wow? Ich wusste nicht so recht, was ich von alldem halten sollte, wurde aber allmählich ein bisschen unruhig.
Am 20. Dezember um Viertel vor drei stand ich – ohne Telefon – im Hauswirtschaftsraum, wo ich eine große 4 aussägte. Nach dem Neuverputzen der Fassade und dem Wegwerfen einer unerhört hässlichen Plastik-4 konnte niemand sehen, dass mein Haus die Nummer 4 ist. Das Sägen war keine Kleinigkeit, da ich nur einen gewöhnlichen Fuchsschwanz und eine kleine Eisensäge hatte. Ich war davon ausgegangen, dass er ohne weitere Nachfragen und Anrufe kommen würde. Als ich fünf Minuten nach drei aus dem Hauswirtschaftsraum zurückkehrte, sah ich, dass er angerufen hatte. Ich hörte die Nachricht ab: »Hi, this is R. It's about quarter to three, and I just left Bitburg, am on my way to Prüm. So I can't be that far. If you get this in time give me a shout, if not maybe in a week's time when I'm driving back. Have a wonderful afternoon.Bye.« Ich rief ihn sofort zurück, ich wusste, dass man über die Autobahn für das Stück Bitburg – Nummer 4 etwa eine Viertelstunde braucht. Er nahm nicht ab. Seltsam, angesichts der Freisprechanlage. Ich sagte seiner Mobilbox, dass er gleich zu mir kommen könne und solle, ich sei zu Hause, ich warte auf ihn. Als er um halb fünf noch nicht aufgetaucht war, fand ich mich damit ab, dass er nicht mehr kommen würde.
Ich kam mir bedauernswert vor. Am Morgen hatte ich geduscht, mir die kurzen Härchen gewaschen, ein Oberhemd angezogen (ich laufe hier meistens in schmutzigen Arbeitsklamotten herum), und ich hatte wirklich gewartet. Vielleicht hatte ich mit Absicht vor drei Uhr mit dem Sägen der 4 angefangen, damit ich ihn durchs Fenster des Hauswirtschaftsraums kommen und er mich am Fenster stehen sehen konnte. Wie man sich dann selbst bemitleiden kann: Warten und zurückgewiesen werden; der Tisch schön gedeckt, und die Gäste kommen nicht; die Geburtstagstorte schon angeschnitten, und es klingelt nicht ein einziges Mal. Ich war auch ein bisschen beleidigt, dachte gleich: Leck mich am Arsch, Mann, wenn du unbedingt durchfahren musst, tu's doch. Wenigstens hatte ich nicht mein Bett frisch bezogen, das hätte noch gefehlt.