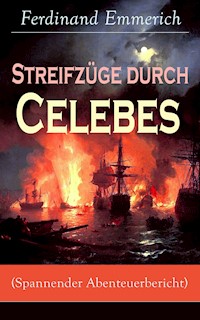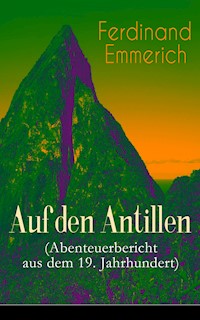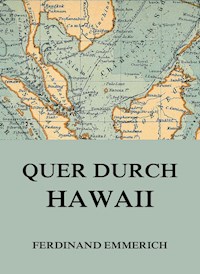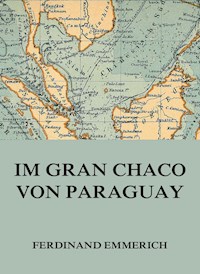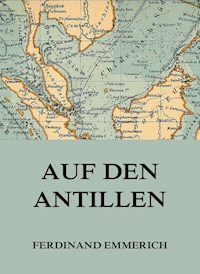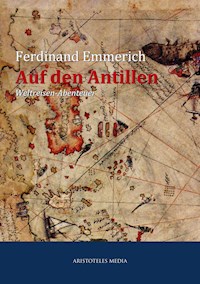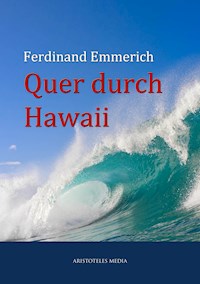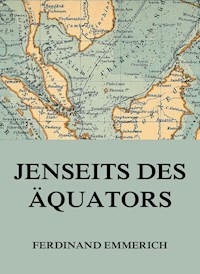
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emmerich gehört zu den bekanntesten deutschen Reise- und Abenteuerautoren des beginnenden 20. Jahrhunderts. Dieses Buch führt ihn in die Anden nach Bolivien und Peru.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jenseits des Äquators
Ferdinand Emmerich
Inhalt:
Ferdinand Emmerich – Biografie und Bibliografie
Jenseits des Äquators
Erstes Kapitel - Die Nacht in der Totenkammer
Zweites Kapitel - Der große Häuptling Karuwaho
Drittes Kapitel - Der »Leichenraub« rächt sich an uns
Viertes Kapitel - Eine Fahrt zur Sonneninsel
Fünftes Kapitel - Ein überflüssiger »Luxus«
Sechstes Kapitel - Eine gestörte Untersuchung
Siebentes Kapitel - Häuptling Ahunda
Achtes Kapitel - Der Mörder
Neuntes Kapitel - »Bismargo!«
Zehntes Kapitel - Unterwegs mit meinem Blutsbruder
Elftes Kapitel - Der weiße Puma
Zwölftes Kapitel - Im Indianerdorf
Dreizehntes Kapitel - »Iibarros!«
Vierzehntes Kapitel - Wir wagen den Wasserweg
Fünfzehntes Kapitel - Auf der schwimmenden Insel
Sechzehntes Kapitel - Die Todesfahrt
Siebzehntes Kapitel - Von den Gefährten getrennt
Jenseits des Äquators, F. Emmerich
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849652944
www.jazzybee-verlag.de
Ferdinand Emmerich – Biografie und Bibliografie
Geboren am 8. Juli 1858 in Viersen-Hamm. Deutscher Forscher, Abenteuerer und Reiseschriftsteller. Nach Abschluß seines Medizinstudium 1886 war er fast 30 Jahren auf Reisen durch die ganze Welt und kam erst wegen des Weltkrieges 1915 nach Deutschland zurück. Seine Romane sind fesselnde Expeditions- und Abenteuerberichte für Jung und Alt. Er starb am 2. August 1930 in München-Pasing,
Wichtige Werke:
· Leitfaden für Auswanderer
· Auf Schleichwegen nach Tibet
· Auf den Antillen
· Das Rätsel des Orinoko
· Der Einsiedler von Guayana
· Der Walfischfänger Erlebnisse eines deutschen Seemanns
· Durch die Pampas von Argentinien
· Hüter der Wildnis
· Im Gran Chaco von Paraguay
· Im Herzen Brasiliens
· Im Reiche des Sonnengottes
· In mexikanischen Urwäldern
· Jenseits des Äquators
· Kopfjäger auf Borneo Reisebericht
· Kulis Tiger Krokodile
· Neuseeland Weltreisen und Forscherabenteuer
· Quer durch Hawai
· Streifzüge durch Celebes
· Unter den Urvölkern von Südbrasilien
· Unter den Wilden der Südsee
· Weltreisen und Forscher-Abenteuer (6 Bände)
Jenseits des Äquators
Erstes Kapitel - Die Nacht in der Totenkammer
Unheimliche Gesellschaft. – Werden die Indianer uns entdecken? Flucht vor den Toten. – Mit unseren Nerven am Ende.
Würden wir diesmal Glück haben? – Diese Frage spannte all unsere Sinne. Wir, der peruanische Forscher und Kollege Dr. Perez und ich, zogen schwer bepackt dem Ziel unserer brennendsten Sehnsucht entgegen.
Ganz unversehens hatten wir es gestern entdeckt, dieses augenscheinlich völlig unversehrte altindianische Grabmal, das eine herrliche wissenschaftliche Ausbeute versprach. Als wir das erstemal eine solche »Chulpa« durchforschen wollten, hatten uns die Indianer einen bösen Strich durch die Rechnung gemacht und uns gezwungen, unverrichteterdinge abzuziehen. Unsere Auftraggeber aber, ebenso wie wir, legten besonderen Wert auf die Funde solch letzter Überreste der uralten Vor-Inkakultur, und unser eigener Ehrgeiz und Forschertrieb spornten uns besonders an, die Erwartungen noch zu übertreffen.
Gern hätten wir uns sofort in die Arbeit gestürzt. Leider aber hinderte uns die zwar liebenswürdige, aber reichlich unbequeme Gesellschaft, die seit einigen Tagen mit uns reiste, am sofortigen Beginn.
Eine eben in Peru ausgebrochene Revolution hatte nämlich den derzeitigen Staatspräsidenten veranlaßt, sich mit einiger Geschwindigkeit zurückzuziehen.
Mit der gesamten Umgebung, deren Damen und einem großen Troß von Beamten, Bedienten und Gepäck wollte man versuchen, die Grenze zu erreichen.
Natürlich hatte keiner von ihnen von den Gefahren und besonderen Anforderungen einer Urwaldreise über das Gebirge eine richtige Vorstellung.
Heilfroh war die ganze Gesellschaft, als sie nach der ersten »Fühlungnahme« – Gewehr im Arm, Finger am Abzug – feststellte, daß wir nicht nur keine Wegelagerer, sondern Forscher waren, deren Erfahrungen dem ganzen »Hofstaat« von größtem Nutzen waren.
Um sie überhaupt wieder loszuwerden, hatten wir ihnen für ihren weiteren Weg, von den Höhen des bolivianischen Gebirges hinab zum Titicacasee, unsere drei Diener als Führer und Beschützer mitgegeben, und heute früh waren sie mit erheblichem Aufwand von Dankesbezeugungen und Freundschaftsversicherungen endlich abgeritten. Felipe, mein getreuer Helfer und Freund, sollte zusammen mit Carlos, dem Diener des Dr. Perez, unten in dem kleinen Uferdorf Maiquia für uns Quartier machen und uns dann wieder bei der Chulpa treffen.
Da lag nun das alte Grabmal!
Der mit Ranken und Schlingpflanzen überwucherte, durch feine Einfachheit imponierende Bau hatte den Grundriß einer Ellipse. Das Gemäuer bestand auch hier aus mächtigen, gut behaltenen Trachyt- und Porphyrblöcken, die bis zu einer Höhe von acht Meter aufeinandergetürmt lagen. Als Dachverschluß diente eine einzige, riesige Porphyrplatte von vielleicht dreißig Zentimeter Dicke. Sie war in geneigter Lage über das etwazwei Meter im Durchmesser haltende Grabmal gebettet. – Ein tatsächlich für die Ewigkeit bestimmter Bau!
Zuerst suchten wir die an jeder Chulpa befindliche Öffnung nach Osten zu entdecken, aus der, nach dem Glauben der Indianer, die Seelen der Toten emporsteigen sollen. Wir fanden sie, unter Brombeeren versteckt, genau an der Stelle, wo die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne sie in jeder Jahreszeit treffen mußten. Sie befand sich vier Meter über dem Erdboden und war rechteckig – groß genug, um einem Menschen das Eindringen zu ermöglichen. – Gegenseitig unterstützten wir uns bei der Überwindung der trennenden, durch Stacheln und Dornen geschützten Höhe. Noch eine letzte Anstrengung, dann konnten wir einen ersten Blick in das geheimnisvolle Halbdunkel des Grabes werfen.
Ein Gefühl der Unsicherheit beschlich mich, als wir uns anschickten, das Innere der Chulpa zu betreten. Ich hatte das Empfinden, etwas Ungehöriges zu tun. Es war weder Furcht noch Abscheu, sondern wohl Scheu und Ehrfurcht vor dem Heiligtum eines fremden Volkes. Ähnlich erging es meinem Begleiter. Doch kurz entschlossen warf ich die Strickleiter in den Raum und stieg langsam hinunter.
Die eindringenden Sonnenstrahlen schufen dort ein ziemlich Helles Zwielicht. Der innere Boden der Chulpa lag etwa ein und einen halben Meter tiefer als der äußere. Durch geschickte Lagerung der Blöcke waren an der Innenwand Stufen geschaffen, die wohl dazu dienen sollten, den Bestatteten dereinst das Verlassen des Grabes zu erleichtern. Diese Toten fesselten natürlich zuerst unsere Blicke. Auf dem aus verwittertem Kalkstein bestehenden Boden saßen im Kreise, die Füße dicht aneinandergestellt,vierzehn Mumien, von denen drei vornübergefallen waren. Quer über den Füßen lag ausgestreckt ein weiterer mumifizierter Körper, den wir auf den ersten Blick für die Überreste eines Kindes ansahen. Neben jeder einzelnen Mumie standen in Körbchen und Näpfchen die Opferbeigaben, aus denen sich unschwer das Geschlecht der Toten feststellen ließ. Wir fanden eingeschrumpfte Maiskolben, dann Keulen, Schleudern, einen Köcher, Fischhaken und Messer aus Knochen, ferner Bastschnüre, die wohl den Männern mitgegeben wurden, während die feingearbeiteten, Binsengeflechte, die Wolle und einige lange Dornen Beigaben für die Frauen darstellten. Wir unterschieden hiernach die Mumien von elf Männern und drei Frauen. –
Im Hintergrunde der fast drei Meter weiten Halle standen, der Öffnung abgekehrt, auf einem glatt geschliffenen Steine neun verschlossene Töpfe aus gebranntem Ton. Drei davon zeigten Verzierungen. Sie hatten die Form unserer Teekannen, waren aber ohne Schnabel. Daneben, säuberlich angeordnet, standen zehn flache Tonschüsseln mit dunkelbraunen Körnern, die wir später als Mais erkannten.
Wir betrachteten lange Zeit wortlos die irdischen Reste von Angehörigen eines Volkes, über dessen Leben und Treiben uns fast gar keine Überlieferungen zur Kenntnis gekommen sind und das doch auf einer so hohen Kulturstufe stand. Wie viele Jahrhunderte mochten verflossen sein, seit liebevolle Hände den hier Versammelten die letzte Ruhestätte errichteten? Diese feste Burg hatte eine jahrhundertelange Regierungszeit des ebenfalls verschwundenen Volkes der Inka unversehrt überstanden. Sogar die alles vernichtende Habgier der spanischen Eroberer waran ber Ruhestätte vorübergegangen ... und jetzt stand ich, der kultivierte Sohn eines hochkultivierten Volkes, hier vor den eingetrockneten Leichen, um mit rauher Hand zerstörend in den Frieden des Grabes einzugreifen! – In diesen Betrachtungen fiel es uns ganz besonders auf, daß sich weder Fledermäuse noch sonstiges Getier in der Chulpa befanden. Das erhöhte noch das Unbehagen, das wir kaum zu bannen vermochten. Wir zögerten beide, Hand an die Mumien zu legen.
Allein, was half das alles. Die Wissenschaft verlangte von uns die Erforschung solcher Stätten verschollener Kultur, und ihr mußten wir gehorchen. Mit solchem zwecklosen Nachdenken war eine kostbare Stunde verstrichen, und die Uhr mahnte zur Aufnahme der Arbeit.
Die Sonne hatte inzwischen ihre Strahlen verschoben und ein tiefes Halbdunkel über die Stätte gelegt. Wir mußten unsere Kerzen anzünden. Beim Aufflammen des Zündholzes fiel mein Auge auf eine etwas verblichene Wandmalerei, die einen Sonnenball mit menschlichem Gesichtsausdruck darstellte. Der in das Antlitz gelegte Ausdruck zeigte so viel Leben, daß mir war, als würde unser Tun von einem Wächter beobachtet.
Wir waren beide Männer, die keine Furcht kannten. Aber als die flackernden Strahlen des matten Kerzenlichtes über den stummen gespenstischen Kreis huschten und die gähnenden Augenhöhlen in den leeren Totenschädeln zu beleben schienen, konnte ich ein Gefühl des Unbehagens doch nicht unterdrücken. Ich glaube, wenn ich schon vorher gewußt hätte, was uns bevorstand, ich hätte auf die Untersuchung verzichtet. Dem Doktor ging es nicht besser. Es ist eben doch etwas anderes, einem Toten an gewöhnlichen Orten gegenüberzustehen oder ihn aus seinerletzten Ruhestätte zu reißen und gezwungen zu sein, ihn in seine einzelnen Teile zu zerlegen.
Die erste Mumie, die wir in Angriff nahmen, war in ein Bastgeflecht eingewickelt, das man über dem Schädel sackartig zusammengebunden hatte. Eine Öffnung für das Gesicht, das uns unheimlich entgegengrinste, war freigelassen. Beim Aufheben der Mumie rutschten die Knochen der beiden Füße mit dumpfem Klappern zur Erde. Das prasselnde Geräusch brach sich in schwachem Echo in den konisch zulaufenden Wänden und fand in allen Winkeln des Baues einen klagenden Widerhall,
Wir versuchten, den Schädel durch die Öffnung herauszuziehen, mußten es aber aufgeben, weil sie zu eng war. Der Doktor trennte nun das Geflecht vorsichtig auf, wobei ich ihm leuchtete. Als der Sack dann in seinem oberen Teil offen vor uns lag, sahen wir ein Gebilde, das an ein riesiges schwarzes Ei erinnerte, auf dessen Spitze gähnende Höhlungen die Stelle von Augen, Nase und Mund bezeichneten.
Bei näherer Betrachtung strahlten wir über den seltenen Fund. Wir hatten einen jener Schädel vor uns, die zu Lebzeiten des Menschen auf künstliche Weise in die Eiform gebracht worden waren, und zwar derart, daß das Gesicht auf die spitze Seite des »Eies« gedrängt wurde. – Aus früheren Funden war bekannt, daß sich diese Kopfform bei den alten Aymaras aus der Vor-Inkazeit fand. Das Alter dieser Grabstätte konnte also mit ziemlicher Gewißheit bestimmt werden.
Als wir den Schädel vorsichtig aus dem Geflecht herausholten, fiel mit metallischem Klirren ein Gegenstand in den unteren Teil des Sackes. Das schwache Kerzenlicht erlaubte jedoch keine eingehende Untersuchung an Ort und Stelle. Wirtrugen die Mumie daher an die treppenartigen Stufen, die zum Eingang hinaufführten, um den Inhalt bei Tageslicht genauer zu prüfen.
Eben hatte der Doktor den oberen Rand der Türplatte erreicht, da traf uns der Schall von Stimmen, die draußen unmittelbar zu unsern Füßen laut wurden: Indianer! – Nun drängte sich uns die eine Frage auf: Kannten diese die Bedeutung der Chulpa? Wenn ja, dann durften wir uns auf eine böse Viertelstunde gefaßt machen, falls sie uns hier entdeckten. –
Besorgt sah ich meinen Gefährten an. Zunächst mußten wir jedes Geräusch vermeiden. Leider befanden wir uns gerade in der denkbar unbequemsten Stellung. Der Doktor stand mit einem Fuß auf dem oberen Vorsprung und hielt sich mit der linken Hand an den Quadern, die den Eingang säumten. In der rechten Hand trug er den Mumiensack. Ich stand auf einem tiefer gelegenen Vorsprung und stützte mit einer Hand den unteren, lockeren Teil des Sackes. So hingen wir bewegungslos an der Wand und lauschten auf das Gespräch der Indianer, dessen sorgloser Inhalt verriet, daß sie von unserer Nähe keine Kenntnis hatten.
Im Innern des Sackes schienen sich einige Verbindungen zu lockern. Ein Zucken ging durch das Gewebe. Es glitt langsam durch meine Hand und drückte mit zunehmender Stärke auf die krampfhaft geschlossenen Finger. Der Inhalt schien Leben zu gewinnen ...
Mechanisch muß sich die Umklammerung meiner Hand unter dem zwingenden Druck der toten Materie gelöst haben: ein Knöchelchen fiel mit hellem Klingen zu Boden. Ich erschrak. –Und dann rieselte, wie eine Kette klingenden Metalles, Knochen auf Knochen über meine machtlosen Hände in die Tiefe. Ohne mein Zutun löste sich mein Griff – ein dumpfes Gepolter folgte, und bebend standen wir mit leeren Händen und warteten! – Die Toten hatten sich gerächt. Würden die lebenden Rächer erscheinen?
Wie mit einem Schlage waren die Stimmen draußen vor der Chulpa verstummt. Dann drang ein lauter Ruf des Erstaunens zu uns herauf. Eiliges, hastiges Scharren an den Wänden. Die Ranken zitterten und warfen einige Blüten auf uns herab. Werden sie kommen?
Nein, die Indianer zogen schleunigst ab! Unsere Toten hatten sie in die Flucht geschlagen. Erleichtert konnten wir mit unserer Untersuchung fortfahren.
Der die Leiche umhüllende Sack wurde nun aufgetrennt und der Inhalt genau betrachtet. – Unter der äußeren Geflechthülle fanden wir einen durch das Alter gebräunten, ursprünglich jedenfalls weißen Webstoff, der mit Malerei verziert war. Leider zerfiel der Stoff, als wir ihn auseinanderwickelten. Unter dieser zweiten Hülle lagen Baststreifen. Sie waren mit einer harzähnlichen Masse zusammengekittet und bestimmt, den Korper zusammenzuhalten. Die Rippen, Wirbelsäule und kleinere Knochen mußten bei der ersten Berührung bereits aus dem Zusammenhang gelöst worden sein, sonst wären sie kaum so leicht herausgefallen.
Interessant war der erwähnte metallische Gegenstand, ein kleiner napfartiger Becher aus reinem Gold. In einer eingebohrten Öffnung hing noch ein Stück Bastschnur, die daraufschließen ließ, daß der Gegenstand um den Hals getragen wurde. –
Von der Öffnung der übrigen Mumien nahmen wir vorerst Abstand. Das, was wir wissen mußten, hatten wir bei diesem einen Leichnam schon gesehen. Nur die kleine Leiche, der die Basthülle fehlte, wollten wir noch untersuchen und dann den Rückweg antreten. Die Überführung der irdischen Überreste dieser tausendjährigen Aymaras in die Museen der Alten Welt sollte später in die Wege geleitet werden. – Ich will hier gleich bemerken, daß ich die Mumien zum Teil später als »alte Bekannte« in Brüssel wieder begrüßen konnte. Unsere kaiserlichdeutschen Museen hatten leider niemals Geld für derartige Stücke.
Das als »Kindesleiche« bezeichnete Skelett erwies sich bei genauerer Prüfung als der eingetrocknete Körper eines Hundes. Wir prüften dann noch den Inhalt der Tongefäße. Aus der Öffnung der Krüge strömte uns ein widerlich-süßer Geruch entgegen. Eine zähe, dickflüssige Masse von dunkelroter Farbe und beißendem Geschmack lag unter einem fingerdicken Schimmelbezug. Es handelte sich wahrscheinlich um ein damals übliches Getränk, das fast allen Gräbern aus jener Zeit beigegeben wurde.
Die Untersuchung hatte uns Hunger, Durst und Zeitrechnung vergessen lassen. Erst als wir bemerkten, daß unser Kerzenvorrat zu Ende ging, machten wir die unangenehme Entdeckung, daß die, Nacht hereingebrochen war. – Nun blieb uns nichts anderes übrig, als den nächsten Morgen hier unten, in der Gesellschaft der abgeschiedenen Aymara, zu erwarten. – Die Müdigkeit, die uns im Eifer der Arbeit geflohen war, stellte sichjetzt mit zwingender Gewalt ein. Wir konnten uns buchstäblich nicht mehr auf den Beinen halten. Wie leere Säcke sanken wir zusammen. Ich fand in meinen Taschen einige Stücke getrocknetes Fleisch, die wir in den Mund steckten, um dem Magen etwas Nahrung zuzuführen, aber die Erschöpfung war zu stark. Nicht einmal kauen konnte ich mehr.
Natürlich waren unsere stummen Gesellschafter nicht auf Besuch eingerichtet. Es fehlte an jeglicher Sitzgelegenheit und ebenso an Platz, uns auszustrecken. Wir setzten uns also Rücken an Rücken neben die Mumien auf den Boden und schlossen die Augen.
Trotz der Erschöpfung floh uns der Schlaf. Die Umgebung und nicht zuletzt das immer noch beunruhigte Gewissen peitschten unsere Nerven auf. Gar oft zuckten wir zusammen, wenn von der Außenwelt her jene unerklärlichen Geräusche zu uns hereindrangen, an die wir im freien Walde gewöhnt waren, das uns jetzt aber zwang, unsere Nerven aufs höchste anzuspannen.
Einmal schrie Dr. Perez leise auf. Wir waren eingenickt und hatten, wie sich herausstellte, beide das Gefühl, als ob sich außer uns noch jemand in der Gruft befände. Ein Schlürfen, wie von leisen Tritten, durcheilte den Raum und machte bei den Tonkrügen halt, die wir gleich darauf leise, kaum vernehmbar klirren hörten.
Dr. Perez griff nach meiner Hand und fragte mich im Flüsterton, ob ich etwas sähe. Ehe ich noch antworten konnte, preßte er plötzlich meine Finger fest zusammen und stieß einen Schrei aus: »Mira!« – Ich blickte um mich und sah nun eine unheimliche Erscheinung. Aus dem Innern der aufgebrochenen Mumie leuchtete uns ein phosphoreszierendes Licht entgegen, das in seinenUmrissen eine ganz bizarre Figur darstellte. Es schien aus dem toten Leibe ein seltsames Etwas emporzuwachsen, das sich langsam auf uns zu bewegte. Dann blieb die Erscheinung plötzlich stehen und zog sich wieder langsam zurück.
Es ist dies eine altbekannte Erscheinung bei überreizten Nerven. Auf mich wirkte sie indes so stark, daß ich bei ihrem jedesmaligen Herannahen auch noch das Wort »Leichenräuber« zu hören vermeinte. – Obgleich wir beide genau wußten, um was es sich bei den Leuchterscheinungen handelte, machten sie unsere Nerven vollkommen rebellisch. Viel, viel zu langsam vertropften die Stunden dieser Nacht. Immer wieder zuckten Dr. Perez oder ich zusammen, so einer den anderen immer nervöser machend. Was nützte alle Vernunft gegen die Vorstellungskraft der überreizten Nerven?
Endlich, endlich verrieten uns die allmählich sichtbar werdenden Umrisse der Öffnung den nahenden Tag. Ganz selten habe ich den aufdämmernden Morgen so dankerfüllt begrüßt wie an diesem Tage.
Zweites Kapitel - Der große Häuptling Karuwaho
Dr. Perez meistert eine gefährliche Lage mit einer brennenden Zigarette. – Militärpatrouille als wirkungsvolle Tarnung. – Felipe kommt wieder einmal zur rechten Zeit.
Sobald das erste Tagesgrauen durch die Mauerlücke schimmerte, kletterten wir eilig aus der Chulpa heraus. Eine innere Unruhe, wie die Vorahnung kommender Gefahr, hatte uns befallen. Als wir draußen auf festem Boden standen, verwischten wir, so gut es ging, die Spuren unseres Einstiegs und liefen dann dem nächsten Hügel zu. Dort warfen wir uns erschöpft zu Boden. Das Land unter uns war noch in leichten Dunst gehüllt, und die aufsteigenden Nebel flatterten unter den ersten Sonnenstrahlen wie künstliche Schattenbilder hin und her. Sie zerflossen und liefen wieder in wirbelndem Reigen zusammen ...
Gedankenverloren blickte ich in dieses luftige Spiel. Meine Augen verfolgten eben ein Dunstbündel, das sich in schillernden Regenbogenfarben über den Berg wälzte und in dem Einschnitt drunten neben der Chulpa sich zu einer dunklen Masse zu verdichten schien. Aber – was war denn das? – die Masse nahm auf einmal feste Formen an. Arme, Köpfe wurden erkennbar ...
Jäh fuhr ich auf. »Alle Wetter, Doktor, sehen Sie mal dorthin, dort sind doch Indianer – sehen Sie sie? – Dort unten – neben der Chulpa!«
»Wahrhaftig, Sie haben recht! Vorsicht, daß sie uns nicht entdecken!«
Wir ergriffen unsere Waffen und schmiegten uns so eng wie möglich unter die Sträucher. Sechs Indianer zählten wir, die, mit Bogen und Keulen bewaffnet, da unten aus dem Nebel sich lösten. Sie blickten suchend umher, merkwürdigerweise aber nicht zu uns hinauf. Dann warfen sie mitgebrachtes Reisig auf einen Haufen und machten Feuer, indem sie zwei Hölzer aneinanderrieben.
Wir waren so in die Beobachtung der Gruppe da unten vertieft, daß wir unserer näheren Umgebung keine Aufmerksamkeit geschenkt hatten, und erschraken daher einigermaßen, als uns plötzlich eine Stimme in gebrochenem Spanisch anredete. Ein großer, bunt bemalter Indianer stand neben uns, betrachtete uns mit unmutig gerunzelter Stirn und wartete sichtlich auf eine Antwort. Das konnte gefährlich werden!
Was er sagte, hatten wir nicht verstanden, aber Dr. Perez war der Lage gewachsen.
»Warum steht der große Häuptling, wenn seine Gäste schon sitzen?« fragte er.
Der Angeredete mochte auf so viel Höflichkeit nicht gerechnet haben, denn auch er wurde nun liebenswürdiger.
»Meine Gäste wurden noch nicht erwartet, darum hat Karuwaho noch nicht für Speise und Trank sorgen können. Die fremden Gäste mögen das nicht übelnehmen!«
»Dann raucht wohl der große Karuwaho einstweilen eine Papyros mit seinen fremden Gästen?« erwiderte der Doktor, der rasch drei Zigaretten hervorgeholt hatte. Ehe der andere antworten konnte, brannte die eine schon, die er dem braunen Königreichte, nachdem er selbst einen Zug daraus getan hatte. Der Indianer schien die Überrumplung zu ahnen, denn er besann sich ein wenig. Schließlich atmete er aber doch einen Zug ein und gab mir die Papyros. So unappetitlich die Geschichte war, durfte ich doch nicht ablehnen.
Damit war unsere Freundschaft mit dem Braunfell besiegelt.
»Meine Freunde werden mit mir zum Lager hinuntergehen und dort das Mahl der Comanites teilen. Sind die Weißen allein hier?«
»Unsere Leute werden uns eingeholt haben, wenn die Sonne auf dem Wasser steht«, antwortete der Doktor, der so wenig wie ich Lust hatte, noch mal zur Chulpa abzusteigen.
»Ua! Habt ihr denn hier nicht die Nacht verbracht?« fragte der Häuptling rasch.
»Sieht mein großer Freund eine Feuerstelle? Sieht er Decken und Rancho? Nein, er sieht sie nicht. Also müssen die weißen Männer an anderer Stelle geruht haben.«
Lange sah uns der Häuptling stumm an. Was in seinem Innern vorging, konnte ich nicht wissen. Daß er uns aber im Verdacht hatte, mit dem gestrigen Spuk in irgendeiner Verbindung zu stehen, sah ich ihm an. Nur wußte er nicht recht wie. Er forderte uns nochmals auf, mit ihm zu seinen Begleitern zu gehen. Wahrscheinlich hoffte er, uns zu einer Unvorsichtigkeit verleiten zu können, wenn er uns erst dort unten hatte. Das fürchteten wir aber auch. – Die Einladung war jedoch zu bestimmt gegeben, als daß wir sie hätten rundweg ablehnen können, und es blieb nun unserm Scharfsinn überlassen, wie wir uns um die Rückkehr zur Chulpa drücken konnten.
Ich setzte meine Hoffnung auf das Erscheinen Felipes. Wennder rechtzeitig eintraf, waren bald Gründe gefunden. Um einen Vorwand zur Verzögerung unseres Abstiegs zu haben, griff ich das Fernglas auf und stieg den nächsten Hügel hinan. Aufmerksam suchte ich das ganze vor mir liegende Gelände ab. Von meinen Leuten aber fand sich keine Spur. Wenn sie nicht schon im Gebirge oder im Walde zu meinen Füßen waren, mußten noch Stunden bis zu ihrer Ankunft vergehen.
Ich setzte mißmutig das Glas ab und wandte mich zum Gehen. Aber, wie man bei getäuschten Erwartungen meistens zu tun pflegt – ich drehte mich doch noch einmal um, und nun wurde mein Auge durch eine dunkle Gruppe von Menschen gefesselt, die um die Vorberge in die Ebene einbog. Ich unterschied deutlich blinkende Waffen und einige goldverzierte Käppis. – Militär! dachte ich und machte den Doktor aufmerksam, um seine Ansicht zu hören.
Der hatte kaum die Streifpatrouille erkannt, als er auch schon die gute Gelegenheit ausnutzte. Er stieß einen lauten Freudenruf aus, packte den überraschten Karuwaho bei der Hand und deutete hinunter auf die Soldaten.
»Wie werden sich meine Freunde dort unten freuen, daß sie den großen Häuptling der Comanites hier begrüßen können!« rief er schmunzelnd. »Aber das Fleisch wird knapp werden beim Mahl deiner Leute, wenn soviel fremde Männer mit ihnen essen. Wir wollen deshalb noch rasch ein paar Schafe schießen. Komme rasch, Karuwaho, damit wir zurück sind, wenn die Soldaten anlangen!«
Der große Karuwaho schien aber – wie der Doktor richtig gerechnet hatte – wenig Lust zu einer Begegnung mit der Patrouille zu verspüren. Die beiden Rassen vertragen sich schlecht.Immerhin war der Häuptling nach indianischem Recht an die ausgesprochene Einladung gebunden und durfte nicht ablehnen, ebensowenig wie wir versuchen durften, uns von dem Mahle der Indianer zu drücken, wenn wir sie nicht schwer beleidigen wollten. Wir saßen also beiderseits in einer Zwickmühle und blickten uns in dieser Erkenntnis mit einem unterdrückten Lächeln an.
Unsere Lage war natürlich jetzt die vorteilhaftere. Allerdings nur dann, wenn die Indianer nicht etwa die Absicht hatten, uns sofort die Hälse abzuschneiden. Unter dem Eindruck der nahenden Soldaten würden sie aber kaum einen offenen Angriff gegen uns unternehmen. Darum glaubte ich, ruhig den Vorschlag machen zu sollen, der unsere Lage retten konnte.
»Laß uns schnell einige Bissen an deinem Feuer essen, großer Häuptling«, sagte ich, ihn und den Doktor mitziehend, »dann gehen wir auf die Jagd. Wir nehmen unsere Büchsen gleich mit, und du beauftragst deine Leute, uns das Wild suchen zu helfen.«
Wenn der Häuptling auf den Vorschlag einging, konnten wir seine Leute teilen. Daß sie dann vor meinem Lauf blieben, dafür wollte ich schon sorgen.
Er ging aber nicht darauf ein. So schlau war er auch. Sogar noch viel schlauer. Denn er sagte weder ja noch nein. Vielmehr rief er durch einen Pfiff die Indianer herbei und befahl ihnen, unser Gepäck an das Feuer zu tragen, während er selbst – die Gewehre umhängen wollte! Seine Gäste dürften keine Arbeit leisten. Das durften wir uns aber nicht gefallen lassen! Wir widersprachen höflich, aber bestimmt gegen diese »Ehre«, doch hörte der Mann gar nicht auf unsere Worte. Er griff mit dergrößten Seelenruhe nach meiner guten Doppelbüchse und betrachtete aufmerksam die Teile beim Schloß. Hinterlader dieses Systems kannte er nicht. Da kam mir ein rettender Gedanke. Mit einem Ruck, der den Indianer zornig aufblicken ließ, nahm ich die Waffe an mich und sagte, die Sicherung einrückend: »Laß mich das Gewehr erst laden, großer Häuptling. Wir könnten es plötzlich gebrauchen müssen. Mit den fünf Kugeln meines Revolvers« – dabei schlug ich den Rock zurück, daß die Waffe sichtbar wurde – »können wir kein Wild schießen. Die töten nur Menschen«, fügte ich hinzu.
Unwillkürlich entfuhr ihm ein erstauntes: »Ua.« Dann flogen seine Blicke zum Doktor, der eben seinen Revolver in die Hand genommen hatte und die Kugeln in der Trommel wechselte. Wenn der Häuptling Böses im Sinn hatte, dann war ihm jetzt die Freude daran bedeutend gemindert.
Er schien das auch einzusehen, denn er änderte plötzlich seine Taktik. Um unsere Waffen kümmerte er sich nicht mehr, sondern sprang mit großen Sätzen den Hügel hinab und rief seinen Leuten einen Befehl zu. Darauf griffen sie in die Asche und holten einen halbverbrannten Fleischklumpen hervor. Der Häuptling riß ihn in drei Teile, schlang das größte Stück hastig hinunter und schickte einen Mann – ich glaube, er hatte den schmutzigsten ausgesucht – mit den andern beiden Stücken zu uns. Der Bursche brachte uns das Fleisch ohne Unterlage in der Hand und leckte unterwegs das von den Stücken herabtropfende Fett sorgfältig ab. Kein Wunder, daß wir unserseits uns mit dem Hineinbeißen nicht sonderlich beeilten.
Als wir unten am Feuer anlangten, sahen wir, daß unsere Felleisen ganz hinten in dem engsten Winkel des Platzes lagen,wo uns die Gesellschaft vollkommen in der Falle hatte, sobald wir uns dort setzten. Der Doktor warnte mich. Ich aber vertraute auf meinen Revolver und ging trotzdem in die Ecke, von der ich gute Aussicht über das Gelände hatte und vor allem mir gegenüber den Hügel, von dem her Felipe und Carlos kommen mußten. Der Doktor setzte sich neben den Häuptling.
Kaum hatte ich meinen Sitz bequem hergerichtet, da fragte mich der Häuptling, warum ich im Kreise seiner Leute Waffen trüge.
»Ein Alemano gibt seine Waffe niemals ab, großer Häuptling«, erwiderte ich. »Mein Stamm ehrt seinen Gastgeber dadurch, daß er nur bewaffnet zu ihm kommt, damit er ihn immer mit seinem Leben verteidigen kann, wenn er angegriffen werden sollte.«
Ein Murmeln der Mißbilligung ging durch den Kreis. Die Kalebasse, die uns den Willkommengruß – oder den Gifttrank, wer weiß es – kredenzen sollte, wurde zur Seite gestellt, und mein Nachbar rückte auffällig von mir ab.
Ich erhob mich.
»Wenn du es denn willst, großer Häuptling, dann gebe ich meine Waffen auch ab. Dort ist ein Teil meiner Leute, die...«
Der Rest meiner Rede erstarb in dem gleichzeitigen Rufe aus sieben Kehlen.
Felipe und Carlos waren eben auf dem Hügel erschienen. Sie führten drei leere Maultiere mit sich, wodurch der Eindruck einer größeren Truppe hervorgerufen wurde.
»Darf ich, großer Häuptling, meine Soldaten an dein Feuer kommen lassen...«
Aber die Indianer warteten erst gar nicht das Ende meinerWorte ab. Wie die Gemsen kletterten sie an den Felsen hinauf und verschwanden, während der Häuptling dem Doktor die Hand reichte und sagte: »Die Comanites und die Soldaten lieben sich nicht. Der Häuptling folgt seinen Leuten. Lebe wohl, großer Medizinmann, lebe wohl, Alemano.« Und langsam, aber leichtfüßig sprang er den felsigen Hang hinauf.
Ich drückte meinem Getreuen dankbar die Hand.
»Du kamst einmal wieder zur rechten Zeit, Felipe. Unsere Unterhaltung mit den Indianern fing gerade an, auf das strittige Gebiet hinüberzuspielen. Der Häuptling hätte eben gern unsere Waffen in sichern Gewahrsam genommen.«
»Ich habe ja immer gesagt, daß ich Sie nicht allein lassen darf, Don Fernando!« war die verschmitzte Antwort.
»Na, diesmal hättest du dich aber über den ›Senor Alemano‹ gewundert, mein guter Felipe. Ich war fest entschlossen, den ersten, der mir zu nahe kam, niederzuschießen. Das hat auch der Häuptling sehr gut gewußt, sonst säßen wir jetzt nicht mehr hier!«
»Dem Himmel sei Dank, Don Fernando, daß Sie nun endlich gelernt haben, in Südamerika zu reisen. Lieber einen Schuß zu viel als zu wenig, und jedenfalls immer den ersten! Wer Ihnen im wilden Gebirge begegnet, den müssen Sie so lange für Ihren Feind halten, bis er Ihnen das Gegenteil beweist. Dann haben Sie wenig zu befürchten!«
»Ich danke dir, Felipe! Sei sicher, daß ich es von jetzt ab so halten werde. Der ›große Karuwaho‹ und seine Leute haben mir gründlich beigebracht, wie man mit ihresgleichen verkehren muß!« – –
Drittes Kapitel - Der »Leichenraub« rächt sich an uns
Ein ungemütlicher Nachtmarsch. – Am gefährlichen Engpaß. – »Wartet, ihr Teufel, noch habt ihr mich nicht!« – Ich stürze ab... in eine Chulpa. –
»Ob Don Fernando schon tot ist?«
Felipe berichtete, daß er unten in dem kleinen Fischerdorf Maiquia ein Häuschen für uns gemietet und unser Gepäck der Obhut eines Zollbootsmanns anvertraut hatte.
Ich wäre am liebsten sofort dorthin abmarschiert. Wie lange schon ersehnte ich einen ruhigen Tag und die Gelegenheit, meinen äußeren Menschen wieder einmal richtig in Ordnung zu bringen. Auch in meinen Tagebüchern war vieles nachzuholen, was nicht in Vergessenheit geraten durfte. Aber ich mußte mich schon gedulden, bis die kostbare Ausbeute des eben bestandenen Abenteuers wohlgeborgen war. Noch einmal selbst in die Chulpa hinabzusteigen – dazu konnte ich mich denn doch nicht entschließen. Ich übernahm also die Wache, während Dr. Perez mit unseren beiden Begleitern den »Leichenraub« besorgte.
Fünf volle Stunden vergingen, ehe alles wohlverpackt zum Abtransport bereitstand. Es begann schon zu dunkeln, als wir das von mir inzwischen bereitete Mahl verzehrt hatten und zum Aufbruch bereit waren. Sollten wir nun doch lieber die Nacht hier zubringen? Ich selbst drängte fort. Die andern drei aber wollten wenigstens einige Stunden ruhen und dann mit dem Mondaufgang den Marsch antreten.
In diesem Meinungsstreit entschied ein – – Indianer!
Ich hatte den Blick über die Hänge schweifen lassen, an denen die letzten Strahlen der sinkenden Sonne ihr Spiel trieben. Da begegnete ich den starr auf uns gerichteten funkelnden Augen eines Indianers, der den Bogen vor sich auf den Stein gelegt hatte und augenscheinlich bemüht war, auf Pfeildistanz an uns heranzukriechen. Ohne meine Stellung zu verändern, hob ich wie spielend die Büchse und feuerte eine Schrotladung auf den Gegner.