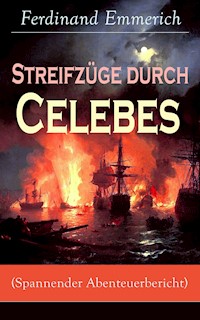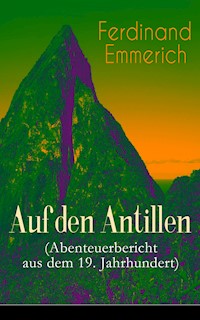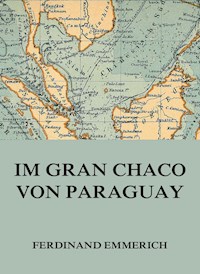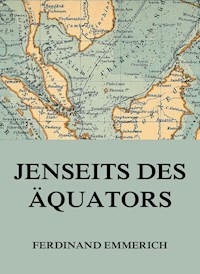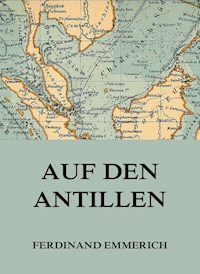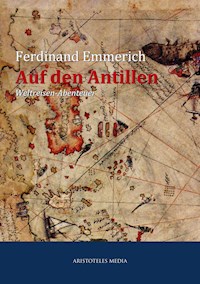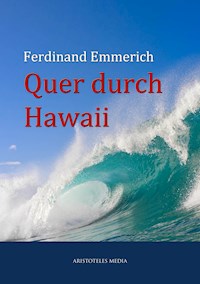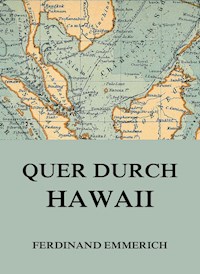
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf seinen Fahrten führte es Emmerich unter anderem auch nach Hawaii, dem Insel-Bundesstaat der USA. Er beschreibt hier nicht nur seine Erlebnisse sondern auch die Kultur der Hawaiianer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quer durch Hawaii
Ferdinand Emmerich
Inhalt:
Ferdinand Emmerich – Biografie und Bibliografie
Quer durch Hawaii
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Quer durch Hawaii, F. Emmerich
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849652982
www.jazzybee-verlag.de
Ferdinand Emmerich – Biografie und Bibliografie
Geboren am 8. Juli 1858 in Viersen-Hamm. Deutscher Forscher, Abenteuerer und Reiseschriftsteller. Nach Abschluß seines Medizinstudium 1886 war er fast 30 Jahren auf Reisen durch die ganze Welt und kam erst wegen des Weltkrieges 1915 nach Deutschland zurück. Seine Romane sind fesselnde Expeditions- und Abenteuerberichte für Jung und Alt. Er starb am 2. August 1930 in München-Pasing,
Wichtige Werke:
· Leitfaden für Auswanderer
· Auf Schleichwegen nach Tibet
· Auf den Antillen
· Das Rätsel des Orinoko
· Der Einsiedler von Guayana
· Der Walfischfänger Erlebnisse eines deutschen Seemanns
· Durch die Pampas von Argentinien
· Hüter der Wildnis
· Im Gran Chaco von Paraguay
· Im Herzen Brasiliens
· Im Reiche des Sonnengottes
· In mexikanischen Urwäldern
· Jenseits des Äquators
· Kopfjäger auf Borneo Reisebericht
· Kulis Tiger Krokodile
· Neuseeland Weltreisen und Forscherabenteuer
· Quer durch Hawai
· Streifzüge durch Celebes
· Unter den Urvölkern von Südbrasilien
· Unter den Wilden der Südsee
· Weltreisen und Forscher-Abenteuer (6 Bände)
Quer durch Hawaii
Erstes Kapitel.
Mein Kurs lag ostwärts. Meine Aufgabe war nahezu erfüllt. Noch blieb mir die Durchquerung der Insel Hawaii, dann winkte mir eine längere Ruhepause. Wie sehr ich mich nach einer solchen sehnte, kann nur der ermessen, der sich in die Lage eines Menschen hineinzudenken vermag, der über ein Jahr lang alle die kleinen Bedürfnisse entbehren mußte, die nun einmal die Kultur dem Manne anhängt. Viele Monate hindurch sah ich kein Bett. Der harte Boden, mit einer Schicht Blätter als Unterlage, dazu den weiten Himmel als Dach über dem müden Haupte, vertrat die Stelle eines Nachtlagers. Halbgares, halbverbranntes Fleisch, mit großen Schwierigkeiten beschafft und oft unter Lebensgefahr am Feuer geröstet, bildete die Kost, wenn nicht die Nähe mordgieriger Eingeborener uns auch diesen Leckerbissen verwehrte. Unsägliche Strapazen, über schroffe Gebirgszüge, durch nie von Menschen betretene Urwälder, durch Sümpfe und über verdorrte Steppen führende, fluchtartige Wanderungen, dazu Hunger und Durst, verschärften die täglich wiederkehrenden Anforderungen an unsere Willensstärke – und nun winkte die Ruhe.
Celebes lag hinter mir. Einen Teil meiner Erlebnisse auf jener Insel findet der Leser in den Schilderungen meines fünften Bandes. Jetzt stand ich auf dem Deck eines deutschen Frachtdampfers, der mich nach Hawaii bringen sollte. Ich wählte in Yokohama diesen schlichten Landsmann aus der Mitte der amerikanischen, englischen nnd kanadischen Luxusdampfer, um wieder einmal einige Wochen heimatliche Laute unvermischt zu hören, um wieder einmal derbe deutsche Schiffskost zu genießen.
Kapitän Michelsen machte anfangs Schwierigkeiten, mich auf seinem Dampfer »Schleswig« als Passagier mitzunehmen. Nicht allein, weil dem Schiffe die Einrichtungen für Fahrgäste fehlten, sondern in echt deutscher Rücksichtnahme auf das, was die Agenten der großen Dampferlinien wohl dazu sagen würden ... Durch Überredung und mit freundlicher Unterstützung des in Japan ansässigen Großkaufmanns Vogel brachte ich jedoch den guten Michelsen dahin, daß er mich der Form wegen unter seine Mannschaft einreihte – als Kajütsjunge! Damit war die Rücksichtnahme auf Engländer, Amerikaner und die schlitzäugigen Japanesen untertänigst gewahrt (o Michel!), und ich durfte mitfahren.
Nach viertägigem herrlichen Wetter suchte uns eine »gute« Brise auf. Sie sorgte ausgiebig dafür, daß mich die Langeweile verschonte. Der wind nahm den Mund ordentlich voll und legte sich fest in die schwellenden Segel, die damals noch von allen Dampfschiffen geführt wurden. So, unter dem Druck von Segel und Dampf, liefen wir in guter Fahrt durch die mehr und mehr auflaufende See. Der langentbehrte Genuß eines in wildem Zorne aufschäumenden Weltmeeres bannte mich fast ununterbrochen auf das Deck, und freudig legte ich Hand mit an, als gegen Mitternacht die Kraft des Windes den Kapitän zwang die meisten Segel fortzunehmen.
Gegen Morgen hatten wir einen richtigen Sturm. Hoch auf die Spitze der Wellenberge kletterte die kleine »Schleswig«, um gleich darauf sausend in ein tiefes Tal hinabzutauchen. In allen Fugen knarrte und ächzte das wackere Schiff, und einem mutigen Renner gleich schüttelte es die schweren Wogen von seinem Rücken, die ihm die gierige See in seinem unaufhaltsamen Laufe ostwärts freigebig spendete.
Mittags lief ein großer englischer Australiendampfer an uns vorbei. Ein gewaltiger Bau gegen unsere kleine »Schleswig«. Aber auch er mußte sich dem gewaltigen Ozean beugen. Heftig rollte er von einer Seite auf die andere, und das leere Deck bewies, daß die Fahrgäste der Seekrankheit zum Opfer gefallen waren.
Fast zwei Stunden lang konnten wir den Engländer vor uns dahintanzen sehen. Dann änderte er plötzlich seinen Kurs etwas südwärts, und wir bemerkten nun ein Fahrzeug, das sich allem Anscheine nach in Seenot befand. Da das Segelschiff fast recht im Kurse des Australiendampfers lag, konnte man sich bei uns dessen Fahrtänderung nicht recht erklären. Kapitän Michelsen sprach kopfschüttelnd sein Befremden über das Manöver aus. Ich aber war in der Lage, eine Erklärung für diese Handlungsweise zu geben. Hatte ich doch – wie ich das in meinem ersten Bande schilderte – am eigenen Leibe die Menschenfreundlichkeit der Engländer erfahren. Ich sagte den Schiffsgenossen den Hergang voraus:
»Geben Sie acht, Kapitän! Der Dampfer da vor uns rührt keine Hand, um dem andern beizustehen. Im Gegenteil, er geht südwärts, um sich zu drücken!«
»Nein, das glaube ich denn doch nicht!« erwiderte Hilmer, der erste Offizier, der mit dem Glase angestrengt nach dem notleidenden Fahrzeug ausgespäht hatte. »Es ist ein Engländer. Ich sehe die Notflagge und die Landesfarbe. Dem wird der Postdampfer sicher Hilfe leisten!«
»Warten Sie es ab!« antwortete ich. »Der Kerl weiß genau, daß wir ihm die Rettung abnehmen, obgleich wir mit uns selbst genug zu tun haben. Sehen Sie nur wie er nach Süden abfällt! Lieber riskiert er ein paar eingeschlagene Fenster, als daß er ein halbes Dutzend Menschenleben dem Verderben entreißt. Die Scheiben zahlt die Versicherung. Ob er für die Nahrung der paar Seeleute eine Vergütung erhält, weiß er noch nicht! Da nimmt er lieber das sichere. Was liegt dem an ein paar Menschen!?«
Die beiden Deutschen sahen mit steigendem Grimm dem abtreibenden Postdampfer nach. Jetzt hätte er Rettungsmanöver einleiten müssen, denn er befand sich in gleicher Höhe mit dem notleidenden Segelschiffe. Unsere gesamte Mannschaft verfolgte gespannt den Kurs des großen Dampfers. Rufe der Erwartung wurden laut ....
Da entrang sich den Lippen des ersten Offiziers eine harte Verwünschung:
»Bei Gott, Sie haben recht!« schrie er, schäumend vor Wut. »Der Hund läßt seine eigenen Landsleute ertrinken! Daß dich doch ....« Das Ende der Rede verschlang die heulende Windsbraut.
Kapitän Michelsen sprang auf das Deck hinunter.
»Klar bei den Booten!« schrie er, den Sturm übertönend. »Freiwillige vor, zur Rettung der Barkbesatzung!«
Während die Mannschaft die Vorbereitungen traf, richtete der kleine »Schleswig« seinen Bug auf die Leeseite des Wracks. Zwar warf uns der Sturm mit zermalmender Gewalt so in der wilden See umher, daß wir oft an den eigenen Untergang dachten. Aber trotzdem gab es keinen Mann an Bord, der es nicht für selbstverständlich hielt, daß das eigene Leben zur Rettung der notleidenden Seeleute gewagt werden mußte.
Wir erkannten bald mit bloßem Auge, daß das hilfesuchende Schiff in leckem Zustande war. Der Großmast war über Bord gegangen und gekappt. Vom Fockmast fehlte der ganze obere Teil. Klüverbaum und Vordergeschirr trieb neben dem Schiff in der See. Das Rettungsboot fehlte. Wie ein Ball flog das Fahrzeug in der hochgehenden See auf und nieder, und schwere Wogen wuschen über das Deck. Jede neue Welle konnte das Ende der Bark besiegeln.
Unser zweiter Offizier Vahsel unternahm das Wagnis mit dem Zimmermann und fünf Matrosen, die mit dem Tode ringenden Seeleute von ihrem sinkenden Schiffe zu holen. Lange dauerte es, bis das Rettungsboot eine günstige Woge erhaschte, die es unversehrt von unserm Dampfer fortbrachte. Eine herankommende Welle würde es unfehlbar an unserer Seite zerschmettert haben.
Atemlos folgten wir dem dahingleitenden Fahrzeuge, in dem sieben brave deutsche Männer dem Tode trotzten, um in heldenmütigster Weise ihren notleidenden Kameraden Hilfe zu bringen. Mit welchen Gefühlen müssen die Schiffbrüchigen ihrem eigenen Landsmanne nachgeblickt haben, als er sie schnöde im Stiche ließ, und welche tiefe Dankbarkeit mag in jenem Augenblick die Seele der Armen erfüllt haben, als sie das kleine Boot des winzigen deutschen Dampfers auf sich zukommen sahen – jetzt hoch auf der Spitze einer Woge balanzierend, jetzt hinabgeschleudert in ein tiefes Wellental.
Wir hatten uns dem Wrack allmählich so genähert, daß wir mit dem Fernglase die Mannschaft zählen konnten. Es waren neun Mann, die sich, an den Maststumpf und andere Schiffsteile angebunden hatten, während das Schiff von der schäumend darüberhin brechenden See bald auf die eine, bald auf die andere Seite geworfen wurde.
Unser Boot war nach unsäglichen Mühen der Bark so nahe gekommen, daß eine Verständigung möglich wurde. Wir bemerkten, wie die Mannschaft der Bark einen runden Gegenstand, an dem Taue befestigt waren, über Bord warf, der von unserm Boote aufgefischt wurde. Damit war die Verbindung hergestellt. Nun sahen wir einen Rettungsgürtel von dem Boote abtreiben, der an dem Tau auf die Bark gezogen wurde. Der Schiffsjunge des Wracks sprang, angetan mit dem Schwimmgürtel, als erster ins Meer. Wild schlugen die Wellen über dem kleinen Körper zusammen. Es durchrieselte uns kalt, als uns die hochgehenden Wogen den Ausblick versperrten, und uns über das Rettungswerk im Unklaren ließen. Eine gewaltige Welle zeigte uns dann für Sekunden den Kopf des Jungen; sofort verschwand er wieder im tosenden Brechen der sich überstürzenden Seen, während jetzt unser Boot mit den fieberhaft arbeitenden Rettern hoch oben auf dem gläsernen Kamme schwebte. So vergingen bange, aufregende Minuten. Endlich erblickten wir acht Menschen im Rettungsboote und wußten nun, daß der Junge gerettet war.
Der nächste Schwimmgürtel brachte gleich zwei Männer durch die zornige See in das rettende Fahrzeug. Dann noch einige Male, und als letzter warf sich der Kapitän des Seglers in den kochenden Gischt, nachdem er noch dem Wasser freien Eingang in das Wrack verschafft hatte, um dessen Sinken zu beschleunigen.
Nun steuerte das Boot, durch die kräftige Beihilfe der Geretteten bewegt, mit raschen Ruderschlägen dem kleinen »Schleswig« entgegen. Grüßend hoben sich die Hände der Schiffbrüchigen, als wollten sie schon jetzt ihren Dank für die ausgeführte Heldentat aussprechen. Aber noch war die Gefahr nicht vorüber. Noch waren die Männer im Boote in der Gewalt der tosenden See.
Kapitän Michelsen wußte den schwer kämpfenden Männern jedoch zu helfen. Er steuerte den Dampfer so, daß er das Boot in die dem Winde abgekehrte Seite brachte und trieb den Ankommenden geschickt entgegen. An Bord wurden inzwischen alle Vorkehrungen getroffen, um der mit der See kämpfenden Mannschaft das Anlegen zu erleichtern. Alle freien Männer standen an Deck mit Tauen und Ringen bereit und verfolgten mit klopfendem Herzen jede Bewegung des herankommenden Bootes. Bald sah man es hoch auf dem Rücken eines Wogenkammes, bald war es wieder hinabgeschleudert in ein tiefes Wellental und unsern Blicken entzogen – Aber das Steuer lag in der Hand eines echten deutschen Seemannes, dessen scharfem Blick keine Bewegung des Meeres entging und dessen kundige Hand den heimtückischen Angriffen der See zu begegnen wußte.
Wohl über eine Stunde lang dauerte der Kampf der braven Bootsmannschaft mit der wilden See. Dann erst gelang es, unserm Dampfer nahe genug zu kommen. Wie oft schon glaubten wir in dieser qualvoll langen Zeit, den Sieg errungen zu haben. Jedesmal aber faßte eine heranschießende Woge das zerbrechliche Boot und schleuderte es weit hinaus in den kochenden Gischt. Endlich aber gelang es, das Boot so heranzubringen, daß ein Zerschellen an der Bordwand nicht zu befürchten war. Mit einer Hast, die durch die ausgestandene zweitägige Todesangst verständlich wurde, kletterten nun die Schiffbrüchigen an Bord. Dort sanken sie der Mannschaft in die Arme und lachten und weinten vor Freude über die Errettung vor dem sicheren Tode.
Vahsel und der Bootsmann hatten dann noch große Schwierigkeiten zu überwinden, bis sie das Boot wieder glücklich in seine Davits verbracht hatten. Alle Hände strecken sich den wackeren Helden mit den heißesten Dankesworten entgegen, als ihr Fuß endlich wieder das sichere Deck betrat. Sie wehrten jedoch bescheiden jede Huldigung ab.
»Was wir vollbrachten, würde jeder andere deutsche Seemann auch getan haben,« sagte Vahsel. »Wir sind ja Gott sei Dank keine Engländer.«
Der brave Offizier trat dann, da seine Wache gerade anfing, seinen Dienst an, als ob er in seiner Koje ausgeruht und nicht sechs lange Stunden einen Kampf auf Leben und Tod mit der rasenden See gekämpft hätte.
Wenige Stunden nach der Rettung der Barkmannschaft ließ der Sturm nach, und bald lag die See wie ein blanker Spiegel vor uns.
Vor Oahu gingen wir vor Anker. Hier schied ich von den wackeren Seeleuten und nahm im Hause eines Bekannten der Firma Hackfeld in Honolulu Wohnung. Eine ganze Anzahl Briefe aus der Heimat, die mich zum Teil schon seit vielen Monaten von Ort zu Ort verfolgten, ohne mich zu erreichen, bannten mich einige Tage an den Schreibtisch. Mitten in diese ungewohnte Beschäftigung platzte eines Morgens mein Gastfreund mit der Meldung:
Zweites Kapitel.
Laute Kommandorufe weckten mich. Ein Poltern und Klirren, und mit klatschendem Aufschlag rasselte der Anker des kleinen Schoners "Maui" in die funkensprühenden Wasser. Das Meer war spiegelglatt. Ein halbmondförmiger Strand mit leise nickenden Kokospalmen und zahlreichen Kanoes träumte dem nahen Tag entgegen. Aus einem schwarzgrünen Haine winkte ein kleines Dorf herüber. Keanhou, mein Reiseziel. Ein Kanakendorf.
Meine Habseligkeiten standen bald auf Deck. Der deutsche Kapitän und sein erster Steuermann waren noch mit den Landungsarbeiten beschäftigt, und in der Erwartung, mich von ihnen bei einem opulenten Frühstück zu verabschieden, trat ich auf das Achterdeck und ließ mein Auge über die herrliche Landschaft schweifen.
Es war noch früher Morgen. Die erhabene Schönheit der erwachenden Natur wirkte in dieser Beleuchtung besonders bezaubernd. Am Firmament prangte, voll aufgerichtet, in seiner hehren Pracht das herrliche Sternbild des südlichen Kreuzes, dessen Spiegelung in tausend glitzernden Perlen über die mattglänzende Wasserfläche zitterte. – Über dem Ufer lagerte der feine, zarte Hauch der Morgennebel, und eine leise Brise trug den würzigen Duft von Millionen von Blüten zu mir herüber.
Da zuckte ein heller Blitz über das Firmament. Der schneebedeckte Gipfel des gewaltigen Mauna Loa stand wie mit Blut übergossen. Einen Augenblick schien es als ob er im Äther schwebe; dann hob sich der glutrote Feuerball aus den Fluten des Weltmeeres, und unter den alles belebenden Strahlen des Tagesgestirnes erwachte geschäftiges Leben.
Der Kapitän trat zu mir:
»Nun, lieber Doktor, sind Sie am Ziel. Von hier aus kann man den immer unruhigen Vulkan, den Kilauea, am besten besteigen. Der Weg zu dem ›ewigen Feuer‹, wie die Kanaken mit Recht den Feuersee dort oben nennen, ist gar leicht zu finden. Er bietet keine besondern Schwierigkeiten. Auch der böse Mauna Loa dort oben kann von hier aus erreicht werden. Aber wie überall in der Welt, stehen auch hier neben den Rosen die Stacheln. Wenn der Vergleich auch etwas hinkt, so trifft er doch zu. Die Kanaken sind hierzulande noch ziemlich rauhborstig und stacheliger Natur. Wenn Sie es vermeiden können, lassen Sie sich nicht mit den Kerlen ein. Sonst – na, Sie haben ja gute Waffen?«
Bordgeschäfte riefen den Kapitän ab. Ich trat an die Reeling, wo sich mittlerweile eine ganze Anzahl von Ruderern eingefunden hatten, um den Fahrgast ans Land zu bringen. Weiß der Himmel, wie die Kanaken von meiner Absicht Wind bekommen hatten, aber jeder wußte schon, daß ich einen Abstecher zu den Vulkanen machen wollte. Jeder drängte sich vor und überbot den Nachbarn in gebrochenem Englisch mit Anpreisungen seiner Zuverlässigkeit. Dabei hatten die Kerle wahre Galgenphysiognomien und mehr als einer trug Narben auf dem Körper, die eine verdächtige Ähnlichkeit mit Messerstichen aufwiesen.
Wie meistens in solchen Fällen ließ ich den Schwall über mich ergehen, ohne die geringste Notiz von den Bootsleuten zu nehmen. Der ortsansässige Schiffsagent würde mir schon den geeignetesten Mann bezeichnen.
Während ich so an der Reeling lehnte und meine Studien an den Kanaken machte, stieß ein Boot vom Strande ab, das ein einzelner, auf unsere Art gekleideter Mann ruderte. Er legte an unserm Fallreep an, und da ihn der wachhabende Matrose ungehindert an Deck kommen ließ, vermutete ich in ihm den Agenten. Der Mann ging jedoch mit leichtem Gruße an unserm Kapitän vorüber und schritt gerade auf mich zu. Mit einem kurzen Lüften des Hutes sagte er, zu meiner größten Überraschung in deutscher Sprache:
»Wenn Sie auf den Kilauea wollen, so machen Sie den Aufstieg am besten von hier aus. Und wenn Ihnen dabei die Gesellschaft eines Landsmannes angenehm ist, so bin ich gern bereit, Sie zu begleiten. Ich habe ohnehin beruflich da hinauf zu tun.«
Ich sah den Sprecher etwas mißtrauisch an. Sein kupferbraun gebranntes Antlitz ließ eher auf einen Südsee-Insulaner als auf einen Deutschen schließen. Ich zögerte daher etwas mit der Antwort. – Aber schließlich sah ich selbst nicht anders aus. Ich dankte dem Manne und fragte, mit der gewissen Unbehaglichkeit im Innern, die den Naturforscher unwillkürlich befällt, wenn er in seinem Arbeitsgebiet bereits einen Kollegen vorfindet:
»Beruflich? Ich habe wohl einen Kollegen vor mir, der hier wissenschaftlich tätig ist? Wohl Zoologe?«
Gleichzeitig stellte ich mich vor.
»Nein, nein!« wehrte der andere lächelnd ab, als er den süß-sauern Tropfen aus der Frage herausfühlte. »Haben Sie keine Angst vor meiner Konkurrenz. Ich bin Missionar Stapelfeldt.«
Die Antwort verscheuchte mit einem Schlage alle Bedenken. Hocherfreut schüttelte ich dem liebenswürdigen Landsmann die Hand und nahm gern seine Einladung, in seinem Hause Wohnung zu nehmen, an. Mein Gepäck war schnell verladen. Ehe wir jedoch von dem Schoner abstießen, rief uns der Kapitän:
»Aber Hochwürden, was ist denn los? Wollen Sie wirklich mein Schiff verlassen, ohne meiner Kajüte einen Besuch abzustatten? Das ist ja gegen alle Regel ....«
»Guten Morgen, lieber Kapitän! Heute müssen Sie mich entschuldigen. Wie Sie sehen, habe ich Gastpflichten zu erfüllen. Machen Sie mir heute einmal die Freude und nehmen Sie ein kleines Frühstück in meinem bescheidenen Häuschen. Es gibt zwar nur Fische ....«
»Und was dazu gehört!« unterbrach ihn lachend der Kapitän. »Es gilt, Hochwürden, in einer Stunde bin ich bei Ihnen.«
Das Missionshaus, in dem der Missionar mit noch zwei Kollegen, die zufällig abwesend waren, wohnte, war ein luftiges Bambusgebäude, das mitten in einem Akazienhaine lag. Der mit einem Bambuszaun umfriedigte gutpflegte Garten barg viele Früchte, besonders Orangen, Bananen, Granatäpfel und Ananas. Zwei alte Kanaken besorgten die Küche und hatten alle sonst vorkommenden Arbeiten zu übernehmen. Der Platz war in seiner durch nichts gestörten Ruhe, in dem Klima des ewigen Frühlings, der auf den hawaischen Inseln herrscht, ein wahres Paradies. Ich machte dem Missionar eine dahingehende anerkennende Bemerkung, die ihm jedoch einen tiefen Seufzer entlockte:
»Sie haben wohl recht. Es könnte ein Paradies sein, wenn – nun, wenn eben alles so wäre, wie es sein könnte, wenn die Kanaken sich nur nicht ewig befehden würden und, was das schlimmste ist, wenn die amerikanischen Missionare mehr Duldsamkeit und Friedensliebe aufbrächten. Aber das ist ein trauriges Kapitel, über das wir uns noch eingehender unterhalten werden. Jetzt fehlt dazu die Zeit, denn dort sehe ich eben den Kapitän herüberkommen.– Aber was schleppt denn der Schiffsjunge da mit? Haben Sie noch Gepäck an Bord zurückgelassen?«
»Nein. Das gehört nicht mir. Das sind zwei Körbe...«
»Halloh, Hochwürden!« rief der Kapitän jetzt. »Wo kann denn der Junge seine Decksladung hinstauen? Ich habe mir erlaubt, eine Kleinigkeit für das Frühstück zu stiften, lauter deutsche gute Sachen, die Sie seit Jahren wohl entbehrt haben.«
Und mit einem spitzbübischen Lächeln in seinem ehrlichen Seemannsantlitz zauberte er viele heimatlichen Sachen auf den Tisch, die damals noch auf Hawaii zu den größten Seltenheiten gehörten: Marinierte Ostseeheringe, Mettwürste, Schinken, Pumpernickel und einige Flaschen Rheinwein.
»So, meine Herren, nun wollen wir einmal auf vaterländische Art frühstücken! – Nein, Hochwürden, keine Einwendungen! Die Eßwaren sendet Ihnen mein ›Brotherr‹, der Sie ebenso ins Herz geschlossen hat, wie Ihr ergebener Kapitän, der sich erlaubt, den Wein zur Befeuchtung der in Aussicht gestellten Fische zu stiften.«
»Dann darf ich wohl eine Kiste Zigarren für den Nachtisch spenden,« warf ich ein. »Ich habe mir einen Vorrat in Manila eingelegt und freue mich, so guten Gebrauch davon machen zu können.«
Das Frühstück zog sich ein wenig sehr in die Länge. Der Kapitän war kaum an Bord zurückgekehrt, als der Gesang der Matrosen das Aufheben des Ankers ankündigte. Unter lebhaften Grüßen sahen wir den kleinen Schoner mit der frischen Brise in das offene Meer hinaussegeln, und noch lange unterhielten wir uns über den genußreichen Nachmittag.
Am nächsten Morgen traten wir den Weg in das Gebiet der Feuerberge an. Mit einigen Kanaken als Trägern und auf guten trittfesten Pferdchcn ritten wir frohgemut in den jungen Tag. Der Weg führte uns an Pflanzungen vorbei, durch Kokoshaine und rauschende Mais- und Zuckerrohrfelder. Vereinzelte Hütten, vor denen zahlreiche Rinder in der paradiesischen Tracht, im Schutze ihrer kaum reicher bekleideten Eltern faulenzten oder sich im Sande wälzten, wechselten ab mit wohlgepflegten Gärten, die sich hinter sauber gehaltenen Lehm- oder Bambushäuschen dahinzogen und deren Bewohner in ihrer vollständigen Bekleidung den europäischen Einfluß verrieten.
Von diesen letzteren wurde der Missionar auffallend freundlich, ja herzlich begrüßt, während aus den Hütten der herumlungernden Tagediebe mehrfach höhnische Worte und herausforderndes Lachen an unser Ohr drang.
Unterwegs zügelte ich einmal mein Pferd, um einige Orangen von den am Wege stehenden, wie ich glaubte, herrenlosen Bäumen zu pflücken. Ich hatte aber kaum den Arm danach ausgestreckt, als ich dicht neben mir rauhe Laute vernahm. Aus dem nahen Gebüsch brach mit allen Zeichen der Wut ein alter Kanake hervor, der mich mit einer Flut von rauhen Worten überschüttete. Ich verstand sie zwar nicht, zweifelte aber keinen Augenblick daran, daß er ein halbes Schimpfwörterlexikon an mich verschwendete. – Empört über eine solche völlig ungerechtfertigte Anpöbelung wollte ich dem Alten das Fell mit der Reitpeitsche gerben. Mein Begleiter fiel mir aber in den Arm und bat mich dringend, den Kerl diesmal laufen zu lassen. Er fügte hinzu:
»Ich gebe Ihnen später die Erklärung für diese feindseligen Ausfälle, die sich, so Gott will, nicht wiederholen werden, obgleich wir auch droben in den Bergen nicht auf allzu freundliche Menschen rechnen können.«
»Aber, bester Freund, ich kann mir doch diese Anrempelung von dem Kanaken nicht gefallen lassen. Einen Hieb muß ich ihm wenigstens über seinen schmutzigen Buckel geben.«
»Bitte, tun Sie es nicht,« bat der Missionar, indem er mein Pferd davonzog. »Heute abend erkläre ich Ihnen alles.«
Bald wurde der Weg steinig und wand sich durch verwitterte Lavablöcke und durch dornenbewachsene Schluchten. Eine Unterhaltung wurde dadurch von selbst abgeschnitten. Der Missionar ritt sorglos voran. Seine Träger aber, die bis dahin an der Spitze marschierten, blieben nun zurück, und die scheuen Blicke, die sie hinauf zu den auf halber Höhe hängenden Blöcken warfen, sagten mir, daß wir uns in einer Gegend befanden, in der wir, vor unliebsamen Abenteuern nicht unbedingt sicher waren.
Pater Stapelfeldt war unbewaffnet. Durch die Wegeverhältnisse hatte sich unsere Zugordnung nach und nach verschoben, und zwar nach meinem Dafürhalten zu unsern Ungunsten, wenn wirklich ein Angriff gegen uns erfolgen sollte. Die hintereinander marschierenden fünf Träger trennten mich von dem Missionar und da nur ich mit Schußwaffen versehen war, strebte ich danach, an die Spitze unseres kleinen Zuges zu gelangen.
Eine buchtartige Verbreiterung des Pfades bot mir genügenden Raum, um mein Pferd an die Seite des Paters zu drängen. Meine Bitte, mich an die Spitze des Zuges reiten zu lassen, wollte er indessen abschlagen, wir stritten uns noch freundschaftlich darum, als plötzlich zwei Kanaken aus dem Gebirge neben uns auftauchten, die ein beladenes Pferd vor sich hertrieben. Der Missionar lenkte sein Tier zur Seite, um den beiden den Weg frei zu geben. Der Treiber aber schien es auf einen Zusammenstoß abgesehen zu haben, denn er nahm nicht nur nicht den freien Weg, sondern trieb sein Roß derart gegen das Pferd des Paters, daß dieses beinahe den Hang hinuntergestürzt wäre.
Diesmal war ich nicht gesonnen, die Beleidigung ruhig hinzunehmen. Ich fiel dem fremden Pferde in die Zügel und trieb es zurück, indem ich nun den Pater mit meinem Tiere deckte. Dieser unvermutete Eingriff versetzte die Kanaken in wilden Zorn. Im Nu blitzten die Messer. Ebensoschnell aber richtete ich den Lauf meines Revolvers gegen den Nächsten, der instinktiv einen Schritt zurückwich. Dann gab ich meinem Pferde die Sporen und drang auf die Kerle ein, die sich langsam gegen den Hang hin vor dem drohenden Laufe in Sicherheit zu bringen suchten.
»Stehen bleiben!« schrie ich ihnen in englischer Sprache nach, und wenn sie vielleicht auch die Worte nicht verstanden, so begriffen sie sicher deren Sinn. Der frechste der beiden blieb stehen und spielte vielsagend mit dem Messer. Ehe er aber noch meine Absicht erraten konnte, wechselte ich den Revolver mit der schweren Lederpeitsche und zog ihm einen so wuchtigen Hieb durch das Gesicht, daß er laut heulend zusammenbrach. Hierauf sprang ich zu Boden, entwand dem Kerl das Messer und ließ nun hageldicht die Hiebe über sein nacktes Fell prasseln.
»So, nun ist der Weg frei!« rief ich meinen Begleitern zu, als ich atemlos von dem sich am Boden krümmenden Kanaken abließ. »Jetzt haben wir Ruhe vor dem Gesindel, denn wenn der auch nichts erzählt, so spricht sein Fell für ihn.«
Der Pater machte mir sanfte Vorwürfe über mein, wie er glaubte, übereiltes Strafgericht, als wir uns später zur Rast niederließen. Ich aber verteidigte mein Vorgehen und sagte:
»Wenn Sie, ehrwürdiger Herr, dem feigen Gesindel auch einmal so gründlich die Leviten lesen würden, wie ich das heute tat, dann würden die höhnenden Stimmen bald verstummen. Warum schreiten Sie nicht energisch ein? Und woher stammt eigentlich dieser Haß?«
»Ich weiß, daß ich Ihnen eine Aufklärung schuldig bin,« sagte der Pater. »Hören Sie, wie die Dinge bei uns liegen:
Die Kanaken hier im Südosten der Insel wurden schon vor vielen Jahren von amerikanischen Missionaren zum Christentum bekehrt. Sie leben aber in den Dörfern im Innern tatsächlich in heidnischer Weise. Vor vier Jahren landete ich in Keanhou und ging sofort ans Werk, um die verwilderten Menschen dem christlichen Glauben zurückzugewinnen. Bei einem Teile gelang es mir. Es sind die Leute, die Sie hier in anständiger Kleidung sehen. Bei dem übrigen Teile der Kanaken stieß ich auf den Widerstand der durch die amerikanischen Missionen aufgehetzten Dorfältesten. Diese beriefen sich auf einen Erlaß des Königs Kalakaua, der bekanntlich ganz unter dem Einflusse der Amerikaner steht. – Seit jener Zeit verfolgen mich die nicht zu unserer Gemeinde gehörenden Kanaken mit einem mir unerklärlichen Hasse, der sich, wie Sie selbst sahen, bei jeder Gelegenheit Luft macht. Der Alte, der uns unten so barsch entgegentrat, ist einer der ärgsten Hetzer. Oft schon hat man mir seine Drohungen gegen meine Person hinterbracht. Aber ich stehe in Gottes Hand. Soll ich einmal den Anfeindungen zum Opfer fallen – nun, so geschehe der Wille des Herrn!«
»Das sind allerdings traurige Zustände,« erwiderte ich. »Es wäre vielleicht doch angebracht, wenn Sie den Kerlen einmal energisch gegenüberträten. Den Eingeborenen imponiert nichts so sehr, wie ein energischer, furchtloser weißer Mann ...«
»Das wäre der Untergang meiner Gemeinde,« warf Pater Stapelfeldt ein. »Die Amerikaner fänden darin sicher Grund genug, meine Abberufung zu betreiben und dann wäre alles verloren!«
Noch lange unterhielten wir uns über dieses Thema, und es war schon spät, als wir in unsere Decken krochen.
Die aufgehende Sonne fand uns wieder unterwegs. Der Pfad führte durch herrliche Koawälder ( Acacia koa), in denen große Mengen bunter Vögel ihr lustiges Spiel trieben. Hin und wieder trafen wir auch noch auf vereinzelte Stämme des selten gewordenen Sandelholzbaumes ( Santalum album), dessen Ausrottung auf der Insel damals schon in naher Aussicht stand. Dracaena, Pitchardia, Lobeliaceen und schönblühende Ranken erfreuten eine Zeitlang das Auge. Dann traten die Bäume und Palmen zurück. Je höher wir stiegen, desto spärlicher wurde das grüne Gesträuch.