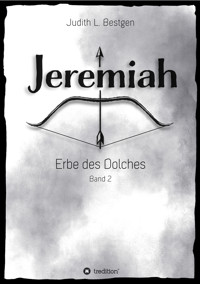
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Erbe des Dolches
- Sprache: Deutsch
Im Schatten eines jungen Tages werden wir sehen, was möglich ist. Im Schatten eines sterbenden Tages sehen wir, was von uns übrig bleiben wird. In der Stille der Nacht sehen wir, was bereits verloren ist. Ein junger König auf einem wackeligen Thron und ein Mann mit einem gebrochenen Herzen auf der Suche nach sich selbst. Inmitten des tiefsten Winters versucht Jeremiah den Gott Nibu ausfindig zu machen, um zurückzuholen, was das Schicksal ihm gestohlen hat. Dabei ignoriert er den Tanz mit dem Feuer, der das neugeformte Königreich in Flammen aufgehen lassen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Judith L. Bestgen
Jeremiah
Erbe des Dolches 02
© 2021 Judith Laura Bestgen
1. Auflage
Autor: Judith Laura Bestgen
Umschlaggestaltung Dorothee Altmann (altmanns-art)
Illustration: Dorothee Altmann (altmanns-art)
Lektorat, Korrektorat: Roberta Altmann
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-347-50652-7
ISBN Hardcover: 978-3-347-50654-1
ISBN eBook: 978-3-347-50655-8
ISBN Großdruck: 978-3-347-50656-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Liebe Leser! (bitte lesen)
Willkommen zurück in der Welt von Yron, Jeremiah und Fey. Danke, dass Du ihr Abenteuer miterlebt hast und dass Du nun den zweiten Band in Händen hältst! Ich freue mich schon sehr darauf, Dich wieder in dieser Welt begrüßen zu dürfen.
Aber ich möchte Dich auch vorwarnen: Es lag nie in meiner Absicht, einen Spannungsbogen aufzubauen, bei dem man sich während des Lesens oft fragt, ob gleich eine Figur das Zeitliche segnen wird oder nicht. Ich glaube fest daran, dass ein Spannungsbogen auch anders auskommen kann.
Außerdem erzähle ich hier aus den Tiefsten meines Herzens. Wenn Du nicht so gerne Bücher liest, bei dem nicht stetig ein Charakter vor dem Tod steht oder alle paar Seiten der Spannungsbogen aufgebauscht wird, warne ich Dich vor. Hier geht es um die Figuren und ihren Weg. Der dritte Band wird deutlich mehr Action haben, versprochen.
Bitte sei nicht enttäuscht, wenn es in diesem Buch ruhiger zugeht (was für mich aber nicht nur wichtig war, sondern in meinen Augen auch einen eigenen Spannungsbogen aufbaut).
Liebe Grüße und viel Spaß!
- Judith
Gewidmet Dir, Roberta.
Schenkerin von Mut und Licht. Leuchtturm in der stürmischen See. Schatzkarte zu einer besseren Zukunft.
Bevor Du dieses Werk kaufst und liest, möchte ich Dich darauf hinweisen, dass es zu „Erbe des Dolches 02 – Jeremiah“ Triggerwarnungen gibt. Sie stehen hinter der Autorenbiografie ausführlicher, aber ich erwähne auch schon hier kurz, wovor ich warne:
- Verlust der Heimat und Flucht
- Posttraumatische Belastungsstörungen
- Halluzinationen
- Selbstmordgedanken
- Erwähnung von durchgeführtem Selbstmord
- Erwähnung von Tod und Verlust von geliebten Personen (z. B. Schwester)
- Erwähnung von Mord
- Erwähnung von Mord am eigenen Kind(!)
- Erwähnung von Brandverletzungen und Tod durch Flammen
- Verarbeitung meiner Depression
Was bisher geschah:
Oft habe ich diese Idee bereits auf Twitter gefunden; von Lesern, die sich genau eine solche Zusammenfassung wünschen, weil zwischen Büchern häufig eine längere Zeit liegt.
Also habe ich mich entschlossen, dass Jeremiah euch selbst nochmals erzählt, was geschehen ist.
Wer hätte am Ende gedacht, dass die falsche Königin Dilara, die ihre eigene Zwillingsschwester opferte, um selbst auf den Thron zu kommen und das Volk im Zaum zu halten, so einfach sterben würde?
Yron und ich haben es geschafft, die Freiheit aus Dilaras Krallen zu befreien, und wir wären niemals auch nur auf die Idee gekommen, dass damit die eigentliche Reise erst beginnen würde.
Zunächst versteckten wir uns bei Cedric und seiner Schwester. Mögen die Götter Zaidas Seele Gnade zeigen! Von dort aus war es sogar Fey, die uns in den Wald brachte.
Wir irrten nach Hause. In ein Zuhause, das wir Jahre zuvor verlassen hatten, um genau die Menschen zu schützen, die wir lieben. Fey heilte mich und gab mir damit das Gefühl der Freiheit in meinem Herzen zurück. Aber gerade, als wir uns fragten, was wir nun mit ihr machen sollten, brachten wir das Dorf mit ihrer Anwesenheit in Gefahr. Yron wurde gefangen genommen und in eine Mine gesperrt, Fey und ich flohen in die weiße Stadt und verloren allmählich unsere Herzen aneinander.
Was Edo, den Göttervogel, der Fey schützen sollte und mich mit gerettet hatte, gar nicht zusagte. Aber noch ehe der Streit in dieser unangenehmen Situation eskalieren konnte, wobei ich mir alle Mühe gab, auszuweichen und meine Zeit bei ein paar Waisen zu verbringen, erzählte uns Malika, die Seherin, dass Yron lebte.
Wir reisten weiter und trafen uns wieder. Mein Bruder konnte uns endlich den richtigen Ort nennen. Dieses verdammte Hochoben hatte die ganze Reise bestimmt, war aber bis zum Schluss im Schatten geblieben.
Das Hochoben. Der Ort, die Insel, auf der Dilara und Elani zur Welt gekommen waren. Und der Ort, an dem Dilara ihre Zwillingsschwester verfluchte und Fey erschuf. Das war der Ort, an dem meine Geliebte uns verlassen sollte.
Eine Gruppe von Außenseitern hatte Yron aus der Mine geholfen und sie kannten einen merkwürdigen alten Seebären, dessen Mann Jahre zuvor von uns gegangen war. Er beschloss, uns zu helfen, und so setzten wir auf die besagte Insel über, die Königin fiel und Fey opferte sich.
Nun kämpft Yron mit dem Thron und ich mit mir selbst.
Jeremiah
Im Schatten eines jungen Tages werden wir sehen, was möglich ist.
Im Schatten eines sterbenden Tages sehen wir, was von uns übrig bleiben wird.
In der Stille der Nacht sehen wir, was bereits verloren ist.
Teil I
Der Thron und der Sand
Kapitel 1
Fey hatte gesagt, dass Glück nur dort zu finden sei, wo Hoffnung weilte, und Hoffnung konnte nur leben, wenn Angst sich zügelte.
Hoffnung. Feys Schwester, die ebenso trügerisch wie unverzichtbar daherkam und selbst dann die Menschen nicht im Stich gelassen hatte, als Fey nicht mehr da gewesen war. Hoffnung hatte dadurch vielleicht ihren guten Ruf verloren, doch hatte es sie nie gekümmert. Stets war sie den Menschen zur Seite getreten. Sie weigerte sich, zu gehen. Auch jetzt.
Um Jeremiah herum war es dunkel und nur die Sterne spendeten fahles Licht. Trotz des Fröstelns, das seinen Körper befallen hatte, sträubte er sich, für diesen Tag eine Pause einzulegen und sich ein wärmendes Feuer zu gönnen. Wenn er verweilte, schienen seine Gedanken ihn schneller einholen zu können. Das Licht eines Feuers bekämpfte die Schatten in seinem Kopf nur mäßig. Es schien, als könnten sie nicht mit ihm Schritt halten, aber sie hafteten an ihm wie Frost und wenn er sich der Erschöpfung ergab, dann nutzten sie diese Schwäche, um die Krallen in ihn zu schlagen.
Und dennoch war er stehen geblieben. Unter seiner Hand nahm er die knorrige Borke einer alten Eiche wahr. Monate war Fey nun bereits fort. War die Freiheit wieder in ihren Herzen. Alles sollte so sein, wie es vor Jahrhunderten gewesen war. Sollte. Einmal mehr ein Wort voller Tücke. Vielleicht hatten Yron und er sich alles zu leicht erträumt. Vielleicht hätten sie auch nie die Stärke gehabt, ihr Vorhaben in eine Handlung umzuwandeln, wenn sie geahnt oder sich eingestanden hätten, dass damit nicht alles auf einmal besser werden würde. Dass es Zeit bedurfte, bis die Menschen diesen Schrecken abgelegt hätten und aus ihrem Albtraum erwachten.
Lediglich die Kinder, die verschont geblieben waren oder nicht lange ohne Fey hatten leben müssen, waren nicht in diesen Schockzustand geraten. Kinder waren unglaublich. Sie nahmen die Welt, wie sie war, und sie passten sich an und lebten damit, während alle anderen jeder Zeit zu erwarten schienen, dass die Hexe aus den Grundfesten der Erde emporsteigen und ihre Herrschaft auf noch grausamere Art zurückerlangen würde. Dass sie vielleicht auch alle zu sehr gelitten hatten, dass sie nun zerbrechen würden, gleich ob Fey wieder da war oder nicht. Was ein Hoffnungsschimmer sein sollte, hatte den zerbrechlichen Frieden, in dem sie alle gelebt hatten, in tausende Scherben gebrochen.
Jeremiah konnte es ihnen nicht verübeln. Das Einzige, das er ihnen nicht verzeihen konnte, war der Empfang, den sie dem wahren Erben des Thrones beschert hatten. Sein Verständnis für die Kälte, die Yron entgegengeschlagen war, hinderte seinen Hitzkopf nicht daran, sie alle als schändlich zu betrachten. Er wollte kein Verständnis verspüren, er wollte sein Recht auf seine Wut ausleben.
Dabei war er selbst doch kein bisschen besser. Nur ein Mal war er bisher lange von Yron getrennt gewesen und da er damals nicht gewusst hatte, ob dieser noch lebte und wenn ja wie, dachte er lieber nicht daran zurück.
Und erinnerte sich doch stets aufs Neue daran. Gefühle …
Jeremiah verstand den komplexen Aufbau Feys und ihrer Schwestern untereinander nicht, obwohl er versucht hatte, Tagebuch zu schreiben und alles aufzuzeichnen. Es war zu einem halbherzigen Versuch verkommen, den er aus Schmerz heraus bereits nach wenigen Tagen beendet hatte. Trotzdem ließen ihn diese Aufzeichnungen nie ganz in Ruhe.
Manchmal hatte er das Gefühl, alles entschlüsselt zu haben, aber dann schien sich wieder etwas zu ändern und er verstand den Sinn dahinter nicht. Dabei hoffte er, sich so in seinem Kummer selbst heilen zu können. Wenn er nur verstehen würde, wie das alles funktionierte, dann würde er sich selbst helfen können. Um keine Last mehr für das Königreich, seine Familie oder Yron zu sein. Mit jedem Tag vermisste er Fey und mit jeder Nacht kamen die schlechten Träume, in denen Hoffnung und Angst sich die Klinke in die Hand gaben und ihren Schabernack mit ihm spielten. Die Hoffnung, sie irgendwie zurückholen zu können; die Angst, es zu können und dabei zu versagen. Seit Monaten schlief er schlecht und der einzige Grund, wieso er überhaupt einige Stunden Ruhe bekam, war die Wanderung, auf die er sich begeben hatte, um einen Weg zu suchen. So war er erschöpft, wenn er abends auf seinen Schlafplatz kippte, und Hoffnung hatte noch eine hellere Flamme, einen längeren Docht, um sich mit aller Macht daran festzuklammern.
Bloß je mehr Zeit verging, je mehr Sonnenaufgänge er sah, umso kleiner wurde dieses schummrige Licht in all der Dunkelheit, die sich in seinem Herzen festgenistet hatte. Mit der Dunkelheit kamen auch die Ängste vermehrt. Der Schmerz. Sie war da, das wusste er jedes Mal, wenn er sich nach Liebe suchend an das gepeinigte Herz klammerte, das so unnatürlich normal in seiner Brust schlug. Sie saß dort, seit sie ihn geheilt hatte, und manchmal fragte er sich, ob das der Grund war, wieso er sich verliebt hatte. Weil sie sich dort eingenistet hatte. Aber das ›Warum‹ war kaum von Belang. Die Trauer nahm ihm so oder so die Luft zum Atmen.
Er wollte so nicht sein. Er hatte schon viele Masken in seinem Leben getragen. Das glückliche Kind; der verliebte Bursche; der Spaßvogel; der treue Freund, der seiner Geliebten die letzten Tage schöner machte. Er war ein Bruder für seine Schwestern und auch für Yron. Er war ein Sohn für seine Eltern.
Und obwohl er all das ehrlich gewesen war, fühlte er sich, als wäre er nie er selbst gewesen. Vielleicht war das hier nicht nur eine Suche nach Fey, sondern auch eine Flucht vor sich selbst. Yron hatte nach viel Misstrauen aus der Bevölkerung tatsächlich den Thron bestiegen und es war unspektakulärer abgelaufen, als man nach all den Jahrhunderten hätte erwarten können. Die Menschen trauten ihm nicht, sie sahen keinen Grund darin, ihre Hoffnungen in den Dolch zu legen, hatte dieser anscheinend schon einmal eine schwache Königin erwählt. Die wenigen Menschen, die Yron kannten und die sich von ihren alltäglichen Pflichten hatten lösen können, waren so ziemlich die Einzigen, die zur Krönung gekommen waren. Ein Ritual, das holprig abgelaufen war, da man alte Schriften hatte befragen müssen. Es gab kaum einen lebenden Menschen mehr, der die letzte Krönung gesehen hatte oder darauf vorbereitet worden wäre, eine durchzuführen. Anders als früher.
Und was tat er? Stromerte durch die Gegend, anstatt bei seinem Bruder zu bleiben. Weil er sich selbst nicht ertrug; weil er die Leere in seinem Herzen nicht ertrug, die eigentlich nicht da war. Es fühlte sich surreal an, Fey zu lieben. Als wäre sie nur eine Figur aus einem Buch, das er gelesen hatte. Einem wohlgeschriebenen Buch, eine Figur, die ihm zu lebendig vorgekommen und ans Herz gewachsen war, wo sie nun eine Lücke hinterlassen hatte, die eigentlich nicht existierte.
Das leise Klirren eines sich lösenden Steins, der in die Tiefe fiel, riss ihn aus all seinen Gedanken und als er den Blick hob, konnte er nicht ganz verstehen, wie der Mond seinen Zenit bereits überstiegen haben konnte. Es musste eine Stunde nach Mitternacht sein und er stand seit geraumer Zeit auf einem Hügel, ohne sich zu rühren, tief vergraben in all seinem Jammer und Kummer.
Er rieb sich die Nasenwurzel und stieß ein langes Seufzen aus. Es befreite ihn nicht. Er fühlte sich noch immer innerlich verkrampft und die losen Fäden seiner Gedanken, die mit dem Geräusch wie abgetrennt in seinem Kopf umherflatterten, warteten darauf, erneut verknüpft zu werden. Dabei hatte er das so oft gemacht. Tag für Tag. Sein Kopf brummte und erneut massierte er sich den Nasenansatz, in der Hoffnung, das Hämmern in seinem Schädel ein wenig bekämpfen zu können. Nichts geschah, also gab er es auf. Seine Schultern sanken herab und er nahm die Tasche wieder auf, die von seinem Rücken geglitten war, um noch einige Meilen zurückzulegen, ehe der Schlaf ihn übermannen würde.
Neben ihm machte eine Eule laut auf sich aufmerksam, aber er sah sie nicht, sie war zu gut versteckt, und einen Moment lang wünschte er sich, er könnte das auch. Andererseits war er wie der letzte Feigling abgehauen, als Yron es gerade einmal geschafft hatte, allein den Weg vom Schlafgemach zum Thron zu finden. Und es hatte auch nur so lange gedauert, damit Jeremiah die ehrliche Ausrede hatte, dass sein Freund schon zurechtkommen würde und ihn gerade nicht an seiner Seite brauchte. Die Wahrheit war, dass Yron ihn höchstens deswegen nicht brauchte, weil Jeremiah ein jämmerliches Bündel geworden war. Sein Freund musste sich schrecklich verloren fühlen, so ganz allein mit der Bürde, die er so lange gescheut hatte und die er am Ende bei all dem Hin und Her vielleicht doch nur übernommen hatte, da er es Fey an ihrem letzten Tag geschworen hatte.
Nun durfte er sich mit den anderen Ländern herumplagen, mit Bittstellern, verlorenen Seelen, obwohl er selbst doch eine war. Jeremiah konnte so gut in seinem Bruder lesen und die letzten Augenblicke, bevor er gegangen war, waren reine Qual gewesen. Er hatte in Yrons Augen gelesen, was er nie hatte lesen wollen. Angst, Verzweiflung, Einsamkeit, auch wenn sein Bruder noch vor ihm stand. Doch Yron hatte nicht ein Wort gesagt, um Jeremiah von seiner Reise abzuhalten. Er hatte ihm nur viel Erfolg gewünscht und ihn darum gebeten, wenigstens Augen und Ohren offen zu halten, um die Bevölkerung besser zu verstehen. Dann hatte Yron ihm ein Pferd bestellt und Proviant zusammengepackt.
Das Essen hatte er genommen, das Pferd im Stall zurückgelassen. So wäre er schneller gewesen, doch er hatte keinen festen Zeitpunkt, wann er irgendwo sein musste. Er wollte nicht rasch ankommen, er wollte niemals ankommen, er wollte sich zerstreuen.
Das war nun einige Wochen her und seither war er im Süden angelangt. Eine Gegend, die in starkem Kontrast zum Norden stand, aus dem Jeremiah stammte. Denn mit jedem Tagesmarsch war es wärmer geworden, wo Winter hätte sein sollen. Die Bäume sahen anders aus und die grünen Wiesen waren von bunten Blumen durchzogen, statt eingefroren und tot zu sein. Sogar die Luft roch anders. Süßer.
Die Landschaften erschienen deutlich wilder. Zumindest sah Jeremiah keine größeren Straßen. Außer den wenigen Handelsstraßen. Der Rest bestand offenbar lediglich aus breiten Trampelpfaden. An einer Stadt war Jeremiah ebenso wenig vorbeigekommen. Nur an kleinen Dörfern, die zufällig in der Gegend platziert schienen. Er mochte seinen Norden deutlich lieber und dennoch hätte er nun gerne jemanden hier, mit dem er all das Neue in diesem Teil der Welt erforschen könnte. Seen, so warm wie ein heißes Bad, hatte er gefunden. Tiere, die er gar nicht kannte, ebenso wie Pflanzen. Er hatte sich ein Reisetagebuch zugelegt, in dem er alles Neue aufschrieb und zu zeichnen versuchte. Gewiss wäre Yron mehr als glücklich über ein solches Geschenk. Jedes Mal, bevor Jeremiah schlafen ging, setzte er sich an ein Feuer und verarbeitete, was er am Tag gesehen hatte, und manchmal hockte er sich auch direkt hin und zeichnete oder schrieb, was es zu zeichnen oder zu schreiben gab.
Seine Schritte wurden allmählich träger, als er die Hügelkuppe hinauf schritt. Die Steigung zog an und ragte im dämmrigen Licht vor ihm in den Himmel auf. Er wusste, dass er dem Schlaf nicht mehr lange entkommen würde. Seine Lider waren schwer, mit jedem Meter wurden sie bleierner und sein ungelenker Körper schrie ihn an, endlich aufzuhören. Er wollte sich gerade ergeben, als er vor sich auf dem Weg die Umrisse von etwas Großem und Dunklem ausmachte und nicht einschätzen konnte, worum es sich handelte.
Einen Augenblick lang wollte er sich wieder zurückziehen. Er hatte Bären in diesen Bergen gesehen, die riesig waren. Bären, deren scharfe Krallen einen Mann einfach durchtrennen konnten. Aber dieses Wesen sah nicht aus, als wäre es einer jener Bären, denn dafür war es doch zu klein. Ein tiefer Atemzug suchte sich den Weg in Jeremiahs Lungen, dann schritt er auf das Ungetüm zu, das den Weg blockierte und sich nicht regte, ganz gleich, wie nahe Jeremiah auch kam.
Als das Mondlicht endlich die Konturen deutlicher aus der Dunkelheit riss, sodass er erkennen konnte, worum es sich handelte, hätte er bei all dem Frust fast über sich selbst gelacht. Auf dem Weg kauerte kein riesiges Tier, das tief und fest schlief. Es war ein verlassenes, halb zerrissenes Zelt und hätte gerade der Wind durch die Bäume getanzt, hätte er auch die Fetzen bewegt. So jedoch war alles unheimlich still und in Jeremiah keimte die Frage auf, wer sein Zelt auf dem Weg aufbaute, damit kein Mensch mehr vorbeikommen konnte.
Niemand war zu sehen, allerdings verwunderte ihn das bei dem Zustand des Zeltes auch nicht weiter. Vielleicht war ein Tier auf den Besitzer losgegangen oder Menschen waren wieder Menschen gewesen und hatten das störende Objekt angegriffen.
Auf eine unbestimmte Weise hatte es etwas furchtbar Trauriges an sich und Jeremiah, müde und abgekämpft, war geneigt, noch weiterzugehen. Direkt hinter dem Zelt führte ein schwindelerregender Weg den Hügel wieder hinab. Er wollte nicht hier verweilen. Seine Nackenhaare stellten sich bei dem bloßen Gedanken auf und einen Moment lang war er davon überzeugt, dass der Besitzer tot in der Nähe lag. Dann riss er sich von diesem Gedanken los und sich selbst zusammen.
In der Nähe des Zeltes waren Ausbuchtungen auf beiden Seiten des Weges in die steilen Felswände geschlagen worden. Sie waren wie für ein Lager geschaffen. Das hätte der Besitzer des Zeltes wohl auch bedenken sollen, aber Jeremiah gab sich Mühe, kein Urteil zu fällen, und nahm stattdessen in einer dieser Ausbuchtungen den Rucksack vom Rücken.
Als er zum Himmel hinaufsah, stellte er sich den Lebensstrom vor, der über das dunkle Firmament zog und von den westlichen Inseln gut zu sehen war. Über ihm war dieses Band der Göttermacht nicht auszumachen. Hier waren nur der silberne Mond und ein paar Sterne zu entdecken. Nichts, das ihm Trost spendete.
Mit einer Bewegung aus dem Handgelenk breitete er seine gepolsterte Decke aus und die leichte Steppdecke darüber. Er legte sich hin, zog sein Tagebuch aus der Tasche und brütete über der Seite, schaffte jedoch nur wenige Zeilen, ehe seine Lider viel zu schwer wurden. Er rollte sich auf den Rücken, starrte erneut zum Nachthimmel empor und schlief rasch ein.
»Jeremiah …«
Er wollte die Lider heben. Sie waren viel zu schwer. Wie angekettet zwangen sie ihn in eine hilflose Blindheit. Er wollte den Arm heben. Es war viel zu kalt. Wie erfroren war er zur Ruhe verdammt. Er wollte sprechen und ihren Namen sagen. Seine Zunge war unkoordiniert, als hätte man sie zu oft verwirrt und sie wüsste nicht mehr, wie sie Atem formen konnte.
»Jeremiah …«
Er mochte weinen und konnte es nicht sagen. Der Schmerz in seiner Brust war allgegenwärtig. Viel zu mächtig, um von nur einer Seele gehalten zu werden. Ein Sehnen, tief in seinem Inneren. Ein Flehen. Er wollte ihren Namen sagen. Fey! Drei Buchstaben. Drei kleine Buchstaben, die er schon so oft gesprochen und so oft geschrieben hatte. Es war ihm nicht möglich. Er war in diesem Zustand gefangen.
Er versuchte, zu denken, in der Hoffnung, dass sie es hören mochte. Er dachte daran, wie sehr er sie brauchte und liebte und wie leer sich seine Arme ohne sie dazwischen anfühlten. Sie schien es nicht zu hören.
»Jeremiah …« Wieso nur wiederholte sie seinen Namen? Wieso nur war es alles, was sie von sich gab?
Kapitel 2
»Welcher König schleicht des Nachts durch sein eigenes Schloss?«
Yron blickte vom Mond auf und zog dabei den Kopf aus dem kleinen Fensterschlitz, an den er sich gestellt hatte. Die Nachtluft war so kalt, dass sein Gesicht zu brennen schien, aber es tat gut, die vor Frost beißende Luft in den Lungen zu spüren. So dumm es klang. Zum Glück musste er sich niemandem erklären, auch Liaz nicht, die in ihrem Nachtgewand, dicken Nachtschuhen und einer Wolljacke auf ihn zutrat, eine Kerze mit den Fingern umklammert, deren Licht sie zum Teil mit der Hand abschirmte. Auch wenn Liaz es gerne gesehen hätte, dass Yron vor ihr rechtfertigte und buckelte, so musste sie wohl oder übel akzeptieren, dass der König auch vor ihr keine Ausnahme machen würde.
»Ein König, der macht, wie ihm beliebt«, meinte er nur und sehnte sich nach der Ruhe von zuvor zurück. Er war nie ein Freund davon gewesen, sich viel entschuldigen zu müssen, und so wichtig ihm Jeremiah war, er hatte gerne Zeit nur mit sich selbst verbracht. »Und was macht ein Neunmalklug wie du außerhalb seiner warmen Bettfedern?«
Sie zuckte mit den Schultern, sichtlich unbegeistert. Aber er hatte auch keine Antwort erwartet, selbst wenn er ihre Frage beantwortet hätte. Er verstand schon, wieso so viele Liaz nicht leiden konnten. Sogar er war sich nie sicher, wie er zu ihr stehen sollte. Doch zumindest hatte sie ihnen treu geholfen und noch immer fühlte er sich auf gewisse Weise mit ihr verbunden. Das wollte er nicht missen. Vor allem nicht jetzt.
»Du machst dir Sorgen um ihn.« Sie hätte niemals fragen brauchen; sie wusste, was in ihm vor sich ging. Trotzdem war es ihr lieber, wenn er seine Gefühle offenlegte. Nun war es an ihm, mit den Schultern zu zucken. »Natürlich sorge ich mich um ihn.«
Jeremiah war losgezogen und Yron hoffte, dass sein Freund sich auf dieser Reise wiederfand. Aber er hatte Angst, dass es eher etwas Schlimmeres würde.
Liaz stellte mit einem leisen Geräusch die Lampe auf einem kleinen Tisch im Flur ab und kam auf ihn zu. Ihr Gesicht war im Halbdunkel verborgen und das Flackern der Kerze spielte mit ihrem hellen Haar. Dennoch machte er ihr Lächeln aus. »Du musst dich nicht sorgen, ich bin mir sicher, dass er bald zurückkommen wird, und vielleicht ist er dann wieder dein alter Freund.«
»Ich fürchte nicht und ich weiß auch nicht, inwieweit ich meinen alten Freund zurückhaben möchte.« Als ihm auffiel, wie diese Worte klangen, kniff er die Augen zusammen und stieß einen tiefen Atemzug aus. »Nein, so war das nicht gemeint. Ich möchte Jeremiah, wie er früher war, ich will nur nicht … Er soll nicht mehr so sein, wie der ganze Schmerz ihn gezeichnet hat.«
»Der Schmerz gehört zu seinem Leben dazu, wie zu uns allen. Wir wollen ihn denen ersparen, die wir lieben, und denen zufügen, die wir hassen. Aber jeder von uns leidet. So ist es nun einmal. Jeder von uns verändert sich deswegen. Manche wachsen, andere schrumpfen und wiederum andere stumpfen ab.«
Yron blickte aus dem Fenster. Ein Reiter preschte durch die Straßen, hin zur Stadtmauer und hinaus in die Nacht. Nichts Ungewöhnliches in der Stadt. Hier hatte er Jahre gelebt, ehe seine Reise begonnen hatte, und es fühlte sich auf mehr als eine Art merkwürdig an, im Schloss der Hexe zu stehen. Das Gebäude, das er so lange nicht hatte erobern können. Die Gänge, in denen sie so lange gewandelt war. Der Thron, auf dem so viele gesessen hatten, deren Namen Yron nicht einmal kannte. Irgendwann würde auch er nur zu Staub zerfallen und der nächste Erbe wäre auf dem Weg. Und das so lange, bis die Alten tot waren und keiner mehr sich Yrons Namen bewusst war. »Ich möchte nicht, dass er diese Schmerzen hatte. Ich will, dass er wieder glücklich wie früher ist.«
»Dann wäre es aber nicht mehr Jeremiah«, nuschelte sie und legte die Arme um ihn. Ihre Wärme war tröstend und einen Moment lang schloss er die Augen, um sich von ihr tragen zu lassen. Leise seufzend löste er sich von ihr.
»Du hast recht«, murrte er, müde und widerwillig. »Ich kann seine Vergangenheit nicht ändern oder auslöschen.«
Sie nickte. Dann lächelte sie ihm aufmunternd zu. »Das bedeutet nicht, dass du seine Gegenwart und seine Zukunft nicht mitbestimmen kannst.«
»Kann ich das? Er ist nicht hier.«
»Aber er wird es wieder sein.« Sie lehnte sich ebenfalls ans Fenster, doch ihr Blick lag nicht auf den Gassen und Straßen der Hauptstadt, sondern auf dem Wald, der im Mondlicht fahl glänzend im seichten Wind wogte. Die kahlen Bäume sahen wie ein Totenacker im Dunkeln aus. Für einen Herzschlag schien es, als würde Liaz etwas sagen wollen. Dann schüttelte sie über sich selbst den Kopf und wandte sich halb um. »Irgendwo unter demselben Himmel ist er.«
»Ja«, hauchte Yron und erneut beobachtete er den Mond, rieb sich durch die Haare. »Irgendwo. Wir sollten zu Bett gehen. Ansonsten holen wir uns in dieser Kälte den Tod. Außerdem wird, wenn der Hahn kräht, wieder ein neuer Tag anbrechen.« Und damit die ganze Verantwortung, die er nachts abstreifen durfte und die dessen ungeachtet jeden seiner Schritte verfolgte. Wie konnte Dilara nur darauf aus gewesen sein? War es, weil sie darauf vorbereitet worden war? Denn er sah nichts Erstrebenswertes darin und mit jedem neuen Tag wurde sein Herz schwerer. Das war die Bürde, die nun bis zu seinem Tod auf seinen Schultern lasten würde.
Wie er Liaz` Nicken betrachtete und kurz darauf hörte, wie sie den Gang entlang schlurfte, den sie vorher gekommen war; wie er selbst den Weg in sein Gemach suchte; wie er sich unter die Bettdecke legte und zum Baldachin, den er nicht einmal mochte, hinaufblickte, da wurde ihm bewusst, wie allein er war. Denn dieses Joch war seines und nicht Jeremiahs. Genauso wenig wie sein Bruder sich um Cedric kümmern musste, dessen Herz durch den Tod seiner Schwester ebenso gebrochen war, wie seine Seele einen Knacks bekommen hatte, nachdem die Hexe ihn unter ihre Herrschaft gezwungen hatte. Jeden Tag aufs Neue fürchtete Yron, dass er aufwachen und nicht mehr als eine weitere Leiche vorfinden würde.
Er fühlte sich, als hätte er niemanden, um sich anzuvertrauen, dabei brauchte er genau das nun mehr denn je. Brauchte ein König nicht Vertraute, damit die Last nicht allein auf ihm lag und sein Gemüt allzu sehr getrübt wurde? Jeremiah hatte sich für das Exil entschieden und es war Yron unbekannt, wann er seinen Freund zurückbegrüßen durfte. Cedric war nicht mehr er selbst und Liaz war eine miserable Zuhörerin, die meinen mochte, dass es eine der vielen Aufgaben eines Menschen war, allein mit seinen Zweifeln zu stehen und sie niederzuschlagen, wie er jeden Feind niederzuringen hatte.
Jeder Tag, den er sich stärker geben musste, als er sich fühlte, war ein Tag, der ihn Stärke kostete.
***
Seine Gebete an sich waren selbstredend wie immer nicht erhört worden. Jeremiah wachte mit schmerzendem Kopf auf und die Muskeln an seinen Kiefern fühlten sich verkrampft an. Hinter seinen Lidern schienen noch die letzten Bilder eines Traumes zu flackern, den er zum Glück nicht hatte halten können und der, dem zum Trotz, sein Herz zum Rasen brachte. Wie so oft.
Am Tag war der Berg nicht mehr so unheimlich und das Zelt nur noch trauriger als in der Nacht und das veranlasste ihn dazu, rasch alles zusammenzupacken, sich ein karges Frühstück aus Trockenfleisch in die Hand zu nehmen, und zu essen, während er sich an den Abstieg machte.
Jeder seiner Schritte abwärts wurde von dem leisen Klirren kleiner Steine begleitet, die sich ihren Weg den Hügel hinab suchten und dabei immer schneller wurden, als sei dies ein Rennen. Ab und an schaute er ihnen dabei zu, denn der Pfad war keine große Herausforderung für ihn. Aber wirklich ablenken konnte nichts seine Gedanken. In ihm war noch immer der Schrecken eines Traumes, an den er sich nicht erinnern konnte. Nach wie vor brachte das ungute Gefühl in seinem Magen das Blut in seinen Adern zum Kochen. Er hätte schreien können und wusste doch nicht, weshalb genau.
Mit einem Mal kam ihm die Einsamkeit wieder in den Sinn. Nicht nur, dass Fey an seiner Seite fehlte. Es war auch die Einsamkeit, keinen anderen Menschen um sich herum zu haben. Nicht einmal Tiere machte er aus. Gleichsam wurde er von sich selbst gejagt. Jeremiah wusste nicht, ob es besser wäre, wenn er sich an den Traum erinnern könnte oder nicht. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Als wäre etwas in ihm, von dem er nur ahnte, dass es da war.
Die Sonne stieg ungnädig höher und höher und bald kam er trotz des leichten Weges ins Schwitzen. Wie ein gejagtes Tier, schoss es ihm erneut durch den Kopf. Er bekam dieses Sinnbild nicht mehr von sich los.
Irgendwann blieb er stehen. Es war kein bewusster Gedanke gewesen, der ihn dazu veranlasst hatte. Mit einem Mal war sein Körper einfach erstarrt. Jeremiah wunderte sich nicht einmal darüber. In seinem Kopf hämmerten die Gedanken. Er musste weiter. Er musste hier weg. Er konnte nicht mehr. Er war inmitten des Nichts und konnte einfach nicht mehr weitergehen. Weil er sich fragte, wozu er es überhaupt machen sollte. Weil er sich fragte, wie auch nur ein Schritt nach vorne noch möglich sein sollte. Weil er keinen Sinn darin sah …
Um sich selbst zu beruhigen, ließ er sich langsam zu Boden gleiten. Ab und an hatte er solche Momente und er wusste mittlerweile, dass es einfach nur zu viele Stimmen in seinem Kopf waren, die ihn blockierten. Wie sollte die, die die Macht über seinen Körper hatte, auch am lautesten zu verstehen sein, wenn alle anderen durcheinander schrien?
Er atmete. Eine einfache Tätigkeit, so sollte man meinen. Aber gerade war es nur eine enorme Bürde, die ihm Angst machte. Er versuchte, sich an der Festigkeit der Erde zu orientieren. Sie war da. Unendlich groß und unerschütterlich. Sie bot ihm Halt, immerzu, denn er war kein Vogel, der sich in die Lüfte schwingen konnte. Jeremiah versuchte, sich einfach nur auf das Einatmen zu konzentrieren und das Ausatmen nicht zu vergessen. Gesammelte Luft in seinen Lungen wirkte wie ein Stein, zog ihn tiefer in den Abgrund der Angst.
Nach einer Weile wurde es besser. Er durfte nur nicht an Fey denken. Oder daran, dass er hier vollkommen allein war.
Als die Panik abflaute, kam abermalig die Wut und diese ließ sich nicht so leicht bekämpfen. Sie brachte seinen Körper zum Beben, zitterte durch ihn hindurch, rieb an jedem Nerv, den sie berühren konnte. Sein Kopf fühlte sich schwer und heiß an, als das Blut hineinschoss. Erneut war es ihm unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht war es ganz gut, dass er allein war, denn so konnte er niemanden verletzen. Er fühlte sich nicht mehr Herr über sich selbst. Als hätte ein kleines Wort ausgereicht, um einen Waldbrand loszulösen.
Verzweifelt versuchte er, gleichmäßig zu atmen. Je mehr er es versuchte, umso unregelmäßiger wurden seine Atemzüge. Er verhaspelte sich, verlor den Weg. Mit einem Mal war er auf den Beinen. Seine Füße kannten keine genaue Richtung. Sie wollten sich bewegen, das war alles.
Sein Rucksack glitt von seinem Rücken, schlug dumpf auf dem Stein auf und blieb friedlich liegen. Jeremiah drehte sich kaum danach um. Er raufte sich die Haare, hätte gerne mit jemandem gerangelt. Ob er Schmerz erfuhr oder austeilte, war ihm egal. Er musste etwas spüren, etwas anderes als das hier.
Er schrie. Jeremiah hätte es in anderen Augenblicken nicht gewagt; aus Furcht heraus, doch gehört zu werden. Dennoch schrie er. Er versuchte, die ohnmächtige Wut in seinem Bauch hinauszuschreien, und beinahe war es, als würden die Berge antworten. Sein Schrei hallte nach.
Er achtete nicht einmal auf seine Worte. Es hätte Gebrabbel sein können, genauso gut wie sinnvolle Sätze. Es war gleich. Der Zorn kannte keine Logik, keine Grammatik, keine Worte. Er kannte Bilder und Gefühle. Jeremiah erinnerte sich an Fey. An das Aufblitzen eines blauen Kleides, aber dieses Bild packte er nicht, er warf es rasch über Bord und zwang sich, nicht dabei zuzusehen, wie es unterging. Vielleicht sank es nicht mehr weiter, wenn er ihm erneute Aufmerksamkeit schenkte.
Die Einsamkeit klebte an ihm.
Ein paar Vögel stoben auf und suchten ihr Heil in der Flucht. Das Schlagen ihrer Flügel konnte er nicht hören, aber er konnte es sehen. Es war geradezu hypnotisch. Wie wäre es, dort oben zu sein? Einfach fortfliegen zu können? Auch nicht anders, als zu gehen, oder? Er war nicht gezwungen, an einem Ort zu bleiben, aber der eine Ort, der ihm eine solche Qual bereitete, der war dazu gezwungen, bei ihm zu verweilen. Sein Herz. So menschlich, so schwach. Es schrie und wusste doch nicht, was es wollte. Fey. Doch neben Fey konnte es sich nicht entscheiden, ob Gesellschaft oder Einsamkeit. Niemand konnte dieses Herz heilen, außer Jeremiah. Und Jeremiah, der wusste keinen Weg, keine Heilung. Er versuchte, in Bewegung zu bleiben, um sich selbst nicht zu begegnen.
Als seine Kehle rau und die Sonne bereits weit gewandert war, fand er sich an einen Stein gelehnt wieder. Er erinnerte sich, wie er hierher gekommen war, und dennoch fühlte es sich wie aus einem anderen Leben an. Ein weiterer Traum vielleicht, nur einer, der ihm noch immer vor Augen stand.
Während er seinen Tränen dabei zusah, wie sie zu Boden tropften, hätte er beinahe mit einem plötzlichen Regenerguss gerechnet. Nichts geschah und so ließ er nur erschöpft seine Schläfe gegen die Kühle des Steins gleiten. Seine Lider sanken herab.
Kapitel 3
Auf keiner Karte verzeichnet und noch ein ganzes Stückchen entfernt, tat sich doch recht bald, vom Hügel aus zu sehen, ein Dorf auf. Da er nur einzelne Giebel entdecken konnte, schien es nur aus wenigen Häusern zu bestehen. Zumindest war es ihm unmöglich, auszumachen, ob zwischen den Hügeln noch weitere flache Gebäude versteckt dalagen. Jeremiah zögerte.
Sein Wutanfall und seine Verzweiflung saßen ihm nicht mehr in den Knochen, wohl aber noch in seinem Nacken. Die Schreie brachten seine Ohren nach wie vor zum Klingeln. Erneut war da dieser Kampf. Wollte er Gesellschaft oder nicht? Es lag ihm fern, eine Aussicht auf einen Erzähler verstreichen zu lassen. Außerdem sollte es ihm möglich sein, jeder Zeit zu gehen. Niemand würde ihn gefangen nehmen.
Seine Füße ließen sich dennoch nur zögerlich dazu überreden, einen Schritt nach vorne zu machen. Er murrte. Allmählich flammte erneute Wut auf, dieses Mal jedoch nicht auf den Traum oder die Situation. Sie richtete sich gegen ihn selbst. Wer wusste schon, welche Hilfen er dort finden würde? Und die Aussicht auf andere Menschen wirkte gerade auch verlockend. Keine Einsamkeit mehr, zumindest für kurze Zeit. Er konnte jeder Zeit gehen, mahnte er sich. Jeder Zeit wieder zwischen den Hügeln verschwinden. Niemand würde ihm Ketten anlegen, niemand würde ihn zwingen, zu bleiben. Jeder Zeit frei.
Er seufzte schwer. Dummer Gedanke … Er musste an Fey denken. Sie wäre offen und freundlich auf die Menschen zugegangen. Oder? Er dachte nur Unsinn! Fey hätte sich stets verstecken müssen. Die Hexe war auf der Suche gewesen und ihre Handlanger hatten ihr geholfen. Selbst die Bevölkerung hatte nichts von ihrem wahren Wesen wissen dürfen. Die naive Fey, das unschuldige Wesen vom Anfang, das wäre vielleicht freundlich auf die Fremden zugegangen. Aber später hatte sie gelernt, was für fatale Fehler dabei lauerten. Betrachtete man es so, war die Freiheit, nachdem man sie gefangen genommen hatte, sogar nicht frei gewesen, als sie nicht mehr im Kerker gesessen hatte. Immerzu hatte Fey sich verstecken müssen, hatte große Teile ihrer wenigen Zeit eingesperrt in Häusern verbracht und manchmal anderen beim Leben zugesehen.
Vielleicht hatten sie deswegen in ihrer einzigen gemeinsamen Nacht, in der sie sich den Hoffnungen hingegeben hatten, so viel über das Reisen und die Länder gesprochen. Sie hatte all das mit ihm sehen wollen. All diese Menschen kennenlernen wollen.
Das war der Punkt. Jeremiah atmete tief ein und aus, zwang Fey in einen anderen Teil seines Bewusstseins und richtete das Augenmerk absichtlich auf etwas anderes, an dem er sich festhalten konnte.
Die Natur erstaunte ihn. Sie wirkte beinahe wie oben im Norden. Ohne Schnee und noch mit voller Farbenpracht, aber bis auf die merkwürdigen, von Ranken umschlossenen Bäume war es ihm kaum möglich, einen großen Unterschied wahrzunehmen.
Das Dorf wirkte wie jedes andere auch. Dichtgedrängte Häuser, geschäftige Menschen und neugierige Blicke, die sich auf den Fremden hefteten. Jeremiah hatte das Gefühl, so tief in den Bergen und Hügeln der Südlande versunken zu sein, dass diese Menschen vermutlich nicht einmal von der Hexe gehört hatten und nun einfach verwundert über Feys Wiederkommen waren. Eine der Herausforderungen, um dieses Land beherrschen zu können, war die schiere Länge. Norden und Süden schienen unterschiedliche Länder zu sein, mit unterschiedlichen Kulturen und Ansichten. Sprachen sie überhaupt seine Sprache? Akzente waren ihm bereits untergekommen, manchmal schwer zu verstehen, doch irgendwie hatte man sich immer verständigen können. Jetzt jedoch war er sich nicht mehr so sicher. Dieses Dorf war so versteckt und klein, dass es dem Kartografen als zu nichtig erschienen war. Und so fühlte es sich auch für Jeremiah an, während er den Leuten fest ins Gesicht blickte und versuchte, herauszufinden, ob es einen Dorfplatz gab oder er einfach den erstbesten Bewohner ansprechen sollte.
Die Entscheidung wurde ihm abgenommen, als ein alter Mann auf ihn zutrat. Obwohl seine Haare und sein Bart weiß waren und das gebräunte Gesicht von Falten geziert war, stand der Mann aufrecht und selbstbewusst vor ihm und der Stock, auf den er sich leicht stützte, schien eher eine Waffe denn eine Gehhilfe zu sein. »Nas?«
»Was?«
Der Mann nickte sich selbst zu, ganz als hätte er ein Rätsel gelöst. Dann räusperte er sich vernehmlich. »Ein Nordling?« Die Stimme war kratzig, als würde sie an den fremden Worten schaben. Der Blick aus dunklen Augen hatte etwas Vorsichtiges, Zaghaftes angenommen. »Warum bist du hier?«
Jeremiah hatte in den südlichen Ländern viel Gastfreundschaft erfahren. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, nachdem er losgewandert war, denn mit den südlichen Regionen von Yrons Königreich hatte er sich nie sonderlich auseinandergesetzt. Aber er war positiv überrascht worden. So wie jetzt, denn obwohl der Südling zurückhaltend und misstrauisch wirkte, schien er in keiner Weise aggressiv. »Ich wandere«, murmelte Jeremiah und wiederholte es laut, als er fragend angesehen wurde. Vielleicht verstanden sie ihn leise nicht so gut? »Ich wandere seit Monaten durch das Königreich auf der Suche nach Geschichtenerzählern.« Als würde es etwas helfen, fuhr er sich über einen langen Bart, den er gar nicht besaß. Anscheinend wirkte die Geste verwirrend. So manch einer warf seinem Nachbarn einen Blick zu. »Menschen, die Geschichten erzählen?«
»Wir kennen die Geschichtenerzähler«, meinte der Alte halblaut und betrachtete Jeremiahs Hand. »Wir verstehen, was du meinst, wenn du langsam und laut sprichst. Dann können wir die Sprache der Nordlinge.«
»Sprechen wir nicht alle dieselbe Sprache?« Jeremiah schluckte den Frust hinab. Er hatte darüber gelesen, dass das Land früher nur sprachliche Probleme erlitten hatte, aber ansonsten war es nie zerrissen gewesen. Das war nun einige Leben her. Sie gehörten zum selben Volk und trotzdem schienen sie sich so fremd.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nicht mehr so weit im Süden wie hier. Manche Dörfer lernen nicht einmal eure Sprache. Warum auch? Ihr lebt, als gebe es uns nicht, und wir wollen nicht auf uns aufmerksam machen.«
»Weshalb?«
»Weshalb nicht? Menschen kommen mit Krieg, mit Kampf, mit Leid. Wir wollen uns nicht einmischen, wir wollen leben. In Frieden.« Er zeigte auf die Häuser um sich. »Wir haben, was wir brauchen; wir haben Felder, Jäger, Sammler und einen Fluss. Wir haben uns, wir haben unsere Feste.« Er schlug mit dem Stock auf den Boden. »Wir haben Glück.«
Jeremiah betrachtete die Leute, die sich um sie her versammelt hatten, und nickte nur. »Und ich suche Geschichten und ebenfalls Glück.«
»Dann bist du hier gerne gesehen. Denn auch wenn wir uns heraushalten, so nehmen wir Gäste immer gerne auf. Erzähl du von dir und dem Norden und wir erzählen dir von uns und dem Süden.« Der Mann wies auf jemanden und eine mollige alte Frau kam aus der Menge herausgelaufen und schenkte ihm ein warmes Lächeln.
»Du kommst mit«, sagte sie, genauso kantig wie der Mann. »Wir richten dir ein Zimmer her. Wir haben keine Gastnacht, aber wir haben Zimmer.« Ihr kleiner Arm legte sich an seinen Rücken und einen Moment lang regte sich das übliche Misstrauen in ihm. Er wollte sich weigern und ihnen sagen, dass er außerhalb des Dorfes auf seiner Decke schlafen konnte. Immerhin waren die Nächte hier warm genug.
Aber dann ergab er sich. Wenn er wirklich lernen wollte, dann konnte er dies nur mit einem offenen Geist und nicht, wenn er sich stur stellte.
Sie führte ihn in ein kleines Kämmerlein direkt unter einem Hüttendach. Die Schrägen ließen ihn nur geduckt laufen, doch die Fenster waren mit Gauben ins Dach eingelassen und machten die Kammer zumindest ein wenig größer. Ein Bett stand an einer Wand, daneben ein Nachttisch. Viel mehr gab es in diesem Raum auch nicht. »Warum habt ihr ein Gästezimmer?«
»Falls Gäste kommen«, meinte sie und nahm ihm die leichte Überjacke ab, um sie an den Haken an der Wand zu hängen. »Wir haben viele Gäste, andere Dörfer schicken Menschen, wir schicken Menschen in andere Dörfer.« Sie lächelte breit. »Und manchmal wird es spät oder der Besuch soll lange bleiben, also schlafen sie hier.«
Er nickte. »Ich möchte aber keine Unannehmlichkeiten bereiten.«
»Das machst du nicht.« Sie klopfte ihm aufs Haupt. Jeremiah hatte sich daran bereits gewöhnt. Die Menschen im Süden waren anders als die im Norden. Wärmer, vielleicht wegen des Wetters. Offener und rascher in ihren Entscheidungen. Sie gaben ihr Herz, öffneten es für Fremde, und Berührungen scheuten sie auch nicht, wo Nordlinge meistens lieber zwei Meter auseinanderstanden. Er war sich nicht sicher, was von beidem er bevorzugte. Beide waren auf ihre Art höflich und offen und gastfreundlich. »Was möchtest du essen? Lammeintopf?«
Am liebsten hätte er den Kopf geschüttelt. Er mochte kein Lamm, aber er wollte auch nicht unfreundlich sein und er hatte festgestellt, dass die Menschen im Süden vermehrt Lamm aßen. Sein einziger Trost war die unterschiedliche Zubereitung. Der Geschmack im Süden sagte ihm immerhin etwas zu.
»Gern.« Er stellte seine Tasche neben dem Bett ab. »Kann ich bei etwas behilflich sein?«
»Du kannst Fässer rollen.« Sie war bereits auf dem Weg zur Treppe, als sie sich zu ihm umdrehte und immer noch so breit lächelte, dass ihre Wangen schmerzen mussten. »Wir haben die Ernte fertig und alles muss ins Lagerhaus.«
Er nickte und folgte ihr die Treppe hinab und als sie ihm gezeigt hatte, wo er hinmusste, begann er damit, die Fässer zu rollen.
Kapitel 4
Am Abend des dritten Tages klopfte Jeremiah sich die Hände ab, nachdem auch die letzten Fässer im Lagerhaus verstaut waren. Er drückte die schmerzenden Schultern durch und atmete zufrieden ein und aus. Die Arbeit war eine Wohltat. Sie war anstrengend gewesen, aber seine Hände beschäftigt zu wissen, öffnete seinen Geist und es freute ihn noch dazu, dass er diesen Menschen, die ihn so freundlich aufgenommen hatten und ihm Geschichten erzählten, eine Hilfe gewesen war.
Über dem Lagerhaus hatten sie die Gemeinschaftsräume gebaut. Eine Küche, die ihre Waren direkt aus dem Keller zog, in dem Jeremiah die vergangenen Tage Fässer untergebracht hatte. Darüber war ein Essenssaal, der eher eine gemeinsame Stube bildete. Die Kinder spielten an langen Abenden dort, die gesamte Dorfgemeinschaft achtete auf Sauberkeit und auch die täglichen Arbeiten wie Nähen oder Schnitzen fanden hier ihre Aufmerksamkeit. Klassische Trennung von Männer- und Frauenaufgaben gab es kaum. Meistens wurde geschaut, wer welche Fähigkeiten besaß, und demnach wurde eingeteilt. Wer nähen konnte, nähte; wer kräftig war – und das waren meistens die Männer – trug die sehr schweren Sachen hinauf und hinunter. Wer malen konnte, malte; und wer Musik machen konnte, spielte. Jeremiah liebte es. Sogar er ertappte sich dabei, wie er neue Fähigkeiten an sich ausmachte.
Während er die Treppe nach oben stieg, liefen unten ein paar Kinder an ihm vorbei in den Keller. Vielleicht waren sie neugierig, was alles gelagert wurde, oder sie wollten in dem alten Gewölbe ein paar Abenteuer erleben. Er lächelte nur und stieg weiter nach oben. Sein Magen knurrte hungrig. Seit Monaten hatte er kaum Appetit und heute war der erste Tag seit Langem, an dem er sich wirklich auf Essen freute und sich nicht nur aus Überlebensinstinkt heraus dazu zwang.
Sein Herz war noch immer schwer, vor allem wenn er sich vorstellte, dass er vielleicht mit Fey hierher gekommen wäre. Andererseits hätte er mit ihr nie einen Grund gehabt, die südlichen Lande zu besuchen und selbst wenn, dann kein Dorf wie dieses. Trotz aller schlechten Aussichten hatten sie sich in der letzten Nacht dem Planen hingegeben. Einer Hoffnung. Einem kleinen Licht auf einem dunklen Meer. Sie hatten reisen wollen, aber hätten sie wirklich den tiefen Süden besucht?
Auf gewisse Weise stimmte diese Vorstellung ihn traurig, dabei könnte er nicht einmal sagen, wieso genau. Wie sollte man vermissen, was man nicht kannte? Und doch fragte er sich, wie viele Dinge er im Leben schon verpasst hatte. Es waren nur drei Tage gewesen, die er hier war, und dennoch waren es drei sehr wertvolle Tage gewesen. Schon am ersten Abend hatte man ihm die Hand entgegengestreckt, als wäre er ein alljährlicher Besucher. So viel Herzlichkeit einem Mann gegenüber, der erst wenige Stunden zuvor plötzlich fremd im eigenen Dorf gestanden hatte, erstaunte ihn nach wie vor.
Er war sich von der ersten Stunde an willkommen vorgekommen.
Mit einem Knirschen der alten Dielen betrat er das obere Stockwerk und bog durch die Tür auf der rechten Seite in den Essenssaal ein. Auf der Linken wäre noch der Arzt gewesen und die Treppe ins oberste Stockwerk, wo die Kinder ihren Unterricht erhielten.
»Setz dich zu uns«, wurde er begrüßt, als er den Türbogen durchschritt, und sein Augenmerk fiel auf zwei Farmer und die Lehrerin, die ihm einen Platz freigehalten hatten. Als er sich setzte, wandte sie sich direkt an ihn. »Du musst zu uns kommen«, war das Einzige, was sie sagte, bis sie seinen verwirrten Blick bemerkte. »Zu den Kindern. Sie wollen bestimmt wissen, wie der Norden ist, und ich möchte das auch wissen.«
Einer der Farmer lehnte sich vor und kratzte sich geräuschvoll den kurzen Bart. »Das wollen wir alle, Addy.«
»Ich kann gerne für alle sprechen und in die Schule kommen«, meinte Jeremiah halblaut. »Aber ich bin auch immer noch auf der Suche nach Geschichtenerzählern. Aus der Gilde.«
Addy wandte ihm den Blick erneut zu. »Wieso? Magst du unsere Geschichten nicht?«
»Doch, sehr gerne. Aber ich suche sie aus einem bestimmten Grund.« Um etwas über Nibu zu erfahren. Der Gott, der Fey überhaupt erst an ihr Schicksal gebunden hatte. Vielleicht konnte er ihm helfen, Fey zurückzubekommen und gleichsam die Freiheit in den Herzen der Menschen zu belassen. Ein Gott sollte das schaffen. In den Kirchen fand er keine Antworten, er brauchte die Gilde der Geschichtenerzähler. Nur leider wusste seit der Hexe niemand mehr, wo genau diese sich aufhielt, nachdem sie das alte Gildenhaus verlassen hatte. Wie die neuen Anwärter zu ihr fanden, war Jeremiah genauso unbegreiflich, und im Winter war kein Erzähler mehr unterwegs. Sie hatten bereits Zuflucht bei ihrer Zunft gesucht.
Darum hatte er seine Hoffnung auf diese Gegend gelegt. Im Süden war es ihnen vielleicht nicht zu kalt und die Hexe hatte sich ebenso wenig um diese Länder gekümmert wie Jeremiah und Yron. Hier waren sie also seltener verfolgt worden. Ob die Gilde hier lag?
»Was für einen Grund hast du?«, wollte Bhart wissen und erneut war das Kratzen zu hören, als er sich über die Gesichtsbehaarung wischte. Seine dunklen Augen glänzten vor Neugierde. »Wieso gerade einen aus der Gilde? Suchst du eine bestimmte südliche Geschichte? Vielleicht kennen wir sie oder wir fragen herum.«
Jeremiah schüttelte den Kopf. »Das wäre sehr schwer zu erklären. Ich brauche nur einen Erzähler und mehr nicht.«
Bajahd nickte nachdenklich und sein Blick lag auf den dunklen Fenstern. »Wir suchen dir einen.«
***
Yron wäre beinahe vor Müdigkeit vom Thron gerutscht. Das langatmige Geplapper mancher Menschen aus dem Reich klang wie die immer gleiche, sich monoton wiederholende Musik eines ungeübten Barden. Aber es bedurfte nicht einmal eines alten Priesters, die früher die Ausbildung der neuen Könige und Königinnen übernommen hatten, damit Yron wusste, dass ein Gähnen oder ein vom Thron Gleiten nicht die richtige Antwort auf all die unnötigen Fragen eines Bauern waren. Er wollte sich all dieser Probleme annehmen, doch wo vor einigen Monaten vor allem noch Verwirrung aufgrund von Fey geherrscht hatte, kamen jetzt hauptsächlich Anfragen von Bauern, die wissen wollten, ob sie ihr Hab und Gut behalten konnten. Dabei hatte Yron extra Herolde engagiert, damit sie diese Botschaft in die Länder hinausbrachten.
Er wollte keinen Grund enteignen, die Menschen sollten ihr Leben fortführen wie eh und je. Er würde kein Dorf überfallen oder einen Wald niederholzen lassen. Es war umso frustrierender, wenn man bedachte, dass er ganz andere Probleme hatte, die ihm unter den Nägeln brannten und die er lösen musste. Er musste sich ein Bild über das Finanz- und Steuerwesen machen, ohne Erfahrung in diesen Dingen zu besitzen. Er musste Sanierungen und Bauten erlassen; sich um die Nachbarländer kümmern; die Armut bekämpfen; Gesetze erlassen und andere zurücknehmen, die seiner Meinung nach zu grausam waren, um sie weiter zu praktizieren.
Stattdessen stand ein ungewaschener Mann vor ihm und jammerte ihm seit einer halben Stunde die Ohren voll, dass seine Kartoffeln das Einzige seien, das seine Familie über den Winter bringen könnte, und dass er jetzt fürchtete, Yron würde für den Palast alles einheimsen.
»Guter Mann«, lehnte er sich zum dritten Mal zu seinem Gegenüber vor und zwang sich dazu, nicht ungeduldig zu klingen. »Ich hoffe, Ihr verzeiht mir meine unwirschen Worte, aber ich wiederhole mich nicht nochmals. Eure Kartoffeln gehören Euch und Eurer Familie und ich werde keinen Finger an sie legen. Also bitte ich Euch, jetzt wieder zu gehen.«
Einen Moment lang starrte der Mann ihn einfach nur an. Dann nickte er, mit dicken Tränen in den Augen. »Euer Hoheit!«, stieß er aus und verneigte sich rasch. »Das ist gütig von Euch.«
Yron hasste diese Bezeichnung. »Es ist nicht gnädig, Euch nicht das zu nehmen, das ihr zum Überleben braucht. Es ist selbstredend. Habt Ihr alles, was Ihr benötigt?« Die Kammern der Hexe waren noch gut gefüllt. Die Steuern waren nie bestialisch gewesen, aber sie hätten gerechter verteilt werden müssen. »Nehmt, was Ihr braucht. Ich will kein Leid in meinem Land und ich weiß, dass ich es mir leisten kann, Euch allen etwas zurückzugeben.«
Die Augen des Mannes schwammen förmlich und Yron hasste es noch mehr als die Bezeichnung »Hoheit«, denn er wollte nicht als der Gönner auftreten, er meinte jedes seiner Worte ernst. Nicht, um die Bevölkerung um den kleinen Finger zu wickeln, sondern um wirklich etwas Gutes in ihr aller Leben zu bringen.
»Hoheit«, verbeugte sich der Bauer erneut und breitete dann die Arme aus. »Ich danke Euch aus tiefstem Herzen und will Euch nicht zur Last fallen, aber ein wenig Korn und eingelegtes Gemüse wären doch sehr hilfreich.«
Yron nickte einer seiner Wachen zu und als diese in der Rüstung klappernd näherkam, befahl der König ihr, dem Mann zu geben, was er verlangte. Sie verließen den Saal und einen Augenblick lang war es still. Yron war nicht allein, denn seit er den Thron bestiegen hatte, war er das nie mehr wirklich. Nicht einmal des Nachts waren die Wachen weit entfernt. Yron fragte sich, inwieweit er diesen Männern trauen konnte. Wer wusste schon, wer sich wahrlich auf seiner Seite befand und nicht im Verborgenen an einer Stürzung der Macht feilte? Wenn er nur Cedric den Auftrag hätte geben können, sich um die Wachen zu kümmern.
Er vermisste seinen Freund, obwohl dieser in der Nähe war und mit ihm sprechen konnte. Aber es war nicht mehr der Cedric von damals. Es war ein anderer Mann; einer, der in diesen Monaten um Jahrzehnte gealtert zu sein schien. Einer, der gebrochen war und tiefen Hass und Groll in seinem Herzen trug.
Yron war geneigt, nach dem ehemaligen Hauptmann zu schauen, doch da öffnete sich bereits ein weiteres Mal das schwere Eingangsportal am Ende des Thronsaals und die Wachen dort ließen den nächsten Bürger eintreten. Eine Frau, wie Yron erkannte. Eine Frau, die auf ihren Stock gestützt leise klappernd den langen Gang hinunter humpelte. Yron erhob sich und kam ihr entgegen und sie musterte ihn unsicher und schien geneigt, einen Knicks zu machen, der ihre alten Knochen zu brechen drohte. Yron hielt sie auf. »Meine Dame«, meinte er leise und die wässrigen blauen Augen in dem runzeligen Gesicht legten sich auf ihn. »Bitte, tut Euch keine Schmerzen an.«
»Mein König?« Ihre Stimme erinnerte ihn an altes Pergament, das man nur zu falten brauchte, damit es rissig und spröde wurde. »Ich muss mich anständig vorstellen.«
Yron nickte leicht. »Aber nicht, wenn Ihr Schmerzen dabei leidet. Wie ist Euer Name?«
»Jasaah«, murmelte sie leise und als sie erschöpft zu wanken begann, rief Yron einen Wachmann herbei und ließ ihn einen Stuhl und einen Krug Wasser bringen. So kniete er sich vor die Frau, als diese saß, und ignorierte ihren Blick und sah stattdessen zu ihr empor.
»Jasaah«, wiederholte er ihren Namen und neigte das Haupt. »Sagt mir, warum habt Ihr Euch hierher geschleppt?« Jeremiah hätte ihn sicherlich angewiesen, dass er so nicht mit einer alten Frau sprechen könne. Nur sah Yron keinen Sinn darin, ihre anstrengenden Bemühungen unter den Teppich zu wischen, eine Lüge herauszukehren und die Wahrheit zu verbergen, um höflich zu sein. »Womit kann ich Euch helfen?«
Ihre runzelige Hand legte sich an ihren Hals und zittrig schloss sie die Augen. Dann hob sie die Lider an und musterte ihn einen Augenblick lang. »Hoheit, ich komme aus einem Dorf in der Nähe und man sagte mir, dass Ihr gütig seid, denn wir brauchen mehr Vorräte für den Winter.«
»Weshalb?«
»Jaddon, dieser Idiot in unserem Dorf, verschüttete im Herbst den Saft der Galgenblume, die wir eigentlich benutzen, um Ungeziefer zu vernichten. Es war unverdünnt und eines führte zum anderen. Es lief in den Fluss und tötete dort viele Fische und vertrieb auch Weitere und es war der Fluss, der unsere Felder mit Wasser versorgt. Wir waren inmitten der Ernte und konnten nicht mehr alles retten, denn entweder war es bereits gestorben oder verdorben. Die Königin hat sich selten um solche Angelegenheiten gekümmert, aber wir brauchen dringend Vorräte.«
Yron nickte. »Wie viele Leute seid Ihr in Eurem Dorf?«
»Ich kann nicht zählen, mein Herr. Es müssen so um die fünfzig sein.« Sie sah aus, als würde sie im Kopf die Personen durchgehen. All die Gesichter nützten ihr nichts, wenn sie sich nicht mit Zahlen auskannte. Es bestärkte Yron nur in dem Ansinnen, die Schulen dieses Landes auszubauen. Seine Mutter selbst war Lehrerin gewesen und durch sie hatte er den Wert von Wissen immer erkannt.
»Ich werde Männer zu Euch schicken, sie werden Euch zählen und Eure Namen erfassen und sie werden sehen, was man machen kann. Ich werde Euch Vorräte zukommen lassen, habt mein Wort.«
Sie umfasste seine Hand und Yron war ein jedes Mal aufs Neue davon fasziniert, wie weich die Haut eines alten Menschen sein konnte. »Ich danke Euch, Herr«, wisperte sie mit fester Stimme und beinahe fühlte er sich geprüft. »Bitte, lernt meine Enkeltochter kennen.«
Yron, völlig überrumpelt von diesem Themenwechsel, lächelte nur. »Ich bin mir sicher, sie ist ein angenehmer Mensch, aber wieso sollte ich sie kennenlernen?«
Jasaah blickte ihn unter trägen Lidern an. Dann hoben sich ihre Mundwinkel langsam. »Weil sie ein feines Herz hat, genauso wie Ihr.«
Er behielt sein Lächeln aufrecht. »Nun, ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich ihr eines Tages begegnen dürfte.«
Kapitel 5
Als die Sonne über dem Schloss aufging und die Strahlen sich deutlich Mühe gaben, golden durch die Fenster hinein zu tanzen, konnte sie die Kälte in den Gängen trotz allem nicht vertreiben.
Yron hatte den Winter schon immer auf gewisse Weise geliebt, doch es bedurfte nicht seiner normalen Schwierigkeiten mit dem Aufstehen, die ihn allzu sehr verlockten, unter der dicken Decke liegen zu bleiben. Auf ihn wartete ein harter Tag und die dicken Mauern des Schlosses schienen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, keinerlei Wärme ins Innere zu lassen. Es war in diesem Frost bitterkalt und auch nur den kleinen Zeh unter dem schweren Stoff hervorlugen zu lassen, kündete von einem anstrengenden Tag.
Dennoch kämpfte er sich aus den weichen Federn hervor und wie immer glitt sein erster Blick, noch von der Bettkante aus, aus dem Fenster hinaus und auf die Welt dort draußen. Und wie immer fühlte er sich zu klein vor dieser Last, denn alles, was er erblickte, stand unter seiner Verantwortung und seinem Befehl und wenn er es nicht schaffte, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann würden sie alle unter ihm leiden. Manchmal fühlte er sich damit schon dem Wahnsinn nahe. Eine Ironie, bedachte man die Hexe, die eine solch lange Zeit auf dem Thron verbracht hatte, dass heute niemand mehr genau sagen konnte, wie viele Jahre ihre Herrschaft angehalten hatte. Die Hexe, die auf diesem Thron immer mehr dem Wahnsinn verfallen war, der die Wurzeln in ihren Geist geschlagen hatte, nachdem nicht sie den Dolch geerbt hatte.
Seine nackten Füße froren fast auf den kalten Steinen fest, die zwischen den Teppichen zu spüren waren. Wieso stellte er seine Hausschuhe nie ans Bett? Er würde niemals aus solchen Angewohnheiten lernen, fürchtete er. Aber es hatte zumindest zu einer beruhigenden Morgenroutine geführt. Er wusch sich rasch.
Seine nächsten Schritte führten ihn ins angrenzende Zimmer, um sich anzukleiden, und wie jedes Mal fiel sein Blick dabei auf die Kleidung, die er früher getragen hatte, und die feinen Sachen, die man ihm nun aufzwang. Jeden Tag fragte er sich, ob er sich gegen diese Regeln stellen sollte. Er war der König, es sollte in seiner Macht liegen. Weiche Wolle, weite Kleidung, grelle Farben, das war nicht er. Er sehnte sich nach seiner dunklen, stabilen Kleidung zurück. Jene, die einen Dolchstoß abfedern konnte; die eng anlag, damit er richtig kämpfen konnte.
Kämpfen würde er vermutlich nicht müssen, denn auch wenn die Situation im Land heikel war, so hatte er dennoch treue Wachen an seiner Seite. Aber vielleicht war es auch kein Kampf gegen einen Feind, der ihm vorschwebte, sondern der Kampf gegen das Neue, das Furchteinflößende. Er wollte etwas von sich selbst im Spiegel erkennen können.
Yron kniff die Augen zusammen und stellte sich vor, wer er war und wie viel davon sichtbar war. Dann seufzte er und hob die Lider. Den Blick. Seine Aufmerksamkeit blieb nicht lange auf der Wollkleidung liegen. Seine Hände fanden den richtigen Weg wie von allein.
Heute entschied er sich endlich. Es war ihm einerlei, was seine Berater davon hielten, denn wenn er ehrlich war, behielt er sie ohnehin nur, damit das Volk zufrieden war, und nicht, weil er wirklich etwas auf ihre Meinung gab. Dafür waren sie ihm viel zu sehr in ihrem Muster verklemmt, viel zu sehr darauf aus, alles an feste Vorstellungen zu bannen, die sie in irgendwelchen alten Büchern gelernt hatten. Die alten Riten hatten sie in dieses Chaos gestürzt und Yron kam nicht umhin, sich zu wünschen, dass sie alle neu anfangen konnten.
Er zog seine Kleidung an und fühlte sich prompt wieder mehr wie er selbst. Ein weiteres leises Seufzen kam über seine Lippen, erstarb jedoch direkt, als seine Finger sich um das kühle Metall der Krone legten. Die Krone eines Königs, die man aus einer Schatzkammer geborgen hatte. Wie es sich gehörte, hatte die Hexe die wesentlich grazilere Krone einer Frau getragen. Eine Krone, die er dem Volk geopfert hatte. Es hatte ein Fest gegeben, als der König sich symbolisch ihrer entledigt und sie vernichtet hatte. Yron würde eine andere machen lassen, sollte er sich jemals eine Königin suchen. Er hätte es nicht ertragen, wenn seine zukünftige Frau diesen Schmuck auf dem Kopf zur Schau stellte.





























