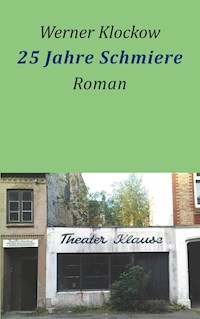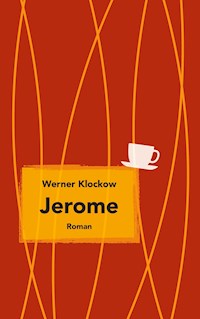
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Familiengeschichte als Agentenkomödie ! Hieronymus Prinz hat das Missgeschick, bereits seit seiner Geburt namentlich auf einer Grabinschrift zu stehen, weil man ihn nach seinem 1945 in Ostpreußen verschollenen Onkel getauft hat. Er benennt sich um in Jerome, verlässt die Familie, und wird Lokalredakteur bei einem Provinzblatt. Doch eines Tages kauft er im Supermarkt ein Pfund Kaffee für mehr Geld, als er ausgeben wollte, wird danach von einem roten Minolta XRS angefahren und von einer schönen jungen Frau, die sich Irmela nennt, entführt. Was er nicht weiß, ist, dass sein Rucksack einen Mikrochip enthält, der, sobald er auf den Gegenchip in seiner Kaffeepackung trifft, den Untergang des Weltwirtschaftssystems verursachen wird. Unversehens gerät Jerome zwischen die Fronten verfeindeter Agentenorganisationen. Da gibt es die Organisation H von ehemaligen Nazigrößen, die von Paraguay aus operiert. Da gibt es aber auch die Organisation Counter-H, finanziert von Jeff Bezos. Da gibt es die 1940 gebaute Luxusyacht Martin B., die mit Atomantrieb fährt. Von diesem Geisterschiff aus zieht der hundertelfjährige Onkel Hiero die Fäden. Und dann gibt es noch die alte Kompaktkassette, besprochen von einer Wahrsagerin aus Königswinter, die - vielleicht - alle Rätsel löst. Ein Feuerwerk aus aberwitzigen Begebenheiten rund um eine dysfunktionale Familie, erzählt in rasanten Shortcuts, phantasievoll, schräg, spannend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Werner Klockow wurde 1956 in Lippstadt geboren. Nach seiner Ausbildung zum Schauspieler folgten Engagements an zahlreichen deutschen Bühnen. Aktuell ist er Ensemblemitglied am Theater Kiel. Nach einigen Texten fürs Theater veröffentlichte er 2014 den Roman „25 Jahre Schmiere“. 2019 folgte der Roman „Trotzdem schade, dass die Jugend vorbei ist“. Werner Klockow lebt in Kiel und Lübeck.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Erster Teil
1
Im Wohnzimmer ihres mit Efeu völlig überwachsenen Hauses in Königswinter am Rhein sitzt die berühmte Wahrsagerin dem deutschen Bundeskanzler Dr. Adenauer gegenüber. Zwischen ihnen ein niedriger Couchtisch mit gehäkelter Decke, darauf Tarot-Karten, eine mittelgroße Kristallkugel, die von drei Frauenfiguren aus Bronze gehalten wird, und ein überquellender Aschenbecher.
Die Wahrsagerin hat den Bundeskanzler gerade in der Entscheidung beraten, ob er zu den „Ssoffjets“ nach Moskau fliegen soll oder besser doch nicht. Nachdem sie die Karten befragt und sich für kurze Zeit in Trance versetzt hat, hat sie dem Kanzler zugeraten.
Dr. Adenauer weiß noch nicht, ob er der Empfehlung der Wahrsagerin folgen wird. Jedenfalls ist der offizielle Teil seines nichtsdestoweniger heimlichen Besuchs in Königswinter (er hat seinen Fahrer angewiesen, in einer Seitenstraße auf ihn zu warten) jetzt beendet.
Die Wahrsagerin serviert Kräutertee und Ingwerkekse. Die Figurengruppe mit der Kristallkugel schiebt sie beiseite, damit die dampfenden Tassen auf dem Couchtisch Platz finden. Der Tee schmeckt dem Bundeskanzler nicht besonders gut, er verzieht etwas den Mund. Auch die Ingwerkekse sind nicht ganz sein Fall.
„Wo wir gerade so nett zusammensitzen, Herr Bundeskanzler“, sagt die Wahrsagerin, „ich warte immer noch auf meine Entschädigung.“
„Entschädigung wofür?“, fragt Dr. Adenauer.
„Ich bin im Konzentrationslager gewesen“, erwidert die Wahrsagerin. „Dafür bekommt man ja wohl eine Entschädigung.“
„Ach wissen Sie“, seufzt Dr. Adenauer, „das waren so viele. Wenn wir da jeden einzelnen … Sie bekommen für Ihre Dienste ein sehr anständiges Honorar. Per Kurier. In bar. Ohne Quittung. Betrachten Sie das als Wiedergutmachung.“
Er setzt seine Tasse ab und schiebt sie von sich weg. „Nehmen Sie es mir nicht übel, aber den Tee kann ich nicht trinken. Er ist mir zu bitter. Behalten Sie Platz. Ich finde allein raus.“
Dr. Adenauer erhebt sich und verlässt das Haus durch eine Hintertür, die in den Garten führt.
Die Wahrsagerin lehnt sich in ihrem zierlichen Sessel zurück und zündet sich eine Zigarette an. Ihr Blick fällt auf die aus dunklem Holz gefertigte Anrichte an der Wand gegenüber. Zwischen den filigran gedrechselten Säulen sind einige Fotografien aufgestellt: das Brustbild eines jungen Mannes in Uniform, in dessen rechtem Auge ein Monokel klemmt, eine beinahe nackte Tänzerin, die sich grotesk verrenkt und förmlich aus dem Bild zu springen scheint, ein Baby mit seltsam starren Augen in einem Kinderwagen aus Korbgeflecht. Daneben und dahinter weitere gerahmte, teilweise bereits nachgedunkelte Portraits.
Die Wahrsagerin lässt den Rauch der filterlosen Senoussi durch Mund und Nase ausströmen. Auf ihrer Stirn bilden sich zwei scharfe, senkrechte Falten.
„Ich sehe etwas“, sagt sie leise und streicht sacht über die Kristallkugel vor ihr auf dem Tisch. „Aber ich sehe es noch nicht deutlich genug.“
2
Es kam, wie es kommen musste. Das kleine rote Auto konnte nicht mehr ausweichen, Jerome hatte aber auch nicht nach rechts und links geschaut, sich allzu sorglos auf die Fahrbahn vor dem Bellavista-Supermarkt begeben.
Das Auto erfasste ihn an der Hüfte, Jerome flog über die rundliche Schnauze des Toyota Aygo oder Hyundai i10, dengelte noch gegen den Mast einer Straßenlaterne, die auf der Stelle erlosch, und blieb neben einer grünen Streusandkiste liegen.
Es war ein düsterer, deprimierender Januarabend, schwere nasse Schneeflocken fielen. Jerome fragte sich, ob er Schmerzen habe, seine Gefühlsrezeptoren meldeten nichts, den Versuch aufzustehen unternahm er aber erst gar nicht.
Er war gerade einkaufen gewesen.
Im Bellavista-Supermarkt hatte er sich wie gewöhnlich über die in Plastik verpackten Wurst- und Käseaufschnitt-Massen aufgeregt und im Kopf die immer gleiche Textzeile wiederholt, dass nämlich das Weltklima nur durch eine radikale Dekarbonisierung zu retten sei. Andererseits ging er nicht gern in Bio-Läden, weil er die wissenden, seine schlechten Ernährungsgewohnheiten durchschauenden Augen der Biowaren-Verkäufer fürchtete. Also nahm er den Wurst-Käse-Plastik-Müll dann natürlich doch aus der Kühltheke und schmiss ihn in seinen Einkaufswagen.
Vor einigen Jahren hatte er die flachen Packungen sogar ganz praktisch gefunden, weil sie beim Klauen so leicht in das aufgerissene Innenfutter seiner Lederjacke glitten.
Hauptsächlich war Jerome an diesem Abend wegen seiner bevorzugten Kaffeesorte in den Bellavista-Supermarkt gekommen: Auslese Spezial gab es gerade im Sonderangebot, das Pfund für dreineunundvierzig statt fünfneunundsechzig, er hatte das große, etwas schief hängende Plakat am Eingang gesehen.
Im Supermarkt war es ungewöhnlich leer. Sie hatten umgeräumt, das Kaffeeregal stand jetzt neben dem Tierfutter. Was das wieder soll, dachte Jerome, nur damit die Leute rumsuchen müssen und dabei Sachen kaufen, die sie gar nicht brauchen.
Er hatte sich ein Paket Auslese Spezial aus dem fast leeren Regal gegriffen, war zur Kasse geeilt und hatte den Kaffee zusammen mit seinen anderen Einkäufen aufs Band gelegt. Als der Kaffee an der Reihe war, erschien auf dem kleinen Kassenmonitor fünf Euro neunundsechzig, Jerome bemerkte es gerade noch rechtzeitig.
„Moment! Stopp!“, rief er. „Fünfneunundsechzig stimmt nicht! Auslese Spezial ist im Angebot!“
Die Kassiererin hatte eine ungesunde, rötlich-blaue Gesichtsfarbe. Jerome hatte sie noch nie im Markt gesehen. Sie hielt inne, sah Jerome an, runzelte die Stirn, stand auf und wand sich schwerfällig durch die Barriere, die den Kassenbereich vom Verkaufsraum trennte.
Jerome schraubte sich ebenfalls durch die Schranke und folgte ihr zum Kaffeeregal. „Sehen Sie, hier steht es!“, sagte er triumphierend. „Kaffee Auslese dreineunundvierzig!“
„Schauen Sie mal genau hin“, erwiderte die Kassiererin, deutete auf ein Preisschild und ordnete nebenbei ein paar Kaffeepackungen, die kreuz und quer im Regal standen. Jerome fiel eine Tätowierung an ihrem linken Handballen auf, ein kleiner Vogel mit ausgebreiteten Schwingen.
„Kaffee Auslese von Grosso kostet dreineunundvierzig“, sagte die Kassiererin. „Nicht Kaffee Auslese Spezial. Der kostet fünfneunundsechzig das Pfund.“
Grosso war die Hausmarke des Supermarkts und stand direkt neben Auslese Spezial. Beide Packungen waren knallgrün.
„Und das Sonderangebot?“, fragte Jerome.
„Keine Ahnung. Habe ich leider nicht in der Kasse.“ Die Kassiererin hob ein Grosso-Paket auf, das ihr aus der Hand gefallen war.
„Na gut“, sagte Jerome, „alles klar.“
Sie gingen zurück zur Kasse.
„Storno?“, fragte die Kassiererin und fummelte, während sie wieder Platz nahm, an ihrem Headset herum.
„Nein, kein Storno“, erwiderte Jerome. „Ist nun mal meine Lieblingssorte.“
„Moment noch“, sagte die Kassiererin. „An Ihrem Kaffee ist ja das Papier eingerissen.“
„Wo? Ich sehe nichts“, sagte Jerome.
„Da oben an der Ecke. Ich gebe Ihnen ein anderes Paket.“
Die Kassiererin holte eine Packung Kaffee Auslese Spezial unter ihrer Kasse hervor und tauschte sie gegen das Paket aus, das vor ihr auf dem Band lag.
Jerome zahlte sein Pfund Auslese Spezial und gestattete sich noch die Bemerkung, dass beide Kaffeesorten, zumal in ähnlichen Verpackungen, sehr dicht beieinander gestanden hätten, was unter Verbraucherschutzaspekten schon ein wenig bedenklich sei.
„Bonuspunkte?“, fragte die Kassiererin, die ihm nicht zugehört hatte, irgendetwas pfiff in ihrem Headset.
„Bonuspunkte?“, fragte Jerome seinen glatzköpfigen Hintermann an der Kasse, vielleicht hatte er Interesse. Der Mann, der einen dunklen Anzug trug, reagierte nicht, fingerte nur wie die Kassiererin an seinem Ohr herum.
„Danke, keine Bonuspunkte“, sagte Jerome.
Er verstaute den Einkauf in seinem schwarzen Swiss-Gear-Rucksack und ärgerte sich einmal mehr über die vielen Reißverschlüsse, die er ständig verwechselte.
Neben ihm piepte es hektisch und schrill. Jerome erschrak.
„Der Scanner spinnt mal wieder“, sagte die Kassiererin. „Gehen Sie einfach durch.“
Jerome verließ den Bellavista-Supermarkt und trat hinaus in den trüben, nasskalten Winterabend. Recht geschieht mir, dachte er.
Die unwürdige Szene am Kaffeeregal hätte als angemessener Abschluss dieses verdaddelten, sinnfreien Tages vollkommen ausgereicht. Aber dann erwischte ihn auch noch das kleine rote Auto; er flog gegen die Straßenlaterne und blieb im Schneematsch vor einer grünen Streusandkiste liegen.
3
Aus dem Auto stürzte eine junge, sehr schöne Frau in einem dunklen Business-Kostüm. Sie beugte sich über Jerome und fragte: „Sind Sie verletzt? Sie sind doch verletzt!“
„Ich weiß nicht genau, ich glaube ja“, erwiderte Jerome.
Er lag etwas verdreht auf der Seite; neben ihm bildete sich eine Pfütze, eine weiße Flüssigkeit, Milch, tropfte aus seinem Rucksack.
„Versuchen Sie mal, sich zu bewegen“, schlug die schöne junge Frau vor, die aus dem Toyota oder Hyundai gestiegen war. „Ganz systematisch, ein Bein, das andere Bein und dann die Arme.“
Jerome hatte das Gefühl, sich überhaupt nicht bewegen zu können, spürte nur das dumpfe Pulsen anrollender Schmerzen.
„Nun machen Sie mal!“, sagte die Frau ungeduldig, „so schwer kann das doch nicht sein!“
Einige Passanten waren stehengeblieben, zückten ihre Mobiltelefone und riefen unisono: „Hallo, hallo, hier ist ein Unfall, schicken Sie bitte einen Krankenwagen!“
Die Frau blickte nervös hoch und sagte leise, beinahe zärtlich zu Jerome: „Versuchen Sie es doch wenigstens. Bitte. Mir zuliebe.“ In ihren langen, schwarzen Haaren glitzerten Schneekristalle. Jerome hob den linken Arm und staunte, dass es funktionierte.
„Na bitte“, flüsterte die schöne junge Frau, die Jerome in diesem Moment trotz seines Zustands extrem betörend vorkam.
„Krankenwagen kommt!“, rief einer der Passanten.
„Nicht nötig“, sagte die junge Frau, „ich bin Ärztin. Er kommt mit mir.“
„Sie sind doch nie im Leben Ärztin“, meinte der Passant, aber die junge Frau hatte Jerome bereits mit einem sehr professionell wirkenden Griff untergefasst und zog ihn zu dem roten Toyota Aygo oder Hyundai i10. Sie verfügte über erstaunliche Kräfte. Jerome ließ es geschehen, ein irgendwie wohliges Gefühl stellte sich ein. Vielleicht war er ja jetzt querschnittsgelähmt, dann war sowieso alles egal. Aus dem Rucksack sickerte weiterhin Milch.
„Moment mal, junge Frau“, sagte ein zweiter Passant, „so einfach geht das aber nicht!“
„Krankenwagen ist unterwegs!“, rief der erste Passant dazwischen.
Die Frau im dunklen Business-Kostüm zauberte von irgendwoher ein Ledermäppchen hervor, klappte es, während sie Jerome mit der anderen Hand weiter festhielt, auf, hielt das Mäppchen dem zweiten Passanten direkt vor die Nase und bellte: „Geheimer Sondereinsatz. Gefahr in Verzug. Alles klar?“
„Ach so“, sagte erste Passant. „Das konnten wir ja nicht wissen.“ Er zeigte auf Jerome. „Ein Agent?“
„Möglicherweise“, erwiderte die Frau, „aber wir wissen es noch nicht genau.“
„Und Sie sind wirklich Ärztin?“ Passant Nummer zwei gab keine Ruhe. Über ihnen rasselte ein Hubschrauber, aus der Ferne war das anschwellende Tatü-Tata einer Ambulanz zu hören.
„Natürlich bin ich Ärztin, denken Sie, ich mache das hier zu meinem Vergnügen?“, herrschte die Frau den zweiten Passanten an. „Stehen Sie nicht herum, machen Sie lieber die Autotür auf!“
Der Mann gehorchte und öffnete die Beifahrertür des Toyota Aygo oder Hyundai i10. Die Frau bugsierte Jerome auf den Sitz und hob mit einer heftigen Bewegung seine Beine in den Fußraum. Dann schmiss sie die Tür zu. Jerome jaulte auf.
Die Frau wechselte zur Fahrerseite, stoppte kurz und wandte sich noch einmal an die fünf oder sechs Passanten, die unschlüssig herumstanden: „Noch etwas: den Sanitätern, die gleich kommen, sagen Sie, die Kollegen seien schon dagewesen. Am besten vergessen Sie alles, was Sie gerade gesehen haben. Sonst –“
„Sonst was?“, fragte der erste Passant.
„Ach – ist ja auch egal“, sagte die Frau im dunklen Businesskostüm. „Schönen Abend noch.“
Sie schwang sich hinters Steuer, schaltete die Scheinwerfer aus, beschleunigte stark, was man aber kaum hörte, weil es sich bei dem Toyota Aygo oder Hyundai i10 offenbar um ein Elektroauto handelte, driftete in die nächste dunkle Seitenstraße und war verschwunden.
4
Jeromes Schmerzen manifestierten sich in einem stetigen, den ganzen Körper ergreifenden Pochen. Von welchem Plan bin ich ein Teil des Teils, dachte er, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Seine schöne Chauffeurin fuhr wie eine Teufelin; sie preschte durch die schmale Straße und durch eine noch schmalere Gasse, durchquerte einen Hinterhof und schoss schließlich in die hell erleuchtete Ausfallstraße. Dort ließ sie das Seitenfenster herunter. Ihr ebenholzschwarzes Haar wirbelte im Fahrtwind.
Jerome wand sich auf dem Beifahrersitz, der Rucksack drückte unbequem im Rücken. „Ich versaue Ihnen gerade Ihr schönes Auto“, sagte er, „der Matsch, die ausgelaufene Milch …“
„Macht nichts“, erwiderte seine rasante Chauffeurin. „Musik?“
Sie berührte das große bunte Display neben dem Lenkrad. Sofort ertönte laute klassische Musik, ziemlich pompös, Jerome tippte auf die Eroica, war nicht gerade wieder ein Beethovenjahr?
Die schöne junge Frau saß kerzengerade hinter dem Lenkrad, steuerte den Toyota oder Hyundai mit ausgestreckten Armen. Jerome kam sie sehr heroisch vor, wie eine Bannerträgerin.
„Wäre es sehr vermessen von mir, erfahren zu wollen, wohin wir fahren?“, fragte er.
Die mysteriöse Chauffeuse antwortete nicht, schaute lächelnd geradeaus.
Jerome wiederholte seine Frage: „Wohin fahren wir, bitte?!“
„La-la-la“, sang die schöne junge Frau und fädelte sich in einen Kreisverkehr ein, in dessen Mitte sich tatsächlich ein riesiges Reiterdenkmal mit einer jungen, bannertragenden Frau befand.
Merkwürdig, dachte Jerome.
Seine Chauffeurin umrundete den Kreisverkehr zweimal, vollführte dann einen abrupten, diagonalen Spurwechsel über fünf oder sechs Fahrstreifen von ganz innen nach ganz außen, und verließ mit quietschenden Reifen das Rondell. In die majestätischen Eroica-Klänge mischte sich ein wütendes Hupkonzert.
Hat sie überhaupt Licht an, fragte sich Jerome.
Die Straße, auf der sie sich nun befanden, war zwar breit, aber nur schwach beleuchtet. Rechts und links anfangs flache Gebäude, Lagerhallen oder ähnliches, dann immer mehr Baulücken, Brachen, schließlich freies Gelände. Diffuse Nebelschwaden, durch die ein paar müde Schneeflocken torkelten, legten sich über die Straße. Jerome schien es, als bewegten sie sich auf ein gähnendes, grauschwarzes Nichts zu.
Sie fährt definitiv ohne Licht, dachte er.
Plötzlich verstummte die Musik, stattdessen ertönte ein schrilles Piepen. Die Fahrtgeschwindigkeit verringerte sich drastisch. Auf dem Display erschien eine große Weinbergschnecke, die schwer an ihrem Haus zu tragen schien, aber trotzdem freundlich lächelte. Auf ihrem Kopf schwankten zwei lange Fühler. Dann aber hörte die Schnecke zu lächeln auf und sah mit einem Mal sehr panisch aus. Die Fühler verfärbten sich und begannen zu blinken. Kurz darauf blinkte die gesamte Schnecke.
„Scheiße! Akku leer!“, sagte die schöne junge Frau. „Aber egal.“
Der Toyota oder Hyundai rollte mit einem sirrenden Geräusch aus. Die Schnecke winkte mit dem linken Fühler, löste sich in tausend Glitzerpunkte auf und verschwand vom Display.
„Gerade noch geschafft“, sagte die geheimnisvolle Chauffeurin. „Wir sind da.“
5
Sie waren an der Kante einer steil abfallenden Hafenmauer zum Stehen gekommen, noch einen Meter weiter, und der Toyota oder Hyundai wäre ins schwarze Wasser gestürzt.
„Ich heiße übrigens Irmela“, sagte die schöne junge Frau, die ihn beinahe umgebracht hätte, zu Jerome. „Nicht mein richtiger Name, wie du dir denken kannst. Aber nenn mich einfach so.“
„Ich bin Leo“, sagte Jerome.
„Quatsch, du heißt Jerome“, entgegnete Irmela. „Und jetzt schauen wir uns mal deine Verletzungen an. Ich glaube, du hast Glück gehabt. Beziehungsweise war es gar kein Glück, sondern – ach, eigentlich brauche ich mir deine Verletzungen gar nicht anzuschauen, denn du hast gar keine.“
Die schöne junge Frau, die möglicherweise Irmela hieß, umrundete den roten Toyota oder Hyundai und öffnete die Beifahrertür.
„Steig mal aus.“
„Ich kann nicht“, erwiderte Jerome, „ich bin verletzt.“
„Los, steig aus. Stell dich nicht so an. Du hast gar nichts.“
„Das weiß ich ja wohl besser! Was haben Sie mit mir vor? Was soll das alles überhaupt?“
„Pschhht!“ Irmela legte den rechten Zeigefinger auf seine Lippen. „Sei brav. Hoch die müden Leiber, die Pier steht voller nackter Weiber!“
Jerome fasste sein rechtes Bein unter und hob es aus dem Auto.
„Na siehst du. Weiter! Weiter!“, kommandierte Irmela fröhlich.
Jerome schaukelte sich aus dem Autositz hoch, suchte für einen Moment Halt am Türholm, stieg aus, stand und streckte sich, als hätte er eine ganz normale längere Autofahrt hinter sich. Aus dem Swiss-Gear-Rucksack, der ihm schief am Rücken hing, tropfte es immer noch.
„Ihr Toyota oder Hyundai wird ganz schön stinken. Den Geruch von saurer Milch kriegen Sie nie mehr raus.“
„Egal, ist nur ein Dienstwagen. Es ist auch kein Toyota oder Hyundai, sondern ein Minolta XRS.“
„Exquisites Sound-System“, lobte Jerome. „Nett, die Eroica mal über eine richtig gute Anlage zu hören.“
„Quatsch Eroica.“ Irmela schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen. „Das war der zweite Satz aus Schuberts Unvollendeter. Die Eroica ist ja wohl läppisch dagegen.“
Irgendwo im Dunkeln tutete ein dumpfes Typhon.
„Ein Schiff wird kommen …“, sang Irmela.
„Was für ein Schiff? Warum singen Sie das?“, unterbrach sie Jerome.
„… und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht …“, sang Irmela unbeeindruckt weiter und deutete ein paar Sirtaki-Schritte an.
„Kommt das Schiff, das da draußen tutet, etwa wegen uns?“, insistierte Jerome.
„Wer weiß …“ Irmela schraubte ihre Handgelenke in den Nachthimmel. „Ná-na-na-ná-na-nanananana-ná …“
„Ich will auf kein Schiff. Auf gar keinen Fall. Ich will nach Haus!“
„Negativ. Geht leider nicht“, sagte Irmela. „Und warum willst du überhaupt unbedingt nach Haus? Was ist da Besonderes los? Haben deine Topfpflanzen Sehnsucht nach dir? Willst du nicht lieber wissen, was hier als Nächstes passiert? Was hinter der nächsten Ecke ist? Ich verspreche dir, es bleibt aufregend.“
Jerome stutzte. Woher wusste Irmela von dem Einblatt, den Wasserlilien und den zwei Gummibäumen in seiner Wohnung, die ihm tatsächlich sehr am Herzen lagen?
Er überlegte. Eigentlich hatte Irmela recht. Endlich mal etwas Bewegung in seinem ansonsten eher ruhigen, zu ruhigen Leben. Die Gummibäume konnten warten.
Jerome begann, die Reise, die sich abzuzeichnen schien, interessant zu finden.
„Ná-na-na-ná-na-nanananana-ná …“, sang Irmela.
Jerome befühlte seinen rechten Arm. „Wieso geht es mir eigentlich so gut? Warum habe ich keine Schmerzen?“, wunderte er sich.
„Weil es dir eben gut geht.“ Irmela drehte eine kleine Pirouette. „Sei doch froh. Nicht allen Menschen geht es so gut wie dir. Und sag endlich du-du-du zu mir.“
Sie machte mit angewinkelten Armen, als wären sie gestutzte Flügel, Ententanz-Bewegungen.
Jerome streifte sich den Rucksack von der Schulter und zog einen der Reißverschlüsse auf. „Scheiße. Alles nass und verklebt von der blöden Milch.“
Er kramte ein Zweihundertgramm-Display Schnittkäse hervor, eine runde Packung Lyoner Wurst, den zerquetschten Milch-Tetrapack, eine Dose Gulaschsuppe, das Paket Auslese Spezial (fünfneunundsechzig das Pfund, für einen Moment stieg in Jerome der alte Ärger wieder hoch), und schließlich eine Tüte Erdnüsse. Er legte alles an die Kaikante, drehte den Rucksack, damit er auslüften konnte, auf links, platzierte ihn neben die Lebensmittel, riss die Tüte mit den Erdnüssen auf und hielt sie Irmela hin.
„Hunger?“
„Gute Idee“, sagte Irmela und griff zu.
6
Plötzlich wurde es taghell. Riesige Suchscheinwerfer rissen die Dunkelheit auf. Hinter Jerome und Irmela heulten großvolumige Motoren wie hungrige Wölfe. Zwei monströs-adipöse Ford-Pickups preschten heran und bremsten scharf. Ungefähr ein Dutzend Männer mit rasierten Schädeln und in dunklen Anzügen stiegen aus oder sprangen von den seitlichen Trittbrettern ab und schritten in breiter Phalanx auf Jerome und Irmela zu. Silberne Colts blitzten in ihren Holstern.
„Ist gut, Männer!“, rief Irmela ihnen entgegen. „Hier ist alles sauber. Ihr könnt wieder abhauen.“
Die Anzugtypen blieben stehen und wechselten einige Blicke.
„Wirklich?“, fragte einer, der wie Clint Eastwood aussah.
„Wenn ich es euch doch sage. Alles läuft nach Plan!“
„Okay. Du bist der Boss.“
Die Männer schickten sich an, den Rückzug anzutreten.
„Moment noch“, sagte Irmela. „Nehmt den Minolta an den Haken und lasst uns einen der Fords da.“
Die Männer ließen ein leises Knurren hören.
„Hey – ist es etwa unter eurer Würde, mal ausnahmsweise in einen Kleinwagen zu steigen!?“ Irmelas Stimme nahm einen scharfen Tonfall an.
Die Männer knurrten und murrten lauter.
„Kusch!“
Irmela hatte mit einer schnellen Bewegung eine Dressurpeitsche aus dem Minolta XRS gezogen und ließ sie knallen.
„Kusch, Ralf! Kusch, Horst! Kusch, Dieter! Kusch auch ihr anderen, ihr Namenlosen!“
Das Murren und Knurren verstummte augenblicklich.
Wahnsinn, dachte Jerome bewundernd. Und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf, da wird’s still.
„Und jetzt ein bisschen Bewegung, wenn ich bitten darf!“, kommandierte Irmela.
Die Männer schoben den Minolta von der Kaikante zurück und wendeten ihn mit einigen umständlichen Manövern, bis er mit dem Heck zum Wasser stand. Sie fuhren einen der Fords rückwärts an den Minolta heran; von einer Winde rollte ein Stahlseil ab, das die Männer am Minolta befestigten. Einer setzte sich hinters Steuer, die anderen Männer gingen zum Schleppfahrzeug. In der Fahrerkabine des ihnen verbliebenen Pickups war nicht genug Platz für alle. Erneut erhob sich in bedrohlichem Crescendo ein Murren und Knurren.
„Kusch!“
Irmela knallte mit der Peitsche. Die Männer hoben beschwichtigend die Arme, steckten die Köpfe zusammen und warfen verachtungsvolle Schulterblicke auf den Minolta XRS. Drei Männer lösten sich schließlich mit angewiderten Gesichtern aus der Gruppe und quetschten sich in den Fond des Minolta. Ein vierter nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Die übrigen Männer bestiegen nun den Ford.
Der Acht-Zylinder-Motor brabbelte und heulte auf, und das Abschlepp-Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Der Minolta jedoch rührte sich nicht. Nur das Stahlseil rollte von der Winde ab. Nach wenigen Sekunden war der unbeleuchtete Ford in der Dunkelheit verschwunden.
„Hey, was soll das?“
Der Mann hinter dem Lenkrad des Minolta machte Anstalten, wieder auszusteigen. In diesem Moment zog das Seil mit einem gewaltigen Ruck an, und der Minolta schoss nach vorn. Mit knapper Not rettete sich der Mann wieder ins Innere des Wagens. Der Minolta tauchte nun ebenfalls in die Dunkelheit ab. Aus der Ferne ertönte raues Gelächter.
„Kindsköpfe“, sagte Irmela. Sie wies auf den verbliebenen Ford-Pickup mit seinem riesigen, bleckenden Kühlergrill. „Schau mal, was für ein schönes Auto.“
„So ein Ford F-150 ist ja wohl das Letzte“, sagte Jerome. „Eine geradezu obszöne Verhöhnung der Klimakatastrophe, jawohl.“
„Sei nicht so streng“, erwiderte Irmela. „Und woher willst du wissen, dass wir genau in diesem Moment nicht gerade etwas Gutes tun für“ – sie malte Anführungszeichen in die Luft – „das Klima?“
„Wie das?“
„Alles hängt mit allem zusammen“, sagte Irmela geheimnisvoll. „Und jetzt komm. Hierbleiben ist keine Option.“
Jerome schaute auf den zweifellos obszönen Ford. Eigentlich sah er ja ganz schick aus. Er war noch nie in so einem Riesenauto gefahren. Vielleicht ließ Irmela ihn sogar ans Steuer.
Jerome fasste sich ein Herz.
„Darf ich – ich meine – darf ich vielleicht –“
„Fahren? Nein, darfst du nicht“, beschied ihn Irmela knapp.
Jerome verstaute die Lebensmittel, die er an der Kaikante aufgebaut hatte, wieder im Rucksack. Nur den leck geschlagenen Tetrapack Milch ließ er stehen.
Sie stiegen ein. Jerome streckte sich wohlig aus. Klimakatastrophe hin oder her – die großzügige Doppelkabine des Fords hatte etwas ungemein Behagliches.
Irmela hob den Kopf, lauschte, ihr Blick konzentrierte sich. Sie glich einem Hund, der Witterung aufnahm.
„Hier stimmt was nicht“, sagte sie. „Raus. Sofort raus.“
„Wieso, warum soll ich –“
„Frag nicht! Raus! Schnell! Und renn!“, schrie Irmela. „Nimm die Beine in die Hand!“
Sie griff hastig nach dem Rucksack, der auf Jeromes Schoß lag, drückte sich gegen die Fahrertür und sprang ins Freie. Jerome kletterte ebenfalls nach draußen, hörte, wie Irmela wiederum „Renn! Renn!“ schrie, und lief los.
Im nächsten Moment knallte es hinter ihm. Der Knall war ohrenbetäubend. Die Druckwelle der Explosion warf Jerome zu Boden, instinktiv bedeckte er den Kopf mit seinen Armen.
Es knallte noch einmal. Irgendetwas, ein Gegenstand, schlug direkt neben ihm auf. Jerome hörte das saugende Prasseln eines großen Feuers. Vorsichtig richtete er sich auf. Neben ihm lag eine schwere Autotür.
Glück gehabt, dachte Jerome.
Er sah sich um. Der Ford brannte lichterloh, die Motorhaube stand senkrecht hoch.
„Irmela?“, rief Jerome. „Irmela! Wo bist du?“
„Hier! Hier bin ich!“
Irmela stand hoch aufgerichtet etwa dreißig Meter von ihm entfernt. Zwischen ihnen loderte, die geborstenen Fenster wie tote Augen, der Ford. Täuschte sich Jerome, oder sah er über Irmela den funkensprühenden Rest einer zerfetzten Fahne? Auf Irmelas Gesicht irrlichterte nervös der Feuerschein. Ein Scheiterhaufen, schoss Jerome durch den Kopf, Irmela auf dem Scheiterhaufen. Sie winkte, deutete nach vorn.
„Bist du okay?“, fragte Jerome, als sie sich an der Kaimauer trafen, und widerstand dem Reflex, Irmela zu umarmen.
„Alles okay“, antwortete sie, „und du? Ach, was frage ich – natürlich bist du okay.“
An ihrer rechten Hand baumelte der Swiss-Gear-Rucksack.
„Was hast du bloß mit diesem Rucksack?“, fragte Jerome.
„Hunger!“, antwortete Irmela. „Huuunger!“
Sie langte in den Rucksack und zog die Dose mit der Gulaschsuppe hervor.
„Ringpull. Wie praktisch.“
Sie riss die Dose auf und setzte sie sich an den Mund. „Lecker! Nur ein bisschen zähflüssig. Soll ich dir was übriglassen? Vielleicht mit einem Schuss Milch?“
An der Kaikante stand immer noch der zerquetschte Tetrapack.
„Nein danke“, erwiderte Jerome. „Ich finde kalte Gulaschsuppe mit Milch ziemlich eklig.“
„So?“, meinte Irmela. „Ich nicht.“
Sie stellte die Dose neben sich ab und schaute aufs Wasser. Ein paar Schneeflocken wirbelten. In der Ferne flimmerten Lichter.
„Ein lauschiges Plätzchen, findest du nicht?“
„Es ist kalt“, antwortete Jerome.
Irmela hob die Arme und machte wiederum ein paar Sirtaki-Schritte.
„Was meinst du“, fragte sie, „wie geht es jetzt weiter?“
„Wenn du es nicht weißt – wie soll ich es dann wissen?“
„Wer sagt denn, dass ich es nicht weiß? Da-dá.“ Irmela fasste Jerome an der Hand. „Komm, tanz mit!“
„Nein, das ist mir zu blöd.“ Jerome riss sich los.
„Ná-nananana … Hast Du jemals einen Ford F-150 so wunderschön abbrennen sehen? Nanana-ná-nananana …“
„Hör auf!“
Jerome kickte die Suppendose von der Kaimauer. „Woher hast du gewusst, dass der Ford explodiert, genau in diesem Moment?“
„Ich wusste es gar nicht. Er hätte auch nicht explodieren können. Aber ich dachte mir, sicher ist sicher.“
„Deine Knechte – stecken etwa deine Knechte dahinter?“
„Ach, Ralf, Horst, Dieter und die anderen – im Leben nicht! Die sind grundanständig. Nenn sie bitte nicht Knechte. Das ist kränkend.“
„Wer war es dann?“
„Keine Ahnung, ich weiß es nicht.“
„Wirklich nicht?“, fragte Jerome misstrauisch.
„Wenn ich es dir doch sage!“
„Na gut.“ Jerome war nicht restlos überzeugt. „Und wie kommen wir jetzt wieder von hier weg?“
„Lass die Dinge einfach auf dich zukommen. Entspann dich.“
Irmela schraubte wieder ihre Handgelenke in die Höhe. „Ná-na-na-ná-na-nanananana-ná …“
7
Die berühmte Wahrsagerin in Königswinter am Rhein drückt, nachdem Dr. Adenauer das Haus verlassen hat, ihre Zigarette im überquellenden Aschenbecher aus, erhebt sich aus dem Sessel und geht die paar Schritte hinüber zur Anrichte, einem dunklen Möbel aus der Gründerzeit. Sie nimmt die Fotografie mit der beinahe nackten, sich grotesk verrenkenden Tänzerin in die Hand und betrachtet sie lange.
„Das bin ich“, sagt die Wahrsagerin leise. „Das war ich.“
Sie stellt das Foto zurück, streift mit dem Blick kurz das Bild mit dem Baby im Kinderwagen aus Korbgeflecht und ergreift dann das Brustbild des jungen Mannes mit dem Monokel im rechten Auge.
„Hans”, murmelt sie.
Hans war Anfang der Zwanzigerjahre für ein paar Monate ihr Liebhaber gewesen. Ein haltloser, wilder Geselle, durch den Ersten Weltkrieg desorientiert und traumatisiert wie so viele seiner Generation. Nachdem auch die Freikorpszeit im Baltikum vorbei war, trieb er sich in Berlin herum, wo es zu dieser Zeit sehr unordentlich zuging.
Die Wahrsagerin betrachtet jetzt ein Bild, das etwas weiter hinten auf der Anrichte steht. Es zeigt das Innere eines Varieté-Lokals mit Tischchen, einer Tanzfläche und einer kleinen Bühne. Das Lokal ist leer, nur hinter dem Tresen stehen einige befrackte Kellner und Gigolos.
„Die Pony-Bar“, murmelt die Wahrsagerin. „Da war ich der Star. Die berühmte Anita B. Ah, da an der Bar ist ja auch der – wie hieß er noch gleich …“
Ein gewisser Hermann Göring, ehemaliger Jagdflieger, in der Pony-Bar als Eintänzer engagiert.
„‚Meine kleine Elfe‘ hat mich der Hermann immer genannt. Und neben ihm, da steht der Hans.“
Hans, der wilde Geselle aus dem Baltikum, der irgendwann in die Pony-Bar gespült worden war. Er kümmerte sich um die Cocktails.
Hermann mochte Hans nicht.
„Eigentlich merkwürdig, denn Hans war genau so ein Raubein wie er selbst. Aber irgendwie habe ich es auch verstanden.“
Denn sie hatte Hermann abblitzen lassen und etwas mit Hans angefangen. Hermann war sehr eifersüchtig, er platzte geradezu vor Eifersucht. Wenn er die kleine Elfe nicht besitzen durfte, dann durfte sie auch sonst niemand haben.
Die kleine Elfe wurde schwanger, bekam eine Tochter, verschwand kurz danach spurlos aus Berlin, und ließ das Baby bei seinem Erzeuger zurück.
Hermann und Hans vertrugen sich wieder.
Die Wahrsagerin nimmt das Bild mit dem Baby im Korbkinderwagen in die Hand und stellt es gleich wieder weg.
„Ich konnte es damals nicht. Ich musste gehen“, murmelt sie. „Verzeih mir.“
Sie zündet sich die nächste Senoussi an und vertieft sich wieder in ihre Kristallkugel.