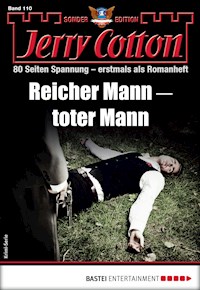
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Reicher Mann - toter Mann
"Nein!", schrie Clayton. "Nein ..." Sein Schrei erstarb in einem qualvollen Röcheln, als die Schlinge sich mit einem Ruck zuzog.
Einer der Männer, die ihn hielten, verknotete das andere Ende des Seils am Geländer der Brücke, auf die sie ihn geschleppt hatten.
Der Anführer trat an ihn heran. In seinen Augen tanzten die zuckenden Lichter des nahen Manhattan. "Reicher Mann - toter Mann!", sagte er. "Das ist unser Wahlspruch, da helfen dir all deine Millionen nicht!"
Er gab den anderen einen Wink. Sie packten Clayton, hievten ihn über das Brückengeländer und ließen ihn fallen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Reicher Mann – toter Mann
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: terrababy/iStockphoto
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8390-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Reicher Mann – toter Mann
»Nein!«, schrie Clayton. »Nein …«
Sein Schrei erstarb in einem qualvollen Röcheln, als sich die Schlinge mit einem Ruck zuzog.
Einer der Männer, die ihn hielten, verknotete das andere Ende des Seils am Geländer der Brücke, auf die sie ihn geschleppt hatten.
Der Anführer trat an ihn heran. In seinen Augen tanzten die zuckenden Lichter des nahen Manhattan. »Reicher Mann – toter Mann!«, sagte er. »Das ist unser Wahlspruch, da helfen dir all deine Millionen nicht!«
Er gab den anderen einen Wink. Sie packten Clayton, hievten ihn über das Brückengeländer und ließen ihn fallen.
Die Jerry Cotton Sonder-Edition bringt die Romane der Taschenbücher alle zwei Wochen in einer exklusiven Heftromanausgabe. Es ist eine Reise durch die Zeit der frühen Sechziger bis in das neue Jahrtausend.
Der Wagen wurde so abrupt gestoppt, dass auch die wundervollen weichgreifenden Bentley-Bremsen den Ruck kaum mildern konnten. Für Elton Clayton jr. hatte die harte Bremsung entsprechende Folgen. Er fühlte sich losgerissen von den üppigen Lippen Cynthias, hinauskatapultiert aus der Duftwolke ihres Körpers, und auch seine Hand, die er schon weit zwischen ihre Schenkel hinaufgeschoben hatte, verlor das eroberte Gelände. Fast schon im Zentrum seiner Wünsche, fegte er die halbvollen Sektgläser vom Tisch der Wagen-Bar.
Cynthia brach in Gelächter aus. Claytons feistes Gesicht mit dem Ausdruck törichter Überraschung, sein verschobener Smoking und die Sockenhalter, die unter den hochgerutschten Hosen zu sehen waren, reizten ihre Lachmuskeln.
Claytons Überraschung verwandelte sich in Wut. Ohne sich aufzurichten, riss er den Hörer des Autotelefons an sich.
»Jack, Sie Idiot! Warum bremsen Sie?«, schrie er den Fahrer jenseits der Trennwand an, vor deren Glaseinsatz die schweren Vorhänge gezogen waren.
Jack antwortete mit einem Seufzer – dem letzten seines Lebens.
***
Das Fenster der linken Tür zerbarst unter einem wuchtigen Kolbenstoß. Eine grau behandschuhte Hand griff durch die Öffnung, löste die Innenverriegelung. Die Tür wurde aufgerissen. Männer drangen in den Bentley ein wie in eine eroberte Festung. Clayton wurde hochgerissen und aus dem Wagen gezerrt. Cynthia begann zu kreischen. Eine Faust traf ihr Kinn und schickte sie in tiefe Bewusstlosigkeit.
Elton Clayton jr. wurde von zwei Männern zum Laderaum eines Transporters geschleift.
Auch die Türen des Fahrerraums standen offen. Die Innenbeleuchtung hatte sich automatisch eingeschaltet. Jack, Claytons Chauffeur und Leibwächter, lag über dem Steuer. Vor Entsetzen atemlos sah Clayton jr. den Griff eines Kampfmessers, das bis zum Heft in Jacks Nacken steckte.
Die Männer warfen Clayton in den Laderaum wie einen Sack Mehl. Er fiel aufs Gesicht und zerschlug sich die Nase. Sekunden später klatschte Cynthias regloser Körper neben ihn. Clayton wälzte sich zur Seite, weil er sie für tot hielt und vor der Berührung zurückscheute.
Der Motor des Transporters sprang an.
»Warte noch, Terrence!«, rief der Mann, der in der offenen Ladetür stand. Unter seiner linken Schulter hing die Maschinenpistole. Für einen Moment erblickte Clayton seinen Bentley, der aussah wie ein gestrandetes und ausgeraubtes Schiff. Der Mann mit der MPi holte einen länglichen Gegenstand aus der Tasche, führte ihn an den Mund, packte mit den Zähnen einen Ring und riss ihn heraus. Dann warf er den Gegenstand durch das zertrümmerte Fenster in den Fond des Bentleys.
»Und los!«, rief er.
Der Transporter setzte sich in Bewegung. Bevor der Mann die Ladetür schloss, hörte und sah Clayton die Explosion. Flammen schlugen aus dem Bentley.
***
Der Mann mit der Maschinenpistole schaltete die Innenbeleuchtung des Laderaums ein. Er musterte Clayton und nickte ihm zu.
»Hallo! Ich bin froh, dass wir den richtigen erwischt haben. Fünf Bentleys standen auf dem Parkplatz deines Clubs, und wir hatten vergessen, uns die Nummer geben zu lassen.«
Der gelassene Ton, in dem der Mann sprach, nahm Clayton etwas von seiner Angst. Er probierte ein Lächeln, das kläglich ausfiel. »Sie entführen mich?«, fragte er zögernd.
»So kann man es nennen.« Der Mann setzte sich auf den rechten Radkasten und holte ein Zigarettenpäckchen aus der Brusttasche seines Overalls. Er zündete sich eine an, ohne die grauen Handschuhe auszuziehen. »Scheußlich, wie es hier stinkt«, sagte er und stieß den Rauch aus. »Gewöhnlich wird der Wagen benutzt, um Fleisch- und Knochenabfälle einer Großschlachterei zu transportieren. Ich fand’s richtig, ein Auto zu nehmen, das von Berufs wegen schon blutverschmiert ist – falls es zwischen uns blutig geworden wäre.«
Er lachte, und Clayton lachte mit, obwohl ihm der kalte Angstschweiß über den Rücken lief.
Der zweite Mann im Laderaum beugte sich zu Cynthia hinunter, die auf dem Gesicht lag, und drehte sie auf den Rücken. »Guarda, che bella bambolina, Roberto!«, rief er. Wie der andere trug er einen Overall, aber mit kurzen Ärmeln, die seine muskulösen, behaarten Arme sehen ließen. Auch seine Hände waren mit Handschuhen geschützt.
»Großartig, aber wisch ihr die Schminke ab, und du wirst sehen, wie wenig an ihr echt ist.«
Cynthias Bewunderer packte ihr Abendkleid, zerfetzte es wie dünnes Papier, riss herunter, was sie darunter trug und wies auf die freigelegte Pracht. »Vedi, che niente è artificiale! – Alles echt!«
Der Mann begann, Cynthia zu bearbeiten. Sie kam zu sich.
»Sorg dafür, dass sie nicht schreit!«, befahl der Mann mit der Maschinenpistole. Der andere gab nur ein Grunzen zur Antwort.
Elton Clayton versuchte, nicht hinzusehen und nicht hinzuhören. Es fiel ihm nicht schwer. Er hatte in Cynthia zwar einige Dollars, aber nur wenig Gefühl investiert. Außerdem schien ihm sein eigenes Schicksal bedrohlich genug.
»Wie hoch haben Sie sich das Lösegeld gedacht?«, fragte er.
»Lösegeld? Darum geht es nicht. Wir wollen dein Geld nicht.«
»Sie wollen kein Geld? Warum haben Sie mich dann entführt?«
»Du musst genauer hinhören. Ich sagte, dass wir dein Geld nicht wollen. Anderer Leute Geld wollen wir durchaus.«
Cynthia stöhnte. Noch einmal zerriss Stoff. »Ti piace, eh?«, knurrte der Mann.
Clayton wischte sich mit zitternder Hand das Blut von der Nase. »Ich verstehe nicht«, stammelte er. »Wenn Sie mein Geld nicht wollen, haben Sie doch keinen Grund, mich zu entführen?«
»Wir werden dich umlegen.«
Der Satz betäubte Clayton wie ein Keulenhieb. Minutenlang war er unfähig zu sprechen, dann brach es aus ihm hervor: »Vielleicht wissen Sie nicht, wie reich ich bin. Mir gehören hundertvierzehn Lebensmittelläden in den USA und eine Kette von Tankstellen. Ich kann sehr schnell eine Million oder zwei flüssig machen. Schon morgen oder übermorgen können Sie im Besitz des Geldes sein. Es genügt, wenn Sie mir erlauben, meinen Bevollmächtigten anzurufen.«
Der Mann mit der Maschinenpistole schwieg. Clayton hörte, wie Cynthia nicht sehr laut »Nein, nein« sagte. Mit überkippender Stimme sprudelte er neue Wortkaskaden hervor.
»Alle kennen mich als zuverlässigen Geschäftspartner. Ich halte immer ein gegebenes Wort. Wenn wir uns auf ein oder zwei Millionen oder auch auf drei einigen, können Sie absolut sicher sein, dass Sie das Geld bekommen und dass die Polizei nicht das Geringste von unserer Begegnung erfährt …«
Der Mann mit der MPi hob einen Fuß und trat ihn vor die Brust. Clayton fiel nach hinten gegen die Beine des anderen, der wütend nach ihm ausschlug und Beschimpfungen schrie: »Bastardo! Imbecile!«
»Schrei nicht, Benito!«, zischte Claytons Gegenüber.
Clayton rutschte mit ungeschickten Bewegungen aus dem Bereich der harten Schuhsohlen. »Bitte, bringen Sie mich nicht um!«, japste er. Jeder Atemzug schmerzte. »Es wäre doch unsinnig. Ich kann viel zahlen. Sie wissen es!«
»Mag sein, mein Freund!« Der Mann spuckte die Zigarettenkippe aus und zertrat die Glut. »Es geht nicht darum, ob du zahlen willst und wie viel du zahlen kannst. Alle deine Freunde aus dem One Dollar Club sollen zahlen. Natürlich genügt es nicht, ihnen eine Rechnung zu schicken. Man muss ihnen auch deutlich vor Augen führen, was mit ihnen geschieht, wenn sie nicht zahlen. Wir wollen ja nicht nur einmal Geld, sondern eine lebenslange Rente. In Strömen soll das Geld aus dem One Dollar Club in unsere Taschen fließen. Du hast das Pech, als Demonstrationsobjekt ausgewählt worden zu sein.«
Der zweite Gangster gab Laute tiefster Zufriedenheit von sich. Gleich darauf stand er auf, zerrte sich den Overall zurecht und sagte: »Dammi una sigaretta, Roberto!« Geschickt fing er das Päckchen auf.
Clayton wunderte sich, dass er immer noch zu sprechen vermochte, obwohl er das Gefühl hatte, ein Ring aus eiskaltem Stahl schnüre seine Kehle ab.
»Nein, nein, Sie werden mich nicht umbringen, wenn ich prompt zahle. Schon in zwölf Stunden, sobald die Banken geöffnet haben, können Sie Millionär sein. Niemand ist so dumm, eine solche Chance auszuschlagen.« Er versuchte es mit einer verzweifelten Schmeichelei. »Sie haben nicht das Gesicht eines Mörders.«
Sein Entführer brach in schallendes Gelächter aus. »Sieht man mir den Killer nicht an? Vielleicht bist du nur blind, mein Junge. Ich habe eine Menge Leute gekannt, die besser sehen konnten als du. Natürlich kannst du keinen mehr fragen, weder die Nigger im Kongo und im Sudan, noch die aufsässigen Contadinos in Bolivien und Nicaragua. Sie alle fanden, dass ich dem Tod zum Verwechseln ähnlich sehen, und ich habe sie nicht enttäuscht.«
Der Transporter verlangsamte die Geschwindigkeit, rollte noch einige hundert Yards und blieb stehen.
»Wir sind angekommen!« Er nahm die Maschinenpistole von der Schulter und stieß Clayton an. »Steh auf!«
Er öffnete die Ladetür und sprang aus dem Wagen. Die Waffe im Anschlag wartete er.
Clayton taumelte hoch. Er stolperte zur Türöffnung. Seine Knie versagten ihm den Dienst. Er fiel aus dem Wagen, verletzte sich aber nicht, denn der Boden war weich – ein Grasgelände.
Er wurde hochgezerrt und vom Lauf der Maschinenpistole vorwärtsgestoßen. Kühle, frische Luft traf sein Gesicht. Er hörte das Rauschen von Bäumen. Die ziehenden Wolken gaben in Abständen den fast vollen Mond frei. Clayton sah sich nach allen Seiten um. Er glaubte, die Gegend zu kennen, und er schöpfte so etwas wie Trost aus diesem Glauben.
Die Maschinenpistole trieb ihn vorwärts, bis ihn ein brusthohes Eisengeländer stoppte. In der Ferne sah er einen riesigen, phosphoreszierenden Fleck. Clayton wusste, dass dieser Fleck Manhattan war, und er wusste jetzt auch, wo er sich befand: auf der Brücke von River Edge, einige Dutzend Meilen vom Zentrum Manhattans entfernt, vierzig Fuß über einem kleinen Fluss, der in den Hudson mündete, und nur eine halbe Stunde Fußweg vom Gelände des One Dollar Club entfernt.
Der zweite Mann, der im kurzärmeligen Overall, kam heran. Er trug ein aufgerolltes Seil in der Hand, schlang ein Ende um das Geländer der Brüstung und verknotete es. Dann näherte er sich Clayton.
»Halt still, amico!«, sagte er halb Englisch, halb Italienisch. Geschickt warf er ihm das andere Ende des Seils als Schlinge um den Hals. Als Clayton entsetzt die Hände hochwarf, war es schon zu spät. Die zugezogene Schlinge schloss sich eng um seine Kehle. Noch schnürte sie ihm nicht die Luft ab, aber Clayton krallte alle zehn Finger in den rauen Hanf und zerrte daran.
»Lass das!«, bellte der Italiener und schlug ihm auf die Arme.
Ein dritter Mann gesellte sich zu der Gruppe. Wie die anderen trug er einen Overall. »Vergesst das Plakat nicht!«, sagte er in einem näselnden, sehr unamerikanischen Englisch.
»Oh, verdammt!« Der Anführer machte mit seiner MPi eine Bewegung zu dem Transporter. »Hol es, Terrence!«
Clayton brach in die Knie.
»Bitte«, stammelte er. »Ihr werdet mich doch nicht wirklich … Es ist doch ein Scherz! Ihr wollt Geld! Ich gebe es, gebe alles … Macht doch keinen Unsinn! Ihr habt doch nichts davon, wenn ihr mich …«
Der Mann, der das näselnde Englisch sprach, kam zurück. Er trug ein kunstlos aus es Plakat Clayton um den Hals.
Clayton begann, um sich zu schlagen. Er schrie laut um Hilfe. Die Gangster packten ihn, rissen ihn hoch. Er versuchte zu kämpfen, sich zu wehren. Ein kalter, routinierter Fausthieb traf sein Kinn und stürzte ihn in eine halbe Bewusstlosigkeit, die seinem Widerstand alle Kraft nahm.
Sie hoben ihn hoch, hievten ihn über die Brüstung. Zwei Sekunden lang schwankte sein Körper auf dem schmalen Geländer. Dann stürzte er in die Dunkelheit. Als das Seil sich straffte, verursachte es einen Ton, ein dumpfes Summen wie die Saite eines riesigen Instrumentes – vielleicht wie eine Saite auf der großen Harfe des Todes.
***
Der Mann schlug mit der Faust auf den Besprechungstisch in John D. Highs Büro. Die Faust war knochig und dürr, und der Mann war alt, aber er schlug so wuchtig zu, dass das Eis in den Fruchtsaftdrinks klirrte.
»Zum Teufel, Sir!«, grollte er mit seiner polternden, rasselnden Stimme. »Ich verlange, dass Sie meinen Neffen auf der Stelle verhaften.« Er ließ die Faust zum zweiten Mal niedersausen, dieses Mal auf einen schmalen Aktenordner. »Hinter dieser Schweinerei steckt niemand anderes als mein Neffe Ryan Roel.«
Unser Chef blieb geduldig und sanft. »Mister Koester, Ihr Neffe hat vor gut fünfzehn Jahren die USA verlassen und …«
»Ich habe ihn aus dem Land getrieben!«, unterbrach der Alte triumphierend. »Er hat meiner besten Sekretärin ein Kind gemacht, die darüber derartig den Kopf verlor, dass sie vergaß, mich an zwei wichtige Termine zu erinnern. Ich hab die Teilnahme an einer Auktion und eine Verkaufsverhandlung für Baugelände verpasst, bei der ich eine Viertelmillion verdient hätte. Ich hab für Ryans Schäferstündchen mit einem riesigen Verlust gezahlt, und ich wage nicht auszurechnen, was mich jede Sekunde seines Spaßes gekostet hat.«
Phil bohrte mir den Ellbogen in die Rippen. Er genoss den Anblick dieses Prachtexemplars eines lederzähen, filzigen Erzkapitalisten, eines Typs, der seit des alten Rockefellers Zeiten ausgestorben schien.
William Koester schnaubte wütend. Ich glaube, niemand von uns hätte sich gewundert, wenn er Flammen geblasen hätte wie ein Drache.
»Ich hab Ryan klargemacht, dass ich ihn ruiniere, wenn er es wagt, noch einmal meinen Weg zu kreuzen. Ich hab ihn rausgeworfen – raus aus allen Firmen des Koester-Trusts, raus aus der Familie und schließlich raus aus den Staaten.«
»Seitdem lebt Ryan Roel in Europa, und ich glaube, er lebt nicht schlecht.«
»Natürlich lebt er nicht schlecht. Er ist immer noch Erbe des Koester-Trusts, und er verfügt über das Privatvermögen seiner Mutter, meiner verstorbenen Schwester. Er führt ein Playboy-Dasein, heiratet und lässt sich scheiden, wie es ihm gerade einfällt, wirft einen Haufen Geld für die verrücktesten Gebilde angeblich moderner Kunst raus und rast mit irren Schlitten durch die Gegend. In den Staaten habe ich die meisten Berichte über seinen Lebenswandel unterdrücken können, aber im alten Europa ist Ryan das bevorzugte Objekt der Klatschpresse. Ständig lässt er sich mit halb nackten Schauspielerinnen fotografieren.«
Mister High nahm das oberste Blatt aus dem Schnellhefter. Der Text war mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammengestellt. Mister High las vor: »Dein Steuersatz ist auf fünfzigtausend Dollar monatlich festgesetzt worden. Wir werden damit die Menschen unterstützen, die von den Vampiren des Kapitalismus ausgesaugt wurden. Wir sorgen für Gerechtigkeit und zapfen den Vampiren etwas von dem Saft wieder ab. Von dir – monatlich fünfzigtausend, nur ein paar Tropfen des Geldstroms, den du aus der Arbeit einiger Hunderttausend versklavter Menschen in deine Kassen leitest. Für deine Zahlungen haben wir das Konto 491212 bei der Parina-Bank in Quito, Ekuador, eingerichtet. Du bist mit deiner Steuer für drei Monate im Rückstand. Dies ist unsere letzte Mahnung. Denk an Elton Clayton junior! Wenn du nicht zahlst, werden wir nachsehen, ob in deinen Adern Blut oder Geld fließt. Die Anarchisten der Gruppe Sieben.« Mister High ließ das Blatt sinken. »Das hört sich nicht an, als wäre es von einem millionenschweren Playboy geschrieben.«
»Ich behaupte nicht, dass Ryan der Verfasser ist, aber ich bin sicher, dass er dahintersteckt. Er hat das Ganze angezettelt.«
»Wie viel Briefe dieser Art haben Sie erhalten?«
»Sieben oder acht im Laufe der letzten vier Monate. Die ersten habe ich einfach weggeworfen. Ich bin daran gewöhnt, alle nur denkbaren unsinnigen Schreiben in meiner Post zu finden, Bettelbriefe, Drohbriefe und sogar Heiratsanträge.«
»Warum kommen Sie jetzt zu uns?«
»Weil ich herausgefunden habe, dass eine gewisse Anzahl der Mitglieder des One Dollar Club Gelder auf geheimnisvolle Konten in Südamerika überweisen. Ich glaube, dass sie ähnliche Drohbriefe erhalten haben, obwohl niemand darüber spricht.«
»Außer Ihnen hat sich niemand an uns gewandt.«
»Sie haben die Hosen voll und zahlen lieber. Keiner von ihnen hat Elton Claytons Schicksal vergessen.«
»Sie denken aber nicht daran zu zahlen, Mister Koester?«
»Halten Sie mich für verkalkt, Sir?«, brüllte er Mister High an. »Ich wäre doch reif fürs Irrenhaus, wenn ich irgendwelche anarchistischen Verbrecher, die unsere Gesellschaftsordnung umstürzen wollen, durch Zahlungen unterstützen würde. Soll ich diese Typen ermutigen, aus unserem Land einen Bananenstaat zu machen, in dem kein ehrlicher Geschäftsmann mehr seines Lebens sicher ist?«
»Vorhin haben Sie behauptet, Ihr Neffe sei der Drahtzieher.«
»Für mich macht das keinen Unterschied«, schrie er laut und unlogisch. »Ryan wird so wenig einen Dollar von mir erhalten wie irgendwelche politischen Wirrköpfe.«
»Haben Sie Schutzmaßnahmen ergriffen, Mister Koester?«
»Genau das habe ich getan«, erklärte er grimmig, »und ich ließ es mich eine Summe kosten, mit der ich sechs Monate lang ihre alberne Steuer hätte bezahlen können. Ich habe meine Leibwache auf sechs Mann aufgestockt, alles Leute, die wissen, wie man mit solchen Burschen umspringen muss. Meine Villa ist gesichert wie Fort Knox, und ich habe einen Lincoln gekauft, der sich nur noch durch die Lackierung von einem Panzerwagen unterscheidet.«
Der schmächtige, grauhaarige Sekretär, der bis jetzt stumm und reglos hinter dem Sessel seines Chefs gestanden hatte, räusperte sich. Koester drehte den Geierschädel über die Schulter.
»Sir, Sie sind um zwei Uhr fünfzehn mit der Direktion der Western-Investions-Bank verabredet«, flüsterte der Sekretär.
Koester erhob sich, und wir alle, Mister High, Phil und ich, standen auf. Der Millionär – oder war er Milliardär? – schüttelte nur Mister High die Hand. Phil und mich bedachte er nicht einmal mit einem Kopfnicken. »Rufen Sie mich an, sobald Sie etwas herausgefunden haben!«
»Selbstverständlich! Darf ich Ihnen einen Rat geben, Mister Koester?«
Er gab einen Knurrlaut von sich, der alles bedeuten konnte. Mister High nahm ihn als ein »Ja«.
»Ändern Sie Ihre Gewohnheiten, Mister Koester! Tun Sie nichts regelmäßig! Verlassen Sie nicht immer zur gleichen Zeit Ihre Wohnung oder Ihr Büro! Benutzen Sie unterschiedliche Wege, wenn Sie Ihre Firmen aufsuchen!«
Einige Sekunden lang blickte der Konzernchef unseren Chef nachdenklich an.
»Ich verstehe, was Sie meinen«, sagte er, »aber ich werde Ihre Vorschläge nur sehr begrenzt berücksichtigen können. Ich bin an einen pünktlichen Tagesablauf gewöhnt, und ich hasse jede Art von Durcheinander. Halten Sie mich für ernstlich gefährdet?«
»Ja.«
Dieses nüchterne, trockene »Ja« ging auch dem alten Wallstreet-Krokodil unter die Lederhaut. Er schluckte ein paar Mal. Sein Adamsapfel stieg auf und ab. »Nun ja, aus diesem Grunde habe ich den gepanzerten Wagen gekauft und die Leibwächter engagiert. Wenn Sie Ihren Leuten mal richtig Dampf machen, brauche ich nicht noch mehr Geld in meine Sicherheit zu investieren. Die ist nämlich eigentlich Ihr Job, richtig?«
Er stampfte hinaus.
Mister High ging zum Schreibtisch, drückte den Knopf der Sprechanlage und ließ sich eine Verbindung mit dem Chef der Mordkommission der New Jersey State Police geben. Während er auf das Gespräch wartete, schaltete er die Freisprecheranlage des Telefons ein.
»Hallo, Captain Stafford«, sagte er, als er den New-Jersey-Beamten an der Strippe hatte. »Sie sprechen mit High vom FBI-Hauptquartier New York.«
»Hallo, Mister High. Was kann ich für Sie tun?«
»Vor einem halben Jahr hatten Sie einen Mord in Ihrem Revier, Captain. Die Opfer waren Elton Clayton junior, sein Chauffeur und seine Freundin Cynthia Sion.«
»Der River-Edge-Mord! Bis jetzt unaufgeklärt. Was wir auch unternommen haben, alles verlief im Sand.«
»Wollen Sie mir alle Unterlagen schicken, Captain?«
»Haben Sie eine neue Spur?«
»Ich weiß noch nicht, ob sich daraus eine lesbare Fährte entwickelt.«
Stafford versprach, alles zu schicken, und er beschwor Mister High, ihn über alle Fortschritte zu informieren.
»Sie erinnern sich an den Mord?«, fragte der Chef Phil und mich.
»Nur an einige Zeitungsüberschriften. Die Untersuchung lag in den Händen der New Jersey State Police, aber die Zeitungen haben den Fall wegen der sensationellen Umstände nach allen Seiten hin ausgewalzt.«
»Clayton war Millionär und verheiratet, aber nicht mit dem Mädchen, das mit ihm umgebracht wurde«, ergänzte Phil. »Das war für die Zeitungsschreiber zusätzlich ein gefundenes Fressen.«
»Es war ein Mord, der wie eine Hinrichtung aufgezogen wurde«, sagte Mister High. »Die Täter haben Claytons Luxusauto gestoppt, seinen Chauffeur getötet und den Wagen in Brand gesteckt. Dann haben sie Clayton zu einer Brücke in River Edge gebracht und ihn am Geländer aufgehängt. Cynthia Sion fand man in einem Gebüsch am Rand der Straße von River Edge nach New Milford, missbraucht und erschossen. Claytons Leiche hatten die Mörder ein Schild umgehängt mit den Worten: ›Tod allen Ausbeutern!‹«
Er ging zum Besprechungstisch und nahm den Brief mit dem Text aus Zeitungsbuchstaben auf. »Damals hat man an ein Verbrechen aus politischen Motiven geglaubt. Von Erpressung war keine Rede. Die Briefe an Koester liefern jetzt, sechs Monate später, so etwas wie ein nachträgliches Tatmotiv.«
»Sie halten die Verfasser der Briefe für Claytons Mörder?«
»Möglich, aber natürlich können es auch Leute sein, die sich einfach an den Clayton-Mord anhängen und Nutzen daraus ziehen wollen, Burschen, die das vielleicht wirklich politisch motivierte Verbrechen als Druckmittel für ihre Erpressungsversuche verwenden.«
Er legte den Brief zurück und wandte sich uns zu. »Da William Koester entschlossen ist, nicht einen Cent zu zahlen, lässt sich die Frage, ob die Briefschreiber und die Clayton-Mörder identisch sind, bald beantworten. Wenn die Gruppe, die Clayton ermordet hat, hinter dem Erpressungsversuch steht, wird sie innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Anschlag auf William Koester verüben, trotz Leibwache und gepanzertem Lincoln.«
Wir erhielten die Antwort schon vierundzwanzig Stunden später, genau die Antwort, die unser Chef vorausgesagt hatte. Sie verübten einen Anschlag auf William Koester. Mehr noch, sie brachten ihn um!
***
Auszug aus dem Bericht der »Daily New York News« vom 23. März.
Gestern fiel William Koester, Chef des Koester-Konzerns, einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer. Wie jeden Tag verließ Koester das Zentralbüro der Gesellschaft im 23. Stock des Koester-Buildings an der 4th Avenue pünktlich um ein Uhr, um sich zum Lunch in ein vegetarisches Restaurant am Irving Place zu begeben. Er benutzte den Privatlift, der nur ihm und seinen persönlichen Begleitern zur Verfügung steht. Im Innenhof bestieg er seinen Wagen, einen Lincoln IV. Außer ihm nahmen im Auto sein Fahrer, sein Sekretär, Ralph Hewitt und zwei Männer aus Koesters persönlicher Leibgarde Platz. Koester benutzte einen gepanzerten Wagen, der als absolut kugelsicher gilt. Als der Lincoln die Kreuzung der 4th Avenue mit der 14th Street passierte, wurde er von einem Geschoss getroffen, das, wie sich später herausstellte, vom Dach eines Eckhauses abgefeuert worden war. Das Geschoss, eine Bazooka-Panzerrohrgranate, durchschlug mühelos das zollstarke Stahldach des Wagens und explodierte im Inneren. Koester und der Chauffeur waren auf der Stelle tot. Der Sekretär und die beiden Leibwächter erlitten schwere Verletzungen, sodass für den Sekretär noch Lebensgefahr besteht. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.
***
Ich musste die Maschine in Paris wechseln und stieg in eine DC 9 der Swiss-Air um. Eine Stewardess brachte mir einen Stapel Zeitungen und erkundigte sich, was ich zu trinken wünschte. Selbstverständlich hatte sie mir englische und amerikanische Zeitungen gegeben, aber auf irgendeine Weise war eine deutsche Illustrierte dazwischengeraten. Im Inhaltsverzeichnis stieß ich auf den Namen des Mannes, den ich in Europa treffen wollte, aber außer dem Namen konnte ich nichts lesen.
Die Stewardess brachte den bestellten Whisky, feinen, uralten Scotch. »Würden Sie diesen Satz für mich übersetzen?« Ich wies auf die Zeilen mit dem Namen.
»Ryan Roels größte Sorge: Werden die Mädchen mich mit meinem vernarbten Gesicht noch mögen?«, las sie vor. »Seite zweiunddreißig.«
Ich schlug die Seite auf. Der Artikel war mit Fotos garniert, von denen das größte einen Mann mit verpflastertem Gesicht in einem bunten Schlafrock zeigte. Andere Bilder zeigten ein zertrümmertes rotes Auto und Ryan Roel unverpflastert in glücklicheren Tagen, auf Skiern, im Badehose, auf einem Pferd und nie ohne mehrere Mädchen.
Ich wies auf den leeren Erste-Klasse-Sitz neben mir. »Leisten Sie einen besonderen Kundendienst und übersetzen Sie mir diesen Artikel«, bat ich die Stewardess. Sie war hübsch, gut gewachsen und sprach Englisch mit einem leichten Akzent, der darauf schließen ließ, dass sie aus der Schweiz stammte.
»Oh, ich kann es nur tun, weil die Maschine nicht ausgebucht ist«, sagte sie und setzte sich.
Wir hielten die Illustrierte gemeinsam und steckten die Köpfe zusammen. Ich stellte fest, dass die Stewardess auch verdammt gut roch.
Sie las mir Ryan Roels schwachsinniges Geschwafel vor. Er machte eine große Sache daraus, dass er bei dem Unfall mit dem Leben davongekommen war, und schilderte, mit welcher Geistesgegenwart er Sekundenbruchteile vor dem Zusammenprall aus dem Wagen gesprungen war. Er bejammerte sein zerschrammtes Gesicht und ließ sich von der Interviewerin trösten, die ihm sagte, seine Augen hätten ihr dämonisches Feuer nicht verloren.
Dann wurde es etwas interessanter, als Ryan gefragt wurde, was er zur Ermordung seines Onkels zu sagen hätte.





























