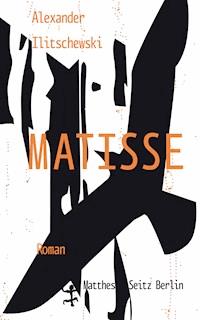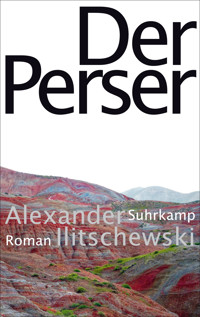Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jerusalem, heilige Stadt und Kampfplatz dreier Religionen, ein unbegreiflicher Ort: Klagemauer, Grabeskirche, Felsendom, Jaffator, Ölberg und steinerne Gassen, in denen die Geschichten ihrer Bewohner jeden Fremden, der sie betritt, in unendliche Verwirrung stürzen. In seinen dichten Reiseaufzeichnungen geht Alexander Ilitschewski der unermesslichen Vielschichtigkeit Jerusalems, der Stadt auf dem Vulkan, auf den Grund. Er lässt sich unmittelbar beeindrucken, beschreibt das Unbegreifliche, die Schönheit und Hässlichkeit dieser Stadt ›expressiv-impressionistisch‹ wie ein Jazzpianist und analysiert mit glasklarer Schärfe die Abgründe der Geschichte, die sich in der Stadt spiegeln und auf Schritt und Tritt fühlbar sind. Mit den Augen dieses ungewöhnlichen, kolossalen Schriftstellers wirft der Leser einen tiefen Blick in einen unbekannten Kosmos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Ilitschewski
Jerusalem
Stadt der untergehenden Sonne
Aus dem Russischen und mit Anmerkungen von Jennie Seitz und Friederike Meltendorf
Mauerspaziergänge
1.
Reiseliteratur ist ein unweigerlich unpräzises Genre, und darin liegt ihr Vorteil und ihre Schwäche. Die Schwäche besteht in der Nähe zum Objekt, gut beschrieben in der Redewendung: »Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.« Ihr Vorteil ist die verfremdende Distanz, dank der zum Beispiel Natascha Rostowa, die keinen Schimmer hatte, was da auf der Theaterbühne vor sich ging, das Wichtigste sah: den Pappmond, dessen Aufgehen den weiteren Verlauf des Romans bestimmen sollte – indem er sie dazu bewog, auf das Werben Kuragins einzugehen. Auf eine solche kindliche Wahrnehmung der Wirklichkeit, die einen Blick in das Wesen einer anderen Welt gewährt, kann ein Reisender nur hoffen, wenn er sich zu Orten aufmacht, deren Straßenschilder und Warenetiketten sich seinem Verständnis entziehen.
Mein liebstes Beispiel für die Kuriosität von Reisenotizen ist Lewis Carrolls Tagebuch seiner Reise durch Europa und Russland. In diesen Aufzeichnungen lassen sich, abgesehen von seiner besonderen Faszination für kleine Mädchen (Graf Golizyn konnte bis zuletzt nicht begreifen, warum es den englischen Schriftsteller so sehr nach einem Foto seiner Tochter in voller Größe gelüstete), ebenso Momente expressiver Treffsicherheit finden. Wenn Carroll beispielsweise die Berliner Synagoge besucht, liest sich das wie die Beschreibung einer Reise zu einem fremden Planeten; unter anderem hält er die goldenen Stickereien auf dem Tallit für Gebetsriemen. Dann wiederum bemerkt er, dass Spaziergänge durch Petersburg von weniger als fünfzehn Meilen wegen der enormen Entfernungen sinnlos sind: Es scheint, als ginge man durch eine Stadt, die von Riesen für Riesen erbaut worden ist. Carrolls Moskau ist eine Stadt aus Weiß mit grünen Dächern, mit vergoldeten Kuppeln und durch unüberwindliche Schlaglöcher verwüsteten Straßen; eine Stadt der Droschkenkutscher, die fordern, man möge ihnen ein Drittel draufschlagen, »weil heut die Kaiserin Geburtstag hat«. Nicht weniger meisterhaft hat der Autor von Alice den Jahrmarkt von Nischni Nowgorod und die dort Anwesenden beschrieben – seltsame Gestalten mit ungesunder Gesichtsfarbe in wehenden bunten Gewändern zwischen Persern und Chinesen; wer sie waren, werden wir nie erfahren, doch dafür werden wir uns immer an den Vergleich der Wehklage des Muezzins in der tatarischen Moschee mit dem Schrei der Unheil verkündenden Todesfee erinnern.
Jerusalem – mein Reiseziel – ist in geografischer und historischer Hinsicht derart vielschichtig und unerschöpflich, dass jeder Reisende, der dorthin gerät, unvermeidlich mit Verfremdung konfrontiert ist, er muss prinzipiell danebengreifen bei dem Versuch, seinem Gedächtnis die durch die Bewegung im Raum angestoßenen Facetten zu entlocken. Thelonious Monk erreichte durch ein clowneskes Spiel mit steif gespreizten Fingern jene virtuose Unschärfe, jenes »expressiv Impressionistische«, das bisweilen treffender ist als jede mimetische Beschreibung des Klassizismus. Doch dafür muss man eben Thelonious Monk sein.
2.
Bekanntlich beginnt ein Theaterbesuch mit der Parkplatzsuche. Und der eines Landes – mit der Schlange am Check-in. »In jeder Passagiermenge findet sich in aller Regel ein Jude mit Pejes und Kindern / schließe dich seinem Reigen an«, schrieb Brodsky in seinem Gedicht Einladung zur Reise.1 Und tatsächlich, zigmal überprüft bei Flügen in alle Himmelsrichtungen: Die richtige Schlange findet man, indem man nach einem breitkrempigen Hut mit Schläfenlocken darunter Ausschau hält.
Am Schalter von El Al bilden die Pilger ein eigenes Schlangenende. Ein akkurater junger Hochwürden mit protestantischem Bärtchen wie Trotzkis (der momentane Trend in der Auslandsabteilung der Russisch-Orthodoxen Kirche, die vor dem Ausland zivilisiert wirken will) und einem riesigen goldenen Kreuz an einer dicken und doch eleganten – den Türketten in den Häusern der Neureichen ähnlichen – goldenen Kette (Prunk für Schönheit zu halten ist eine byzantinische Eigenart). Ein schneeweißer Kragen, den eine Frau zurechtzupft, wahrscheinlich seine Mutter; sie tritt zur Seite und betrachtet ihren Schützling aus der Distanz, mit unverhohlener Genugtuung: So jung und schon so eine hohe Position, eine große Karriere liegt vor ihm. In Anton Tschechows Erzählung Der Bischof bekommt seine Eminenz Besuch von der Mutter, die ihn einschüchtert und die man nur ungern zu ihm lässt … Jedenfalls ist dieser junge Priester übertrieben wohlerzogen, das Kreuz übertrieben groß und die Kette maßlos.
3.
Am Flughafen Moskau-Domodedowo, vor den zwei geöffneten Büdchen der Passkontrolle, eine riesige Menschenmenge, wie auf den Bahnhöfen zu Zeiten des Bürgerkriegs. Ich stehe da und denke ungefähr: »Die Bipolarität Russlands: Dreifaltigkeit und Dreigespann. Rubljow und Gogol. Wir beten und stehlen. Tschechow schrieb, dass es für den russischen Menschen Gott entweder gibt, oder es gibt Ihn nicht; eine aufgeklärte Mitte ist unerreichbar.«
4.
Der junge Securitymann ruft mich zum Schalter und verschwindet selbst. Ich schaue mich um. Plötzlich ist er wieder da, wie aus dem Nichts.
»Wen suchen Sie da in der Menge?« – Fangfrage.
»Sie.«
Er lächelt, doch dann besinnt er sich auf die Anweisungen, das Gesicht wird streng.
»Kennen Sie jemanden in der Schlange? Warum haben Sie sich umgesehen?«
Nach und nach muss ich diesem gewissenhaften jungen Mann alles über mein Leben erzählen, über den Fonds Avi Chai, die Zeitschrift Lechaim, den Verlag Knischniki, darüber, wie mir meine Frau beim Kofferpacken geholfen hat, und worüber ich in Jerusalem schreiben will. Bis ich plötzlich das Gefühl habe, am Ende fliegt der noch mit – so gute Freunde sind wir geworden. Seine zwei Vorgesetzten, in anderer Uniform, durchbohren mit ihren Blicken derweil die Menge, mustern streng jeden Einzelnen. Und mir fällt wieder ein, wie ich vor zwanzig Jahren auf einem Schiff in den Hafen von Haifa einfuhr; bewegte See, die sich in der Bucht beruhigt; alle Passagiere an der Reling zusammengetrieben, damit die Leute vom Grenzschutz, mit einem Motorboot aus dem Hafen gekommen, sie gut sehen können. Jetzt, am Flughafen, spüre ich genau die gleichen durchdringenden Blicke auf mir wie von jenem Boot aus, das damals zwei, drei Runden um unser Schiff drehte. Kontrolle auf allen Ebenen – Aussehen, Verhalten, Herkunft usw. – ist die Gewähr für Sicherheit. Wenn man aus dem Haus geht, sieht man auch nach, ob Gas und Wasser abgedreht sind.
5.
Ich gehe zum Gate, wo das Flugzeug bereitsteht, und betrachte unauffällig die Menge; merke, wie das Auge auf jüdisch aussehenden Gesichtern ruht: Diese Gesichter vermitteln aus irgendeinem Grund Sicherheit; wahrscheinlich ist es das Gefühl der Zugehörigkeit – immerzu erinnert uns jemand an jemand anderen, wenn auch unbewusst … Ich trete ans Aussichtsfenster und beobachte die Flugzeuge auf dem Rollfeld. Ein bulliger, stämmiger Schlepper, der gerade eine Boeing 747, groß wie ein Schiff, von der Gangway gezogen hat, kriecht unten vorbei, auf seiner niedrigen Bordwand steht in riesigen Lettern: »EIMER ABSTELLEN VERBOTEN«.
Ein leerer Gepäckwagenzug kreist beim Wenden unter den Flugzeugflügeln wie ein Karussell, traurig: ein leeres Karussell im herbstlichen Park, verwaiste Pferdchen, Raketen, Tiere – ein Symbol für das sich dem Ende zuneigende Fest des Sommers …
Ein auffälliges Paar mit Kleinkind: Der junge Familienvater, ein bärtiger, schüchtern wirkender Schmächtling mit Brille, Käppi und Zizit, fügt sich den Kommandos einer Frau im Kopftuch, die ich erst für eine Pilgerin gehalten hatte. Sie ist herrisch und hat eine dezidierte Vorstellung davon, was aus dem Handgepäck rausund was drinbleiben soll; hinten auf dem Käppi des Mannes eine Känguru-Silhouette; der bezaubernde kleine Junge heißt Motja; mit dem spricht die Mutter nicht weniger herrisch und in demselben Vokabular wie mit ihrem Mann.
Vor dem Fenster kriecht eine Boeing 787 Dreamliner vorbei, bemalt mit Chochloma-Mustern in hellblauen anstatt der traditionellen schwarz-goldenen Töne. Plötzlich wird mir bewusst, dass die Eltern des kleinen Motja eine sehr spezielle Art haben, miteinander zu reden: Ihre Sprache ist die der Schrift und keine mündliche. Das nervt – wie alles, was bemüht wirkt. Das gesprochene Russisch lässt genügend Raum für Intellekt wie für Noblesse, was beides seit jeher das Unterpfand für eine klare, lebendige Sprache war und nicht für Verkniffenheit. Diese beiden hier drücken sich in geschraubten Wendungen aus, und darin spürt man den kleinbürgerlichen Wunsch, gebildet zu wirken, was der Rede die starre Bandage der Schriftlichkeit anlegt und die Sprache verknöchert. Das kann auch mit den Mühen der Zweisprachigkeit zusammenhängen – wenn das Gesagte zugleich der Übersetzung zugänglich sein will. Das Dolmetschen ist nicht bloß eine Kunst, sondern eine praktische Unmöglichkeit. Nicht umsonst kann man die großen Simultanübersetzer an einer Hand abzählen. Am Ende verlangt Motjas Mutter, dass der Vater den Kinderwagen zusammenklappt, und der schlägt sich dermaßen hilflos mit der Konstruktion herum, dass ich mich in der Hoffnung wiege, er sei doch nicht ihr Mann, sondern der jüngere Bruder.
6.
Die Entfernung zum Horizont beträgt in einer Höhe von elftausend Metern dreihundertfünfundsiebzig Kilometer. Unter dem Flügel kriecht die Schwarzmeerküste vorbei, scharf umrissen durch die vielen Lichter entlang der Uferlinie, und dann taucht die Küste Kleinasiens vor uns auf, üppiger und weitläufiger übersät von Licht.
Nachts aus dem Flugzeugfenster betrachtet, gleichen kleine Ortschaften phosphoreszierenden Spermien unterm Mikroskop: eine einzige beleuchtete Straße und ein Fleck locker hingestreuter leuchtender Fenster – ein Glühwürmchen mit Schwanz. Gut, wenn hinter jedem Fenster ein neues Leben seinen Anfang nimmt.
7.
Verwirrenderweise scheint es, als gäbe es am Flughafen von Tel Aviv weniger Juden als im Moskauer Bezirk Marjina Roschtscha. Das Auge ist an Kippas, Käppis, Hüte und Schläfenlocken dermaßen gewöhnt, dass es enttäuscht ist, wenn es sie nach der Landung nicht in ausreichender Menge vorfindet. Und es hängt sich mit Freude an die zerbrechliche Figur eines rothaarigen Jungen in Hut und bodenlangem Gehrock mit äußerst scharf umrissener fragiler Silhouette, schmalem Gesicht, umrahmt von zwei feuerroten, bei jedem Schritt hüpfenden Pejesspiralen, und jähen, abgehackten Armbewegungen, mit denen er zielstrebig durch die Ankunftshalle rudert.
8.
Gott wusste, wem er die Gebote übergab. Es wäre sinnlos gewesen, sie einem gewissenlosen Volk zu überlassen. Das Gewissen musste in dieser Gemeinschaft tief verankert sein, um so über Generationen hinweg das Befolgen der Vorschriften zu gewährleisten, die wiederum den Grundstein für Gewissenhaftigkeit legen. Und was ist Depressivität, wenn nicht Ausdruck des Gewissens – zumindest eine seiner Folgen? Darum ist die Psychoanalyse auch eine jüdische Erfindung.
9.
Ein alter Bahnhof in der Nähe von Jaffa. Von hier gelangte Agnon 1907 mit dem Zug nach Jerusalem. Kreosotgetränkte hölzerne Eisenbahnschwellen duften in der Sonne: ein Geruch aus der Kindheit; wo sind heute noch solcherart Eisenbahnschwellen aus Holz zu finden? In der Ferne schimmert das Meer, ausgeblichen von der Gluthitze, die Segel der Yachten darauf wie Kommas, ein schwarz-weißer Schiffskoloss im milchigen Dunst; auf dem Bahnhofsvorplatz wächst ein gigantischer Feigenbaum, in seiner Größe und der Pracht seiner Krone einem dreistöckigen Palast ähnlich. Darunter sind die Tischchen eines Restaurants aufgestellt, in der Ferne erklingt schmeichelnd ein orientalisches Saiteninstrument …
Erstaunlich, wie die Israelis trotz aller ethnischen Vielfalt durch das wunderbare Wachs des Judentums miteinander verbunden sind. Das kann man von Bürgern anderer Staaten nicht unbedingt behaupten. Wo finden sich andere Beispiele eines solch informelltiefgreifenden, vereinigenden Prinzips? Ein Staat funktioniert als strukturgebender Faktor ganz gut, aber das Judentum ist eine sehr viel mächtigere und heißere Quelle für ein Schmelzfeuer – das Feuer, das eine Nation begründet und formt. Das Judentum ließe sich wunderbar in einen alle verbindenden anarchistischen Wesenskern verwandeln, der jene kluge Union aus autonomen Persönlichkeiten ermöglichte, von der Kropotkin und Bakunin träumten. Ist der Aufbau des israelischen Staates nicht deshalb so reich an horizontalen Verbindungen, die es möglich machen, einen beliebten Premierminister ohne Weiteres vor Gericht zu bringen?
Wie kann man den Israelis vorwerfen, beim Aufbau des Staates würden sie von Nationalismus geleitet, wenn es einen solch schlagenden Gegenbeweis gibt wie die Operation Solomon: 1991 waren binnen 36 Stunden 18 000 Flüchtlinge aus Äthiopien nach Israel evakuiert worden. Meines Erachtens sind es wohl einzig die USA, die heute noch versuchen, eine neue nationale Synthese heranzuzüchten – die Nationalität des »Amerikaners«.
Joseph Brodsky schrieb: »Und antworte, wenn einer dich fragt: ›wer bist du?‹ / ganz einfach ›ich bin – Niemand‹, wie dem Polyphem einst Odysseus.«2
Im Leben beantwortete der Dichter diese Frage mit größerer Entschiedenheit: »Ich bin Jude.« Und das nicht nur, weil seine geliebte Marina Zwetajewa der Ansicht war, alle Dichter seien Juden.
2007 wurde auf dem Jerusalemer Herzlberg ein Denkmal für die viertausend äthiopischen Flüchtlinge errichtet, die auf dem Weg nach Israel umgekommen waren.
10.
Die Kinder sind eine Augenweide. Das klingt vielleicht hart, aber in einem Land verrät das äußere Erscheinungsbild der Kinder mehr über Gesellschaft und Eltern als diese selbst. Soziale Benachteiligung und Missstände in der Kinderheilkunde erkennt man mit bloßem Auge.
Über dem Strand kreist ein Hubschrauber, zwei-, dreimal fegt ein Flugzeug der U-Boot-Abwehr über das Meer hinweg. Ein extravaganter Lockenkopf mit Strohhut, dickem Bauch und buntem Blumensträußchen spaziert kokett am Ufer entlang. »Hallo, ich bin Ihre Tante!«3
Der amerikanischen Botschaft mit Zugbrücke am Eingang fehlt nur noch der Burggraben.
Sonne und stilles morgendliches Meer.
11.
Und dann freut man sich an den Frauengesichtern: orientalische, scharfe Züge, dichte und schmale hohe Brauen über riesigen Augen. Schönheit vermittelt Sicherheit; daher das wohlige Gefühl auf den Plätzen der Stadt: Auge und Hirn entspannen. In Moskau vermittelt fast jedes Gesicht Gleichgültigkeit oder Furcht.
Freitagabend. Jabotinsky-Straße in Ramat Gan. Ein Glatzkopf in grünen Shorts und ausgeleiertem Unterhemd gerät im Laufschritt beinah unter die Räder. Der Stoßstange knapp entkommen, stürzt er sich auf den Fahrer, der sich demütig die Vorwürfe seines Beinaheopfers anhört. Ein Junge und sein Vater, in Festtagskleidung auf dem Weg zur Synagoge, mustern den Jogger von oben herab.
In Kalifornien schrillen die Ampeln, wenn sie auf Grün schalten, und signalisieren damit den Blinden, dass sie nun über die Straße dürfen. In Tel Aviv knattern die Ampeln unentwegt wie gigantische Grillen, nur der Rhythmus wird schneller, wenn sie grün aufleuchten.
Die Fischrestaurants an der Hafenpromenade verströmen strengen Jodgeruch. Vor einem hantiert ein Jongleur mit sieben Kautschukbällen; die Erwachsenen sind nicht weniger begeistert als ihre Kinder. »Zwölf Jahre hartes Training«, sagt der dürre lockenköpfige Artist, und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, wie schwierig das ist: Als Kind habe ich nach Wladislaw Tretjaks Torwarttrainigs-methoden zur Steigerung des Koordinationsvermögens haufenweise Tennisbälle gegen die Wand geschleudert.
Am Saum der Brandung fädelt ein Fischer einen riesigen sich windenden Wattwurm auf einen Haken; oben leuchtet phosphoreszierend die Spitze seiner Angelrute.
Auf der Promenade bewegt ein dicker Mann verstohlen den Joystick eines ferngesteuerten Spielzeugautos, das von selbst zu fahren scheint. Angepasst an das Tempo der Menschenmenge und die entgegenkommenden Hindernisse, gleicht es einem riesigen intelligenten Insekt. Die ganze Promenade ist wie ein Schiffsdeck mit Holzplanken ausgelegt; Kinder auf Inlineskates und Rollern, Hinfallen tut nicht weh. Auf den Gesichtern ihrer Eltern eine nie gesehene Vitalität: Sie sind Herr über ihr Leben – im eigenen Land, in der eigenen Zeit; nicht ein Fünkchen Selbstzufriedenheit, nur vollkommene Entspanntheit.
Der frische Geruch des Meeres und die Gischt der an den Felsen zerberstenden Wellen. Nachts ist das Meer besonders archaisch. Seit vielen tausend Jahren unterscheidet es sich nicht von dem, das wir heute sehen. Dasselbe sah schon Jonah, ganz in der Nähe, an den Stränden von Jaffa, auf seinem Weg in das Innere des Wals.
12.
Weißer Oleander auf dem Mittelstreifen der Chaussee ist Vorbote des weißen Gesteins der Stadt. An den Hängen die Schrägen der Stützmauern. Der Aufstieg verursacht Druck auf den Ohren.
Über Jahrtausende strebten Generationen nach Jerusalem. Der Traum ist Wirklichkeit geworden.
Der Friedhof am Hang gleicht einem Bienengarten, wie es sie zuhauf in den Bergen von Armenien gibt; die Steingräber sind die feierlichen Bienenstöcke.
Das Licht rinnt herab an Jerusalem, der Sabbat geht zu Ende. Über den Hügeln verdichtet sich die Dämmerung. Kinderstimmen sind zu hören. Aus der Synagoge dringt erhabener Gesang.
Nachts erschrickst du vor zwei dunklen Gestalten unter einem Baum. Zwei junge Männer stehen da und wiegen sich leicht vor und zurück, während sie zum Mond beten, der als dünne Sichel dicht über der Böschung hängt.
Der Jerusalem-Stein ist ein Mondstein: Im Licht des Mondes wirkt er gespenstisch; dann scheint es, als wäre nichts um dich herum wirklich da.
13.
In Agnons Ido und Enam erklingt eine besonders diachrone Darstellung des Heiligen Landes. Im Erzählstrom lagern verschiedene Zeitschichten übereinander, sodass der Eindruck von einer Gleichzeitigkeit vieler Epochen an diesem konkreten Ort entsteht. Das verleiht dem Heiligen Land ein metaphysisches Gefühl von Durchsichtigkeit, um das es später gehen wird. Der Autor und seine Freunde waren lange Zeit gezwungen, in Europa zu leben. Der alte Gelehrte Gerhard, um dessen Haus sich das Alter Ego des Autors kümmert, verlässt das Heilige Land für eine lange Zeit. Agnon selbst verlor zweimal sein ganzes Vermögen. Im Zuge der Pogrome von 1929 wurde sein Haus geplündert. Der Schriftsteller musste nicht verreisen, um die punktierte Zerbrechlichkeit des Seins zu spüren, um sich nicht mit Bindungen zu belasten und stets auf einen Wechsel des Wohnortes vorbereitet zu sein. Er abonnierte nicht einmal Zeitungen, sondern lieh sie sich zum Lesen von einem Nachbarn.
Indem zwischen meinen Reisen mehrere Jahrzehnte verstrichen waren, wurde mir klar, dass in Israel anzukommen ist, als würde man aus dem Abgrund der Zeitlosigkeit an Bord des Schiffes Zeit steigen und sich umschauen, in dem Versuch, an den Sternen festzumachen, wo genau im Ozean sich in diesem Moment nicht das Schiff, sondern die Epoche selbst befindet.
Das Gelobte Land war immer, und ist es heute besonders, ein Land der Pilger; die Reisen hierher haben in vielen Kulturen Spuren hinterlassen. Die Juden kamen nicht von hier, sie kamen hierher; im Prinzip ist der Großteil des Tanach ein Reisebericht, der mit den Worten: »Lech Lecha« – »Gehe hinweg!« beginnt und sich der Erforschung von Sehnsucht, Erlangung, Vertreibung und Heimkehr widmet. Agnons großer Roman Gestern, Vorgestern ist einer der bedeutendsten Reiseromane der Weltliteratur, gleich neben Kafkas Amerika und den Abenteuern des Huckleberry Finn.
14.
Ich habe mich in einem Bezirk niedergelassen, in dem auf den Straßen mehr Englisch zu hören ist als Hebräisch. Von dem steil aufragenden Hang aus sieht man die Knesset mit der wehenden Flagge obenauf, über die Hügel verstreute weiße Steinhäuser und viel Himmel. Früher waren hier, an diesem Hang, auf dessen oberster Ebene die Ussischkin-Straße verläuft, über viele Jahrzehnte die Kreativen angesiedelt – Schriftsteller, Dichter, Maler. Eine Art Montmartre, bloß gepflegter, ohne verarmte Boheme; noch heute findet man hier und dort ein bescheidenes Café, das von einem Schriftsteller betrieben wird – etwas in Russland schier Undenkbares. Doch die Zeiten haben sich geändert, in den letzten Jahren werden die Häuser in dieser Gegend zunehmend von reichen Amerikanern aufgekauft und saniert, die dann nur über die Herbstfeiertage nach Jerusalem kommen und sie für den Rest des Jahres leer und verschlossen lassen. Es ist der Abend vor Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, und es wimmelt vor fahrradfahrenden Jungs, die auf Englisch darum wetteifern, sich die Handlung des neuesten Teils von Fluch der Karibik zu erzählen.
Der Kiryat-Wolfson-Komplex – hier wohne ich – grenzt an Rehavia, einen Stadtteil im Bauhausstil, entworfen 1922 von Richard Kauffmann. Dieser Bezirk sieht aus wie eine typische Jerusalemer Vorstadt: Häuser mit Rundbalkonen und schmalen Fenstern, umgeben von Gärten hinter gusseisernen Gitterzäunen. Ursprünglich war Rehavia von deutschen Migranten bewohnt, weswegen es in den 1920er Jahren als »preußische Insel im Meer des Orients« bezeichnet wurde. Hier lebten viele führende Köpfe des jüdischen Jischuw (Arthur Ruppin, Dov Yosef, Menachem Ussischkin, Golda Meir) und, für mich der Wichtigste, Gershom Scholem. Auch die vielen Kaffeehäuser in Rehavia sind diesem »preußischen« Erbe geschuldet – der deutschen Tradition des Nachmittagskaffees. Nach dem Besuch eines Kaffeehauses kann man wunderbar durch die dicht mit bunter Vegetation bewachsenen Gassen des Viertels streifen und dann auf einer Bank am Jason-Grab entspannen. Hier, bei der Ruhestätte des wohlhabenden Jerusalemers, erbaut unter der Herrschaft der Hasmonäer im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit und ausgegraben 1956, ist ein lauschiger Park angelegt. Mitten in den dunklen Tiefen Jerusalems, an einer der Schrägen, die sich in sein Innerstes hinein öffnen, duftet es nach Nadelgehölz …
15.
Ich trete unter dem Grollen eines Kampfjets über dem Regierungsviertel auf die Straße – ein Gefühl wie in der Kindheit, als über dem Moskauer Umland noch Militärflugzeuge den Himmel durchfurchten, damals, als es in Moskau noch drei Luftwehrkreise gab. Mit Rückstoßtriebwerken ertönt die Stimme des Himmels, furchterregend und schützend zugleich.
Als ich die Altstadt betrete, verliert das GPS die Satellitenverbindung: Die zu engen Gassen schirmen den Navigationshorizont ab – du betrittst sie und bist sofort verloren. Wie sollte es auch anders sein an einem Ort mit einer solchen Konzentration von Zeit und Ereignissen.
An den Wänden des Armenischen Viertels Plakate, die sich dem Genozid widmen. Eine Umrisskarte mit den türkischen Kriegsführungsplänen, Fotos: abgehackte Köpfe an Haken, darunter posierende Janitscharen, Berge von Leichen, halbverhungerte Kinder. Eine ausgegrabene Straße aus den Zeiten des Großen Herodes tut sich plötzlich unter deinen Füßen auf. Deshalb scheint Jerusalem fast durchsichtig: Die Straßen sind wie mit dickem Vergrößerungsglas gepflastert. Jerusalem lässt sich nicht idealisieren. Das Leben lässt sich nicht verleugnen. Man kann nur das Alltägliche vom Heiligen trennen.
16.
In den Supermärkten sprechen die Damen an der Kasse oft Russisch. Vor mir sitzt eine typische Vertreterin, über fünfzig, schlechte Dauerwelle, flammend roter Lippenstift ziert den schmalen Mund. Sie schmeißt meine Einkäufe wütend von einer Seite auf die andere, aber ihre Miene verändert sich sofort, als sie merkt, dass ich auf Hebräisch nicht bis drei zählen kann.
»Und, wie geht’s dort?«
»Es geht.«
»Eigenes Business?«
»Nein.«
»Wie leben Sie denn ohne eigenes Business?«
»Ich habe zwar kein Business, aber genug zu tun.«
»Aha … Aber, ich bitte Sie, was nützt denn Ihr ›Tun‹, wenn es kein Business ist? Das ist doch die reinste Plackerei.«
»Ja, die reinste Plackerei.«
Meine Anwesenheit bereitet der Kassiererin offensichtlich Kopfzerbrechen, sie grübelt krampfhaft nach und fragt dann eher sich selbst:
»Nein, also wie kann man da leben, wenn in einem Jahr acht Flugzeuge abgestürzt sind?!«
»Ja, das ist viel.«
»Viel ist gar kein Ausdruck! Ich bin aus Leningrad, wir sind alle weg, vor drei Jahren habe ich zum ersten Mal seit zwanzig Jahren eine Freundin besucht. Dieser Service, die Bedienung! Nie wieder, hab ich mir gesagt! Nein, ich verstehe das nicht. Wie halten Sie es dort bloß aus?«
17.
Was braucht jemand, der in warmem Klima, umgeben von Oleander aufgewachsen ist? Bei Tee und Keksen sitzt man im üppigen Garten, betrachtet den Sonnenuntergang, der sich über die hügelige Stadt legt. Jerusalem, die Stadt des Weißen Löwen, duftet hier und dort nach unsichtbaren Hyazinthen. Über den Tag aufgeheizt, atmen die weißen Steine bei Dunkelheit Wärme, die man sehen kann.
In einem Zeltstädtchen hinter dem Friedhof von Mamilla brennen in bunten Röhrchen Kerzen, an Zweige gebundene Plakate schaukeln im Wind. Beim Anblick der Zelte stelle ich mir nicht die Frage, wogegen hier protestiert wird; aber offenbar geht es um die hohen Lebenskosten (zu Recht, denn in Israel verspürt man beim Blick auf den Kassenbon im Supermarkt oder Restaurant nicht dieselbe Erleichterung, wie wenn man von Moskau nach Kalifornien reist). Sollte ich jemals obdachlos werden, denke ich, dann im Winter in Tel Aviv und den Sommer über in Jerusalem – von Zeit zu Zeit an die Küste wandern, Wäsche waschen und baden. Und dann erinnere ich mich an die beiden Englisch sprechenden Penner, die ich eines Morgens nahe der Ben Jehuda, der Touristenstraße, dabei beobachtet habe, wie sie sich aggressiv Kleingeld fürs Konterbier zusammenschnorrten.
Phantasmagorische, an Pfählen montierte Umspannstationen erinnern an Tannenbäume auf Moskauer Plätzen zur Neujahrszeit: abgeschirmt mit spitzen Wellblechen und drohenden Warnhinweisen – ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem gegen neugierige Jungs.
18.
In einem Café im Touristenviertel Mamilla, beim Jaffator, hat eine nervöse alte Dame ihren bockigen Enkel nicht im Griff: Ihre hellen Hosen sind hinten mit Tintengekrakel vollgeschmiert.
Es gibt ein geheimes Buch aus Stein – die Chroniken der Jerusalemer Mauern: Sie sind übersät mit sinnerfüllten Einkerbungen; ich gehe durch die Altstadt und betrachte aufmerksam die seltsamen Keilschriftzeichen, hinterlassen von denen, die diese Mauern erstürmt, verteidigt oder bei ihnen Schutz gesucht haben.
Ein kleiner Park am Steilhang über Gehinnom – dem Hinnom-Tal. Ein Schnaps ausdünstender Araber, in der Hand eine Flasche Arrak, pöbelt mit Bassstimme eine Gruppe von Schülern an. Die witzeln herum, aber halten sich lieber fern.
Auf Arabisch heißt Gehinnom »Dschahannam« – ein aus den Turksprachen bekanntes Schimpfwort, das einen in den Hinterhöfen im Baku meiner Kindheit in ernsthafte Schwierigkeiten bringen konnte.
Warmer Wind berührt die Zwergthujen und robuste, von kleinen Blüten übersäte Sträucher mit duftenden harzigen Blättern. Auf diesem Grün sind schon Kreuzritter, Römer und Babylonier herumgetrampelt. All das ist viel zu klein im Verhältnis zu Gott, und doch entspricht es Ihm genau. Gnaeus Pompeius Magnus betrat das Allerheiligste und sah nichts. Nicht für jeden ist Jerusalem von Gott erfüllt. Nicht für jeden bringt Er es zum Glühen. Nichts ist einfacher, als in dieser Stadt einen Haufen steiler Hänge und verstreuter Steine zu sehen. Aber auch der Mensch ist – auf den ersten Blick – nichts als Fleisch und Knochen; es erfordert harte Arbeit, an seinen göttlichen Ursprung zu glauben.
19.
Lichtflüsse strömen in der Dunkelheit die Stufen der Stadt hinab. Wütend rauscht die Chaussee entlang des Gehinnom: Steigungen und Ampeln lassen Busse und Lastwagen hochtourig aufheulen.
Ein griechischer Geistlicher mit Brille und grauem Bart geht nachdenklich den griechischen Friedhof ab. Unter den erleuchteten Fenstern einer Herberge, auf deren Dach die britische Flagge weht, ein Garten mit Serpentinenweg und Rosmarinbüschen. Die Mauern sind von Flutlichtern angestrahlt, in der Ferne ragt der Davidsturm wie eine Kommandobrücke zwischen Schattensegeln auf.
In Mamilla, im Öffnungswinkel des steinernen Amphitheaters, tanzen alte und nicht so alte Jerusalemer zu orientalischen Klängen im Reigen.
Bald ist es vollkommen dunkel, und die Stadt strebt hinauf in feurig leuchtenden Fäden, die sich die Hügel entlang in die Höhe winden.
20.
Jerusalems Straßen sind im Grunde angeordnet wie ein Fächer mit Bögen: Von fern betrachtet verlaufen sie in Richtung Altstadt, von Nahem erschließen sie die Terrassen der hügeligen Landschaft. Die Stäbe des Fächers (die großen sind die Straße nach Gaza, die Agrippas- und die Jaffa-Straße, die kleinen zum Beispiel Keren Kayemeth, Bezalel und Ramban) überbrücken die Entfernung zum Tempel oder die Höhenunterschiede zwischen den Ebenen; die Bögen (einer der großen ist die King George, einer der kleinsten die Menachem Ussischkin) überspannen die gesamte Oberfläche der Terrasse – das Relief Jerusalems und seiner Vororte ist stufenförmig, mit zahlreichen Tälern, Engen, Schluchten und Plateaus. Eine großartige und seltene Topologie: Heute folgt man einem der Bögen, wechselt irgendwann auf einen der Stäbe und landet am Jaffator; am nächsten Tag läuft man auf demselben Bogen in die entgegengesetzte Richtung, gleitet unbemerkt einen anderen Stab hinab und kommt wieder an derselben Stelle heraus, am Davidsturm – dort, wo der Held aus Bunins Erzählung Frühling [in Judäa] sich eine Ziegenkäsehändlerin angelacht und dafür eine Beduinenkugel kassiert hat, die ihn sein Leben lang hinken ließ.
Es entsteht der Eindruck, man bewege sich auf der Oberfläche einer Sphäre. Egal, ob du nach links oder rechts, rauf oder runter gehst – du fällst sowieso wieder ins Zentrum: an eines der Stadttore, hinter denen der Raum in seiner tunnelartigen Verdichtung dann völlig verschwindet. Die Altstadt ist keine Sphäre, sondern eine Kugel, in der man auf und ab wandert – von der Klagemauer hinauf in die Oberstadt, durch archäologische Ausgrabungsschächte und überwölbte Passagen hindurch, über Straßen, die sich winden und kreuzen; auch zusammenhängende Routen über die Landschaft aus Dächern gibt es – ein besonders vergnüglicher und nicht allen zugänglicher Sport: Auf diese Weise bewegen sich manche Militärpatrouillen durch die Stadt. So ist der Körper in Jerusalem einer Bewegung innerhalb der Sphäre ausgesetzt, mit der Kugel des Tempels an einem ihrer Pole – wobei unklar ist, an welchem genau: dem oberen oder unteren, und deshalb scheint es, als käme an irgendeiner Stelle die Möbiusschleife ins Spiel. Jerusalem ist folglich die Sphärenoberfläche, die sich gleich Blütenblättern in komplizierter Weise um die Kugel des Tempels legt, zu dem sie hier und dort Eingänge gewährt. Woran erinnert uns das alles? Selbstverständlich, mit an Homöomorphismus grenzender Genauigkeit an die Topologie des literarischen Raums in Dantes Göttlicher Komödie, mit unbedingtem Verweis auf Florenskis Imaginäre Größen in der Geometrie. Das verstand ich, als ich gestern durch das Armenische Viertel zur Westmauer kam und dann durch den 1976 ausgegrabenen Nordgang zur Oberstadt wieder zum Jaffator tauchte. Bleibt nur noch, diesen besonderen Umkehrpunkt zu finden, an dem Dante und Vergil, der Topologie des Möbiusbandes folgend, sowohl mit den Füßen nach oben als auch nach unten stehen konnten, je nach Bewegungsbahn. Diese Art Topologie – wenn der Raum in viele enge Falten gelegt ist, wenn es darin keine einzige Kathete gibt und alles von Hypotenusen durchzogen ist, wenn es von undurchdringlichen Labyrinthen wimmelt, die die Zeit darin verdichten,– kenne ich von den Durchgangshöfen meiner Kindheit. Ein Kind macht kleinere Schritte als ein Erwachsener, es muss sich mehr anstrengen, um mit dem Erwachsenentempo mitzuhalten. Und darum mochte ich alle denkbaren Schritteinsparmethoden – Fahrten im Taxi und jene Durchgangshöfe, die geheimnisvolle Teleportationsmaschinen zu sein schienen. Es kam einem Wunder gleich: Im Wissen, dass ein weiter, schnurgerader Weg im offenen Raum vor uns lag, lief ich meinem Vater hinterher, und plötzlich tauchten wir in irgendeine nur ihm bekannte Durchgangshypotenuse. Der Raum der Innenhöfe ist spannender als der Raum der Fassaden, dort hat das Auge zu tun: Vorgärten, Veranden, Kinderspielplätze, das Leben hinter den Fenstern und auf den Balkonen bietet Ablenkung, und ehe du dich versiehst, bist du schon am anderen Ende der Stadt wieder aufgetaucht. In Jerusalem kann man jede Menge solcher Teleportationen unternehmen – sobald man durch die Sphäre in die Kugel gefallen ist. Und erinnert diese Sphäre aus weißem Stein, durchdrungen vom Licht der untergehenden Sonne, das Geheimnis der Kugel darin eingebettet, etwa nicht an eine Lotosblume?
21.
Ein metaphysisches Modell von Jerusalem könnte Dantes Topologie folgen und mit seinem Reichtum an geistigen Ebenen ein Amphitheater mit vielen vielen Rängen bilden, das eine Menge von Blickwinkeln beherbergt und unserer Hypothese von Jerusalem als einer Sphäre mit der Altstadt als Kugel an einem ihrer beiden Pole Gewicht verleiht. In der Vorstellung von ebendieser Dualität der Pole ist der himmlische Tempel vor den Ruinen des irdischen Tempels noch erhalten, der in der Realität wiederauferstehen muss.
Eines Abends nahm ich von Rehavia aus die Straße nach Gaza, dann die Keren Ha-Yesod Richtung Zeev-Jabotinsky-Straße und Jemin Mosche, wo die Mühle des Montefiore steht, dem Begründer des ersten Stadtteils außerhalb der Altstadtmauern, wo einst in einem kleinen Hotel der Autor der großartigen, Faulkners Der Bär in nichts nachstehender Erzählung Damit du dich an mich erinnerst wohnte: Ein paar Tage lang hatte Saul Bellow, wenn er morgens die Zimmertür öffnete, links das Jaffator gesehen und rechts in der Ferne jenen Hang, den man heute, vorbei am Menachem Begin Museum und der Kirche von Schottland, in den Wolfson Park hinabsteigen kann, zur Kinemathek, deren Postadresse das Wort Gehenna enthält. Genau das tat ich, doch zuvor hielt ich auf der kleinen Fußgängerbrücke über der Straße nach Hebron inne. Ich stand da und dachte, dass die an mir vorbeilaufenden Menschen wahrscheinlich nicht das sehen, was ich sehe, denn sonst würden sie erstarren und sich lange, mit angehaltenem Atem nicht vom Fleck rühren. Hinter mir tauchte der Sonnenuntergang die mit stiller Flamme glimmenden Steine Jerusalems in immer sattere Töne. Vor mir im Osten leuchtete im graublauen Nebel von innen heraus die Stadt, verstreut über zwei Berge. Hier und da funkelten schon brillanten und perlengleich die Lichter. Und hinter diesen Bergen, hinter der Stadt, war nichts als blauer Himmel. Nie zuvor hatte ich etwas Derartiges gesehen. Selbst am Ufer eines Meeres oder eines Ozeans stehend, hatte ich nie dieses das Kleinhirn durchbohrende Gefühl, ich befände mich gerade am Ende der Welt. Erst schien mir, als läge dort, hinter dem östlichen Teil der Stadt, in einer von Nebeldunst und der einbrechenden Dunkelheit verhangenen Ferne, das Meer. Und so ist es auch: Von den höchsten Türmen der Altstadt aus kann man bei besonders klarem Wetter das Tote Meer erkennen. Der Eindruck, gleich östlich hinter Jerusalem eröffne sich das All, ist leicht zu erklären, was jedoch seine – des Eindrucks – Erhabenheit keineswegs schmälert: Gleich hinter der Stadt beginnt die Wüste Juda, die sich langsam und stetig in den tiefsten Graben des Planeten hinabsenkt, an dessen Grund sich das Tote Meer und der hypothetische Kampfschauplatz des zukünftigen Armageddon befinden.
Der Sonnenuntergang ist der König Jerusalems. Der weiße Kalkstein – die mineralisierten, Millionen Jahre alten Zeitenwasser des prähistorischen Ozeans Tethys – glimmt in der untergehenden Sonne, und der Cézanne’sche Pfirsichton des Steins wiederholt den Farbton der Dachziegel des Jemin-Mosche-Viertels und der Kinemathek. Die schmalen Bänder der sich wölbenden Fußgängerbrücken eröffnen dem Betrachter einen Blick auf den »Boden der Auferstehung am Jüngsten Tag«: das Tal des Kidron. In diesen Fluss floss einst das Opferblut hinab, das die Gärtner als Dünger nutzten. Man sagt, in Jerusalem seien noch heute Grundstücke zu finden, deren Böden rätselhaft fett sind. Hierher, zum Kidron – heute in Rohre gefasst – führten auch vom Tempelberg her kommende unterirdische Tunnel, durch die man Unreines und zerstörte Götzenbilder abführte, Zeugen des unermüdlichen Kampfs der Propheten gegen das Heidentum. In nördlicher Richtung sind das Kloster im Garten Gethsemane und eine Reihe ehrwürdiger Grabstätten zu sehen, von denen eine Abschalom, dem Sohn Davids, zugeschrieben wird. Sie ist voller Steine, die über viele Jahrhunderte als Zeichen der Verachtung gegenüber dem ungehorsamen Königssohn durch die eingebrochenen Wände geworfen wurden (an das Schlechte erinnert man sich eher als an das Gute; wo zum Beispiel ist – wenigstens das mythische – Grab Davids selbst?). Eine Stadtlegende besagt, im Geburtsjahr Alexander Puschkins 1779 habe die Napoleon’sche Artillerie auf dieses Grabmal gefeuert und so ihre Missbilligung gegenüber Abschalom zum Ausdruck gebracht.
Im Sonnenuntergang dringt dumpf Glockengeläut aus der Altstadt herüber. Alles erscheint irreal, ohne jede Mystik oder Vorahnung eines Wunders. Das vollkommen reine, ausschließlich landschaftliche Sehen fasziniert und verändert das Bewusstsein, das Auge ist unfähig, sich von diesem stillen Widerschein loszureißen, der ringsum alles in geheimnisvolle Durchsichtigkeit taucht. Es ist, als erhöbe sich Jerusalem ein Stück weit über sich selbst, käme dem Himmel noch näher – daher das Gefühl, man wäre hier auf Laputa, einer schwebenden Insel.
Zum erstem Mal wird Jerusalem auf viertausend Jahre alten ägyptischen Keilschrifttafeln erwähnt – in Ächtungstexten gegen Städte, die der 12. Dynastie der Pharaonen gegenüber feindlich gesinnt waren. Vor drei Jahrtausenden wurde der Name der Stadt vermutlich Uruschalimum ausgesprochen, einer Hypothese zufolge von yru – »Gründung« und schalim beziehungsweise schulmanu, dem Namen des westsemitischen Gottes der Abenddämmerung, einst Schutzpatron der Stadt. Folglich bedeutet Uruschalimum »Gründung des Schalim« oder auch »Stadt der Abenddämmerung«. In der Midrasch-Literatur wiederum wird der Name der Stadt meist mit dem Wort schalom, Frieden, in Verbindung gebracht, und die spätere griechische Bezeichnung verbindet die Stadt mit dem Heiligen – deshalb heißt »heilig« auf Griechisch auch ieros.
So geht das Wort für Abenddämmerung – schalim – durch die Jahrhunderte in das Wort für Frieden über. Schalim und schahar – Abenddämmerung und Morgenröte: Der Schriftsteller David Shahar (Verfasser der Romane Ein Sommer in der Prophetenstraße und Eine Reise nach Ur in Chaldäa), der vornehmlich in Frankreich bekannt ist, wo man ihn als den »israelischen Proust« bezeichnet, ließ den Widerschein der untergehenden Sonne oft liebevoll auf die Glatze seines Helden fallen.
22.
Mir erschien die außerweltliche – jenseitige – Existenz schon immer emporgehoben und weit über solch Ränge, Stege und Inselchen verteilt zu sein; ich sah sie vor mir als eine Art Nistplatz, ein Aufenthaltsglück mit vielen Ebenen: So, als würde man nach dem Tod in ein metaphysisches Loft geraten, ein Zwischengeschoss – einen Taubenschlag, in dem die Seelen Vögel sind: Von Zeit zu Zeit lässt man die Tauben ins Freie fliegen, unter schallendem Geträller im Blau herumplantschen, den Himmel genießen – und dann lässt man sie wieder herein, streut ihnen Korn hin, lässt sie an die Tränke zum Wasser …
Es scheint, warum auch immer, offensichtlich, dass der komplexe und zugleich kompakte Aufbau Jerusalems sich analog zur Welt verhält. Alle biblischen Ereignisse – die auf die eine oder andere Weise historischen Auseinandersetzungen, Dramen und Tragödien als Modell gedient haben oder einfach nur unwillkürlich wiederholt wurden – waren räumlich und zahlenmäßig durchaus fassbar, kompakt und folglich analysierbar. Und anders konnte es eigentlich nicht sein: Ein Modell ist immer überschaubar und verständlich, gemäß dem Gebot der vollständigen Kontrolle durch den Forschenden. Im Laufe der letzten Jahrtausende gab es kaum einen autoritativen Text, der einen derart universellen Anspruch auf seine Befolgung erhoben hätte wie der Tanach. Dafür musste er genau das erfassen, was man prinzipiell überschauen, in die Hand nehmen und im konkreten Sinne nachfühlen konnte. Der Tanach behandelt Allegorien, Symbole und Tropen mit maximaler Strenge. Er enthält die Forderung nach Peschat, einer wörtlichen Textexegese. Und das ist eine notwendige Folge der Kompaktheit – d. h. Fassbarkeit mit menschlichen Fähigkeiten – der beschriebenen Welt. Denn alles Symbolische und Abstrakte, oft nicht weniger lebendig und wichtig, liegt hinter dem Horizont und ist eine nächste Stufe der Erkenntnis.
Anders konnte es nicht sein. Die optimale Größe der Heimat entspricht den Möglichkeiten des menschlichen Körpers. Für Adam Kadmon ist er selbst das Universum. Alle biblischen Ereignisse spielten sich auf einem eher kleinen Territorium ab, die erwähnten Stämme und Ländereien waren bloß Grüppchen von Menschen und kleine Besitztümer. Das Sakrale eines Modells (und insbesondere einer Landkarte) besteht darin, dass es in unserer eigenen menschlichen Annäherung das darstellt, was der Allmächtige sieht (beim Blick auf den Raum, auf Geschichte, auf Fragen nach kausalen Zusammenhängen; nach Vergeltung oder Willkür des Geschehenden etc.). Das macht den Tanach zu einer Art Geschichtskarte. Erinnert die Eroberung und Aneignung Nordamerikas etwa nicht an die Inbesitznahme eines weiteren Gelobten Landes? Der Tanach ist ein System, mit dessen Hilfe sich der Fortgang der realen Welt, einschließlich des Raumes und der zwischenmenschlichen Beziehungen, vorhersagen ließe.