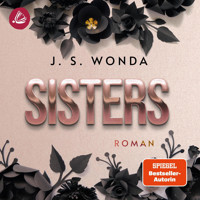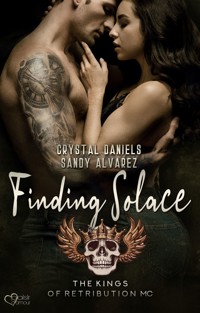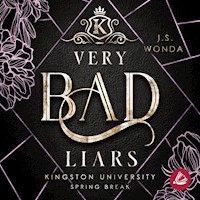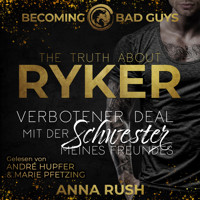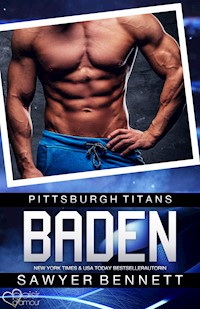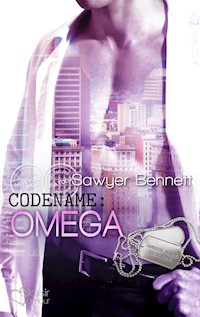Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Nach dem Konkurs seiner Firma schlägt sich der Mittfünfziger Louis als Schriftsteller durch. Auf der Party seines Freundes Daniel, der in der Werbebranche erfolgreich ist, lernt er die über 30 Jahre jüngere, faszinierende Joanna kennen. Er ist sofort beeindruckt von ihrer Schönheit und ihrer besonderen Einstellung zum Leben. Joanna ist überzeugt, mit Delfinen kommunizieren und durch sie die Welt retten zu können. Trotz oder gerade wegen ihrer als verrückt geltenden Überzeugungen verliebt sich Louis Hals über Kopf in sie. Als die beiden in den Süden reisen, lernen sie sich inniger kennen. Joannas wechselhafte Gefühle und ihre kindliche, leidenschaftliche Liebe berühren ihn zutiefst. Als Joannas Wahnvorstellungen psychotische Züge annehmen, steht Louis ihr fest zur Seite und gerät dabei selbst in einen Strudel zwischen Wahn und Wirklichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOANNA
UNTER DEM ZERBROCHENEN BLAU DES HIMMELS
DRAMA
KADEE MAZONI
Für Michi und Angie
Copyright © 2021 Kadee Mazoni Alle Rechte vorbehalten.
www.kadeemazoni.com
ISBN: 9798761979369
Christiane Schell ,LektoratSajjal Kahn, CoversThomas (Toxi) Mutter, Lay Out
Inhalt
Cover
Titelblatt
Kapitel 1
Kapitel 2
ÜBER DEN AUTOR
Joanna - Unter dem zerbrochenen Blau des Himmels
Cover
Titelblatt
Kapitel 1
Joanna - Unter dem zerbrochenen Blau des Himmels
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
Kapitel 1
Tack, tack, tack … neben mir steht mein Freund Daniel und zerhackt fein säuberlich mit einer Rasierklinge auf einem Spiegel weiße Klümpchen zu einem Pulver.
„Mensch Louis, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, was du da planst“, spricht er zu mir.
Laut ertönt Musik aus Lautsprecherboxen, die Etage ist eng gefüllt mit Partygästen, zögerlich tanzen einige Leute in der Mitte des Raumes. Etappenweise klingelt es an der Tür, abermals strömen Menschen herein.
Es ist Daniels Party, hier in einer ausgebauten, schicken Fabriketage, in der einst Arbeiter für einen Hungerlohn malochten. Arbeiter, die erst spät abends in ihre feuchten Wohnungen zu Frau und Kindern zurückkehrten und einen läppischen Lohn mitbrachten, von dem sie sich nur knapp ernähren konnten. Mottenburg wurde die hiesige Gegend getauft, weil unter den Arbeitern aufgrund der ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse Tuberkulose wütete, die in ihre Lungen Löcher fraß, die aussahen, wie ein von Motten zerfressenes Stück Stoff. Kein Wunder, dass die meisten von ihnen nicht älter als fünfunddreißig wurden.
Diese Arbeiter gibt es nicht mehr. Die alten Werkstätten und Fabriken wurden zu Wohnraum umfunktioniert. Noch bis in die Achtzigerjahre wollte kaum jemand hier wohnen, Türken, Punks oder Arbeitslose beherrschten das Straßenbild. Die Wohnungen waren zwar feucht und stanken nach Schimmel, waren aber billig.
Dann wurde flächendeckend saniert. Die Fassaden im Gründerzeitstil wurden frisch gestrichen, die Stuben trockengelegt und mit Heizungen und Bad versehen. Die Eigentümer bekamen vom Staat für den Umbau ordentlich Geld, doch eine Wohltat für die Bewohner waren die frisch sanierten Wohnungen nur bedingt. Das allzu „menschliche“, nämlich die Gier von Eigentümern und Bodenspekulanten, setzte sich durch, die Mieten schossen in die Höhe und die Arbeiter mussten gehen – sie konnten sich fortan die Mieten nicht mehr leisten. Wo allmorgendlich Kolonnen von Arbeitern in die Fabriken pilgerten, wo aus Arbeiterkneipen Seemannslieder ertönten, hatte sich eine konsumbereite Kultur des Mittelstandes breitgemacht. Daniel gehört dazu, anders als ich, er verdient gutes Geld mit Werbung, er kann sich den großflächigen Wohnraum in der mittlerweile angesehenen Gegend, nahe der Elbe, spielend leisten.
„Es muss sich was ändern“, erwidere ich und wende mich hin zu den Leuten, die ausgelassen gegenüber dem Lastenfahrstuhl tanzen. Daneben ist ein DJ Pult aufgebaut, die wummernden Bässe der Elektroklänge spüre ich im Bauch.
„Ich hab das Gefühl, ich ersticke in dieser Stadt. Ich komme hier nicht voran, mir gehen hier die Ideen aus. Es muss was Neues passieren - das Alte muss ausradiert werden. Ich komme mir vor wie in einer Endlosschleife von Erinnerungen“, sage ich.
Daniel, noch immer über den Spiegel gebeugt, setzt akribisch seine Arbeit fort.
„Wie oft willst du von vorne anfangen, Louis? Ich meine, du bist kein Kind. Du bist über fünfzig, mehr als zwanzig Jahre älter als ich …“
Er redet weiter, ich höre kaum zu, er hatte es mir schon so oft erzählt, ich weiß, was kommen wird. Seine Freundin Sylvie ist im fünften Monat schwanger. Bald wird er solche Parties nicht mehr geben können, sondern muss zu Hause sitzen, auf sein neues Kind aufpassen und sie beide, sie und er, werden sich mit Kindererziehung auseinandersetzten. Er hat einen guten Job, verdient genug, vielleicht leistet er sich eine Nanny für seine Göre. Sylvie arbeitet auch in seiner Firma, beide werden ein finanziell abgesichertes Leben führen.
Ich kenne Sylvie seit Jahren, lange bevor sie bei Daniel als Bürokraft anfing. Vor nicht allzu langer Zeit und vor ihrer Schwangerschaft, zogen wir noch gemeinsam durch die Kneipen und betranken uns, lachten und waren oftmals die letzten Gäste, die rausgeschmissen werden mussten. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, hörte sie abrupt mit dem Rauchen auf, trank fortan Kräutertees und schwor dem Alkohol ab. Ich werde sie heute nicht zu sehen bekommen, sie liegt längst im Bett, schläft und träumt ihren Mutterschaftstraum.
„Wie viel Jahre braucht ein Mensch, um zu wissen, wo er hingehört?“, frage ich Daniel.
„Louis, fang nicht damit an. Du machst es dir zu schwer. Ich habe dir angeboten, in meiner Firma zu arbeiten. Aber du willst nicht. Ist es denn so schlimm, mal Geld zu verdienen? Wie lange willst noch den ach so bemitleidenswerten „Lonesome Cowboy“ spielen? Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, den Film Noir will niemand mehr sehen.“
„Ich bin weder einsam noch bemitleidenswert“ erwidere ich.
„Vielleicht wirkt es für Außenstehende so – ich suche nur, und ich suche verdammt noch mal solange, bis ich es gefunden habe. Die Suche kann über mein Leben, über meine Existenz hinausgehen …“
Ich breche den Satz ab. Ungewollt habe ich etwas gesagt, worüber ich mir vorher noch nicht klar gewesen bin. Es gibt keinen Abschluss, es gibt kein Ende der Suche. Jetzt in diesem Moment stelle ich fest, es war schon immer in mir - die Abneigung vor allem Endgültigen. Ich mag den Tod genauso wenig wie feststehende Begriffe. Ich bin ein Nichts, aber bin auf dem Weg ein Kaiser oder König zu werden. Ich rede nicht über mein Alter, nicht um es zu leugnen, sondern, um nicht einer bestimmten Altersgruppe anzugehören. Gar keiner Gruppe angehören und gar keiner Gemeinschaft. Einfach immer nur Fremder bleiben, einer der vorbeigeschaut hat und wieder geht.
Kind bleiben - im Strom der Dinge schwimmen und ein Leben in Unendlichkeit führen. Sicherlich ist das der Grund, weswegen ich nichts geworden bin, warum ich keinen festen Job, kein regelmäßiges Einkommen, keine Familie, keine Beständigkeit habe. Ein innerer Abwehrmechanismus hindert mich, irgendwo Platz zu nehmen, um sagen zu können: das bin ich, hier gehöre ich hin, das ist meine Heimat.
Ich bin gar nicht betrübt deswegen, ich lasse die Züge, auf die ich hätte aufspringen können, getrost an mir vorüberziehen. Ich empfinde keinen sonderlichen Stress dabei, keine Panikgefühle darüber, etwas im Leben verpasst zu haben. Mir tun diejenigen leid, die stressbeladen einem Sinn hinterherhecheln und meinen, einen Plan erfüllen zu müssen. Frei ist nur, wer nichts besitzt, keine Ansprüche hat, wer morgens aufsteht und glücklich und unbedarft, majestätisch seine Flügel, gleich einem Adler, ausbreitet um der Sonne entgegenzufliegen. Zufrieden ist, wer keine Zukunft und keine Vergangenheit braucht, wer einzig Freude daran findet das Schlagen des Herzens in der Brust zu fühlen. Solch einen Zustand, über alle Widrigkeiten, über den Alltag hinweg zu erreichen, ist die große Herausforderung. Es ist eine nie endende Suche nach einem Juwel des Glücks, das, wenn es gefunden wird, mit fluoreszierendem Licht die Seele beleuchten wird.
Um der Monotonie zu entkommen, muss man lernen zu flüchten, denn sonst wiederholen sich die Bilder der Vergangenheit, rotieren und mutieren zur Horrorshow, in der die Gesichter vergangener Freundschaften und Lieben zu bewegungslosen Wachsfiguren erstarren. Ich muss weg von hier. Das Gebüsch, in dem ich als dreizehnjähriger meine ersten Küsse austauschte, ist mir dadurch, dass ich immer wieder darauf stoße, zuwider geworden.
Neue Bilder müssen her und die Erinnerungen in eine Truhe, die vielleicht an einem melancholischen Abend am Kaminfeuer geöffnet wird, verbannt werden.
In dieser Stadt fröstelt es mich, die meisten Monate sind grau und kalt. Ich muss das innere Eis, das sich in mir gebildet hat, mit der Hitze eines neuen Feuers auftauen. Im Übermut sich erheben, seine Flügel ausbreiten … was macht es schon, im Gegensatz zur Gleichförmigkeit, wenn man wie Ikarus der Sonne nahekomme, die Flügel schmelzen und man dabei in den Abgrund stürzt.
Wie auch immer, angesichts dieser Suche, ist es mir unmöglich, einen Job zu machen, dem ich Tag ein Tag aus nachkommen müsste, der mich geistig verarmen und meine Glieder ermatten ließe. Das Eis würde sich in mir ausdehnen, ich würde das Gefühl und die Verbindung zu mir verlieren.
Daniel wird es nicht begreifen, genauso wenig wie ich verstehe, warum er es nicht versteht. Er hat sich angepasst, hat Angst vor dem Alleinsein und macht darum Dinge, um in der Gesellschaft Anerkennung zu erlangen. Vor Jahren war es noch anders; da träumte er davon, Philosoph zu werden, ein bedeutsames Buch herauszubringen und gegen den Strom zu schwimmen. Ich bestärkte ihn damals in seinem Vorhaben und riet ihm, das Buch unbedingt zu schreiben. Was könnte schon passieren, sagte ich. Schlimmstenfalls wäre das Buch kein Weltbestseller und ein Flop. Aber es wäre sein Buch, ein Traktat mit der Tinte seiner Seele geschrieben, es wäre seine Reise durch seine Wälder, Berge und Meere, es wäre eine Exkursion durch die Blutbahnen von Erinnerungen und Gedanken – es wäre ein Buch, das er niemals vergessen würde. Nicht der Applaus wäre entscheidend, sondern die Schöpfung eines fleischgeworden Kunstwerkes. Das, was ich versuchte, ihm schmackhaft zu machen, nämlich abgeschottet von der Außenwelt, nur für sich in einem Kämmerlein zu schreiben und mit Worten Welten zu erschaffen, Traumschlösser zu bauen, ließ ihn insgeheim erschaudern.
Er entschied sich gegen die Schreiberei und gegen die Einsamkeit und suchte stattdessen Zuflucht im gesellschaftlichen Leben. Einen Applaus als Philosoph zu bekommen, erschien ihm zu schwer, also tauschte er ihn gegen finanziellen Erfolg ein. War als Jugendlicher noch sein Augenmerk auf Herzensdinge gerichtet, so entschied er sich, erwachsen und ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden. Er gründete eine Marketing-Agentur. Fortan war er mit dem Firmenaufbau dermaßen beschäftigt, dass seine Wunschträume zurückstehen mussten.
Für viele, wie auch für Daniel, sind die kurzen Jugendjahre bloß ein Übergang zum sogenannten richtigen, ernsthaften Erwachsenleben. Die wichtigen und existenziellen Dinge werden zumeist von Jugendlichen aufgegriffen. Sie sind die Rebellen einer neuen Zeit. Doch sobald die Kids erwachsen werden, verstirbt die Rebellion, und das Etablissement wird siegen, weil die Rebellen von einst sich aufgegeben und ihre Gedanken nicht fortgeführt haben. Geld und Besitz ist das verlockende Goldene Kalb, um das der zivilisierte Mensch tanzt und sich dabei selbst vergisst und verrät. Wie können wir etwas unseren Besitz nennen, wenn wir nicht einmal wissen, wer wir sind? Wie kann Grund und Boden erworben werden, ohne eine Ahnung von der Welt mit ihren Pflanzen, Tieren und Menschen zu haben?
Ich fühle mich nicht einsam, vielmehr fühle ich mich verbunden mit allem, was existiert, wenn ich alleine, fern dem Geschnatter der Menschen bin. Dann bin ich ein Liebender, in der Welt in der ich lebe.
Ein Kind hat ein ausgeprägtes Empfinden, was die grundlegenden Dinge im Leben betrifft – nur kann es sie noch nicht benennen, ihm fehlen die Worte dafür. Einem Dichter ist es vielleicht vergönnt, dem Seelenstoff des Infantilen Ausdruck zu verleihen. Ein Kind, wach und offenen Auges durch die Welt laufend, trägt sämtlichen Stoff des Lebens in sich. Erst im Alter, wenn Vernunft und Alltagsleben die Sichtweise trüben, droht das Gefühl, das man als Kind empfand, zu verschwinden.
„Du kannst doch schreiben“, unterbricht Daniel meinen Gedankenfluss, „also was hindert dich daran, den Job zu machen? Es ist ein guter Job. Du kannst kommen und gehen wann du willst. Ab und zu entwirfst du ein paar Texte …“
„Es sind Werbetexte. Ich kann das nicht. Ich kann dafür keine Leidenschaft aufbringen. Ich hab‘s schon mal probiert und versucht… Es geht nicht, ich saß manchmal tagelang an einem Fünfzeiler … Es stresst mich nur.“
Daniel hackt weiter auf den Spiegel ein, als wolle er die Krümel zu feinem Mehl verarbeiten. Dann zieht er eine lange weiße Line; das Werk ist vollendet. Er kommt mit einem bunten Plastiktrinkhalm in der Hand auf mich zu.
„It's your turn, baby.“
Nur zu gerne empfange ich mein Geschenk, ich kann es gebrauchen, vielleicht bringt es mich auf neue Gedanken.
„Früher gab es einen fünfzig Euro Schein statt einem Plastikhalm. Das machte es irgendwie wertvoller“, sage ich und grinse ihn an.
„Plastik ist aber bakterienfreier.“
Nichts darauf erwidernd neige ich mich zum Spiegel. Erschrocken betrachte ich die Falten in meinem Gesicht, die aufgrund meiner gebeugten Haltung regelrecht Furchen gebildet haben. Der Trinkhalm wandert in mein rechtes Nasenloch, und ich sauge das schneeweiße Kokain in mich hinein. Ehe ich ein Drittel der Strecke verschlungen habe, kommt mir mit schnaubendem Geräusch ein anderer Trinkhalm entgegen. Ich fahre hoch, kann aber aufgrund der Dunkelheit, die Person, die mir einen Großteil meines Vergnügens geraubt hat, nicht erkennen. Erst als ich ein helles „Hach!“, gefolgt von einem seufzenden Ausatmen vernehme, bemerke ich sie.
„Ein geiles Zeug!“, ruft sie aus, reibt sich die Nase und schaut mich mit zufriedenem Gesichtsausdruck an. Ein Lichtschein von irgendwoher hat sich auf ihr Antlitz gelegt, und ich sehe, wie mich ihre dunklen Augen anfunkeln.
„Haha! Das ist Joanna“, klärt mich Daniel auf und klopft mir jovial auf die Schulter, als wolle er mich über den Koks-Verlust trösten.
„Aha! Joanna der Staubsauger“, entgegne ich, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
„Sag mal Joanna, deine Nüstern müssen über eine unglaubliche Saugkraft verfügen. Ein Pferd ist gar nichts dagegen. Nie hab ich jemanden gesehen, der in so kurzer Zeit solch eine Menge Stoff in sich reinziehen kann. Ich hatte schon die Befürchtung, du würdest mir auch noch das Zeug aus meiner Nase ziehen.“
„Ich lasse euch besser alleine und kümmere mich um meine Gäste. Ich kann nachher ja eine neue Linie legen“, sagt Daniel zu mir. Ich nicke ohne meinen Blick von Miss Staubsauger zu lassen.
Sie kommt auf mich zu und ich nehme ihre eindrucksvolle Gestalt wahr. Aus einem engen, kurzen, hellen Kleid ragen ihre langen Beine heraus. Auf ihren weißen, hohen Plateauschuhen wirkt sie ziemlich groß und mächtig. Sie lächelt mich ironisch an. Wellig fällt ihr schwarzes, dichtes, langes Haar über ihre Schultern und mit einer Art Schlafzimmerblick, wobei ihre langen Wimpern auf und nieder gehen, spricht sie mit verführerischer Stimme zu mir:
„Hast du für mich eine Zigarette?“
Ein süßlicher, angenehmer Duft ihres Parfums umgibt sie. Ihre geballte Weiblichkeit erstaunt mich. Sie ist so anders als all die anderen Frauen hier, so mondän und extravagant. Wie paralysiert, sowohl von ihrer Erscheinung als auch von ihrer Frechheit, krame ich in meinem Sakko umher, fingere die Zigarettenschachtel heraus und biete ihr an, wonach sie verlangt. Ich gebe ihr Feuer, entzünde mit dem Zippo Feuerzeug eine Flamme. Ihre dunkelrot geschminkten Lippen leuchten im Lichtschein des Feuers mir entgegen. Kräftig zieht sie an der Zigarette, auf der eine helle Glut entsteht. Tief und genüsslich inhaliert sie den Qualm des Tabaks und bläst ihn mir entgegen.
„Faszinierend!“, rufe ich nach diesem atemberaubenden Schauspiel aus.
„Ja, faszinierend!“, gibt sie mir mit einem sonnigen Lächeln zurück, dreht sich und ist im Begriff zu gehen.
„Joanna“, versuche ich sie zum Anhalten zu bewegen, „So ist doch dein Name?“
Sie dreht ihren Kopf über die Schulter, ohne sich dabei umzudrehen.
„Gewiss. So ist mein Name.“
Ich gehe auf sie zu, denke nach, was ich sagen könnte. Natürlich bin ich ihr nicht böse, dass sie mir mein Koks wegsaugte.
„Bestimmt möchtest du dich gerne revanchieren …“, sage ich und hole tief Luft. Sie steht mir frontal auf Augenhöhe gegenüber.
„Ich werde es annehmen …“, sage ich.
„Was annehmen?“, fragt sie mit warmer Stimme und einem ebenso warmen Lächeln in ihrem Gesicht.
„Die Gegenleistung zu deinem Nasentornado von vorhin.“
„Haha! Ach so! Natürlich werde ich das machen“, lacht sie, lässt mich stehen und verschwindet Richtung Tanzfläche.
Verdammt, sie gefällt mir. Ich gehe zur Bar, bestelle mir einen Gin-Tonic. Mit dem Glas in der Hand beobachte ich die Tanzenden, die sich zu den Rhythmen von House- Musik neben dem DJ Pult bewegen. Und da entdecke ich sie – Joanna. Wie ein leuchtender Punkt bewegt sie sich in der Menschenmenge. Um sie herum tanzen die Leute, einige wirbeln wild ihre Haare hin und her, andere heben die Arme und fuchteln mit den Händen umher – nur sie scheint die Kontrolle nicht zu verlieren; ihr Tanz wirkt distanziert, fast schon aristokratisch und dennoch bewegt sich ihr Körper geschmeidig und harmonisch zur Musik. Die Rhythmen werden schneller, über die Tanzenden ergießt sich flackerndes Stroboskoplicht. Jubelschreie ertönen, die Stimmung ist stürmisch. Ich habe Joanna aus den Augen verloren, sie ist verschwunden. Die Musik wird wieder ruhiger, das Licht wechselt zu hellen, bunten Farben. Noch immer kann ich sie nicht entdecken, sie scheint mir abhandengekommen zu sein. Von der Bar aus, an der ich stehe, blicke ich durch den Raum, kann sie aber nirgendwo erblicken. Plötzlich spüre ich, wie mir jemand von hinten auf meine Schulter tippt.
„Komm mit!“, es ist Joanna. Ich drehe mich zu ihr.
„Du wolltest doch, dass ich mich revanchiere.“
Sie hat sich meine Hand ergriffen und versucht mich von der Bar wegzuziehen.
„Warte einen Augenblick“, entgegne ich und bestelle mir einen erneuten Drink. Mit dem gefüllten Glas in der Hand folge ich ihr, gehe mit ihr quer durch die Etage, hin zu einem gegenüberliegenden Raum. Sie öffnet die Tür. Wir betreten Daniels Arbeitszimmer, in dem es sehr viel ruhiger ist. Daniel steht hinter einem Schreibtisch, erneut ist er dabei Koks zu zerhacken.
„Diesmal werde ich aufpassen, dass alles gleichmäßig verteilt wird“, sagt er.
Wieder, als sei es für den heutigen Abend seine Aufgabe, ist er über einen Spiegel gebeugt. Joanna hat meine Hand losgelassen. Rechts und links an den Wänden des Raums stehen schwarze Ledersessel. Auf einem davon sitzen zusammengepresst zwei kichernde Girlies. Sie sehen mit ihren langen, glatten, blonden Haaren zwillingsgleich aus und wie aus der Retorte entsprungen. Ihre jungfräulichen Körper sind bekleidet mit knappsitzenden, bauchfreien Tops, sowie darunter mit engen, an den Knien aufgerissenen Bluejeans.
„Habt ihr euch, Joanna und du, einander bekannt gemacht?“, fragt Daniel, ohne den Kopf vom Spiegel zu heben.
„Ja, wir haben uns in der Zwischenzeit ein wenig kennengelernt“, antworte ich.
Ich nehme auf der Ledercouch, die zwischen den Sesseln steht, Platz.
„Sag nicht, dass sie auch in deiner Firma arbeitet“, frage ich Daniel.
„Nein, das tut sie nicht“, sagt sie an seiner Stelle. Sie geht auf ihren hohen Schuhen durch den Raum und setzt sich neben mich auf die Lehne.
„Ich arbeite für mich alleine“, sagt sie.
Jetzt, im hellen Licht, kann ich sie noch besser erkennen, blicke in ihr ebenmäßiges Gesicht mit den geschwungenen, roten Lippen und den ausgeprägten Wangenknochen. Ihre langen Wimpern an den leicht gesenkten Augenlidern, ihre glänzenden, schwarzen Augen, verleihen ihr etwas Geheimnisvolles. Ihre schlanken, langen Beine hat sie übereinandergeschlagen.
„Ich habe es mir schon fast gedacht … Du könntest niemals für jemanden arbeiten“, sage ich. Sie lacht.
„Joanna hat ein eigenes Grafikbüro“, belehrt mich Daniel und schaut endlich zu uns herüber. Die beiden Girls neben uns sind mit sich selbst beschäftigt und spielen mit ihren Telefonen.
„Sie ist sozusagen ein Ein-Frau-Betrieb. Stimmt's Joanna?“
„Richtig!“, antwortet sie knapp. Jetzt bemerke ich auch ihre roten Fingernägel - sie sind im gleichen Rot lackiert wie das ihres Lippenstiftes.
„Und es läuft gut für dich?“, will ich von ihr wissen.
„Wenn ich mir deine äußerst geschmackvolle Kleidung betrachte, muss es doch gut laufen“, sage ich.
„Wenn ich mir deine Kleidung betrachte“, kontert sie, „dann wird es scheinbar auch gut für dich laufen. Erzähl mir, was machst du? Arbeitest du auch für dich alleine?“
„Haha! Erzähl es ihr“, fordert mich Daniel hinter seinem Schreibtisch auf.
„Nun, von dem was ich an Geld einfahre, kann ich mir solche Anzüge nicht leisten. Der einzige Grund, warum ich sie dennoch trage …, ich hatte mal ein Geschäft, kaufte in England Anzüge ein und verkaufte sie an Läden. Das ging schief und ich ging pleite. Das liegt zwei Jahre zurück. Das Geld, das ich mir von der Bank lieh, konnte ich bis heute nicht zurückzahlen. Nun verfolgen mich die Gerichtsvollzieher. Zum Glück wollte niemand die Anzüge pfänden. Jemand sagte mir mal, wenn du ein Geschäft aufmachst, überlege dir, was es ist. Denn wenn du pleitegehst, ist es das Einzige, was du zurückbehältst. Ich habe die Anzüge. Einige habe ich verkaufen können, doch die, die mir passen, habe ich behalten. Ich bin pleite, aber laufe umher, als hätte ich viel Geld auf der hohen Kante. Alles nur Schein. Also Joanna, wenn du dich auf mich einlässt, pass auf, es ist alles nur Fassade.“
„Ach, ist das so? Wäre ja interessant es herauszufinden und den Schleier zu zerreißen, hinter dem sich das wahre Ego verbirgt“, sagt sie mit einem aufreizenden Lächeln.
„Was wird mich hinter dem Schleier erwarten? Eine Maske und hinter der Maske eine neue … und so weiter?“ Sie erhebt sich von der Sitzlehne, geht durch den Raum und lässt mich einen flüchtigen Blick auf ihr prächtig geformtes Gesäß werfen.
„Sind wir denn nicht alle auf die eine oder andere Weise maskiert?“, fragt sie in den Raum hinein.
„Wenn wir einkaufen, tragen wir die Maske eines Kunden. Als Ehefrau habe ich eine für meinem Mann, als Freundin für meine Freunde und Freundinnen. Mit jemandem, mit dem wir zusammenleben, reden wir anders, als mit jemandem, dem wir flüchtig begegnen. Ich würde sogar sagen, umso weiter wir uns entwickeln, desto mehr Masken brauchen wir. So wie ein Baum Jahresringe bildet, legen auch wir uns Masken zu. Die Erde baut immer wieder neue Erdschichten auf und begräbt die alten. Wer kann schon von sich sagen, was er oder sie ist. Und könnte ich als reines, durchsichtiges Ich überhaupt existieren? Würde ich nicht als gläsernes Wesen völlig zusammenbrechen. Wir brauchen die Maske zum Schutz …“
„Oh Joanna, bitte! Das führt jetzt zu weit“, unterbricht Daniel ihren Redefluss.
„Nein“, sage ich, „das ist interessant, ich will es hören.“
„Ach, interessant findest du es?“, fragt sie mit einem ironischen Unterton.
„Ja. Rede weiter“, fordere ich sie auf.
Ihre Gedanken reizen mich, genauso wie der warme Klang ihrer Stimme.
„Gut“, grinst sie mich an. „Mein Ich“, sagt sie und versucht wieder den Faden aufzunehmen.
„In welchen Abgründen in mir, finde ich diesen geheimnisvollen Kern, der mich ausmachen soll? Versuche mal bei einer Zwiebel den Kern zu finden. Du pulst sie auf, Schale für Schale und am Ende liegen nur verstreut ihre Blätter umher, aber kein Kern. So ist auch es mit dem Ich. Nehmen wir den Bäcker von nebenan. Geboren war er nicht als solcher. Er hat sich eine Maske aufgesetzt und wird erst zum Bäcker. Auch der Weise, der Philosoph, die Ehefrau, der Vater, die Mutter …
„Ist schon gut“, unterbricht Daniel sie. „Du brauchst nicht alle aufzuzählen. Willst du denn abstreiten, dass jeder Mensch einen eigenen Charakter, eine eigene Identität besitzt?“
„Der Mensch besitzt einen Instinkt wie ein Tier“, antwortet Joanna.
„Natürlich ist jeder Mensch verschieden. Verschieden aber sind alle Dinge auf der Welt. Nichts ist genauso wie das andere. Die Natur hat es sich erlaubt, keine Kopie zuzulassen. Nicht mal eine Fliege ist der anderen Fliege gleich. Kein Baum, kein Strauch …“
Joanna geht lebhaft im Raum auf und ab und holt tief Luft. Es sieht aus, als habe sie sich in Rage geredet.
„Jeder Mensch ist dazu verdammt alleine zu sein. Alleine kommt er zur Welt, und alleine stirbt er. Die Maske, die er sich aufgesetzt hat, tröstet ihn nur über diese Tatsache hinweg. Alles, was wir glauben zu sein, ist nur behelfsmäßig und auch eine Lüge. Guter Mensch, schlechter Mensch - alles ist nur eine Maske. Die Maske kann dir helfen, aber sie kann dir auch schaden. Ein erfolgreicher Musiker sagte mal: „Wenn du ein Rockstar werden willst, musst du dich auch wie einer benehmen“. Alles ist Schauspiel. Suche dir die beste Rolle in dem Stück, das Leben heißt und setzte dir die passende Maske auf. Vergiss aber nicht, sie hin und wieder zu wechseln, vergiss nicht, sie war nur als Übergang gedacht. Ich behaupte mal, je mehr Masken wir im Leben tragen, desto mehr können wir erfahren und desto weiser werden wir.“
„Geht das nicht etwas zu weit?“, fragt Daniel. „Das klingt ja so, als haben wir keinen eigenen Willen.“
„Doch wir haben den Willen, so wie ich Joanna verstanden habe, unsere Masken auszusuchen und aufzusetzen“, sage ich.
„Genau! Suche dir deine Maske aus, die zu dir passt, sonst suchen andere Leute sie für dich aus“, erwidert Joanna.
„Der menschliche Charakter ist formbar. Besser du formst ihn dir selbst, sonst machen es andere für dich. Schaffe dir deine eigenen Probleme, lass dich nicht dazu verleiten, die Probleme anderer dir zu eigen zu machen. Wir brauchen eigene Masken und eigene Verkleidungen.
Das Leben ist ein Kostümball. Tritt hinaus auf die Bühne und führe dein Drama auf. Gut und böse gibt es nicht ….“
Sie unterbricht mit einem Mal ihre Rede und richtet ihren Blick nachdenklich nach unten.
„Wir sind alleine …“, sagt sie, „Einsamkeit ist die wahre Eigenschaft, die uns Menschen ständig begleitet. Niemand kann uns unsere Entscheidungen abnehmen. Wir werden als Fremde auf die Welt geworfen und wir verlassen sie als Fremde. Alles ist nur Schein, alles nur Betrug.“
Kurz herrscht betroffene Stille, nur die beiden Mädchen, die sich am Gespräch nicht beteiligen, spielen weiter, als befänden sie sich mit ihren Smartphones in ihrer eigenen Welt.
„Das klingt sehr depressiv, meine Liebe“, sagt Daniel hinter dem Schreibtisch. Für kurze Zeit hat er seine Tätigkeit unterbrochen und hält mit zwei Fingern die Rasierklinge in seiner Hand.
„Das klingt sehr optimistisch, mein Lieber“, kontert sie. „Wir alle sind unbedeutend, und demzufolge haben wir auch nichts zu verlieren. Es gibt keine höheren Aufgaben zu erledigen. Wir können uns amüsieren. Wir sind frei. Frei auch vor uns selbst. Wir müssen nichts anderes im Leben erreichen, als zu leben.“
Sie lacht mit einem Male laut auf, ihr Gesicht strahlt und sie wirkt wie verwandelt und, wie sie es zuvor apostrophierte, frei und unbeschwert. Daniel hält noch immer die Rasierklinge zwischen seinen Finger.
„Mir gefällt deine Maske“, sage ich ihr.
„Und – willst du versuchen sie mir zu entreißen?“
„Der Versuch wäre gewiss interessant“, erwidere ich. „Aber so, wie ich dich verstanden habe, wird es mir nicht gelingen.“
„Genau, mein Lieber. Du wirst nur erreichen, dass ich mir zum Schutz eine neue zulege“, sagt sie und grinst mich herausfordernd an.
„Aber irgendwo im tiefen Inneren muss doch ein Motor sein, der all das, was ich von dir zu sehen bekomme, formt und erschafft. Es musst da was sein, das deinen Geist und deine schönen Worte hervorbringt.“
„Vielleicht gibt es den“, lächelt sie mir zu. „Aber das Wesen im Inneren ist still und willenlos. Es sitzt hinter einer matten Scheibe. Erst wenn ich den Körper verlasse, wird es herauskommen. Dann wird es umherwandern und sich einen neuen Körper suchen.“
„Kommt jetzt her, es ist so weit!“, ruft Daniel uns zu.
Ich denke flüchtig darüber nach, was sie mit dem ominösen Wesen meint, das versteckt in ihr wohnt. Meint sie damit, das wahre Selbst sei stumm und ohne Handlung, schnappt sich nach dem Tod einen anderen Körper und vergräbt sich dort erneut still und bewegungslos? Ist es überhaupt ein Wesen im eigentlichen Sinn? Ist es gasförmig oder ist es ein Geist?
Joanna und ich gehen zum Schreibtisch, wo Daniel die weiße Pracht ausgebreitet hat.
Daniel fordert mich auf, als erster „eine Nase“ zu nehmen. Ich beuge mich über den Spiegel und sauge, verteilt auf die einzelnen Nasenlöcher, den Schnee in mich herein. Ein scharfes Brennen verspüre ich an den Nasenwänden. Nach und nach setzt ein hellwacher, angenehmer Rausch ein. Joanna nimmt die restliche Linie des Stoffes, nachdem Daniel bekundet, er habe genug gehabt und wolle nichts mehr. Ich stehe neben ihr und schaue ihr dabei zu, wie sie sich genüsslich die andere Line durch die Nase zieht. Was für eine Frau, denke ich.
Ein leichter, lustvoller „Ahh!“-Seufzer und ein „das tut gut!“, entweicht aus ihrem Mund. Sie reibt sich die Nase. Aus meiner Schachtel ziehe ich zwei Zigaretten, zünde sie an und stecke eine davon zwischen ihre Lippen.
„Alles ist also eine Maskerade … meinst du damit, man müsse sich äußerlich so kleiden, damit man es auch in seinem tiefsten Inneren wird?“
„So ähnlich“, antwortet sie mir und bläst den Zigarettenrauch neben mir zur Seite. „Wie im Märchen ‚Kleider machen Leute‘. Der Schneider, der sich trotz Armut gut kleidet. Alle glauben, er sei ein Aristokrat. Am Ende wird er tatsächlich ein reicher Edelmann.“
„Dann können wir beide Königin und König werden?“, lache ich.
„Ja, wenn du ein Prinz werden willst, musst du das auch zeigen. Schönheit kommt nicht nur von innen …“
„Du meinst ein Prinz für die Königin“, sage ich.
„Für die Königin und für dich“, lacht sie ironisch.
„Was denn nun, für die Königin oder für mich?“
„Für dich, weil du die Königin liebst. Sie trägt die Maske der Unschuld. Es ist nur vorgetäuscht, aber für dich ist es Wahrheit – so funktioniert die Liebe. Alles, was du für sie tust, tust du auch für dich.“
„Ich bin geplättet“, erwidere ich.
„Das ist doch schön: Sklave der Liebe“, lacht sie laut auf. „Wahre Liebe ist immer rein …“
„Ich wollte, es wäre so“, fährt Daniel dazwischen, „aber ich befürchte, Liebe ist auch nur ein Betrug. Ich wäre gerne bereit, in ihr etwas Reines und Engelhaftes zu sehen. Aber ist das wirklich so?“
„Es ist so!“, behauptet Joanna, während sie sich vom Schreibtisch entfernt und wieder auf dem Sofa Platz nimmt. Ich setze mich neben sie. Sie greift sich mein Glas und nimmt einen tiefen Schluck daraus.
„Liebe ist schön. Schönheit und Hässlichkeit kann man nur fühlen. Das sind Geschmackssachen. Liebe ist eine Illusion, da gebe ich dir recht. Aber die Illusion macht aus hässlichen Menschen schöne Menschen.“
Sie geht bei ihren Worten wieder im Raum auf und ab, als wolle sie über jedes Wort, das sie ausspricht, sinnieren. Geschmeidig ist ihr Gang auf den hohen Schuhen, anmutig bewegen sich dabei ihre Hüften.
Das Kichern der beiden Mädchen, die uns die ganze Zeit nicht beachtet haben, wird lauter. Sie stehen auf und ohne etwas zu sagen, verlassen sie den Raum.
„Joanna, das ist alles sehr schön gesagt“, wirft Daniel ein, „es klingt wie ein Hippietraum. Ich will ja nicht sagen, man solle erwachsen werden, aber ….“
„Aber was?“, fahre ich dazwischen, mir gefällt es nicht, dass er versuchen will, ihr Gedankenbild zu zerstören. Mir ist, als müsse ich ihre eindrucksvollen Gedanken beschützen.
„Was hast du gegen Träume?“, rufe ich ihm zu.
„Wo sind deine Träume geblieben, Daniel? Erinnerst du dich, du wolltest schreiben. Vor zwei Jahren sagtest du noch, schreiben sei dir das Wichtigste. Und was machst du nun? Statt deiner Träume erfindest du Wortspielereien für deine Werbekunden, damit sie ihr Produkt besser absetzen können. Ist das der Traum, den du wolltest, Daniel?“
„Der Traum ist zerplatzt“ sagt er, „Einfach so: Puff! Na und, ich bin zufrieden. Ja verdammt, so zufrieden, dass ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, welche Raserei mich packte, als ich noch schreiben wollte. Der Vorhang ist gefallen, das Spiel als Dichter und Philosoph ist aus. Es hat mich gequält,aber jetzt spüre ich diesen Schmerz nicht mehr …“
„Aber auch nicht das übervolle Glücksgefühl“, unterbreche ich ihn.
„Richtig! Auch nicht mehr das überbordende Glücksgefühl. Ist das so schlimm? Ich schwimme im seichten Wasser des Lebens, und ich fühle mich wohl dabei. Ich bade gerne lauwarm. Was ist falsch daran, wenn man mit sich Frieden geschlossen hat und sich nicht mehr mit Sorgen plagt? Ich erwache morgens ohne erschütternde Gedanken, die mich quälen und mein Leben zur Hölle machen. Einfach nur sein, inmitten dieser Welt, einfach nur da sein, den Wind um meine Nase wehen lassen und weder lieben noch hassen. Ich liebe Sylvie, aber nicht, wie du es in deinen Geschichten beschreibst, nicht mit dieser verausgabenden Raserei – ich liebe sie in einer Art stillem Glücksgefühl und freue mich auf das Kind, das aus ihr heraus entspringt. Das ist Glück, mein Lieber. Das ist Zufriedenheit, und das wünsche ich auch dir.
Verschwenden wir doch nicht unser Leben mit Zerrissenheit und nicht zu verwirklichenden Träumen. Hier auf dem Planeten, wo wir leben – das ist Traum genug und vor allem einer, den wir bedienen können.“
Ich denke über seine Worte nach und nehme mein Glas, trinke es leer – leer fühle ich mich auch. Leer macht mich, was er gesagt hat. Zufriedenheit. Bin ich denn nicht zufrieden? Wonach suche ich? Was vermisse ich, was ich in all den Jahren nicht gefunden habe? Ist Daniels Weg der Genügsamkeit nicht der bessere? Joanna schaut mich an, als habe sie meine Gedanken erraten.
„Du schreibst also?“, fragt sie, als wolle sie mich aus meiner Grübelei herausreißen. Daniel lacht auf und schüttet erneut Koks aus einer kleinen Tüte auf den Spiegel.
„Sag, was du schreibst!“, fordert Daniel mich auf.
„Ich schreibe Kurzgeschichten. Ja, so unabhängig bin ich auch nicht. Ich werde dafür bezahlt. Ich kann mich gerade so eben davon ernähren. Nachdem ich mit meinen Anzugverkäufen keinen Erfolg hatte, beschloss ich, Schriftsteller zu werden.“
„Ah! Das ist doch wunderbar“, sagt sie.
„Ja, vielleicht. Jetzt wo ich überlege, was du über die Maske gesagt hast … ich zog sie mir tatsächlich über. Zuerst passte sie nicht so recht, ich zog daran, rückte sie zurecht, setzte sie wieder ab. Es dauerte eine Weile, bis sie mir endlich passte und ich sagen konnte: 'Ich bin ein Schriftsteller'. Irgendwann funktionierte es, es war wie eine geheime Kraft, es war, was ich wirklich wollte. Es war tatsächlich so ein Baby in meinen Armen, das wuchs und größer wurde.“
„Also ein sehr dickes Baby“, grinst sie.
Ich zünde mir eine Zigarette an. Sie betrachtet mich neugierig. Jetzt, wo ich so rede und mich erkläre, verstehe ich ihre Gedanken zur Maske besser.
„Ja ein dickes, schweres Baby. Ich wollte irgendetwas, was ich nicht kenne, aus mir herausbringen und dachte, wenn ich fortwährend schreibe, käme es an die Oberfläche. Ich führte über mein Schreiben Tagebuch. Sodann musste ich mir überlegen, wie ich davon leben könnte. Ich suchte im Internet nach Schreibaufträgen. Sex-Geschichten liefen am besten. Also schrieb ich erotische Geschichten. Zuerst gab es einen Cent pro Wort, dann wurden es zwei und dann fünf Cent. Es kamen Tage, an welchen mir nichts einfiel, an welchen ich keine neuen Wörter mehr für das immerwährende penetrieren aufbringen konnte. Ich versuchte, psychologische Betrachtungen, aber dem Auftraggeber gefiel das nicht. Er wollte, dass die Geschichte schnell zur Sache kommt. Ich schrieb und schrieb, meine Sätze wurden prägnanter, ich konnte schneller die Bausteine einer Geschichte zusammenstellen. Acht Geschichten á fünf Seiten in einem Monat, zwei Geschichten in einer Woche. Es folgten längere Erotik-Geschichten. Die Stories gewannen an Lebendigkeit. Je mehr ich schrieb, desto häufiger traten Erinnerungen in Erscheinung, die ich längst vergessen hatte. Bilder tauchten auf, Menschen, die ich nicht kannte, spazierten in meinen Geschichten umher. Ich wurde durch das Schreiben zum Schöpfer. Ich konnte mit allen beliebigen Frauen ins Bett steigen, wann und wo ich wollte. Ich konnte meinen Personen Wörter in den Mund legen, die mir gefallen. Ich konnte es regnen, schneien oder den Himmel sich öffnen lassen – ich wurde ein Schreiber. Mein Wohlgefühl hing von nun an davon ab, wie viele Wörter ich an einem Tag schaffte. Es ist ein aufgewühlter Traum. Oder ist es ein Albtraum? Ich weiß es nicht. Manchmal verzweifle ich und denke, ich müsste was Anderes machen. Vielleicht, so wie Daniel zufrieden sein … Nein, das geht auch nicht.
Zufriedenheit ist ein Ungeheuer, ist eine Hydra. Schlägst du ihr einen Kopf ab, wächst der nächste nach. Bist du ausgeglichen, frisst dich die Einförmigkeit. Ein guter Job bringt dir Geld und Anerkennung, aber macht dich auch leer.“
„Er macht dich nur leer, wenn du dich leer machen lässt“, protestiert Daniel. Joanna lacht, als nehme sie nicht ernst, was Daniel sagt.
„Also bist du nicht glücklich mit dem, was du machst?“, fragt sie mich.
„Doch, doch“, wehre ich ab. „Die Unzufriedenheit ist mein Glück. Ich kann nicht anders. Ich muss schreiben. Die Rastlosigkeit ist meine Heimat und die Suche ist …“
Gerade als ich ausführen und darlegen will, ob die Suche nach dem Glück auch schon das Glück sei, öffnet sich die Tür, und ein Typ mit blond gefärbten Haaren, bekleidet mit einem weißen Sweatshirt und einer schwarzen Trainingshose, kommt herein. Als interessiere sie meine Antwort auf ihre Frage nicht mehr, ruft sie lauthals: „Felix!“ heraus. Auch Daniel erbietet ihm ein kühles „Hallo Felix“. Ich bin offensichtlich der Einzige, der den Neuankömmling nicht kennt. Ich nicke ihm, der Freundlichkeit halber, mit dem Kopf zu. Er nimmt, was mir nicht gefällt, zwischen Joanna und mir auf dem Ledersofa Platz.
„Du weißt, ich muss morgen früh aufstehen“, spricht er vorwurfsvoll zu ihr. Es ist ein Tonfall wie er Eheleuten, die sich lange kennen, eigen ist.
Ich stehe auf, gehe zu Daniels Schreibtisch, schnappe mir den Strohhalm, der daliegt, als würde er auf mich warten, beuge mich über die weiße Line und sauge sie ein.
„Das ist Felix“, erzählt mir Joanna im stolzen Ton, umarmt diesen Felix mit seinem, für meinen Geschmack ausdruckslosen Gesicht mit einem Dreitagebart und kleinen, hellbraunen Augen, die wie Knöpfe aussehen. Sie streichelt ihm, wie eine Mutter ihrem Kind, über sein Haupt.
„Felix hat morgen einen wichtigen Termin, er läuft beim Hanse-Marathon mit“, verkündet sie uns stolz.
„Es ist schon spät“, erklärt ihr Felix und sagt, dass er ins Bett müsse und ob sie nicht endlich mitkommen würde.
„Ach, du bist Sportler“, rufe ich ihm zu und versuche dabei einen beißenden Unterton zu verbergen.
„Ja, er ist Sportler“, gibt sie mir an seiner statt zur Antwort, „er ist total durchtrainiert. Das bist du doch, nicht?“. Sie streichelt ihm über die Brust, so als wolle sie dort seine Muskeln fühlen.
„Er trainiert jeden Tag zwei Stunden“, führt sie weiter aus, als sei es für uns wichtig, es zu erfahren.
„Und morgen ist sein großer Tag. Er will es unter die ersten hundert schaffen. Das ist doch so, oder? Nicht wahr?
Morgen ist dein großer Tag.“ Sie verpasst ihm einen Kuss auf die Wange.
„Bitte Jo, lass uns gehen“, erwidert Felix und dreht seinen Kopf von ihr weg, „ich muss morgen fit sein, das weißt du doch.“
„Vielleicht solltest du eine Nase nehmen“, schlage ich ihm vor, ohne zu glauben, dass er das Angebot annehmen würde.
„Es soll ja enorme konditionelle Auswirkungen haben. Oder werdet ihr vorher kontrolliert?“
Felix winkt ab und zerrt stattdessen an Joannas Hand.
„Ich bleibe noch eine Weile“, entgegnet sie ihm, „vielleicht ist es auch besser, wenn ich später zu dir ins Bett komme und du für morgen ausgeschlafen bist.“
Es klingt eher ironisch als fürsorglich. Felix reibt sich nervös mit zwei Fingern seine Unterlippe und rutscht auf der Couch hin und her. Ich bemerke, es gefällt ihm nicht, obwohl er andererseits im Stress zu sein scheint, ausgeruht seinem „großen Tag“ entgegenzugehen.
„Also gut“, sagt er genervt, sich mit der Situation abfindend, dass er Joanna auf die Schnelle nicht davon überzeugen kann, mitzukommen.
„Komm bitte nicht so spät, du weißt schon. Bitte.“
Er erhebt sich von seinem Sitz, jetzt sehe ich seine weißen Turnschuhe. Er sieht aus, als sei er zu jeder Stunde für eine sportliche Herausforderung, die sich eventuell ergibt, bereit. Er gibt ihr noch einen trockenen Kuss auf ihre Wange, winkt uns zum Abschied zu und verlässt den Raum.
„Er nennt dich Jo?“, frage ich Joanna, nachdem Felix den Raum verlassen hat. „Jo klingt so männlich. Läufst du mit ihm um die Wette?“ Ich habe mich wieder neben sie auf die Couch gesetzt und bin froh darüber, dass er gegangen und sie geblieben ist. Durch seine kurze Anwesenheit fühle ich mich herausgefordert, Joanna für mich zu gewinnen. Sie ist mein Marathon. Mit einem aufreizenden, fast schon überheblichen Lächeln strahlt sie mich an.
„Ja, so nennt er mich. Kurz und knapp. Alles muss bei ihm schnell gehen.“
„Ach, alles muss schnell gehen?“, hake ich nach, sodass Daniel laut auflacht.
„Bitte, ich kenne Felix schon länger“, wendet Daniel ein, „er ist ein netter Typ, er ist nicht, wie du vielleicht denkst.“
„Er weiß was er will“, sagt Joanna und schaut mich dabei mit einem provokanten Lächeln an, „er ist konsequent …“, sie unterbricht sich. „Gib mir eine Zigarette!“
Ich reiche ihr die Schachtel. Mit ihren roten, spitzen Fingernägeln zieht sie sich eine Zigarette heraus. Ich gebe ihr Feuer.
„Er hat immer eine Antwort auf meine Fragen. Frauen stehen auf so was. Das musst du als Erotikautor doch wissen.“
Sie bläst den Rauch gen Decke.
„So was gibt Halt“, sagt sie und lacht dabei, als nehme sie es nicht ernst.
„Er ist gut gebaut, und es ist schön, in seinen muskulösen Armen zu liegen und zu wissen, dass er dich tragen könnte, wohin du willst.“
Sie lehnt sich im Sofa zurück, legt einen Arm auf die Lehne, ohne dabei ihre durchdringenden Blicke von mir zu lösen.
„Und wie ist es bei dir?“, fragt sie.
„Meine Arme sind vielleicht nicht so stark wie die von … Wie heißt er gleich?“
„Felix“, hilft sie mir auf die Sprünge.
„Kommt es drauf an? Was willst du von mir hören? Muss ich mich mit ihm vergleichen? Du bist gewiss sehr glücklich mit ihm, rührst ihm morgens seine Fitness-Drinks an, machst ihm Mut für seine Wettkämpfe und hast Verständnis, wenn er abends früh ins Bett muss und auf seine Gesundheit achtet. Nein, da kann ich nicht mithalten.“
„Höre ich da vielleicht eine Gemeinheit heraus?“, fragt sie mich.
„Gemeinheit? Ich verstehe nicht, was du meinst“, kontere ich naiv, „ich kann nichts Gemeines zu ihm sagen. Schließlich habe ich ihn vorhin das erste Mal gesehen. Außerdem muss ja was dran sein, wenn …", ich zögere noch einen Augenblick.
„Wenn was?"
„Ach nein. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich muss betrunken sein, mich da einzumischen."
„Ich will es aber hören", insistiert sie. Das Lächeln auf ihren Lippen ist gewichen.
„Sag du es mir. Gehst du morgen hin und schaust dir an, wie er sich abkämpft, um unter die ersten hundert zu kommen? Bist du dabei, um zu sehen, wie er mit durchgeschwitztem Shirt und verzerrtem Gesicht in die Zielgerade läuft?“
„Haha! Um Gotteswillen! Ich schaue mir solche Veranstaltungen niemals an", sagt sie frei heraus und gibt mir damit zu verstehen, dass ihr an seinem Sport nicht viel liegt. Vielleicht auch ebenso wenig an ihm?
„Ach, das ist interessant. Unterhaltet ihr euch auch niemals über seine Heldentaten? Immerhin scheint ihm doch sehr wichtig zu sein, was er da treibt."
„Ja, ihm ist es wichtig. Das heißt nicht, dass es mir auch wichtig sein muss."
„Du musst wissen", setzt Daniel ein, der unserem Gespräch aufmerksam zugehört hat, „dass Louis eine sehr idealistische Vorstellung von Liebe hat. Lass dich von ihm nicht in die Enge treiben. Er glaubt nämlich, wenn man sich liebt, müsse man alles gemeinsam empfinden."
„Von Muss kann keine Rede sein", verteidige ich mich, „Liebe kommt von allein. Man braucht dazu nichts unternehmen. Sie kommt wie aus dem Gebüsch gesprungen, versetzt einen in Flammen und dann, so glaube ich, ist das Empfinden ‚geben zu wollen‘ stärker als das Nehmen."
Sie hat ihre Zigarette aufgeraucht, ich beuge mich hin zu ihr, ziehe eine weitere Zigarette aus der Schachtel, zünde sie an, und reiche sie ihr. Sie nimmt sie ohne Worte, wie selbstverständlich, entgegen und zieht daran. Hatte ich zuvor noch gedacht, ich müsse das unsichtbare Band, das sie und Felix zusammenhält, zerschneiden, so habe ich jetzt, wo ich die Zigarette glimmend zwischen ihren roten Lippen sehe und ein Anflug von nervöser Nachdenklichkeit bei ihr bemerke, das Gefühl, dass das Band schon länger durchtrennt ist. Während ich überlege, wie ich es schaffe, sie für mich zu gewinnen, erhebt sie sich von ihrem Sitz. Sie baut sich vor mir auf, stemmt die linke Hand in die Hüfte, hält mit der anderen die Zigarette und erklärt, sie müsse jetzt gehen. All meine Hoffnung, die ich hegte, die mir zum Greifen nahe erschien, bricht im Nu zusammen.
„Bist du dir sicher, dass er ohne dich nicht einschlafen kann“, frage ich sie. Auch ich habe mich erhoben, vis-a-vis stehen wir uns gegenüber.
„Ja“, antwortet sie, ihren Kopf leicht in den Nacken gelegt, „ich bin mir sicher. Auch wenn du es nicht glauben magst, aber ich kenne ihn. Er schläft unruhig, wenn ich nicht bei ihm bin.“
„Ich bin beeindruckt“, schmunzle ich. In resoluter und gerader Haltung demonstriert sie ihre Entschlossenheit zu gehen. Ich gebe auf, sie zum Bleiben zu überreden.
„Ich hoffe, er wird es wertschätzen, was du für ihn tust.“
„Das muss er auch“, sagt sie keck und schaut mir dabei tief in die Augen, nimmt einen weiteren Zug und drückt anschließend die Zigarette auf Daniels lackiertem Holzfußboden aus. Sie dreht sich um, geht zu Daniel, beugt sich über seinen Schreibtisch, notiert etwas auf einen Zettel, verabschiedet sich von ihm und kommt zu mir zurück.
„Wir werden uns bestimmt wiedersehen“, sagt sie, drückt mir den Zettel in die Hand, den ich ausbreite und darauf eine Telefonnummer entziffere.
„Ganz bestimmt werden wir uns bald wiedersehen“, bestätige ich ihre Aussage und stecke in heimlicher Freude das kostbare Stück Papier in meine Tasche. Verblüfft schaue ich hinterher, wie sie mit geschmeidigem Gang den Raum durchquert und ohne zurückzuschauen die Hand auf die Türklinke legt, die Zimmertür öffnet und verschwindet.
„Warum musstest du ihr das über die Liebe erzählen? Das war unpassend“, sage ich zu Daniel.
„Ah, ich werd verrückt, du bist scharf auf sie. Aber du wirst sie nicht bekommen. Schlag es dir aus dem Kopf, sie wird sich von Felix nie trennen. Haha!“
„So, das glaubst du nicht? Warum hat sie mir dann ihre Nummer gegeben?“
„Ist es denn auch die richtige Nummer?“
„Warum sollte sie mir eine falsche geben?“
„Weil sie ein Biest ist, ein reizendes Biest. Sie spielt mit den Männern …“
„Ja und? Was stört dich daran?“, frage ich. Es gefällt mir nicht, wie er über sie spricht. Und doch macht es mich nervös, sie könnte mir vielleicht eine falsche Nummer gegeben haben. Reflexartig streiche ich mit meiner Hand über meine Hosentasche, indem sich der Zettel befindet, den sie mir überreichte, will mich vergewissern, dass er sich noch an der gleichen Stelle befindet.
„Das fragst du noch?“, erstaunt Daniel sich über meine Frage, „ich will einfach nicht verletzt werden von solchen Frauen. Du müsstest doch am besten wissen, wovon ich spreche.“
Ich versuche, das Gespräch zu beenden. Daniel will ohnehin wieder zur Party hinaus zu seinen Gästen. Es ist knapp zwei Jahre her, als es zwischen mir und Lena auseinanderging. Ich glaubte damals, nie wieder eine andere Frau lieben zu können, der Schmerz über die Trennung war gewaltig. Nachts konnte ich nicht mehr schlafen, hatte das Gefühl, ich stünde vor einem Abgrund. Als Lena mich verließ, war es gleichbedeutend mit dem Tod. Morgens wenn ich aufwachte, lag sie nicht mehr neben mir - es war, als stürzte ich in eine Finsternis, aus der ich niemals wieder herausfinden könnte. Daniel, dem ich all meinen Schmerz anvertraute und der sich jedes Detail meiner unglücklichen Liebe anhören musste, versuchte, mich dazu zu bewegen, sie zu vergessen. Er konnte nicht verstehen, dass ich nicht vergessen wollte, konnte nicht verstehen, warum ich diesen Schmerz nicht einfach wie ein Krebsgeschwür aus mir schneiden wollte. Ich war nicht in der Lage, in den Alltag zurückzukehren und Gespräche über belanglose Dinge zu führen. Ich fühlte mich wie ein Corpus, der erst ans Kreuz genagelt werden musste, um wieder Leben zu erlangen. Ich begriff durch die Liebe zum ersten Mal die Bedeutung des Wortes „Leidenschaft“. Jede noch so simple Nachricht, die ich von Lena bekam, packte ich in die Schatztruhe meiner Erinnerung, jede Phase, die wir zusammen verbrachten, versuchte ich neu zu interpretieren. Jedes Blatt an einem Baum, jeder Schmetterling, jede Knospe, die aufging, jedes Wolkenspiel am Himmel, jede Welle im Ozean hatte etwas mit ihr zu tun. Ich war verzweifelt, ich war unglücklich verliebt, ich spürte wie nie zuvor eine rasende Energie der Liebe in mir. Ich wollte das Chaos in mir wachsen lassen und dem gewohnten Gang den Rücken zukehren.
„Lass uns zu den anderen gehen“, fordert Daniel mich auf. Wir gehen hinaus.
Auch Daniel war einst unglücklich verliebt. Laura war sein Verhängnis und ist es wohl immer noch. Als sie ihn verließ, redeten wir viel über unsere verflossenen Lieben. Zu dieser Zeit trank er viel, er wollte einfach vergessen. Und eines Tages sah es auch so aus: Er hatte vergessen und fortan kam nie wieder ein Wort zu Laura über seine Lippen. Ich konnte nicht begreifen, wie schnell er über ein Ereignis, das ihn fast um den Verstand gebracht hatte, so schnell hinwegkommen konnte. Er hatte sie einfach, wie Kreide an einer Tafel, weggewischt und sich stattdessen in seine Arbeit vertieft. Möglicherweise waren unsere unglücklichen Lieben das Band, das uns zusammengehalten hatte und an jenem Tag zerriss, als er beschloss, in die Normalität zurückzukehren.
„Hast du eigentlich wieder was von Laura gehört“, frage ich ihn in einem plötzlichen Einfall, als wir zur Bar gehen. Er schaut mich an, wendet aber schnell wieder seinen Blick von mir ab und bestellt zwei Drinks. Zwei Gläser werden uns hingestellt. Er will, wie es scheint auf meine Frage nicht antworten, nimmt einen kräftigen Schluck.
„Warum fragst du mich?“
Ich zucke mit den Schultern.
„Warum willst du es mir nicht sagen?“, frage ich.
„Ich hab sie gestern getroffen.“
„Nein!“, rufe ich aus, als sei ich Zeuge eines Weltereignisses und nehme ebenfalls einen kräftigen Schluck von meinem Gin Tonic. „Erzähl! Erzähl mir alles!“
„Ja, gestern. Sylvie schlief schon. Ich saß lange vorm Computer, als ich dachte, ich müsste noch mal raus gehen. Also ging ich zum Kiez in die 'Toast Bar' – die kennst du doch.“
Ich nicke mit dem Kopf, klar kenne ich die Bar.
„Es war so gegen drei Uhr morgens … und da saß sie. Sie war schon ziemlich angetrunken, aber …“, er zündet sich eine Zigarette an.
„ … sie sah total toll aus. Vielleicht haben mich meine Sinne getäuscht, aber sie ist noch schöner geworden.“
„Verdammt!“, rufe ich dazwischen, er tut mir leid. Erst wollte er sie vergessen und nun das. Besser wäre es, sie wäre hässlicher geworden, dann käme er gut damit zurecht.
„Nun rede schon“, fordere ich ihn auf, „über was habt ihr euch unterhalten. Was macht sie so?“
„Wir haben gar nicht richtig geredet, sondern herumgealbert und getrunken und getrunken. Ich wurde besoffener und sie war es sowieso schon. Auf einmal stand sie auf und sagte zu mir: 'Komm lass uns tanzen. Wir haben nie zusammen getanzt'. Sie zog an meiner Hand, ich sollte ihr folgen. Neben dem Tresen legte ein DJ Musik auf und ich überwand mich – du weißt, ich tanze fürchterlich. Ich ließ mich darauf ein. Wir waren die einzigen Tanzenden. Die anderen wenigen Gäste saßen am Tresen, unterhielten sich oder schauten uns zu. Plötzlich spielte der DJ ein langsameres Stück. Laura kam auf mich zu, legte ihre Arme um meine Schulter und sagte mir, sie wolle mich führen. Früher wollte ich sie führen; nicht im Tanze, sondern durch das Leben und wollte für sie sorgen und ihr alles geben, was ich ihr geben konnte. Es war ein eigenartiges Gefühl, wie selbstbewusst sie sich gab. So kannte ich sie nicht. Es war, als sei sie nach unserer Trennung freier geworden. Verstehst du, was ich da empfunden habe? Fuck, dachte ich, ich hab sie mit meiner Liebe beengt. Jetzt war sie frei und jetzt führte sie mich … Ach, was bin ich bloß für ein schlechter Tänzer, ich trat ihr auf Füße, aber sie lachte nur. Und dann …“, er macht eine Pause, während ich ihm gespannt zuhöre.
„Ja, dann schaute sie mir in die Augen. Wir tanzten nicht mehr, wir standen uns still gegenüber. Verdammt … sie küsste mich … und wie … und ich küsste sie … und sie …“
„Und weiter? Nun rede doch weiter, was ist dann geschehen?“
Ich kann die Spannung kaum noch ertragen. Eine Katastrophe bahnt sich an, ein Erdbeben.
Seit über zwei Jahren ist er mit Sylvie zusammen. Nun ist sie schwanger. Wahrscheinlich hatte sie nach einem Vater für ihr Kind gesucht und geglaubt, ihn mit Daniel gefunden zu haben. Er hat ihr sicherlich nie was von Laura, seiner großen Liebe, verraten. Sie hätte es auch nicht verstanden. Ich mag Sylvie trotz ihrer leidenschaftslosen Eigenschaft. Ich mag ihr zartes Wesen, ihre hagere Gestalt, ihre leise, mitunter gebrochene, Stimme. Sie erweckt in mir das Gefühl, sie beschützen zu müssen. Beschützen vor irgendetwas, vielleicht vor einer kräftigen Windböe, oder vor der grausamen Wirklichkeit.
„Louis, du bist wie ein Teenie. Gibt es für dich nichts Wichtigeres als 'wer hat es mit wem und warum getrieben'? Nichts ist passiert. Ich bin zum Tresen gegangen, hab bezahlt und bin gegangen.“
„Du bist ein Ochse. Wirklich Daniel, ich könnte dich schlagen. Dann bin ich eben wie ein Teenie, die haben offensichtlich mehr Verstand als du. Deine Leidenschaft ist wie die einer Amöbe.“
„Ok. Willst du es hören: Es fiel mir schwer. Es schmerzte mich. Ich wollte mich nicht auf sie einlassen. Was soll der Scheiß? Soll ich wieder von vorne beginnen? Sylvie erwartet ein Kind von mir. Wie stellst du dir das vor?“
„Darum geht es nicht“, rede ich mich um Kopf und Kragen. Ich weiß, er hat recht. Er kann nicht eine schwangere Frau einfach im Stich lassen. Es geht nicht, er muss treu zu ihr stehen. Gerechtigkeit, was für ein nichtssagender Begriff. Sind denn Triebe nicht gerecht? Sylvie und das Baby in ihrem Bauch … gibt es keinen anderen Weg? Irgendetwas sträubt sich in mir, in solcher Kategorie, in solcher Rationalität, denken zu müssen.
„So? Worum geht es dann, Schlaumeier? Soll ich meinen Emotionen freien Raum lassen und …“
„Ja, genau das solltest du“, versuche ich den Faden aufzugreifen, „lass ihnen einfach freien Lauf. Du willst sie, das merke ich doch. An welchem Busen möchtest du jetzt lieber liegen? Du kennst die Antwort. Es sind Lauras Brüste, die du anfassen willst. Gib es zu, du wärst sehr viel glücklicher, wenn Laura die Mutter des Kindes wäre.“
„Es ist aber nicht so, und damit muss ich mich nun mal abfinden.“
„Abfinden? Du musst dich damit abfinden?“, entsetze ich mich. „Daniel, du redest wie ein Sterbender auf dem Totenbett, der keinen Ausweg mehr sieht. Stell dir vor, du würdest zu Sylvie sagen: 'ich muss mich mit dir abfinden …'“.
„Das sind doch Wortspielereien. Das würde ich niemals sagen.“
„Es ist doch wahr: Sylvie ist für dich das kleinere Übel.“
„Übel?“
„Ja, Übel“, setze ich fort, „denn das Beste wäre es gewesen, die Herausforderung anzunehmen und um die Wahrheit deiner Gefühle zu kämpfen.“
„Also gut“, entgegnet Daniel gefasst, „ich hätte es gestern Nacht so, wie du es meinst, machen können. Ich wäre nicht zum Tresen gegangen und hätte nicht voreilig bezahlt, sondern hätte mir einen erneuten Drink bestellt, mich auf den Barhocker gesetzt und sie gebeten, sich zu mir zu gesellen. Eng umschlungen hätten wir die Zeit, bis die Bar schließt, miteinander verbracht. Wir hätten uns weiter leidenschaftlich geküsst und – nichts hätte meine Triebe zügeln können, sie zu fragen, ob ich mit zu ihr nach Hause kommen dürfte. Sie wäre nicht abgeneigt gewesen, und zusammen wären wir in ihre Wohnung gegangen. Ich hätte sie ausgezogen, sie nackt an mich herangezogen … kurz - alles wäre nach dieser langen Zeit der Trennung,