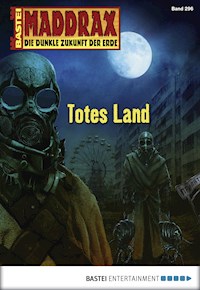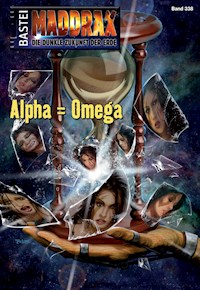1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Fall begann mit dem mysteriösen Tod des Buchhalters Robert Saul. Er war an einem Herzinfarkt gestorben. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch seine Leiche war mit alten Narben übersät, die er laut seiner medizinischen Akte wenige Tage zuvor nicht gehabt hatte. Nach und nach erfuhren Suko und ich, dass es mehrere merkwürdige Todesfälle dieser Art gegeben hatte - und schließlich führte die Spur zu Sinayra, die wir als ›Göttin des Vergessens‹ kannten, eine machtvolle Entität, die aus einer anderen Realitätsebene in unsere Welt eingedrungen war. Doch Sinayra war nicht einmal die wahre Bedrohung, wie wir feststellen mussten, als Suko und ich in eine grausige Albtraumwelt gezogen wurden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Im Bann der bösen Träume
Grüße aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Im Bann derbösen Träume
von Oliver Fröhlich
Sie hatte gedacht, die Flucht aus ihrem sterbenden Reich brächte alles zurück, was sie verloren hatte. Die Freiheit, das Leben, das Glück – und die Erinnerung. Ein schrecklicher Irrtum, wie sie inzwischen wusste.
Lange Zeit hatte man sie die Göttin des Vergessens genannt, dabei war sie alles andere als das. Nein, sie war keine Göttin. Sie war eine vom Schicksal Gezeichnete, eine Gestrandete, nun mehr denn je. Und sie drohte, sich selbst zu verlieren.
Aber wenn sie sich an eines erinnerte, dann an dies: Sie war auch eine Kämpferin. Also sagte sie sich einen Satz immer wieder vor.
»Mein Name ist Sinayra – und ich werde überdauern!«
Vom Buchhalter zum Walfänger, was für ein Karrierewechsel. Und eigentlich war er doch Buchhalter, oder? Robert Saul war sich nicht sicher.
Er lehnte sich auf die Reling des Segelschiffs und starrte übers Meer zum Horizont.
»Ey, Saukerl! Du wirst wohl kaum fürs Rumstehen bezahlt! Aber mich bezahlt man, um Faulpelze kielholen zu lassen!«
Sofort stand Robert stramm. Mit Kapitän Philbrick war nicht zu spaßen, das wusste er. Allerdings wusste er nicht, woher er das wusste. Schließlich war er eigentlich ... Er war ... Egal.
Der Betrieb auf einem Schiff funktionierte nur, wenn jeder diszipliniert seine Arbeit tat. Bei Verfehlungen drohten harte Strafen. Robert verspürte kein Verlangen, gefesselt unter dem Schiff von einer Rah zur anderen gezogen zu werden. Abhängig davon, wie viele raue Ablagerungen sich am Rumpf angesammelt hatten und wie groß der Pott war, endete das im besten Fall mit schweren Verletzungen, im schlimmsten mit dem Tod. Bei der Größe der ›Dream Job‹ ziemlich sicher mit Letzterem.
Also schnappte er sich den Mopp und wischte das Deck. Es musste stets sauber sein, denn beim Walfang kam es auf reibungslose Abläufe an. Das Tier jagen, erlegen, auseinandernehmen, verstauen und anschließend die Sauerei wegputzen, damit niemand auf den von Überresten glitschigen Planken ausrutschte, wenn der nächste Wal in Sicht kam.
Nur dass das Deck bereits vor Sauberkeit blitzte und sich seit Längerem kein Wal gezeigt hatte.
»Kapitän, Sir?«
Philbrick, der sich schon abgewendet hatte, drehte sich noch einmal zu ihm um und hob fragend eine Augenbraue.
»Glauben Sie, dass dies die beste Route ist?«, fragte Robert. »Wir haben seit Wochen keinen Fang gemacht.«
»Stellst du meine Kompetenz infrage?«
Robert stützte sich auf den Mopp. »Natürlich nicht. Aber wenn das so weitergeht, erfüllen wir die Quote nicht und bekommen kein Geld.«
»Möchtest du, dass ich das Unterfangen anpeitsche?«
Robert wunderte sich über die seltsame Formulierung, bejahte aber.
Als er wenige Minuten später an den Mast gefesselt war, wunderte er sich nicht mehr. Mit einer neunschwänzigen Katze in der Hand stand Philbrick hinter ihm und ließ Roberts Rücken die Lederriemen schmecken, während die versammelte Mannschaft zusah. Zusehen musste.
Zehn Schläge, weil Robert die Entscheidung des Kapitäns infrage gestellt hatte. Und noch mal zehn Schläge wegen Arbeitsverweigerung – jedenfalls hatte Philbrick das Aufstützen auf den Moppstiel so ausgelegt.
Stevenson, Roberts Freund, hatte ihm ein kleines Stück Holz zwischen die Zähne geklemmt, damit er sich nicht die Zunge abbiss. Der nächste Schlag traf, zerriss Haut, und ein dumpfer, qualvoller Laut zwängte sich an dem Beißholz vorbei.
Wie viele hatte er schon geschafft? Wie viele würden noch folgen? Robert wusste es nicht. Er versuchte, sich auf die Gesichter seiner Kameraden zu konzentrieren, während ihm jeder Hieb mehr und mehr Haut und Fleisch von den Knochen schälte. Er sah Bedauern in ihren Mienen, Mitgefühl, aber auch Schadenfreude oder einfach nur Erleichterung, dass es nicht sie traf.
Tränen trübten ihm die Sicht. Er sehnte sich nach der Umarmung der Ohnmacht, doch diese Gnade war ihm nicht vergönnt. Ein Schwall kaltes Wasser klatschte ihm ins Gesicht und riss ihn kurz aus der Lethargie, damit er die letzten Schläge bei vollem Bewusstsein mitbekam.
Er hörte das Knallen der Lederriemen, fühlte, wie sie durch rohes Fleisch pflügten, roch das Blut, roch seinen Schweiß – und spürte nach Sekunden der Unendlichkeit schließlich, wie sich die Fesseln lösten.
Robert Saul sank zu Boden.
Die Mannschaft säuberte und verband seine Wunden, so gut es ging. Allerdings nicht aus Nächstenliebe, sondern um ihn schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu bekommen ...
Tage verstrichen, in denen Robert Saul die ihm aufgetragenen Arbeiten mit gesenktem Kopf und vor Schmerz stöhnend erledigte. Seine Kameraden ignorierten ihn, oft wichen sie ihm sogar aus, als wäre er ein Aussätziger.
Das gehörte zur Strafe und würde erst enden, wenn der Nächste die Neunschwänzige zu spüren bekam. Die Schande des Nachfolgers rehabilitierte den Vorgänger.
Als er eines Tages wieder einmal die sauberen Planken des gespenstisch leeren Decks wischte, wurde ihm bewusst, dass er nicht hierhergehörte. Er war doch nur ...
... nur ...
Beinahe wäre ihm der Begriff eingefallen, aber er entglitt ihm. Jedenfalls war er kein Matrose, kein Walfänger. Also was, verdammt noch mal, tat er auf diesem Schiff? Und wie war er hergekommen? Was suchte jemand wie er auf dem Meer? Er hasste das Meer!
Ein absurder Gedanke schlich sich in sein Bewusstsein. Konnte es sein, dass er ...
... träumte?
Aber wieso fühlten sich dann die fast verheilten Wunden auf dem Rücken so echt an? Warum war der Schmerz so real? Nein, er musste sich irren. Und dennoch ...
Als hätte diese völlig falsche Welt um ihn nur auf diesen Moment des Zweifels gewartet, fiel ihm etwas unter der Wasseroberfläche auf. Ein Schatten. Endlich ein Wal?
Vergessen war die absonderliche Anwandlung, dass er nicht auf dieses Schiff gehörte. Er eilte zur Reling, starrte aufs Meer hinaus, hoffte, die Umrisse eines Wals zu erkennen.
Doch es war kein Wal. Der Schatten war zu schmal. Meterlang wandte er sich unter den sanften Wellen auf den Schiffsrumpf zu. Eine Seeschlange?
Robert versuchte, den Kopf des Tiers auszumachen, fand aber keinen. Stattdessen entdeckte er einen zweiten Körper, der sich neben den ersten schob. Oder nein, das waren ... O Gott! Diese riesigen Dinger waren Tentakel! Wie groß mochte dann die gesamte Kreatur sein?
Seine Finger krallten sich so fest an die Reling, dass die Knöchel weiß hervortraten. Er fühlte sich wie gelähmt.
Langsam hob sich eine Tentakelspitze aus dem Wasser. Selbst die kleinsten Saugnäpfe waren groß wie Handteller. Schmatzend hafteten sie sich am Schiffsbug fest.
Das Geräusch riss Robert aus der Schreckensstarre. Er rannte zur Alarmglocke an einem der Masten und schlug sie, so kräftig er konnte.
»Krake! Angriff!«
Verdammt! Warum bin ich allein auf Deck? Wieso sitzt niemand im Krähennest? Was ist das für ein Albtraum?
Eben das, schoss es ihm erneut durch den Sinn. Ein Albtraum.
Die Rippen schmerzten, und die tiefsten Peitschenstriemen rissen wieder auf und bluteten. Aber Robert gab nicht auf. Er zog am Glockenseil und schrie. Zog und schrie. Zog und schrie.
Endlich tauchte die Mannschaft auf. Robert hätte nicht sagen können, woher sie so plötzlich gekommen war.
Sofort stürzte Kapitän Philbrick an die Reling und beugte sich darüber. »Verflucht!«
Er sah Robert an, als hätte er den Kraken durch seine bloße Existenz angelockt. Hatte er das womöglich sogar? Schließlich war das hier nur ein ...
Ein Traum! Du musst nur aufwachen, dann ist die Gefahr vorüber. Wach auf!
Robert entglitt der Gedanke, als er Philbricks Ruf hörte. »An die Harpunen! Wenn wir einen Wal erlegen können, gelingt uns das auch bei diesem Vieh!«
Robert bezweifelte das, behielt es aber für sich.
Die Männer reihten sich mit ihren Waffen auf und schossen dorthin ins Wasser, wo sie den Kopf des Kraken vermuteten. Sie waren so konzentriert, dass sie nicht sahen, was Robert sah.
Mehrere Tentakel brachen auf der anderen Seite des Schiffs durch die Wasseroberfläche. Sie klatschten auf die Planken, tasteten umher, bekamen schließlich die Masten zu fassen und schlängelten sich beinahe liebevoll um sie.
Entsetzensschreie erklangen, nicht laut genug, um das bedrohliche Knirschen und Knacken der Planken zu übertönen.
»Das Schiff ist verloren!« Robert rannte zu den Beibooten. »Wir müssen fliehen!«
Ein paar Männer ließen ihre Waffen fallen und wollten in seine Richtung stürmen.
Philbrick trat ihnen in den Weg, das Gesicht rot vor Zorn. »Ihr geht nirgendwohin! Niemand verlässt mein Schiff!«
Unschlüssig sahen sich die Seeleute um. Einer bückte sich und hob die Harpune wieder auf.
In diesem Moment verstärkten die Tentakel ihren Griff um die Masten und zogen daran.
Langsam neigte sich das Schiff zur Seite. Wer sich nicht sofort irgendwo festhielt, schlitterte über das Deck auf das Meer zu – und auf das, was darin lauerte.
Robert konnte gerade noch den Rand des Ruderboots packen, da verlor er den Boden unter den Füßen, während sich das Deck immer weiter aufrichtete.
Rasch schmerzten ihm die Finger, an denen sein gesamtes Körpergewicht hing. Allmählich rutschte er ab. Nicht mehr lange, und er würde ins Meer stürzen.
Gerade als sich Robert mit seinem Ende abfand und damit, dass er wohl doch nicht in einem Traum gefangen war, gaben die Tentakel das Schiff frei. Mit einem lauten Platschen fiel es zurück in die Ausgangsposition.
Eine Sekunde lang geschah nichts.
Dann erklang das ungläubige Gelächter der Überlebenden. Wenige Augenblicke später lagen sich die Männer in den Armen. Sie hatten dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen.
Aber das hatten sie nicht. Und Robert wusste es, bevor es die anderen wahrhaben wollten. Ein Tier dieser Größe gab sich nicht mit zwei oder drei Häppchen zufrieden.
Robert packte seinen Freund Stevenson am Arm. »Hilf mir, das Boot zu Wasser zu lassen.«
»Diese Nussschale wird uns nicht retten.«
»Sie ist unsere einzige Chance.« Robert sah Stevenson durchdringend an. »Vielleicht ist sie gerade klein genug, dass der Krake sie für unwichtig hält und sich weiter um das Schiff kümmert.«
Stevenson hielt seinem Blick stand, dann nickte er.
Sie packten die Seile an den beiden Enden des Boots und ließen es über die Seilwinden im Gleichtakt hinab.
Gerade als es das Wasser berührte, schossen wieder Tentakel aus dem Meer.
Der Kopf des Kraken musste sich unterhalb des Walfängers befinden, denn die Bestie nahm das Schiff in eine tödliche Umarmung.
Robert sah Stevenson an. Der schien zu verstehen. Zeitgleich sprangen sie von Deck.
Der Aufprall im Beiboot presste ihnen die Luft aus den Lungen. Egal. Sie lebten. Nur das zählte.
Sie packten die Ruder. Mit kräftigen Schlägen entfernten sie sich Zug um Zug von dem Walfänger. Sie mussten genug Abstand gewinnen, damit sie der Sog nicht in die Tiefe riss, sobald der Krake das Schiff mit sich nahm.
Wie von Sinnen ruderten sie. Robert ignorierte den Schmerz in den Rippen. Wenn er das Paddel nicht genauso kräftig bewegte wie Stevenson, fuhren sie im Kreis und wären verloren.
Sie sprachen nicht, sahen nicht zurück.
Aber sie hörten das Bersten von Holz. Wahrscheinlich die Masten, die von den Tentakeln abgeknickt wurden. Dann schallten Schreie über das Wasser. Hysterische Laute im Angesicht des Todes.
Nicht umdrehen! Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Du musst nicht sehen, was dort passiert, um es zu wissen.
Die Wellen, die ihr Boot auf und ab hüpfen ließen, sprachen Bände, ebenso wie das Gurgeln, das nur von dem untergehenden Schiff stammen konnte.
Und dann war es still. Gespenstisch still.
In den ersten Stunden redeten sie nicht, sahen sich nicht an, starrten nur stumpf zum Horizont.
Schließlich brach Robert das Schweigen. »Wir sollten nachschauen, ob jemand überlebt hat.«
Die Angst, dass sich die Bestie aus der Tiefe einen Nachtisch holen könnte, verschwieg er.
Sie ruderten zurück. An der Unglücksstelle schwammen einzelne Holzbalken, ein Stück des Segels und ein paar Kisten. Das war alles, was von dem stolzen Schiff und seiner Besatzung übrig geblieben war.
»Es muss noch jemanden geben. Irgendwen!« Robert griff zum Paddel, um das Boot zu wenden und den Suchradius zu erweitern.
Sein Freund legte ihm behutsam die Hand auf den Arm. »Sie haben es nicht geschafft. Es wollte niemand auf dich hören. Und es hilft ihnen auch nicht, wenn wir uns weiter in Gefahr bringen. Der Krake könnte noch da sein, und ich möchte unseren Kameraden nicht in die finstere Tiefe folgen.«
Robert wusste, dass Stevenson recht hatte. Trotzdem wollte er nicht wahrhaben, dass all die Männer, mit denen er monatelang auf engstem Raum gelebt hatte, tot waren. Gut, um Philbrick war es nicht schade. Dennoch ...
»Wir sehen, ob wir etwas aus den Kisten verwenden können«, sagte Stevenson, »dann hauen wir ab, in Ordnung?«
Robert nickte wie betäubt.
In den Kisten war nichts. Nicht nur nichts, was ihnen geholfen hätte, sondern tatsächlich nichts. Leere Kisten. Aber wozu waren sie dann an Bord gewesen? Das ergab keinen Sinn. Es sei denn ...
Nein, die Wiederholung seines albernen Gedankens wollte er nicht mehr zulassen.
Das einzig Brauchbare, was sie fanden, waren zwei halb volle Wasserflaschen, die zwischen den Trümmern trieben. Sie fischten sie aus dem Meer.
»Was meinst du, in welcher Richtung das nächste Land liegt?«, fragte Robert.
Stevenson zuckte mit den Schultern. »Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind.«
»Dann müssen wir uns eben für eine Richtung entscheiden.« Robert atmete ein paarmal durch. »Wir fahren nach Osten. Auf die aufgehende Sonne zu. Möge sie uns ein gutes Omen sein. Und nachts orientieren wir uns am Polarstern. Abgemacht?«
Stevenson sank erschöpft zurück. »Einverstanden.«
Zuerst schliefen sie abwechselnd, um zu Kräften zu kommen. Dann ruderten sie. Dabei behielten sie ihre Umgebung stets im Auge. Bei jedem Schatten, bei jeder unnatürlichen Kräuselung der Meeresoberfläche beschleunigte sich ihr Puls.
Doch der Krake zeigte sich nicht mehr.
Am Anfang sprachen sie viel. Über ihre Rettung. Und dass sie immer noch besser dran waren als die anderen, die Toten.
Das Boot war mit zwei Harpunen ausgestattet. Sie rammten die mit Widerhaken versehenen Speere ins Wasser, fingen jedoch nichts.
Dann klarte sich der – wie Robert erst jetzt bemerkte – bisher verhangene Himmel auf. Zuerst freuten sie sich. Denn nur wenn sie die Sonne sahen, konnten sie sich an ihr orientieren.
Aber mit der Sonne kam der Durst. Und weil sie nichts auf dem Boot hatten, worunter sie sich hätten verstecken können, verbrannte sie ihnen die Haut, bis sie Blasen warf.
»Immerhin sind deine Wunden am Rücken fast ganz verheilt«, meinte Stevenson. »Die Damen werden ganz versessen auf die Geschichte sein, wenn du mit solchen Narben nach Hause kommst.«
»Falls wir nach Hause kommen«, murmelte Robert.
Doch die Hoffnung war alles, was ihnen blieb. Sie durften sie nicht verlieren.
Eines Morgens erwachte Robert von einem Schluchzen. Stevenson saß am anderen Ende des Bootes, das Gesicht in den Händen vergraben. Seine sonnenverbrannten Schultern zuckten.
»Was ist los?«, fragte Robert.
»Ich habe den letzten Schluck getrunken. Es ist alles weg.«
In Roberts Flasche war ebenfalls nur noch ein klägliches Rinnsal, das nicht einmal mehr ganz den Boden bedeckte. Er gönnte sich eine Winzigkeit davon und reichte den Rest an seinen Freund.
Der benetzte die Lippen mit den letzten Tropfen.
Wieder verging ein Tag, und schließlich stand wieder die Sonne am Himmel. So unerbittlich wie ihre Strahlen auf der Haut brannte auch Roberts Kehle.
Überall Wasser, aber nichts zu trinken.
Er fühlte sich schlapp, so schlapp. Immer wieder döste er ein.
Er wachte auf, als sich das Boot neigte. Stevenson hatte sich hinausgebeugt und trank von dem Salzwasser.
»Nicht!« Roberts Schrei war nicht mehr als ein Keuchen.
Sein Freund ließ das Wasser von den Lippen tröpfeln. »Ich nehme es nur in den Mund und hoffe, dass mein Körper die Feuchtigkeit aufnimmt.«
»Funktioniert es?«
»Nein. Der Durst wird nur schlimmer.« Stevenson ließ sich wieder ins Boot sinken und vergrub das Gesicht in den Händen.
Wäre es nicht windstill gewesen, hätten sie einander kaum mehr verstanden. Sie hauchten die Worte nur noch aus ihren trockenen Kehlen.
Roberts Speichel verdickte sich und schmeckte abstoßend. Die Zunge klebte am Gaumen und an den Zähnen. Dennoch konnten sie nicht aufhören, über ihren Durst zu reden. Kein anderer Gedanke als der an Trinkwasser beherrschte sie.
Irgendwann war Roberts Hals so rau, dass er kein Wort mehr herausbrachte. Ein Knäuel aus trockenen, kratzigen Tüchern schien ihm in der Kehle zu sitzen, das er verzweifelt wegzuschlucken versuchte. Aber mit dem sirupartigen Speichel gelang das nicht.
Er glaubte, Stimmen zu hören, war sich jedoch nie sicher, ob jemand mit ihm sprach oder ein Vogel über ihnen kreischte. Beides wäre ein gutes Zeichen gewesen, ein Zeichen von Rettung. Aber vielleicht halluzinierte er auch schon.
Oder ich träume. Immer noch ...
Seine Zunge fühlte sich mittlerweile an, als gehörte sie nicht zu ihm. Als hätte ihm jemand ein Stück Dörrfleisch in den Mund gelegt.
An diesem Punkt hielt er es nicht mehr aus. Er lehnte sich aus dem Boot und trank und trank und trank.
»Nicht ...«, hauchte Stevenson.
Doch Robert konnte nicht anders. Schluck um Schluck saugte er gierig in sich hinein.
Und dann sah er es wieder. Schlangenartige Schatten unter der Wasseroberfläche.
Möge der Krake uns holen und unser Leid beenden, dachte Robert. Er war sich mittlerweile sicher, dass all jenen mehr Gnade widerfahren war, die ihr Leben bereits beim Schiffsuntergang verloren hatten. Der Tod war nah, das wusste er nun, aber er kam qualvoll langsamer als bei den Kameraden.
Ein Harpunenspeer fiel an ihm vorbei. Stevenson hatte wohl versucht, ihn zu werfen, doch zu mehr reichte seine Kraft nicht. Der Tentakelarm – wenn er denn überhaupt dagewesen war – verschwand.
Robert sank zurück ins Boot und wartete auf das Ende. Aber es kam nicht.
Minuten vergingen, dann Stunden. Das Innere seines Mundes schmerzte mehr als sein Rücken beim Auspeitschen.
Und als Robert begriff, dass es noch immer nicht vorbei war, dass der Krake sie verschont – bestraft! – hatte, weinte er.