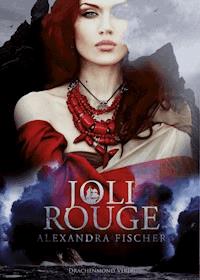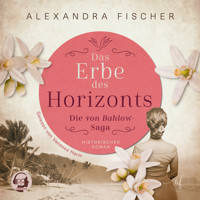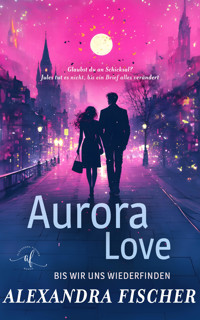4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Liebesroman ist so tiefgründig wie das Meer, so stürmisch wie der Wind und so unvergesslich wie ein Sonnenuntergang auf Hawaii! Ein Buch für Romantiker und solche, die es noch werden wollen. Sommer 2004: Nach dem spurlosen Verschwinden ihrer Schwester verbringt Allie die Ferien bei ihren Großeltern auf Kauai – und trifft Kale. Ein Junge, der das Meer mehr liebt als alles andere. Doch während Allie Wasser eher meidet, fühlt sie sich auf seltsame Weise mit ihm verbunden. Sommer für Sommer kehrt sie zurück und aus zaghaften Gefühlen wird eine Liebe, die so endlos scheint wie der Ozean. Doch Kale ist Apnoetaucher – je tiefer er taucht, desto weiter entfernt er sich von ihr. Während Allie darum kämpft, ihn nicht zu verlieren, muss sie sich fragen: Kann sie jemanden lieben, der immer auf der Suche nach der Tiefe ist? Oder ist es an der Zeit, ihn loszulassen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
IMPRESSUM
Coming of Age | Liebesroman
Copyright © 2021 Alexandra Fischer
All rights reserved
Alexandra Fischer
c/o COCENTER
Koppoldstr. 1
86551 Aichach
www.wortfischerin.de
Innenseitengestaltung:
depositphotos.com | © Polyudova, © Baksiabat
Coverdesign: © missuppercover.com | Andrea Janas unter Verwendung eines Motivs von © thorstenhenning.de
INHALT
Charakter des Buches
Meine erste Begegnung mit Kale
Sommer 2004
Mein erster Abschied von Kale
Sommer 2004
Mein erstes Wiedersehen mit Kale
Sommer 2005
Mein erster Kuss mit Kale
Sommer 2005
Mein erstes Thanksgiving mit Kale
Herbst 2005
Meine erste Party mit Kale
Sommer 2007
Mein erstes „Ich liebe dich“ mit Kale
Sommer 2007
Mein erstes Mal mit Kale
Sommer 2009
Mein erster Wettkampf mit Kale
Sommer 2009
Meine erste Bewährungsprobe mit Kale
Sommer 2010
Mein erstes Silvester mit Kale
Winter 2011
Meine erste Krise mit Kale
Sommer 2013
Mein erster Kampf um Kale
Sommer 2016
Mein erstes Wiederfinden mit Kale
Sommer 2017
Mein erstes bedeutendes Versprechen mit Kale
Sommer 2018
Epilog
Du möchtest gleich in das nächste romantische Buch eintauchen?
Nachwort
Wettkampfdisziplinen des Apnoesports
Rezept für Kokosnuss Cupcakes á la Coconut House
Über die Autorin
CHARAKTER DES BUCHES
WAS DARF DER/DIE LESER/IN ERWARTEN?
Genre: Coming of Age | Liebesroman
Erzählweise: Ich-Perspektive aus Sicht der Hauptprotagonistin in der Vergangenheit
Stimmung: Ruhig, gefühlvoll, romantisch, langsame Entwicklung der Charaktere, Schwerpunkt auf Familie und Beziehung
Zeitspanne: 2004 - 2019
Alter der Hauptprotagonisten: 12 - 27
Handlungsort: hauptsächlich USA (Hawaii)
Einzelband/Serie: in sich abgeschlossener Einzelband
Triggerwarnung: keine
Zeitsprünge: vorhanden
Dramaelemente: vorhanden
Erotikelemente: nicht vorhanden
Thriller-/Krimielemente: nicht vorhanden
LGBTQ-Elemente: nicht vorhanden
Cliffhanger: nicht vorhanden
Happy/Unhappy Ending: Happy Ending
Meet Allie & Kale:
Statistisch gesehen macht der Mensch in seinem Leben eine halbe Milliarde Atemzüge. Den wenigsten davon schenkt er Beachtung, bis auf ein paar wenige, die für ihn wirklich von Bedeutung sind.
MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT KALE
ODER: KOKOSNÜSSE SIND SCHEISSE
SOMMER 2004
Wie viele erste Male gab es in eurem Leben? Hundert? Tausend? Vielleicht mehr? Viele erste Male merken wir uns nicht, andere aber schon. Sie brennen sich in unser Gedächtnis ein und bleiben dort für immer. Dies ist die Geschichte meiner ersten Male mit Kale. Manche davon waren wundervoll, andere traurig und bei einigen war ich einfach nur scheißwütend auf ihn. Trotzdem wird er für mich immer der eine Mensch sein, den ich am meisten liebe. Für jeden seiner Atemzüge.
Alles begann auf Hawaii, genauer gesagt auf der Insel Kauai, wo Kale in mein Leben fiel. Buchstäblich. Er stürzte von einer Kokospalme direkt vor meine Füße. Eine Kokosnuss donnerte hinterher und verfehlte mich um Haaresbreite. Es war der Sommer, den ich bei meinen Großeltern verbrachte, und in diesem Moment war ich alles andere als begeistert über unser erstes Zusammentreffen. Kale erwischte mich in einem Augenblick, in dem ich allein sein wollte. Das war ihm aber egal.
»Ups«, sagte er und grinste.
Mein Blick wanderte von der Vertiefung im Sand, den die Kokosnuss hinterlassen hatte, zu dem Jungen mit den wuscheligen, braunen Haaren und weiter zum Meer. Ich wischte meine Tränen fort. Bis gerade eben war ich noch traurig gewesen. Jetzt fühlte ich Scham, weil mich ein Junge in meinem Alter weinen sah.
»Was soll das?«, fuhr ich ihn an, um das Gefühl der Unsicherheit zu überspielen.
Er spreizte Daumen und kleinen Finger seiner rechten Hand ab und erwiderte: »Aloha, Schwester. Bist du vom Festland?« Mit einer geschmeidigen Bewegung sprang er zurück auf die Beine, schnappte sich die grüne Kokosnuss und warf sie von einer Hand in die andere. Sein Oberkörper war nackt und er trug eine rote Badehose, die aussah wie die von David Hasselhoff in Baywatch. Ansonsten mutete er wie ein typischer Hawaiianer an. Damals war er noch nicht besonders groß, aber er war braungebrannt, hatte mandelförmige Augen und ein Dauerlächeln im Gesicht, das ich in diesem Moment nur schwer ertragen konnte. Wortlos setzte ich meinen Weg fort.
»Wollen wir die Kokosnuss zusammen essen?«, rief er mir hinterher, doch ich schüttelte den Kopf.
Ehe ich mich versah, folgte er mir. »Wo kommst du her?«, wollte er wissen.
Ich sah zur Seite. Die Tränen brannten noch immer hinter meinen Augenlidern und machten mich beinahe blind.
»Kalifornien?«
Ich schwieg.
»Ostküste vielleicht? New York? Du bist ziemlich blass.«
Ich schnaubte. Warum glaubten Hawaiianer eigentlich, dass nur über ihren Inseln die Sonne schien?
»Kanada?« Er hörte nicht auf, Fragen zu stellen.
»Scottsdale«, presste ich schließlich hervor, damit er aufhörte. Ich wollte für mich sein. Nur deshalb war ich zum Strand gegangen. Im Haus meiner Großeltern herrschte ständig Betrieb. Sie führten das Coconut House, ein Bed & Breakfast mit insgesamt sieben Zimmern, und ein angeschlossenes, kleines Restaurant direkt am Poipu Beach.
»Scottsdale in Arizona?«, hörte ich Kales Stimme neben mir. »Du kommst aus der Wüste?«
»Na und?« Zum ersten Mal sah ich ihm direkt ins Gesicht. »Bin ich dir zu blass dafür?«
»Ein bisschen.« Er lächelte. Schon wieder. »Aber vielleicht sind Rothaarige einfach blass.«
»Ich benutze einen hohen Lichtschutzfaktor. Außerdem bin ich blond«, widersprach ich. Mein Großvater nannte mich Melemele, das war der hawaiianische Ausdruck für die Farbe Gelb oder auch für eine Blondine.
»Du bist definitiv nicht blond.«
»Und du bist definitiv nervig.« Ich beschleunigte meine Schritte. Meine Tränen waren versiegt.
»Hey!« Kale holte auf und stellte sich mir in den Weg. »Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«
Ich ließ mich von ihm nicht aufhalten und ging zielstrebig auf das Haus meiner Großeltern zu. In der Ferne sah ich es bereits. Es war ein typisches weißes Cottage im Plantagen-Stil, wie man es hier öfter sah, mit umlaufender, überdachter Veranda und Möbeln aus Bambusholz. Vor dem Restaurant steckten Surfbretter im Sand. Es war Happy Hour, der Teil des Tages, den die Touristen meist mit einem von Grandmas berühmten Cocktails ausklingen ließen.
»Ich bin übrigens Kale.« Ich wurde die Nervensäge einfach nicht los. Kale. Niemand auf meiner Schule hieß so. Bei uns gab es Michaels, Christophers, Matthews und Joshuas, aber keinen einzigen Kale.
Wir kamen dem Coconut House immer näher. »Ich weiß, wer du bist«, rief Kale in meinem Rücken. »Du bist Allie. Die Enkelin von Leilani und John. Du hast dieselben roten Haare wie dein Opa!«
Ich verdrehte die Augen und sprang auf die erhöhte Holzterrasse. War diese Insel tatsächlich so klein, dass jeder jeden kannte? In Scottsdale kannten wir nicht einmal die Leute, die in der nächsten Querstraße unseres Viertels lebten.
»Aloha, Melemele.« Mein Grandpa stand hinter der Bar und zwinkerte mir zu. »Limonade?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Kokosnusswasser?«
»Kokosnüsse sind scheiße!« Ich betrat das Innere des Hauses und rannte die Treppen nach oben in den zweiten Stock. Mein winziges Zimmer lag unter dem Dach, direkt neben dem Schlafzimmer meiner Großeltern. An den Wänden hingen so viele gerahmte Fotos, dass man die geblümte Tapete kaum noch erkennen konnte. Abends, wenn ich im Bett lag, kniff ich die Augen fest zusammen, um all die Fotos nicht ansehen zu müssen. Es kam mir vor, als würde mich meine gesamte Verwandtschaft beim Schlafen beobachten. Sogar der Teil, der schon tot war. Ich hatte bereits gefragt, ob wir die Bilder während meines Aufenthalts nicht abhängen könnten, aber meine Großeltern hielten nicht viel davon. Sie sagten, das würde die Ahnen beleidigen. Ohana war etwas Gutes, erklärte mir mein Grandpa. Ohana bedeutete Familie und Familie war ein ewiger Kreislauf. Doch ich fragte mich, wie jemand, der schon gar nicht mehr am Leben war, noch Familie sein konnte.
Ich schloss die Tür hinter mir und stellte mich ans Fenster. Von hier oben hatte ich einen coolen Blick über den Strand. Kale war noch immer da, wo ich ihn stehengelassen hatte. Inzwischen hockte er im Sand und trank aus der geöffneten Kokosnuss. Ich schämte mich ein bisschen, weil ich so fies zu ihm gewesen war, aber es machte mich fertig, dass ich nie allein sein konnte. Seit ich vor einer Woche bei meinen Großeltern angekommen war, hatten sie mich ständig zu irgendwelchen Tanten, Onkels oder entfernten Cousinen geschleppt. Ich hasste es, mich andauernd vorstellen zu müssen und dann zu hören, dass wir uns schon gesehen hatten und ich mich nur nicht daran erinnern konnte. Ich wollte nicht mehr lächeln und freundlich sein, weil ich am liebsten jeden angeschrien hätte. Alle taten so, als wäre nichts passiert, als wäre ich einfach so ohne meine Eltern zu Besuch gekommen. Keiner verlor ein Wort über meine Schwester oder darüber, dass Tara seit drei Monaten spurlos verschwunden war. Ich drehte dem Fenster den Rücken zu und starrte die Fotos an der Wand an. Irgendwo dort zwischen all den fröhlichen Hawaiianern hing auch ein Bild von uns beiden. Ich hatte es noch nicht gesucht, seit ich hier angekommen war, aber ich wusste, es war da. Ich konnte mich daran erinnern, wie Tara es mit Grandma gerahmt und dann aufgehängt hatte. Das war vor vier Jahren gewesen. Damals war Tara zwölf Jahre alt gewesen und damit ebenso alt wie ich jetzt. Wer hätte gedacht, dass das unser letzter gemeinsamer Urlaub auf Kauai gewesen war?
Ich spürte die Beklemmung in meiner Brust und suchte die Wand ab. Da waren wir! Melemele und Nani, wie Grandpa uns nannte. Zwei lachende Schwestern in einem hellblauen Rahmen. Hinter uns glitzerte das Meer und wir trugen Frangipaniblüten in den sonnengebleichten Haaren. Unsere honigbraunen Augen blitzten übermütig und wir sahen unbeschwert aus. Ich war es zu dem Zeitpunkt zumindest gewesen. Aber war es Tara ebenfalls? Ich nahm das Foto von der Wand und starrte es an. Seit meine Schwester verschwunden war, stellte ich alles infrage. Unsere Streiche, die wir ausgeheckt hatten, unsere Streits, die wir gehabt hatten und in denen es meist um irgendwelches Spielzeug gegangen war, und jene Momente, in denen wir uns im Dunklen unter der Bettdecke verkrochen und uns Gruselgeschichten erzählt hatten. Ich hatte immer geglaubt, ich würde sie kennen. Bis zu jenem Tag, an dem sie plötzlich nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen war. Es klopfte an der Tür und ich hängte das Bild rasch zurück an die Wand.
»Was ist mit dir, Melemele?« Meine Grandma Leilani wackelte ins Zimmer. Sie war rund wie eine Kokosnuss und hatte stets ein Lächeln auf ihren Lippen. Ihre Haare waren noch nicht völlig ergraut und glänzende schwarze Strähnen schoben sich zwischen das Silbergrau. Mein Grandpa sagte gerne, das ließe sie aussehen wie ein Stinktier. Damit brachte er Leilani regelmäßig zum Lachen. Ich hatte es immer süß gefunden, dass sich die beiden ständig neckten, aber momentan hatte ich andere Dinge im Kopf.
»Es ist alles in Ordnung.« Ich zuckte die Schultern. Es war schwer, jemandem seine Trauer zu vermitteln, der immer gutgelaunt war.
»Hast du Hunger nach deinem Spaziergang?« Sie öffnete die Tür ein Stückchen weiter und die Gerüche des Restaurants wehten mir in die Nase. Grandpas Spezialität war Huli Huli Chicken. Es klang lustig und schmeckte unglaublich lecker. Ich aß es fast jeden Abend.
»Du hast Kale kennengelernt?« Meine Grandma deutete mit dem Kinn aus dem Fenster und ich nickte langsam. Ich wusste, dass meine Großeltern wollten, dass ich hier Anschluss fand. Acht Wochen Sommerferien waren eine lange Zeit. Das war auch der Grund, warum sie mich all meinen Großcousinen vorstellten. Ich sollte nicht allein sein. Aber sie ahnten nicht, dass ich mich danach sehnte.
»Kale ist keiki o ke kai.«
Ich musste lächeln. Hawaiianisch klang niedlich. Mein Vater hatte es versäumt, uns die Sprache näherzubringen, daher verstand ich so gut wie gar nichts. »Was bedeutet das?«, erkundigte ich mich und beobachtete Kale durchs Fenster hindurch. Er kratzte das Fruchtfleisch aus dem Inneren der Nuss, stopfte es sich in den Mund und warf die Schalen ins Gebüsch. Dann schlenderte er in Richtung Meer. Als er dort ankam, hechtete er in die Wellen und entschwand meinen Blicken.
»Kale ist ein Kind des Ozeans.« Auf meinen fragenden Blick fügte Grandma hinzu: »Du wirst es herausfinden, wenn du ihn näher kennenlernst.« Es klang geheimnisvoll.
»Das sagst du nur, um mich neugierig zu machen«, bemerkte ich.
»Wirkt’s?«
»Nein.« Das tat es doch. Ein bisschen zumindest. Aber das wollte ich nicht zugeben.
»Kommst du jetzt mit nach unten zum Essen?« Grandma berührte mich an der Schulter.
»Okay.« Ein letztes Mal blickte ich aufs Meer, doch Kale war nirgends mehr zu sehen.
Ich folgte Grandma ins Restaurant. Auf dem kleinen Fernseher über der Bar lief eine Zusammenfassung der Olympischen Sommerspiele in Athen und ein Großteil der Gäste starrte gebannt auf den Bildschirm. Michael Phelps hatte im 400-Meter Freistil der Männer die erste Goldmedaille für die USA geholt. Man sah ihn auf dem Gewinnerpodest stehen, im Hintergrund lief die amerikanische Nationalhymne.
»Ke aloha!«, rief mein Grandpa in die Runde und alle hoben ihre Gläser und jubelten.
»Wir haben gewonnen«, freute sich Grandma und schob mir einen Stuhl an den Familientisch. Ich setzte mich. Der Familientisch war der größte Tisch im Restaurant. Er stand in der Mitte des Raums und war immer besetzt, denn jeden Abend kam irgendjemand aus der riesigen Familie meiner Großeltern zum Essen vorbei. An diesem Abend war meine Großtante mit ihren beiden Töchtern und deren Kindern anwesend. Ich war ihnen bereits vorgestellt worden, doch ich wusste schon längst nicht mehr, wie sie alle hießen. Also beschränkte ich mich darauf, freundlich zu lächeln, und aß mein Huli Huli Chicken mit Kartoffelbrei. Um mich herum wurde gelacht und gescherzt und ich kam mir vor, als säße ich in einer riesigen Blase, durch die der ganze Lärm nur gedämpft zu mir drang. Gerade, als ich mit dem Essen fertig war, kam Grandpa zu mir.
»Emily ist am Telefon«, sagte er.
Erleichtert darüber, eine Entschuldigung zum Gehen zu finden, stand ich auf und spazierte in das kleine Zimmer hinter dem Restaurant, das Rezeption, Büro und Aktenzimmer in einem war. Der Lärm wurde weniger und ich fixierte den Hörer, der neben dem Telefon lag. Emily war meine Mutter. Grandpa hatte keinen Spitznamen für sie, so wie er es für mich und Tara hatte. Für ihn war meine Mutter einfach nur Emily.
Ich nahm den Hörer in die Hand. »Hallo«, sagte ich und hörte das Rauschen in der Leitung. Es war, als würde der Ozean zu mir sprechen.
»Wie geht es dir?« Die Stimme meiner Mutter durchbrach das Rauschen. Sie klang weit entfernt und genauso mutlos wie vor einer Woche. Also hatten sie immer noch nichts von Tara gehört.
»Gut.«
»Gefällt es dir bei Oma und Opa?«
»Ja.«
»Bist du viel am Strand?«
»Ja.«
»Benutzt du auch die Sonnencreme, die ich dir mitgegeben habe?«
»Ja.« Ich war einsilbig, weil ich ihre Fragen nicht leiden konnte. Damit überspielten wir nur das eine Thema, um das sich seit drei Monaten alles drehte.
»Hast du schon Freunde gefunden?«
»Nö.« Ich sagte es trotzig, um sie zu ärgern. Eigentlich hätte ich ins Sommercamp fahren sollen. Alle meine Freunde waren dort und ich verübelte meiner Mutter, dass sie mich abgemeldet und mich stattdessen zu meinen Großeltern nach Hawaii geschickt hatte. Ich verstand noch immer nicht, was ich hier sollte.
»Kocht Opa dir jeden Tag etwas Gutes?«
»Mhm.«
»Möchtest du noch mit Chris reden?«
»Mhm.« Ich hörte, wie sie den Hörer weiterreichte und die dunkle Stimme meines Vaters erklang.
»Melemele, pehea ’oe?«
»Gut.« Ich seufzte. »Du musst nicht Hawaiianisch mit mir reden, Paps. Ich verstehe nichts.«
»Du verstehst mehr, als du zugibst. Sonst hättest du mir nicht geantwortet. Und wir sprechen übrigens Pidgin.«
»Was auch immer.«
Ich hörte ihn leise lachen. »Was macht deine Verwandtschaft?«, erkundigte er sich. »Hast du schon deine tausend Großcousinen und deine ananasförmigen Tanten getroffen?« Ich musste wider Willen grinsen. Mein Vater war der Spaßvogel unserer Familie. Damit ging er meiner Mutter manchmal gehörig auf die Nerven. Ich dagegen mochte seine Witze.
»Warum kommst du nicht her?«, bettelte ich. »Wir könnten eine Zipline Tour machen, so wie beim letzten Mal. Oder Kajak fahren.«
»Das werden wir wieder tun, Melemele. Versprochen!«
»Wann?«
Er schwieg und ich spürte seine Anspannung durchs Telefon hindurch.
»Gibt es was Neues?«, fragte ich.
»Nein. Nichts.«
Es war wie ein kleiner Pikser ins Herz. Einer von so vielen in den letzten drei Monaten. »Aber sie kommt doch wieder?« Ich stockte, weil ich nicht aussprechen wollte, was mir noch durch den Kopf ging.
»Natürlich.« Mein Vater räusperte sich. »Wir werden sie finden, Melemele.«
Ich hörte, wie meine Mutter ihm etwas zuflüsterte und mein Vater sagte zu mir: »Holst du mal John ans Telefon, mein Schatz?«
»Klar.« Ich legte den Hörer zur Seite und ging ins Restaurant. »Grandpa.« Energisch zupfte ich an seinem Ärmel und er wandte sich von den Gästen ab, die er gerade bediente. »Paps möchte dich sprechen.«
»Ich komme.« Er entschuldigte sich bei den Gästen und ließ mich stehen. Das Gelächter und die Unterhaltungen der Leute schlugen über mir zusammen. Es gab nichts Neues. Tara war noch immer fort. Vom Erdboden verschluckt. Verschollen. Unauffindbar. Vielleicht … tot. Ich schluckte und redete mir ein, dass ich das spüren müsste. Wir waren Schwestern. Zwischen uns bestand eine Verbindung. So war es doch, oder? Ich blieb unschlüssig stehen und wartete, bis Grandpa zurückkam.
»Was hat Paps gesagt?«, wollte ich wissen.
Er sah mich lange an und strich mir übers Haar. »Nichts Wichtiges, Melemele. Er wünscht uns einen fantastischen Sommer.« Das klang, als hätten meine Eltern nicht vor, sich allzu oft bei mir zu melden. Grandpa schien meinen geknickten Gesichtsausdruck zu bemerken und fügte hinzu: »Kommst du morgen früh mit mir auf den Fischmarkt nach Kilauea?«
Ich nickte langsam. Vor mir lagen sieben weitere Wochen ohne meine Freunde. Da konnte ich genauso gut toten Fisch anstarren. »Ich gehe ins Bett.«
»Jetzt schon?« Er winkte weiteren Gästen zu, die das Restaurant betraten. »Es ist nicht einmal acht Uhr. Setz dich doch noch ein wenig an unseren Familientisch.«
»Ich bin müde«, log ich, um dem Trubel zu entgehen.
»In Ordnung. Aloha po, Melemele.«
»Dir auch po und so, Grandpa.« Ich lächelte, als er mir einen Nasenstüber gab, und ging zurück auf mein Zimmer. Draußen war es schon dunkel und die Fackeln vor dem Eingang des Restaurants erhellten einen Teil des Strands. Der Ozean war nicht mehr zu sehen, aber ich konnte ihn hören. Zwischen dem Stimmengewirr der Gäste drang das Rauschen der heranbrechenden Wellen zu mir. Ich öffnete das Fenster ein stückweit und legte mich aufs Bett. Mein Blick schweifte über die Fotos an den Wänden.
»Findest du mich hübsch?«, hörte ich Taras Stimme in meiner Erinnerung.
»Klar.« Ich war erst sechs Jahre alt gewesen, als sie mir eines Tages diese Frage gestellt hatte, und ich konnte nicht verstehen, wieso meine Schwester Zweifel hegte. Sie war mein Idol. Ein blonder Engel, der genauso aussah wie der Glücksbringer am Rückspiegel im Auto unserer Eltern. Ich wollte wie Tara sein. Deshalb trug ich dieselben rosa Glitzerhaarspangen wie sie, tupfte Erdbeer-Lipgloss auf meine Lippen und bevorzugte die Frühlingstöne der Revlon Nagellackkollektion. Als Tara ein Tamagotchi bekam, wollte ich ebenfalls eins. Aber nur in derselben Farbe. Wir hatten auch Dutzende von Beanie Babys. Alle in doppelter Ausführung. Es war, als wären wir Zwillinge, obwohl ich mich neben meiner superschlanken Schwester selbst wie ein rundes Beanie Baby fühlte.
»Findest du, ich habe Ähnlichkeit mit Alicia Silverstone?«
»Klar.«
»Ist das alles, was du sagen kannst, Allie?« Tara feuerte ihre Bürste in die Ecke und sah mich dabei böse an.
»Was ist denn?« Ich verstand nicht, warum sie plötzlich wütend auf mich war.
»Mama sagt, ich muss mich mehr bemühen.« Tara betrachtete sich im Spiegel. »Sie sagt, sonst nimmt man mich nicht für die Werbeanzeige.«
Ich kicherte, weil ich es lustig fand, dass meine Schwester vielleicht bald das Aushängeschild für eine große Frühstücksflockenfirma sein sollte.
»Was ist daran so witzig?« Tara verzog den Mund.
»Du bist witzig«, sagte ich und zog eine unserer Barbiepuppen aus dem Regal. »Lass uns spielen.«
»Nein!« Tara vergrub ihr Gesicht in den Händen, bevor sie sich zu mir umdrehte. »Komm her.« Ich ging zu ihr und setzte mich auf ihren Schoss. Tara entfernte meine Haarspangen und glättete mir die Haare mit einem Kamm. »Du kannst froh sein, dass du nicht so blond bist wie ich«, bemerkte sie. »Mama mag deine Haarfarbe nicht.«
»Wieso?« Es versetzte mir einen Stich, dass Tara so etwas sagte. Auch wenn ich es nicht zugeben wollte, tat es mir weh, dass unsere Mutter Tara stets mehr Aufmerksamkeit zukommen ließ als mir.
»Du bist erdbeerblond«, erklärte mir meine Schwester und hielt eine meiner Haarsträhnen gegen eine von ihren. »Siehst du? Da ist ein Hauch von Rot drin.«
»Sehe ich nicht.« Ich schüttelte den Kopf und betrachtete all die Dinge, die vor Tara auf dem Tisch standen. Gedankenverloren spielte ich mit den Cremetuben und den Döschen mit der Glitzerschrift.
»Lass das!« Tara hielt mich davon ab. Im Spiegel sahen wir einander an. »Und hör auf, meine Nagellacke zu benutzen.«
»Aber sie sind hübsch.«
»Du brauchst das nicht, hörst du? Du brauchst gar nichts davon.«
»Aber ich …«
»Nein, Allie! Du bist hübsch. Genauso, wie du bist.«
Ich war geschmeichelt, weil Tara mir sagte, dass ich hübsch war und gleichzeitig war ich entsetzt über ihren strengen Tonfall. Bisher hatte ich alle ihre Sachen verwenden dürfen. Mam bestand darauf, dass Tara sich stets hübsch machte. Warum sollte ich das nicht tun?
»Wollen wir jetzt spielen?«, fragte ich, um meine Schwester aufzuheitern. Ich wusste, wie gerne sie mit ihren Barbiepuppen spielte.
»Ich kann nicht.« Tara hob mich von ihrem Schoss herunter und stand auf. Schon hörte ich die Schritte unserer Mutter auf der Treppe. Sie betrat das Zimmer und sah uns an.
»Bist du fertig?«, fragte sie Tara.
»Ja, Mama.« Meine Schwester nahm ihre rosafarbene Balletttasche vom Haken an der Wand.
»Darf ich mitkommen?« Ich folgte Tara zur Tür, doch meine Mutter schüttelte entschieden den Kopf.
»Chris ist schon daheim«, erwiderte sie. »Er passt auf dich auf, okay? Zum Abendessen sind wir wieder da.«
»Mhm.« Ich blieb zurück und starrte meine Fingernägel an, von denen der orangefarbene Nagellack abblätterte. Ich kratzte daran herum, bis nur noch winzige Pünktchen von Farbe zurückblieben.
Auch in diesem Moment im Gästezimmer meiner Großeltern betrachtete ich meine Fingernägel. Ich hatte sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr lackiert und fragte mich, ob Taras Aussage von damals etwas damit zu tun hatte. Müde von all meinen Gedanken und traurigen Erinnerungen drehte ich mich zur Seite und schlief ein.
* * *
Am nächsten Tag saß ich um sechs Uhr früh neben Grandpa in seinem alten, hellblauen Chevrolet Pick-up und gähnte.
»Wie kannst du müde sein, Melemele? Du bist doch so zeitig ins Bett gegangen«, neckte er mich und lenkte den Wagen in Richtung Norden. Wir fuhren an der Ostküste von Kauai entlang. Ich kannte die Strecke. Paps war mit uns schon mal nach Kilauea gefahren. Dort hatte er Tara und mir den Botanischen Garten gezeigt und anschließend hatten wir Minigolf gespielt.
»Warum fährst du jeden Tag so weit, um Fisch zu kaufen, Grandpa? Gibt es bei uns am Strand keine Fischer?«, fragte ich und beobachtete, wie sich die Sonne langsam höher schob und den Himmel golden einfärbte. Die Straße und die Bäume vor uns wurden in ein pastellfarbenes Licht gehüllt.
»Es ist der zentrale Markt von Kauai. Alle Fischer bringen ihren Fang dorthin. Nirgends gibt es bessere Ware als dort.« Er warf mir einen Blick zu. »Hast du einen Wunsch, was ich heute für dich kochen soll?« Grandpa war ein leidenschaftlicher Koch und liebte die hawaiianische Küche, obwohl er eigentlich Australier war. In jungen Jahren war er zum Surfen nach Kauai gekommen. Hier hatte er sich dann in Leilani verliebt und war geblieben. Paps sagte immer, dass Grandpa zwar kein Hawaiianer war, sich aber hawaiianischer verhielt als alle Verwandten meiner Grandma zusammen.
»Ich mag dein Hühnchen«, erwiderte ich.
»Du solltest aber auch mal meinen Fisch probieren. Wie wäre es mit Loco Moco vom Mahi-mahi?«
Ich musste kichern. Grandpa war wie Paps. Sie sahen sich mit ihren roten Haaren und braunen Augen nicht nur ähnlich, sondern sie sagten auch oft komische Dinge.
Grandpa zwinkerte mir zu. »Loco Moco bedeutet ›verrückter Schleim‹.«
»Das klingt eklig.«
»Das ist es nicht. Als du klein warst, hast du es schon mal gegessen. Traditionell ist es Reis mit einer Frikadelle, einem Spiegelei und dunkler Bratensauce. Aber es gibt das Gericht in vielen verschiedenen Formen.«
Ich verzog den Mund. »Und was ist Mahi-mahi?«
»Der Delfinfisch, wie man bei uns sagt. Ansonsten ist er als Goldmakrele bekannt. Mahi-mahi bedeutet ›sehr stark‹. Wenn man einen solchen Fisch an der Angel hat, dann weiß man, warum er so heißt.«
»Du möchtest mir also verrückten Schleim mit einem Delfinfisch servieren?«
Grandpa lachte. »Manchmal solltest du dich auf Abenteuer einlassen, Melemele.«
»Ich mag keine Abenteuer.«
»Warum?«
Weil ich wollte, dass meine Welt so blieb, wie sie war. Weil ich mir wünschte, dass Tara zurückkam und wir wieder eine normale Familie waren. Weil nur verrückte Mädchen sich nach Abenteuern sehnten. Ich zwirbelte eine Haarsträhne um meinen Finger. »Denkst du, Tara ist tot?«, fragte ich leise.
Meine Frage brachte Grandpa zum Schweigen. Ich drehte den Kopf und sah, wie er das Lenkrad fest umklammerte.
»Sie wollte plötzlich anders sein«, fuhr ich fort und dachte daran zurück, wie sehr sich meine Schwester vor ihrem Verschwinden verändert hatte. Sie hatte sich ihre Haare blau gefärbt und ihre Lippen schwarz angemalt. Außerdem hatte sie sich einen Nasenring stechen lassen. Meine Mutter war ausgerastet, als sie es gesehen hatte.
»Ich glaube fest daran, dass sie noch lebt«, sagte Grandpa und sein Satz machte mir Hoffnung. Ich gierte nach solchen Aussagen.
»Warum?«, hakte ich nach.
»Weil sie zu lebensfroh war, um sich umzubringen.« Er stockte, als wenn ihm erst jetzt bewusst wurde, zu wem er das sagte.
Ich hatte die Möglichkeit noch nicht in Betracht gezogen, dass sich meine Schwester vielleicht umgebracht hatte. Der Satz brachte mich aus dem Konzept und Grandpa griff nach meiner Hand, um sie zu drücken.
»Das Leben ist eine Geschichte, Melemele. Und du allein entscheidest, wie du sie schreibst.«
»Was meinst du damit?«
»Das sind nur Weisheiten deines alten Opas. Eines Tages verstehst du es vielleicht.«
Ich rutschte in meinem Sitz nach unten. Mein Grandpa war ebenso wenig in der Lage, mit mir über Taras Verschwinden zu reden, wie es meine Mutter und mein Vater waren. Ich mochte erst zwölf sein, doch ich war nicht dumm. Ich hörte Dinge, aber vor allem fühlte ich Dinge und ich wollte mit diesen Gefühlen nicht alleingelassen werden.
»Wann sind wir da?«, erkundigte ich mich.
»In einer Viertelstunde.«
Ich verfiel in Schweigen und sah aus dem Fenster. Manchmal fragte ich mich, ob alles so gekommen wäre, hätte Mam Paps’ Wunsch nachgegeben und wäre mit der Familie zurück nach Kauai gezogen. Paps vermisste seine Heimat. Er sprach oft von seiner Kindheit und von seinen Freunden, vom Surfen und den Tagen am Strand, von seinen Verwandten und dem Lebensgefühl der Hawaiianer. Aber meine Mutter weigerte sich, Scottsdale zu verlassen. Sie arbeitete dort für eine Kosmetikfirma und wollte ihre Karriere nicht aufgeben. Das sei alles, was sie habe, hatte sie einmal zu meinem Vater gesagt. Ich wollte Scottsdale ebenfalls nicht verlassen. Meine Freunde lebten dort und ich war froh, dass Paps es aufgegeben hatte, uns zu überzeugen, nach Kauai zu ziehen. Und doch fragte ich mich, ob Tara dann auch verschwunden wäre.
»Wir sind da.« Grandpa fuhr auf den Parkplatz vor der Großmarkthalle. Obwohl es so früh war, standen überall Autos. Leute trugen Kisten voller Eis aus dem Gebäude, Arbeiter beluden LKWs direkt vor der Laderampe. Ich rümpfte die Nase. Es roch nach Algen und Ozean, nach Fisch und anderen Meerestieren. Angewidert verzog ich den Mund.
»Sei nicht so empfindlich, Melemele!« Grandpa kannte keine Gnade und drückte mir eine Plastikkiste in die Hand. »Wir gehen jetzt shoppen.«
Darunter hatte ich bisher etwas anderes verstanden, aber ich folgte Grandpa ins Innere. Hier schwoll der Lärmpegel merklich an und ich fröstelte in meinem T-Shirt. Männer hielten Fische in die Höhe, schrien und gestikulierten, andere warfen sie umher, hackten ihnen die Köpfe ab und stapelten sie in Kisten. Ich hielt mich instinktiv an Grandpas Hemd fest, um ihn nicht zu verlieren, und folgte ihm durch das ungewohnte Chaos. Der Boden war nass, überall lag Eis und der intensive Geruch nach Fisch verstärkte sich. Als Grandpa plötzlich stehenblieb, rempelte ich ihn an. Dann erst registrierte ich, dass er einen Mann begrüßte, der hinter einer mobilen Ladentheke aus Holz stand.
»Aloha, John! Was darf es heute sein?« Der Mann hatte sein lockiges, dunkles Haar zu einem Knoten gebunden und trug eine Latzschürze aus weißem Gummi. Seine Unterarme waren tätowiert und er wirkte riesig und furchteinflößend. Aber er lächelte mich freundlich an. »Hallo Allie.«
»Hallo.« Ich lugte hinter dem Rücken meines Grandpas hervor.
»Ich bin Brian Kamaka. Wir haben uns schon ein paarmal gesehen. Ich bin der beste Freund deines Vaters. Erinnerst du dich?«
Ich schüttelte den Kopf und Brian fuhr fort: »Chris und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Wie geht es ihm?«
»Gut.« Ich hatte keine Ahnung, ob er wusste, dass meine Schwester verschwunden war, daher machte ich es wie alle hier. Ich tat so, als wäre es nicht passiert. »Es geht ihm sehr gut«, wiederholte ich.
»Das freut mich.« Brian wandte sich wieder an meinen Grandpa. »Also, John, du hast die Qual der Wahl. Wir haben Bonito, Gelbflossenthunfisch, Mahi-mahi, Ono und Barrakuda.«
»Ich nehme Mahi-mahi und Barrakuda.«
»Die übliche Menge?«
»Ja.«
Brian drehte sich um und rief etwas in der hawaiianischen Sprache. Kurze Zeit später erschien ein Junge neben ihm und hievte eine eisgefüllte Lade auf den Tresen. Es war Kale. Ich blinzelte überrascht.
»Hallo Allie«, sagte er und brachte seinen Vater damit zum Schmunzeln.
»Ihr kennt euch?«, fragte Brian.
»Bin gestern fast auf sie drauf gefallen.« Kale holte die Fische aus der Lade und zeigte sie meinem Grandpa. Der nickte und nahm mir die Plastikkiste ab.
»Du bist auf sie drauf gefallen?« Ich bemerkte, wie sich Brian und Grandpa einen Blick zuwarfen.
»Seine blöde Kokosnuss hätte mich fast erschlagen«, bestätigte ich.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du vorsichtig sein sollst, Kale?« Brian klang ernst, aber sein Gesichtsausdruck war es nicht.
»Wenn sie von hier wäre, wüsste sie, dass man nicht unter Kokospalmen umherspaziert.« Kale legte die Fische in die Kiste, die Grandpa ihm hinhielt, und bedeckte sie mit Eis.
Ich runzelte die Stirn. Gestern war Kale noch eine vor Freundlichkeit strotzende Nervensäge gewesen, heute wirkte er schlecht gelaunt.
»Wie wär’s, wenn du abends zum Essen bei uns vorbeikommst, Kale? Ich koche Loco Moco für Allie«, schlug Grandpa vor. Kale sah mich an und ich stellte fest, dass er für einen Jungen ungewöhnlich dichte Wimpern hatte. Seine Brauen thronten wie kleine Balken über den dunklen Augen und betonten seinen intensiven Blick. Außerdem hatte er einen Leberfleck links neben der Nase, der mir erst jetzt auffiel.
»Weiß nicht«, meinte er und zuckte die Schultern. »Vielleicht komm ich mal vorbei.«
»Er kommt vorbei! Danke dir für die Einladung, John.« Brian umfasste Kales Nacken und schüttelte ihn wie einen jungen Hund.
»Komm doch auch«, sagte Grandpa. »Und bring deine Familie mit.«
»Mahalo.« Brian hob die rechte Hand und spreizte Daumen und kleinen Finger ab. »Wir kommen gerne.«
»Bis heute Abend.« Grandpa bezahlte und wir gingen weiter. Während er an einem anderen Stand Muscheln und Seegras kaufte, schielte ich zu Kale hinüber, der Fisch sortierte und riesige Laden mit Eis umhertrug. Er wirkte nicht mehr wie der Junge, der mir vor die Füße gefallen war.
»Grandma hat mir erzählt, dass Kale ein Kind des Ozeans ist«, sagte ich, als wir zurück zum Auto gingen. »Meinte sie das damit? Dass er ein Fischer ist?«
»Nein.« Grandpa lächelte. »Er trägt den Geist des Meeres in sich.«
»Den Geist des Meeres?«
»Ja, das Meer holt ihn sich zurück, wenn es nicht einem Menschen gelingt, ihn für immer an Land zu binden.« Grandpa schüttelte den Kopf. »Oh, Melemele, dein Vater hat dir nicht viel über unsere Kultur beigebracht, nicht wahr?«
Ich verneinte und Grandpa öffnete mir die Tür des Pick-ups, bevor er seinen Einkauf auf der Ladefläche verstaute. Dann setzte er sich neben mich und ließ den Motor an. Wir fuhren vom Parkplatz.
»Was weißt du über Aumakua?«, wollte Grandpa wissen.
»Gar nichts«, gab ich zu.
Er seufzte. »Aumakua ist die Verbindung zu unserer Vergangenheit. Es sind unsere Ahnen, die uns hier in der Gegenwart beschützen. Du triffst sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In Form eines Tieres, einer Pflanze oder eines Felsens.«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Das klang nach den Dingen, die Paps uns oft versucht hatte zu erzählen und die meine Mutter stets als ›unsinnigen, esoterischen Kram‹ abgetan hatte.
»Schau nicht so.« Grandpa bemerkte meinen Blick. »Nur weil du etwas nicht siehst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Unsere Familie kennt viele heilige Tiere und Orte.«
»Welche denn?«
»Zum Beispiel die Meeresschildkröte, den Hai oder die Ratte, die unter unserer Veranda lebt …«
»Die Ratte?« Ich bekam große Augen.
»Ganz recht.« Grandpa lächelte. »Als meine Schwester letztes Jahr starb, saß ich lange im Schaukelstuhl auf der Veranda. Und die Ratte kam und setzte sich darunter. Sie blieb bei mir, bis ich spät am Abend aufstand. Da verstand ich, dass meine Schwester sie mir geschickt hatte. Sie ist nun an ihrer Stelle bei mir.«
Ich verzog den Mund. Mam würde einen Schreianfall bekommen, wenn sie davon hörte. Wir hatten in unserem Haus in Scottsdale mal Mäuse unter dem Dach gehabt. Ein Kammerjäger hatte kommen müssen, um jedes einzelne Tier zu beseitigen. Meine Mutter war auf Nager nicht besonders gut zu sprechen und ich war mir sicher, dass sie Grandpa für verrückt erklären würde, wüsste sie von seiner Theorie mit der Ratte und meiner Großtante.
»Und was bedeutet das jetzt?«, fragte ich vorsichtig. »Diese Ratte ist also Auma-dingsda?«
»Sie ist eines unserer Seelentiere. Ein Wegweiser für das Unsichtbare.« Er tippte mit dem Zeigefinger gegen meine Stirn. »Bei Kale ist es der Wal. Sein Vater sagt, er zieht diese Tiere magisch an. Du magst denken, dass ich dir Unsinn erzähle, aber du wirst es eines Tages selbst erleben, Melemele. Sehen, Hören und Schmecken sind nur ein Teil des großen Ganzen. Viele Dinge musst du einfach fühlen. Nicht mit den Fingern, sondern mit dem Herzen. Verstehst du, was ich meine?«
Das tat ich nicht, aber ich wollte Grandpa nicht verletzen. »Ich verstehe«, murmelte ich.
»Das ist gut.« Grandpa wirkte zufrieden und wir setzten den Rest des Weges schweigend fort. Ich schwor mir, dass ich nach dieser Ratte unter der Veranda Ausschau halten musste.
* * *
Am Abend desselben Tages kniete ich im Sand vor den Holzpflöcken und starrte ins Dunkle. Die Lücke zwischen dem Boden und der Veranda war so breit, dass ich hätte darunter krabbeln können, aber natürlich würde ich den Teufel tun! Da unten lebten bestimmt Spinnen, Kakerlaken oder … Monster! Ich würde ganz sicher nicht mein Leben riskieren, um irgendeine heilige Ratte zu finden. Ich war neugierig, aber so neugierig auch wieder nicht.
»Was suchst du?«
Ich zuckte zusammen, stieß mir den Kopf an der Querverstrebung an und sah auf. Neben mir stand Kale und grinste. Auf einmal grinste er wieder.
»Nichts«, murrte ich.
»Keine Sorge, hier gibt’s keine Schlangen«, bemerkte er und sprang auf die Veranda.
Ich stand auf. »Überall gibt’s Schlangen.«
»Irrtum, auf Hawaii gibt’s keine. Weder giftige noch ungiftige.«
»Im Ernst?«
Plötzlich lächelte er nicht mehr. »Dafür, dass dein Vater Hawaiianer ist, weißt du ziemlich wenig über uns.«
»Ich lebe ja auch nicht hier, sondern in der Wüste«, schoss ich zurück. »Und dort gibt es Schlangen.«
»Ich weiß.« Er hob das Kinn. »Das haben wir in der Schule gelernt. In Arizona lebt die Diamant-Klapperschlange. Die ist ziemlich giftig.«
Ich schnaubte und folgte ihm. »Wo sind deine Eltern?«
»Die kommen später.«
»Und warum bist du schon hier?«
»Weil ich dachte …« Er brach ab. »Egal.« Für einen Moment sah es so aus, als ob er wieder gehen wollte, doch dann kam uns Grandpa entgegen.
»Kale! Wie schön, dass du da bist. Kommt rein, ich habe schon alles fertig für euch.«
Ich warf Kale einen Seitenblick zu und ging voraus. Wie selbstverständlich setzte ich mich an unseren Familientisch, nur um dann festzustellen, dass Kale von all meinen Verwandten herzlicher begrüßt wurde als ich. Er schien nicht zum ersten Mal hier zu sein und doch war er mir bei meinen Besuchen nie bewusst aufgefallen. Aber da war ich natürlich noch jünger gewesen.
»Lasst es euch schmecken.« Mein Grandpa stellte uns jeweils einen Teller hin. »Loco Moco mit Mahi-mahi in Buttersauce für Allie und Loco Moco mit Limu für Kale.«
Ich starrte Kales Teller an, auf dem kein appetitlicher Fisch auf dem Reis lag, sondern grünes Zeug, das aussah wie Spinat.
»Was ist das?«, fragte ich und man konnte deutlich hören, was ich von seinem Essen hielt.
»Algen«, erwiderte Kale, nahm die Gabel und begann, die grüne Pampe in sich reinzuschaufeln. Ich sah ihm dabei zu, bevor ich den Fisch probierte. Er schmeckte gut. Ich war überrascht. Normalerweise aß ich nur Fisch, wenn mich Mam dazu zwang.
»Isst du keinen Fisch?«, erkundigte ich mich nach einer Weile.
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich esse nichts, was mal eine Familie hatte.«
Wow! Diese Aussage überraschte mich. Jungs in meinem Alter liebten Fleisch. Fastfood in jeder Form war in meiner Klasse das Hauptnahrungsmittel. »Was hat das mit Familie zu tun?« Ich stocherte im Essen herum. Er hob den Kopf und sah mich an. Sein stechender Blick verunsicherte mich derart, dass ich mir schnell noch mehr Fisch in den Mund schob. »Was für eine Familie soll ein Fisch bitte haben?«, murmelte ich dabei.
»Du würdest dich wundern.« Er aß ebenfalls weiter und schien das Thema damit für beendet zu erklären.
Ich schwieg und beschloss, dass Kale der merkwürdigste Junge war, den ich je kennengelernt hatte. Wir hatten nichts, aber auch gar nichts gemeinsam.
Zehn schweigsame Minuten später ließ Kale seine Gabel auf den leeren Teller fallen. »Danke fürs Essen«, sagte er und stand auf. Ich nickte ihm zu und hielt ihn nicht auf. Damals war ich der festen Überzeugung, dass Kale ganz bestimmt nie mein Freund werden würde.
MEIN ERSTER ABSCHIED VON KALE
ODER: FREUNDLICHE SCHWIMMER IM PAZIFIKWIRBEL
SOMMER 2004
Die acht Wochen bei meinen Großeltern zogen sich wie Kaugummi in die Länge. Der ganze Urlaub war eine Abfolge der immer gleichen Dinge. Aufstehen, frühstücken, an den Strand gehen, lesen, Mittagessen, Musik hören, Abendessen. Natürlich gab es dabei auch ein paar gute Sachen. Ich schaffte es endlich, Harry Potter zu lesen. Zumindest bis zum fünften Band, denn mehr waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Außerdem hatte ich Taras iPod mitgenommen und hörte alle Lieder, die darauf waren. Ich entdeckte die Musik von Avril Lavigne für mich und lauschte gefühlte tausend Mal dem Song The Reason von einer Band mit dem merkwürdigen Namen Hoobastank. Er war für mich in diesem Sommer ein Trost, denn er erinnerte mich an Tara. Sie hatte diesen Song ständig gehört, bevor sie verschwunden war, und ich suchte nach Antworten in dem Songtext. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie zu finden, dann wieder nicht.
Ab und zu wurde ich zu einer Familienfeier geschleppt und ertrug sie mit stoischer Ruhe, weil ich wusste, dass mich am nächsten Tag wieder derselbe eintönige Rhythmus erwarten würde. In all dieser Zeit sah ich Kale nicht. Er war nicht am Strand und er kam auch nicht zu unserem Restaurant. Es schien, als sei er zu demselben Schluss gekommen wie ich. Wir hatten einfach nichts gemeinsam. Selbst meine Großeltern hatten das eingesehen. Zumindest erwähnten sie ihn nicht mehr und luden ihn auch kein weiteres Mal zum Essen ein. Erst zwei Tage vor meiner Abreise lief Kale mir plötzlich wieder über den Weg. Ich ging am Strand spazieren und fand dort eine blaue Gummischildkröte, die das Meer angespült hatte. Ich bückte mich, um sie aufzuheben, und als ich mich wieder aufrichtete, stand er da. Er war wie aus dem Nichts vor mir aufgetaucht und trug wieder einmal nur seine Baywatch-Badehose. Das Wasser tropfte aus den nassen Haaren auf seine Schultern.
»Hey«, sagte ich unsicher.
»Aloha.« Er sah die Schildkröte in meiner Hand an.
»Was ist?« Ich begutachtete das ausgeblichene Gummitier. »Ist das deine?«
»Nein.«
»Warum starrst du sie dann so an?«
»Es sind lange Zeit keine mehr hier angespült worden.« Er strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht und ein sanftes Lächeln umspielte seinen Mund. »Soll ich dir zeigen, was ich meine?«
Ich wollte den Kopf schütteln, aber aus irgendeinem Grund nickte ich. Was hatte ich schon zu verlieren? In zwei Tagen war ich wieder zuhause. Zurück bei meinen Eltern, meinen Freunden und dem Haus, in dem mich der Anblick von Taras leerem Zimmer jeden Tag quälen würde.
»Komm!« Kale spazierte voraus und ich folgte ihm zögerlich. Wir passierten das Coconut House meiner Großeltern und ich sah meine Grandma auf der Terrasse sitzen. Sie winkte uns zu.
»Kale will mir was zeigen«, rief ich. Grandma nickte und gab mir mit einer Geste zu verstehen, das alles in Ordnung war. Wäre ich daheim gewesen, hätte Mam mich zu sich gerufen und ich hätte ihr erzählen müssen, wohin ich genau ging, wann ich wieder kam und wer mich begleitete. Doch meine Großeltern waren gechillt, was meine Aufsicht betraf, und ich rannte hinter Kale her. Wir liefen über den Parkplatz, die Straße hinunter bis zum felsigen Ende des Strandes. Hier standen einige heruntergekommene Hütten, von deren Holzwänden die Farbe abblätterte. Boote lagen davor und Fischernetze hingen in der Sonne zum Trocknen. Der Geruch von Algen und Fisch lag in der Luft. Kale steuerte auf die erste Hütte zu und stieß die sperrige Tür auf.
»Wohnst du hier?«, wollte ich wissen.
Sein Lächeln verschwand sofort wieder. »Denkst du tatsächlich, dass ich hier wohne?«, erwiderte er und schüttelte ungläubig den Kopf. »Ihr Leute aus der Wüste habt merkwürdige Ideen. Ich wohne mit meiner Familie ganz in der Nähe vom Coconut House.« Er schien es bereits zu bereuen, mich mitgenommen zu haben, und deutete ins Innere. Ich streckte den Kopf in die Hütte. Der Geruch nach Fisch verstärkte sich und ich bemühte mich, keine abfällige Bemerkung zu machen. Licht drang durch die Ritzen der Bretter in die fensterlose Hütte, Staub tanzte durch die Luft. Ganz langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Dann erkannte ich es. Auf Regalbrettern und kleinen Tischen standen unzählige Gummitiere. Blaue Schildkröten, grüne Frösche, rote Biber und gelbe Entchen. Es mussten weit über hundert sein. Ich verglich die Schildkröte in meiner Hand mit denen in der Hütte. Sie waren identisch. Überrascht runzelte ich die Stirn.
»Woher kommen die?«, wollte ich wissen.
»Aus einem Container.«
Ich verstand nicht und warf Kale einen ratlosen Blick zu. Er schloss die Tür wieder und wir balancierten über die Felsen zum Wasser. Dort setzten wir uns.
»Ich war noch ganz klein, als es passierte«, begann er zu erzählen. »1992 verlor ein Frachter aus Hongkong mitten im Pazifik einige Container. Einer davon hatte diese Gummitiere geladen. Er öffnete sich und seitdem schwimmen Tausende von ihnen auf den Ozeanen herum.«
»Tatsächlich?« Ich drehte die blaue Schildkröte in meinen Händen. »Die ist seit 1992 unterwegs? Das ist mein Geburtsjahr.«
»Ende 1992 wurden die ersten Quietscheenten in Alaska an Land gespült. 1995 fand man sie überall an den Stränden von Hawaii. All die Gummitiere in der Hütte habe ich hier mit meinem Vater eingesammelt. Momentan sieht man sie vor allem im Atlantik vor der Küste Neuenglands.«
»Wow!« Das beeindruckte mich. »Wie sind sie dorthin gekommen?«
»Die Meeresströmungen haben sie über Grönland in den Atlantik getragen.«
Ich war nicht besonders gut in Erdkunde und hatte schon gar keine Ahnung, wie die Meere miteinander zusammenhingen. »Hm«, machte ich daher nur bedeutungsvoll. »Hm.«
»Man nennt diese Gummitiere friendly floatees. Ozeanforscher benutzen ihre Fundorte mittlerweile dazu, um die Meeresströmungen genauer zu bestimmen. Bis letztes Jahr gab es sogar einhundert Dollar Finderlohn für so ein Gummitier.«
»Im Ernst?« Ich bekam große Augen.
»Jetzt habe ich dein Interesse geweckt, was?« Sein Lächeln kehrte zurück.
»Naja, ich meine …«, beinahe liebevoll strich ich mit dem Daumen über die matte Oberfläche der Schildkröte, »stell dir nur vor, was sie alles erlebt hat.«
»Vermutlich ist sie auf der Ringströmung des Pazifiks Karussell gefahren.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon Kale redete. »Wenn es einen Finderlohn gab, warum hast du all diese Tierchen dann nicht verkauft?«, fragte ich. »Wozu hebst du sie auf?«
Er zuckte die Schultern. »Das Meer hat sie mir geschenkt.«
»Hebst du alles auf, was das Meer dir schenkt?«
»Einiges. Du hast keine Ahnung, was hier manchmal angespült wird.«
Dieser Junge war noch immer merkwürdig. Selbst acht langweilige Wochen auf dieser Insel hatten meine Meinung nicht geändert.
Er nahm mir die Schildkröte aus der Hand. »Wusstest du, dass der Nordpazifikwirbel die größte Müllhalde der Meere ist? Diese Schildkröte hat es vermutlich mit eigenen Augen gesehen.«
Ich kam mir vor wie bei einer Ansprache der Umweltgruppe unserer Schule. Sie waren als ›grüne Streber‹ verschrien und keiner wollte etwas mit ihnen zu tun haben. »Bist du ein Umweltaktivist oder sowas?«, fragte ich.
»Ich lebe hier und bin jeden Tag im Meer«, antwortete er. »Aber wenn man in der Wüste lebt, ist einem die Meeresverschmutzung vermutlich egal.«
Ich entriss ihm die Schildkröte wieder. »Warst du schon mal in der Wüste?«
»Nein.«
»Dann solltest du nicht darüber urteilen.«
»Vielleicht hast du recht.« Er stand auf. »Wo ist eigentlich deine Schwester?«
»Meine …« Mir stockte der Atem. Keiner hatte mich während meines Aufenthalts auf Tara angesprochen. Keiner außer Kale. Ich spürte, wie mein Herz zu rasen begann.
»Woher weißt du, dass ich eine Schwester habe?« Meine Stimme war tonlos.
»Ihr wart jeden Sommer für eine Woche hier. Ich habe euch gesehen. Allerdings ist das letzte Mal schon länger her.«
»Vier Jahre«, sagte ich und presste die Schildkröte an mich. »Dann kam der Anschlag aufs World Trade Center in New York und meine Mam wollte nicht mehr, dass wir fliegen. Danach war Tara zu beschäftigt mit ihren Castings.«
Kale sah mich an und ich bemühte mich, unter seinem prüfenden Blick nicht in Tränen auszubrechen. Acht Wochen lang hatte ich das Verschwinden meiner Schwester verdrängen können. Jetzt konnte ich es nicht mehr.
»Tara ist weg«, flüsterte ich.
»Warum?«
»Keine Ahnung.« Ich schüttelte heftig den Kopf. »Sie ist einfach nicht mehr da.«
»Wie kann das sein?«
»Sie kam vor drei Monaten nicht mehr von der Schule nach Hause.« Ich schluckte und verbesserte mich: »Vor fünf Monaten.« Fünf Monate!
»Was ist passiert?«
»Das wissen wir nicht.« Gleichzeitig fragte ich mich, ob meine Eltern inzwischen mehr Informationen hatten, die sie mir nur nicht erzählten. Übermorgen würde ich es erfahren. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen.
»Ich habe drei Geschwister«, sagte Kale. »Mari und Jolana sind meine beiden älteren Schwestern und dann gibt es noch Manu, meinen jüngeren Bruder.« Er sah mich an. »Magst du schwimmen gehen?« Die Frage ließ mich blinzeln und Kale deutete nach rechts. »Dort bei dem Felsen lebt eine Muräne. Sie ist meine Freundin.«
»Du bist mit einer Muräne befreundet?« Ich wischte die Tränen fort. Gerade eben hatte mich Kale an meine schmerzhafte Realität erinnert und jetzt verhielt er sich so wie alle hier. Er überging meine Gefühle und ich war ehrlich gesagt froh, dass er nicht weiter nachbohrte.
Ich warf den Robben, die sich auf einem Felsen in unserer Nähe sonnten, einen misstrauischen Blick zu. »Was ist mit denen?«
»Das sind Mönchsrobben. Die tun nichts.«
»Okay!« Kale wirkte derart unbesorgt, dass ich zustimmte. »Lass uns schwimmen gehen.«
Während ich mir noch das T-Shirt über den Kopf zog, meine Shorts abstreifte und den Badeanzug in Form zupfte, hechtete Kale bereits in die Wellen. Ich war froh darüber, denn dann schaffte ich es vielleicht, im Wasser zu sein, bevor er auf die Idee kam, mich zu mustern. Zwar hatte ich vor lauter Kummer abgenommen, seit Tara verschwunden war, aber ich war trotzdem ein bisschen pummlig.
»Mist!« Ich stakste über die rutschigen Steine und zog den Bauchnabel ein, als die Wellen an mir hochschwappten. Ich war keine begnadete Schwimmerin. Wasser zählte allgemein nicht zu meinem Lieblingselement. Ich liebte die Poolpartys, die meine Freunde regelmäßig veranstalteten, aber es wäre falsch gewesen, mich als Wasserratte zu bezeichnen. Außerdem war der Ozean etwas anderes als ein ruhiger glasklarer Pool. In den acht Wochen auf Kauai war ich immer mal wieder kurz im Meer gewesen. Meist bis zum Bauch, um mich abzukühlen. Ich war eher der Strandtyp. Zuhause war ich im Beachvolleyball-Team meiner Schule und fühlte mich generell wohler, wenn ich trockenen Sand unter meinen Füßen spürte.
»Kale?« Ich starrte auf die Wasseroberfläche, doch er war nirgends zu sehen. Beunruhigt ging ich etwas tiefer hinein und keuchte auf, als die nächste Welle über meinen Bauchnabel schwappte. »Kale!« Er war nicht zu sehen und das unruhige Meer machte es mir nicht einfacher, etwas zu erkennen. Langsam bekam ich es mit der Angst zu tun. Wie lange war er bereits unter Wasser? Wann wurde es gefährlich? Ich würde ihn nicht retten können, so viel wusste ich. Nervös sah ich mich um. Der Strand an diesem Abschnitt war leer. Die Touristen bevorzugten das flache, sandige Ufer vor dem Restaurant meiner Großeltern.
»Hey!«, rief ich und wedelte mit den Armen, aber niemand bemerkte mich.
»Was schreist du denn so?« Direkt vor mir tauchte Kales Kopf auf.
»Du blöder Idiot!« Ich schlug mit den Händen auf die Wasseroberfläche. »Wo warst du denn?«
Er blickte mich derart erstaunt an, dass ich lachen musste. Die Spannung löste sich und er lachte ebenfalls.
»Wieso stehst du noch immer hier rum?« Er tauchte wieder unter, nur um wenige Meter weiter wie ein Delfin aus dem Wasser zu schnellen. »Komm schon!« Er winkte mir zu.
Ich schüttelte den Kopf. Kale konnte schwimmen. Offenbar konnte er auch ziemlich gut tauchen. Und plötzlich kam ich mir dämlich vor, weil ich beides nicht besonders gut konnte.
»Was ist?« Er kraulte zurück zu mir.
»Ich mag doch nicht schwimmen«, murmelte ich und trat den Rückzug an. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Dass wir ein bisschen mit Schwimmnudeln oder aufblasbaren Tieren plantschten, so wie wir es auf den Poolpartys machten?
»Hast du Angst?« Wieder einmal traf mich sein Blick, der direkt in mein Innerstes zu schauen schien. »Oder denkst du, du könntest dich blamieren?«
»Nein«, log ich und mied es, ihn anzusehen.
»Komm schon!« Er streckte mir die Hand hin. »Ich lass dich nicht los. Versprochen!«
Das führte nicht dazu, dass ich mich besser fühlte. Der Kontakt zu Jungs in meinem Alter war ohnehin schon eine schwierige Sache. Händchenhalten tat man nur, wenn man miteinander ging. Und das taten Kale und ich ganz bestimmt nicht!
»Was ist denn?« Er wirkte verständnislos. Wie es schien, kapierte er nicht, dass jemand das Meer nicht als ebensolche Offenbarung erlebte wie er.
Ich atmete tief durch. Mir blieben zwei Möglichkeiten. Entweder zog ich mich wie ein Feigling zurück und bestätigte Kale in seiner Meinung über Leute aus der Wüste, oder … Mein Blick heftete sich auf die Hand, die er mir immer noch entgegenstreckte. Oder ich tat, als wäre es das Normalste der Welt, mit einem gutaussehenden Jungen Händchen haltend schwimmen zu gehen. Ich beschloss, mir einen Ruck zu geben.
»Die Steine sind glitschig«, überspielte ich meine Verunsicherung und ergriff Kales Hand. Sie fühlte sich warm an, obwohl er schon länger im Wasser war. Ich folgte ihm und war erleichtert, dass er keine blöden Bemerkungen machte, weil ich jedes Mal innehielt, wenn eine Welle auf uns zukam. Irgendwann kamen wir ans Ende der Felsen und das tiefe Wasser begann.
»Ab hier musst du schwimmen.« Grinste er etwa? Ich überwand mich, ging in die Knie und bewegte Arme und Beine. Wir schwammen ein Stück hinaus, bevor wir uns in den Wellen treiben ließen.
»Alles okay?« Kale blieb dicht neben mir. Während ich schnaubte und prustete wie ein Walross, bewegte er sich ohne Anstrengung.
»Ist dir das nicht unheimlich?« Ich lugte nach unten.
»Was denn?«
»Ich fühle mich wie ein leckerer Happen für hungrige Fische.«
»Du zappelst zu viel.«
»Wenn ich es nicht tue, gehe ich unter.«
»Das tust du nicht.« Er tauchte ab und ich schrie auf.
»Kale!«
»Ich bin hier«, hörte ich seine Stimme in meinem Rücken.
»Hör auf damit!« Ich ruderte mit dem Armen, um mich zu ihm umzudrehen.
»Du paddelst wie ein Hund.« Jetzt grinste er wirklich. »Und du hältst ständig die Luft an. Atme weiter, bleib ganz ruhig und beweg deine Arme seitwärts und nicht auf und ab.«
»Ich schwimme nicht oft.«
»Darauf wäre ich nie gekommen.«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. »Warum kannst du so lange unter Wasser bleiben?«
»Im Gegensatz zu dir kann ich die Luft kontrolliert anhalten.«
»Wie lange?«
»Fast drei Minuten.«
»Im Ernst?« Ich dachte daran, wie Tara und ich in der Badewanne die Zeit gestoppt hatten, die wir unter Wasser bleiben konnten. Keine von uns hatte eine Minute geschafft.
»Willst du die Muräne sehen?« Er sah mich erwartungsvoll an.
»Ich kann nicht so lange tauchen wie du.« Genaugenommen war ich überhaupt nicht gerne mit dem Kopf unter Wasser.
»Warte.« Er packte meine Handgelenke und ich wehrte mich. Für einige Sekunden bekam ich Panik, weil ich glaubte unterzugehen. Doch ich blieb an der Oberfläche.
»Siehst du.« Kales Lächeln wurde breiter. »Das Meer will dich nicht verschlucken. Es trägt dich. Atme ganz normal und strample nicht so.«
»Woher weißt du, dass ich strample?«
»Ich spüre es unter Wasser.« Er nahm meine Hände in seine. »Und jetzt schließ die Augen.«
»Bist du verrückt?«
»Schließ die Augen.« Ich tat es, jedoch nicht ganz. Misstrauisch beobachtete ich ihn durch meine Wimpern hindurch. »Man kann nicht lange unter Wasser bleiben, wenn man zu heftig atmet. Also musst du lernen, dich sicher zu fühlen.«
Ich fühlte mich aber nicht sicher. Oder doch? Kales Hände hielten mich und obwohl ich mich gar nicht viel bewegte, war ich noch nicht ertrunken.
»Dort unten«, hörte ich Kales leise Stimme, »ist eine andere Welt. Da kann ich mehr ich selbst sein als hier oben.«
Ich öffnete die Augen. Er sprach nicht wie Jungs in meinem Alter, die Dinge wie Power Ranger Figuren oder ihre eigenen Fürze cool fanden, aber ansonsten nicht viel redeten.
»Bist du jeden Tag im Wasser?«
»Ich bin jeden Tag unter Wasser.«
»Wenn du mit deinem Vater beim Fischen bist?«
Sein Lächeln verschwand. »Nein, da tauche ich nur, wenn sich das Netz irgendwo verfängt. Ich sehe den Fischen lieber zu, als sie aus dem Meer zu ziehen.«
»Du bist also nicht gerne Fischer?«
Er schüttelte den Kopf und ich verstand, warum er auf dem Fischmarkt so anders gewesen war. »Mein Vater möchte, dass ich eines Tages in seine Fußstapfen trete, aber das kann ich nicht.«
»Weiß er das?«
»Nein.« Kale drückte meine Hände und wechselte das Thema, so wie er es vorhin auch bei meiner Schwester getan hatte: »Du musst deine Anspannung loslassen, bevor du abtauchst. Du darfst nicht daran denken, dass du die Luft anhältst. Konzentrier dich auf etwas anderes.«
»Okay.« Ich nickte tapfer und bemühte mich, ruhig zu bleiben.
»Und jetzt beug dich nach vorne. Und keine Angst, ich halte dich. Tauch dein Gesicht ins Wasser und sag mir, was du hörst.«
Ich tat es. Das Meer gluckerte in meinen Ohren. Es rauschte, es klackerte, irgendwo brummte es. Prustend richtete ich mich wieder auf. »Wie lange war das?«, wollte ich wissen.
»Vielleicht zehn Sekunden.«
»Was?« Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man drei Minuten die Luft anhalten sollte.
»Was hast du gehört?«
»Es hat geklickt.«
»Das sind kleine Steine, die von den Wellen bewegt werden. Oder auch Fische.«
»Fische?«
»Ja, die nagen an den Korallen. Was hast du noch gehört?«
»Ein Brummen.«
Kale deutete Richtung Horizont. »Siehst du das Schiff dort? Das ist ein Frachter. Du hörst seine Schiffsschrauben.«
»Im Ernst?«
»Wasser leitet den Schall viel besser als Luft.«
Ich war beeindruckt von Kales Wissen. Und mir wurde die Tatsache überdeutlich bewusst, dass er noch immer meine Hand hielt. »Das Salzwasser brennt in den Augen«, sagte ich und kam mir im selben Moment dämlich vor, weil ich so eine Memme war. Weder das Salzwasser, noch der dunkle Ozean oder die Wellen beeindruckten Kale.
»Hättest du Lust …«, begann er und biss sich dann auf die Unterlippe.
»Was?«, hakte ich nach.
»Also, ich kenne da eine Stelle, wo man unheimlich viele Fische beobachten kann. Wir könnten dir eine Taucherbrille und einen Schnorchel besorgen.«
»Ja, cool.«
»Im Ernst?« Er schien nicht glauben zu wollen, dass ich tatsächlich zusagte. Ich war selbst ein wenig verwundert. »Wenn wir morgen gleich in der früh losziehen, dann sind die Wellen nicht so hoch und man sieht unglaublich viele Fische.«
»Du meinst, die Wellen sind in der Früh noch müde?«, scherzte ich und Kale sah mich verständnislos an.
»Dann ist Ebbe«, erwiderte er. »Da ist das Wasser niedriger.«
»Hm.« Mein Humor war anscheinend nicht bei ihm angekommen.
»Dann hole ich dich um sieben ab?«
»Um sieben?« Ich hob die Augenbrauen. »Klar, warum nicht? An meinem letzten Tag muss ich ja nicht ewig im Bett liegen.«
»Du fährst schon wieder?«
»Ähm, ja, meine Sommerferien sind zu Ende.«
Er ließ meine Hand los. »Tatsächlich? Habt ihr nicht zwei Monate Ferien?« Das war das erste Mal, dass ich mit Kales Gefühl für Zeit in Berührung kam. Es würde mich in den nächsten Jahren noch viel Nerven kosten, aber an diesem Tag fand ich es witzig.
»Ich bin seit acht Wochen hier.«
»Wow!« Er lächelte schief. »Das kam mir gar nicht so lange vor.«
Ich schüttelte amüsiert den Kopf. »Wo warst du eigentlich die ganze Zeit?«
»Hier und da.« Er schien zu überlegen. »Ich habe einen Tauchkurs gemacht. Das war schon cool, aber ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich kann eines Tages auch ohne diese Flasche am Rücken so tief tauchen wie mein Tauchlehrer.«
»Du hast einen Tauchkurs gemacht?« Ich musste lachen. »Und das erwähnst du so nebenbei?«
»Es war nichts Besonderes.« Er zuckte mit den Schultern und tauchte unter mir weg. Ich schwamm zurück zum Strand und setzte mich auf die Felsen. Es dauerte ein wenig, bis Kale wieder an der Wasseroberfläche erschien. Er kraulte zu mir und legte eine Muschel neben mich auf den Stein.
»Für mich?« Verlegen nahm ich sie in die Hand. »Wie hübsch!« Die Muschel leuchtete in Gelb-, Orange- und Rosatönen.
»Das ist eine Sunrise Shell.« Kale stieg zu mir auf den Felsen. »Du kannst ein Loch durchbohren und sie an eine Kette hängen.«
»Nette Idee.« Ich betrachtete die Muschel auf meiner Handfläche. So etwas tat man vielleicht hier auf Hawaii, aber ich wusste, dass meine Freunde es uncool finden würden, wenn ich mit einer Muschelkette in der Schule erschien. Im letzten Schuljahr hatten die Jungs Lederbänder um den Hals getragen und die Mädchen Bettelarmbänder an den Handgelenken. Was der neueste Trend sein würde, wusste ich nicht. Ich hatte den gesamten Sommer verpasst.
»Warum wohnt ihr eigentlich in Scottsdale?« Kale schüttelte sich das Wasser aus den Haaren. »Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo zu leben, wo kein Meer ist.«
»Wegen meiner Mutter.«
»Wollte sie nicht hier bei deinem Vater bleiben?«
»Ich glaube, sie mag Hawaii nicht besonders.«
»Warum?«
Das wusste ich nicht, es war mehr so ein Gefühl. Ich zuckte die Schultern. »Sie war mal Miss Vize Arizona und war sehr beschäftigt, als sie meinen Vater kennengelernt hat.«
»Was macht man denn so als Miss Vize Arizona?«
»Fotoshootings und sowas.« Unser gesamtes Haus in Scottsdale war voller Bilder meiner Mam. Sie war sehr hübsch. Ganz hellblond mit Augen wie das Meer. So formulierte Paps es. Auf den meisten Fotos sah sie sich jedoch gar nicht ähnlich. Sie waren aus Magazinen und Werbeanzeigen, aber es gab auch Fotos, auf denen man sie mit berühmten Leuten sah. Zum Beispiel mit Bruce Babbit, dem ehemaligen Gouverneur von Arizona, Christie Brinkley, dem amerikanischen Supermodel der 1980er Jahre und Rob Lowe, Mams Lieblingsschauspieler.
»Wart ihr deshalb immer nur so kurz hier?«
»Ja, ich denke schon.« Seit ich drei Jahre alt war, waren wir jeden Sommer für eine Woche zu meinen Großeltern nach Kauai geflogen. Nur Paps, Tara und ich. Mam hatte immer etwas zu tun gehabt. Sie fuhr anschließend mit uns für eine Woche zu meinen anderen Großeltern nach Flagstaff, die wir viel häufiger sahen. Ich mochte es dort nicht besonders. Mams Eltern waren merkwürdig, seltsam kühl und distanziert. Mein Opa war Polizist gewesen, meine Oma hatte ihr Leben lang an der Rezeption eines Motels gearbeitet. Ich fand keinen Draht zu ihnen, ganz im Gegensatz zu meiner Schwester Tara, die mit meiner Oma stundenlang in der Küche gestanden und Cupcakes gebacken hatte.
»Und was macht deine Mam jetzt?« Kale sah mich fragend an und ich wunderte mich, dass ihn das interessierte.
»Sie arbeitet für eine Kosmetikfirma.«