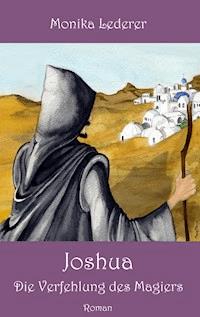
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Joshuas Leben steht unter keinem guten Stern. Seit er im Alter von sieben Jahren in die Fänge des Magiers Hazrad gerät, scheint sein Schicksal besiegelt zu sein. Entführt und eingesperrt, ohne die Möglichkeit, seine Eltern und Geschwister jemals wiederzusehen, verbringt er viele Jahre in Hazrads Schule der Magie. Seine Ausbildung ist fast abgeschlossen, als ihm endlich die Flucht gelingt, die Flucht vor dem Missbrauch seiner Kindheit und vor der Aussicht, als Sklave verkauft zu werden. Zuerst scheint die Freiheit die Erfüllung aller Wünsche zu versprechen, doch sein Freund Hannis, dem mit ihm gemeinsam die Flucht gelungen ist, erweist sich nicht als der Partner, den sich Joshua erhofft hat. Ein schlimmer Streit entzweit die beiden Männer. Kann das geheimnisvolle magische Experiment ihrem Leben eine neue Richtung geben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Fremde im Sturm
Eine Geschichte
Erste Bestrafung
Eine besondere Ausbildung
Das Freudenhaus
Auf der Flucht
Kind mit zwei Vätern
Auf der Wanderschaft
Die Schule
Liebespartner
Der Anfang der Liebe
Die neue Heimat
Die Schriftrolle
Das Experiment
Heimatlos
Die Rache
Das Ende der Nacht
Der Fremde im Sturm
Rayko kämpfte verbissen gegen den Wind an. Mit halb geschlossenen Augen, den unteren Teil des Gesichtes zum Schutz vor den herumwirbelnden Sandkörnern im Gewand verborgen, setzte er beharrlich Fuß vor Fuß. Immer schmaler und steiler wand sich der Weg in die Höhe. Nach Luft ringend hielt er inne, presste den schlanken Körper schutzsuchend gegen die Felswand und versuchte, die aufgewirbelten Staubmassen mit seinen Blicken zu durchdringen.
Die Gegend schien ihm plötzlich düster und unbekannt. Er hatte im Sturm die falsche Abzweigung gewählt, wurde ihm schlagartig klar. Endlich stieg eine Ahnung in ihm auf, wo er sich befand, und diese Erkenntnis trieb ihm die Schweißperlen auf die Stirn. Hier war im letzten Jahr der Sohn des Schmieds verunglückt. Nur einige Meter hinter der nächsten Wegbiegung endete dieser Pfad am Rand einer unzugänglichen Schlucht, deren zerklüfteter Steilhang senkrecht in die Tiefe abfiel. Wer dort ins Stolpern kam, spürte erst nach hundert Metern im freien Fall den Erdboden wieder unter sich – in Form eines heftigen Aufpralls auf schartige, unbarmherzige Felskanten.
Rayko war nicht selbst bei dem Suchtrupp dabei gewesen, aber er hatte die bleichen, entsetzten Gesichter der Männer gesehen, die den sorgsam verhüllten Leichnam ins Dorf geschleppt hatten. Hier gab es kein Weiterkommen. Noch ein paar unbedachte Schritte und sie könnten auch seinen Körper dort unten von den Felsen kratzen.
Mit einem Schaudern vertrieb Rayko die düstere Vorstellung und wandte sich wieder praktischeren Überlegungen zu. Er würde umkehren müssen. Das bedeutete noch einmal eine Strecke von mindestens drei Wegstunden. Und das bei diesem Wetter! Missmutig blickte er zum wolkenverhangenen Himmel auf. Ein dunkler Schatten ein Stück weiter oben am Berghang zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Höhleneingang vielleicht?
‚Immerhin erreicht mich die Erkenntnis, dass ich es heute nicht mehr nach Hause schaffe, gerade in Reichweite eines Unterschlupfs‘, dachte er grimmig. Er schüttelte sich den Sand aus den Kleidern und machte sich daran, den Aufstieg zur schützenden Höhle zu suchen. ‚Eigentlich geht es mir häufig so’, registrierte er ein wenig verwundert. ‚Erst sieht es schlimm aus, aber irgendwie wendet sich doch immer alles noch zum Guten ... Wenn nicht gerade ein Bär oder ein Haufen Skorpione schon vor mir Gefallen an diesem schönen Plätzchen gefunden haben.’ Er lächelte über diesen verrückten Gedanken, während er vorsichtig ins Dunkel der Höhle – und vor allem in den Windschatten – trat.
Einen Moment brauchten seine Augen, um sich an das schummrige Halbdunkel zu gewöhnen. Dann schrak er zurück. Die Höhle hatte wirklich schon einen Bewohner! Aber für einen Bären war der Körper zu klein, der ausgestreckt und reglos, unter einer schäbigen Decke verborgen, dort vor ihm lag. Das Heulen des Windes verschluckte alle anderen Laute, er konnte kein Atemgeräusch ausmachen. Zögernd näherte er sich der starren Gestalt, tastete unsicher nach Kopf und Stirn. Aber statt der erwarteten Kälte des Todes traf er auf fiebernde Hitze. Seine Hand schnellte zurück. Unwillkürlich stöhnte er auf. Vor dem Fieber waren fast alle Familien des Dorfes in die Berge geflohen. Hatte es sie in Gestalt dieses Fremden jetzt doch noch erreicht?
Forschend betrachtete er das Gesicht des Mannes. Ebenmäßige Gesichtszüge, die schön gewesen wären, wenn nicht das Fieber, der Hunger – oder großer Kummer – sie ausgezehrt und entstellt hätten. Strähniges, dunkles Kopfhaar, ein struppiger Bart, als habe jemand, der sein Gesicht sonst glatt hält, seit Wochen jede Rasur versäumt.
Das Alter ließ sich schwer schätzen. Nicht mehr ganz jung jedenfalls. Wahrscheinlich noch ein paar Jahre älter als er selbst, vermutete Rayko, und sein vierzigster Geburtstag lag schon einige Monate zurück.
Seufzend kämpfte er den Impuls nieder, die Höhle ebenso leise und schnell wie er gekommen war, wieder zu verlassen. Wenn dies wirklich die Seuche war, vor der sie geflohen waren, mochte er sich ohnehin schon angesteckt haben. Und falls der Fremde nur erschöpft war oder an einer anderen Krankheit litt, wäre es unverantwortlich, ihn hier in der Einöde völlig sich selbst zu überlassen.
Rayko hockte sich auf den Boden und tastete in seinem Bündel nach der Wasserflasche. Dunkle Augen starrten ihn erschreckt an, als er begann, die Stirn des Fremden mit einem feuchten Tuch abzutupfen. Der ausgemergelte Körper spannte sich abwehrend unter der Decke, wenn auch der Kranke nicht die Kraft fand, Hände und Arme unter dem verschlissenen, rauen Stoff herauszuwinden. Die aufgesprungenen Lippen bewegten sich murmelnd. Rayko beugte sich dichter heran.
„Will nicht ... lass mich ... will ...“, verstand er endlich.
„Komm, du musst dich aufsetzen. Du musst trinken! Es wird alles gut“, versuchte er den Fremden zu beruhigen.
Aber der sträubte sich immer noch. „Lass mich. - Ich will - sterben“, stieß er abgehackt hervor. „Ich will einfach nur sterben.“
Trotz seiner Gegenwehr hatte Rayko den widerstrebenden Mann halb aufgerichtet und versuchte, ihm etwas Wasser einzuflößen. Aber der Fremde presste die Lippen fest aufeinander. Das Wasser floss ihm über Kinn und Hals in die Kleidung, tropfte auf den Boden und benetzte Raykos Hände. Plötzlich packte ihn die kalte Wut. Wasser war kostbar! Niemand wusste, wie lange der Sturm sie in dieser Höhle festhalten würde!
„Trink jetzt!“, herrschte er den anderen an. „Ich teile mein Wasser mit dir. Die Gastfreundschaft ist hier in den Bergen heilig. - Und falls du von weit her kommst und mit den Sitten und Gebräuchen hier nicht vertraut bist: Sie auszuschlagen kommt einer tödlichen Beleidigung gleich. Wenn du jetzt nicht anständig schluckst, bist du schneller tot, als dir lieb ist!“
Ohne den Fremden loszulassen, setzte Rayko die Wasserflasche ab, zog den breiten Dolch aus dem Gürtel und legte ihn griffbereit neben sich. Es war keine Angst oder Unterwürfigkeit, was er in den Augen des anderen aufflackern sah, eher ungläubiges Erstaunen und eine neue Klarheit, als hätten die heftigen Worte die Schleier des Fiebers im Kopf des Kranken ein wenig gelichtet. Er trank nun gehorsam Schluck für Schluck aus der angebotenen Flasche, ohne Rayko dabei aus den Augen zu lassen. Rayko wurde plötzlich bewusst, dass er immer noch den Arm um die Schultern des Mannes gelegt hatte.
‚Wie lange ist es wohl her, dass ich zum letzten Mal einen Mann umarmt habe?‘, schoss es ihm durch den Kopf. ‚Seit ich im Haushalt meiner Schwester lebe, hatte ich jedenfalls keine Gelegenheit mehr dazu. - Und jetzt ist wohl kaum der richtige Augenblick, um ausgerechnet daran zu denken!’, rief er sich selbst zur Ordnung, als er erneut das ausgezehrte Gesicht mit den vorstehenden Wangenknochen und die schweißverklebten Haare des Fremden musterte und durch den Stoff des Gewandes den mageren, fiebernden Körper spürte.
Und doch ... Die dunklen Augen waren jetzt geschlossen, der Kopf des Mannes war erschöpft zurückgesunken und ruhte schwer auf Raykos Arm. ‚Er ist schön, trotz allem‘, dachte er verwirrt. ‚Und er scheint mir irgendwie vertraut. Doch ich weiß nicht, wo wir uns begegnet sein könnten ...‘ Entschlossen drängte er den Gedanken beiseite, ebenso wie das flaue Gefühl in der Magengrube, das ihn plötzlich erfasst hatte. Oder war es ein Ziehen im Herzen? ‚Wenn es ihm besser geht, wird sich alles aufklären‘, dachte Rayko. Sie würden reden ...
Vorsichtig ließ er den Schlafenden zu Boden gleiten und bettete seinen Kopf wieder auf die schäbigen Lumpen. Er öffnete sein Bündel und entrollte seine eigene Decke. Einen Moment zögerte er, dann rückte er entschlossen dicht an den anderen heran und breitete die Decke auch über seinen Körper. In der langen Nacht würde der Kranke jede zusätzliche Wärme brauchen können.
Flimmerndes Sonnenlicht fiel durch den Höhleneingang und weckte Rayko. Der Sturm hatte sich in einen zwar noch kräftigen, aber erträglichen Wind verwandelt. Raykos erster Blick galt dem Fremden, an dessen Seite geschmiegt er die Nacht verbracht hatte. Zu seinem Erstaunen waren seine Augen geöffnet und sein Blick klar. Verlegen rückte Rayko ein wenig von ihm ab und rappelte sich hoch.
Er hatte eine unruhige Nacht mit Fieberfantasien und Krampfanfällen erwartet, aber der Fremde wirkte erfrischt und entspannter als am Abend zuvor. Forschend suchten seine Augen Raykos Blick. Rayko spürte grenzenlose Erleichterung. Dies konnte nicht die gefürchtete Seuche sein; sie gönnte ihren Opfern niemals eine Ruhepause, sondern führte sie, wenn die Ansteckung erfolgt war, unter Fieber, Krämpfen und Schmerzen auf direktem Wege zum Tod.
Das Sprechen schien den Kranken noch anzustrengen. Mit einer Kopfbewegung zeigte er auf ein Bündel an der gegenüberliegenden Höhlenwand.
„Dort drüben“, krächzte er heiser. „Im Beutel.“
Rayko erhob sich und kramte zwischen den Sachen des Fremden. Seine Hände fanden den weichen Lederbeutel und lösten die Verschnürung. Sogleich stieg ihm ein kräftiger, aromatischer Duft in die Nase und sein Blick fiel auf verschiedene sorgfältig gebündelte Kräuter. Rayko wandte sich zurück und reichte dem Fremden seinen Fund. Der senkte bestätigend den Kopf und zeigte mit zitternden Fingern auf eines der Bündel.
„Falls noch Wasser da ist ...?“, flüsterte er und Rayko glaubte einen Schimmer von Schuldbewusstsein in seiner Stimme zu hören. Er verkniff sich eine bissige Bemerkung und langte nach der Flasche.
„Aber wir haben kein Gefäß, falls du die Kräuter einweichen willst, meine ich. Vielleicht geht es so?“
Rayko formte aus seinen Händen eine Schale und lächelte dem Fremden zu. Der antwortete mit einem dankbaren Nicken, öffnete das Kräuterbündel, zählte einige Stiele in Raykos Hände und benetzte sie mit dem Rest des Wassers. Rayko presste die Finger so fest zusammen, dass es schmerzte. - „Nur einige Minuten“, erklärte der Fremde. Rayko nickte abwesend. Ihn beschäftigte inzwischen etwas ganz anderes.
„Sag mal“, knurrte er, „heißt das, du hattest die ganze Zeit ein Heilmittel bei dir und lässt es dennoch zu, dass du in so einen Zustand gerätst? Ein schöner Heiler bist du!“
Der Fremde senkte den Blick. „Das bin ich eigentlich nicht. Kein Heiler. Eher ... Nein, nicht direkt ein Heiler.“ Er verstummte und drückte die Kräuter ein wenig tiefer ins Wasser.
„Du solltest auch etwas davon nehmen. Es ist ein Stärkungsmittel. Es hilft gegen die Erschöpfung. Es gibt dir Kraft, den Weg zu dir nach Hause zu schaffen.“
„Du meinst: Es gibt uns die Kraft, den Weg zu schaffen“, widersprach Rayko. „Ich werde dich nicht hier zurücklassen.“
„Aber ...“
„Entweder du läufst selbst oder dein Kraut gibt mir die Kraft, dich zu tragen.“
Der Fremde seufzte und fügte dem Gemisch ein paar weitere Pflanzenstängel hinzu. Nach einigen Minuten des Wartens schien er zufrieden. Er presste die Kräuter über Raykos Händen aus, ohne etwas von der Flüssigkeit zu verschütten, und schob ihm den dritten Teil der feuchten Masse in den Mund. Er selbst nahm den Rest. Sie kauten ausgiebig und tranken das Einweichwasser aus Raykos Händen. Erleichtert schüttelte und entspannte Rayko seine Finger.
Der Fremde hatte sich wieder ausgestreckt. „In einer halben Stunde müsste die Wirkung einsetzten“, erklärte er. „Sie hält fünf bis sechs Stunden an. Es ist ein Anregungsmittel. Es kann sein, dass du dich später schlechter fühlst als vorher, aber es befähigt dich, deine letzten Energiereserven zu mobilisieren.“
Während der Fremde noch seine Kräfte sammelte, begann Rayko schon, die Sachen zusammen zu packen und die beiden Bündel zu schnüren. Er wagte es nicht, sich den Heimweg auszumalen. Mit oder ohne Stärkungsmittel – er war sicher, es würde eine Strapaze werden.
Rayko hatte erwartet, von dem belebenden Kräutermittel in eine angeregte, aufgekratzte Stimmung versetzt zu werden. Stattdessen fühlte er sich immer mehr von einem trägen Gleichmut ergriffen. Mit schlafwandlerischer Sicherheit setzte er einen Fuß vor den anderen, gleichgültig, wie steil der Weg sich erwies, wie oft er auf losen Steinen ausglitt, wie sehr der Wind an den Kleidern zerrte und wie schwer das Gewicht des Fremden auf ihm lastete, der sich, den Arm um seine Schultern gelegt, bei jedem Schritt fest auf ihn stützte.
Die Zeit verlor ihre Wichtigkeit. Jeder Gedanke an das Ende der Wanderung schien in unerreichbare Ferne gerückt. Ein Schritt – noch ein Schritt. Stolpern, sich aufrappeln ...
Erst die aufgeregten Stimmen brachten Rayko wieder zu sich. Hände griffen nach ihm und stützten ihn. Taumelnd und strauchelnd wankte er über die Schwelle der Hütte, sank schwer atmend auf die grobe Holzbank nieder und beobachtete mit starrem Blick wie die zwei Männer den Fremden zwischen sich hereinschleppten und ihn auf den Lehmboden gleiten ließen. Kari und Mirek, seine Nachbarn, die mit ihm und der Familie seiner Schwester hierher in die Berge gezogen waren, erkannte er.
Dann sah er sich dem wutverzerrten Gesicht einer schlanken, kleinen Frau gegenüber, seiner jüngeren Schwester, die aber, seit er denken konnte, immer versucht hatte ihn entweder zu bemuttern oder zu erziehen.
„Wen schleppst du denn hier an?“, zischte sie erbost. „Einen Kranken aus dem Dorf vielleicht? Sind wir deshalb so weit in die Wildnis geflohen, damit du uns jetzt das Verderben noch selbst ins Haus bringst?“
„Rana, so hör doch! Es ist nicht die Seuche. Er ist nur erschöpft. – Und er ist mein Gast!“, setzte Rayko mit Nachdruck hinzu.
„Dein Gast! Du bist selbst nur Gast in meinem Haus, vergiss das nicht! Wer gibt dir das Recht ...“
„Dies ist aber nicht dein Haus!“ Jetzt blitzte der Zorn auch in Raykos Augen. „Dies ist unser gemeinsamer Unterschlupf, der uns vor der Seuche gerettet hat. Diese Hütte gehört uns allen und ich selbst habe sie einst entdeckt!“
Für einen Moment herrschte Ruhe. Dann brach die Frau plötzlich in Tränen aus.
„Uns allen. Du sagst es! Es ist doch wahrlich eng genug hier! Noch ein Esser mehr! Was denkst du dir bloß?“ Sie streifte den Fremden mit einem Blick voller Abscheu. „Einen schönen Freier hast du dir da eingeladen. Eine Schande ist das!“ Rana wandte sich um und stürzte hinaus.
Rayko hatte das Gesicht in den Händen vergraben. „Es tut mir leid“, brummte er schließlich zu den beiden Nachbarn gewandt.
„Du solltest ihr folgen“, drängte einer der Männer. „Sie ein wenig beruhigen. Ich glaube, sie ist am Ende ihrer Kräfte. – Wir alle sind es“, setzte er ein wenig leiser hinzu. „Es wird wirklich Zeit, dass wir zurückkehren. Was hast du überhaupt herausfinden können?“
Rayko blickte auf. Das eigentliche Anliegen seiner Wanderung war durch die neuesten Ereignisse weit in den Hintergrund seines Bewusstseins verdrängt worden.
„Aber wir können zurückkehren!“, rief er freudig. „Ich war in unserem Dorf und auch im Nachbardorf. Es sind keine neuen Krankheitsfälle mehr aufgetreten. Einige Familien haben ihre Häuser schon wieder bezogen. Wenn ihr wollt, könnt ihr morgen aufbrechen.“
„Und er?“ Mit einer Kopfbewegung zeigte Kari auf den Fremden, der teilnahmslos an der Stelle verharrte, wo sie ihn hingelegt hatten. Rayko zögerte nur kurz.
„Ich werde bei ihm bleiben, bis er wieder gesund ist. Wir können ihn nicht so weit tragen und ich kann nicht von euch verlangen, seinetwegen noch hierzubleiben. - Ihr könnt morgen aufbrechen“, wiederholte er fest.
„Du allein in dieser Wildnis? Die Vorräte sind fast aufgebraucht.“
Rayko wirkte zuversichtlich. „Es wird nicht lange dauern, bis er reisefähig ist. Lasst mir eine der Ziegen hier, dann komme ich schon zurecht.“
Eine Geschichte
Die Erschöpfung und die Nachwirkung des unbekannten Kräutergemischs forderten ihren Tribut. Rayko hörte nichts mehr von den Gesprächen der anderen, die vor dem Einschlafen noch lange über die Rückkehr nach Hause debattierten. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, wie er auf sein Lager gekommen war.
Als er am nächsten Morgen erwachte, fand er sich allein in der Hütte – mit Ausnahme des schlafenden Fremden. Die hilfreichen Nachbarn, seine Schwester mit ihrem Mann und ihren Söhnen und Töchtern, die Eltern ihres Mannes... Alle, die in den letzten Wochen den engen Unterschlupf mit ihm geteilt hatten, waren bereits auf dem Rückweg ins Dorf.
Die Ziege fand sich angepflockt hinter dem Haus und auf dem wackligen Tisch entdeckte er einen Krug frischen Quellwassers, einen Laib Käse und zwei runde Brotfladen, die seine Schwester trotz ihres Wutausbruchs - und trotz ihrer Verachtung - für ihn und seinen Gast zurückgelassen hatte.
Der Fremde hatte Recht behalten. Nachdem die Wirkung des Krautes verflogen war, hatte Rayko wie ein Stein geschlafen und fühlte sich trotzdem ausgelaugt und kraftlos wie nach einer langen Krankheit.
Kein Vergleich jedoch zu der Wirkung, die das Mittel auf den Fremden zu haben schien. Trotz aller Anstrengung konnte Rayko ihn nicht zum Bewusstsein bringen. Das Fieber war wiedergekehrt; es tobte den ganzen Tag und ließ den Körper des Kranken mit ständigem Wechsel von Schüttelfrost und Schweißausbrüchen keine Minute lang zur Ruhe kommen.
Erst am Abend schien sich der Zustand des Fremden zu stabilisieren. Endlich schlug er die Augen auf und verlangte nach Wasser. Rayko versorgte ihn, flößte ihm etwas Ziegenmilch ein und zwängte ihm ein wenig eingeweichtes Brot zwischen die Zähne. Jetzt erst wagte er es, den erhitzten Körper zu waschen; er wechselte die verschmutzte und verschwitzte Kleidung und hüllte den Fremden in eines seiner eigenen Gewänder.
Rayko spürte zunächst nur Erleichterung darüber, dass es seinem Schützling besser ging, doch als er ein wenig zur Ruhe kam, neben dem Lager des anderen hockte und ihn beobachtete, fühlte er plötzlich die Wut wieder in sich aufsteigen.
„Das hattest du dir ja toll ausgedacht“, knurrte er den Fremden an. „Und ich Dummkopf bin darauf hereingefallen. Du hast mir die Wirkung deines Krautes auch noch beschrieben! Du hast mit Absicht die doppelte Menge genommen. Du dachtest, es bringt dich um, nicht wahr?“ Grimmig starrte er in die dunklen Augen.
„Denkst du, ich schleppe ich dich den ganzen langen Weg hierher, um dich dann dennoch sterben zu sehen? Was, um alles in der Welt, stört dich so sehr daran zu leben?“
„Das ist eine lange Geschichte“, murmelte der Fremde.
„Dann erzähle sie!“, forderte Rayko.
Ein störrisches Kopfschütteln antwortete ihm. „Nein. Es ist keine schöne Geschichte. Außerdem bin ich müde. Ich bin zu schwach.“
„Wer stark genug ist, sich über immer neue Formen des Selbstmords den Kopf zu zerbrechen, wird wohl noch etwas Kraft zum Reden finden!“, fauchte Rayko den Fremden an. „Und wenn es dich umbringt – dann hast du schließlich nur erreicht, was du ohnehin wolltest!“
Zum ersten Mal sah er den anderen lächeln. Ein kurzes Aufleuchten in den Augen, ein winziges Heben der Mundwinkel, dann war es wieder verflogen.
„Es geht nicht“, widersprach der Fremde immer noch. „Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.“
„Nun, am Anfang natürlich“, sagte Rayko ungerührt. Er zog seinen eigenen Strohsack neben das Lager des Fremden und hüllte sich in seine Decke. „Los. Fang an. Ich bin bereit. Wir haben Zeit. Die ganze Nacht, wenn du willst.“
Immer noch zögernd sah der andere zu ihm herüber. „Was diese Frau – deine Schwester - gestern Abend sagte ... Ich glaubte herauszuhören, dass du in der Liebe ... Männer bevorzugst ...“, begann er stockend.
„Na und?“, schnappte Rayko, „Ich bin ein freier Mann. Ich kann lieben, wen ich will! Und außerdem ...“
„Versteh mich nicht falsch!“, unterbrach der Fremde ihn hastig. „Ich hätte wohl eher sagen sollen: Dass auch du die Liebe der Männer bevorzugst. Wenn ich von mir erzählen soll ... dann wirst du vielleicht besser verstehen ...“
Mit einer heftigen Handbewegung wischte Rayko das Thema beiseite - ehe der Fremde am Ende noch seine Verlegenheit bemerken würde.
„Was ist denn nun Schlimmes geschehen?“, drängte er. „Hast du Geld verloren? Oder Freunde? Deine Familie?“
Der andere nickte. „Das alles und mehr. – Aber wenn ich am Anfang beginnen soll ...“ Er legte den Kopf zurück auf den kratzigen Strohsack, schien in sich hineinzuhorchen. Rayko verhielt sich ruhig. Er spürte die veränderte Stimmung des Fremden und wartete nun geduldig, bis er seine Gedanken geordnet hatte.
„Ich habe mich schon oft gefragt“, begann der Fremde schließlich mit schleppender Stimme, „an welchem Tag meines Lebens ich dem Lauf der Ereignisse noch hätte entfliehen können. Ich suche immer noch die Tür, die mir den Weg gezeigt hätte hinaus, weg von dem unausweichlichen, gnadenlosen Schicksal, das mich ereilte.
Doch wie sollte es mir gelingen, mein Leben frei und glücklich zu gestalten, nach dieser Jugend, nach diesem Lehrer, der seinen Willen mit all seiner magischen Macht in meinen Charakter einbrannte, Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr, bis nur ein Gedanke mich trieb: Niemals so werden zu wollen wie er!
Doch wenn ich jetzt an meinen eigenen, hageren Körper denke und an meine dunklen, vom Reisestaub gezeichneten Gewänder, sehe ich wieder seine Gestalt vor mir, so wie ich mitunter die gleiche unbarmherzige Kälte und Härte in mir spüre, mit der er allen um sich herum stets begegnete ...“
Die Stimme verebbte. Rayko warf einen schnellen Blick zu dem Erzähler hinüber, der versuchte, seine Gefühle wieder unter Kontrolle zu bringen.
„Höchstens vorher noch, bevor ich ihn traf“, fuhr er schließlich fort. „Wenn ich mich dort anders entschieden hätte, damals als Kind, als er zum ersten Mal meinen Weg kreuzte. Wenn ich mich dort besonnen hätte auf meine Liebe zu meinen Eltern, Geschwistern und Nachbarn, zu der Hütte in der wir lebten, die meine Heimat war ... Doch ich folgte seinem Ruf wie einem schimmernden, funkelnden Stern und er führte mich in Verzweiflung und Untergang.“
Die Geschichte beginnt an einem klaren Sommertag. Ich lehne an der Hauswand, döse, betrachte den rötlichen Straßenstaub aus halbgeöffneten Augenlidern. Heute gibt es hier nichts als Hitze – und Langeweile.
Beinahe hätte ich den Alten nicht bemerkt, der mit seltsam zögernden Schritten in unsere Gasse einbiegt.
‚Ein Fremder, hier bei uns?‘, denke ich überrascht. Er hat etwas Verstohlenes an sich, als hätte er in den Taschen seines langen, schwarzen Gewandes irgendetwas Geheimnisvolles, Gefährliches verborgen.
Inzwischen hellwach, rappele ich mich hoch und folge ihm vorsichtig durch die menschenleere Gasse. Er biegt um eine Ecke, blickt suchend um sich, wählt dann mit ruhiger Gewissheit sein Ziel. Er klopft hart gegen die Tür; sie öffnet sich und der hagere Mann verschwindet im Haus des Kupferschmieds.
Ich hätte gar nicht bis dicht unter das Fenster zu schleichen brauchen, um die streitenden Stimmen zu belauschen. Das Weinen der Frau, das laute, heisere Schimpfen des Schmieds und die etwas leisere, aber schneidend kalte Stimme des Fremden sind weithin zu hören.
‚Es geht wohl um Geld‘, denke ich mit der ganzen Lebenserfahrung meiner siebeneinhalb Jahre.
‚Oder um Wichtigeres!‘, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Die Ereignisse fesseln meine Aufmerksamkeit, sodass ich vergesse, der Stimme zu widersprechen.
Ich kann gerade noch zur Seite huschen und mich im Schatten der Hauswand verbergen, als die Tür wieder aufspringt. Der Fremde tritt heraus. Er hält sich den linken Arm kurz unterhalb des Ellenbogens. Hinter ihm erkenne ich den schimpfenden Schmied und die schluchzende Frau, die verzweifelt versucht, ihren Mann ins Haus zurückzuziehen.
„Das werdet ihr bereuen! Ihr werdet euch noch wundern!“ Der Mann lässt seinen Unterarm los. Blut sickert durch schwarzen Stoff, sammelt sich am Saum des Ärmels und tropft auf den Boden. Die rechte Hand des Fremden malt seltsame Zeichen in die Luft, seine Lippen formen dunkle Laute, die aber kaum bis an mein Ohr dringen.
Ich sehe ihn ganz deutlich, als er sich jetzt umdreht und dicht an mir vorbei hastet. Dunkles, kurz geschnittenes Haar, von einigen grauen Strähnen durchzogen. Ein scharfes Profil mit Habichtsnase, hervorstehende Wangenknochen, buschige Augenbrauen. Alles sieht scharfkantig aus an diesem Gesicht, zackig und schartig. Er hat helle Augen, selten in unserer Gegend, und einen stechenden, harten Blick. Kälte geht von ihm aus. Ich fröstele trotz der Mittagshitze, schrecke dann auf.
Ich muss ihm folgen!
Er ist fast schon am Ende der Gasse angekommen, die jetzt belebt ist. Die Nachbarn sind, angelockt vom Lärm des Streites, aus ihren Häusern getreten, staunen und gaffen, während die Tür des Schmieds schon lange wieder verschlossen ist. Instinktiv weiche ich der Hand aus, die mich aufhalten will, weiß nicht einmal, zu welchem der Nachbarn sie gehört.
Ich muss ihm folgen!
Beinahe wäre ich in ihn hineingerannt. Er ist stehen geblieben, hat einen Streifen von seinem Gewand abgerissen und um den verletzten Arm gewickelt. Ein Messerstich vielleicht? Aber ich verschwende keinen Gedanken mehr an die mögliche Ursache des Streites. Mein ganzes Denken ist erfüllt von der neuen Aufgabe, ungesehen diesem Mann zu folgen, der mich irgendwie in seinen Bann geschlagen hat. Meine Angst, das Unheimliche, das von ihm ausgeht, selbst die Tatsache, dass wir längst unser Stadtviertel verlassen haben und ich nie und nimmer allein zurückfinden würde - alles wird überdeckt von dem brennenden Wunsch diesem Mann auf den Fersen zu bleiben, zu sehen, was er tut, wo er hingeht, wer er ist.
Hätte ich damals schon das Wort gekannt: ‚Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten erfüllt werden!‘ – Es wäre mir vieles erspart geblieben.
Der Kranke schwieg, schien tief in seine Erinnerungsbilder versunken zu sein.
„Und?“, fragte Rayko sanft. „Hast du ihn eingeholt?“
„Oh ja!“Die Stimme klang angespannt und bitter. Der Erzähler nahm einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche und fuhr dann wie selbstverständlich fort, als sei er jetzt selbst entschlossen, sich all die alten Erinnerungen von der Seele zu reden.
Ich folge dem Mann bis zu den bewachten Toren, die die Bewohner der vornehmen Innenstadt vor den Räubern – und wahrscheinlich auch vor allen einfachen Leuten – schützen sollen. Er scheint den Wachen bekannt zu sein. Mit einer ehrerbietigen Verbeugung lassen sie ihn passieren. Ich schaffe es gerade noch, mich zwischen zwei schwer beladene Esel eines Händlers zu zwängen und den Augen der Wächter zu entgehen.
Ich überwinde ungeschoren diese Hürde, aber als ich mich auf der anderen Seite der Stadtmauer umsehe, ist der Mann verschwunden. Unschlüssig schlendere ich ein paar Schritte in eine Gasse hinein, schiebe mich vorsichtig an der Hauswand entlang und halte nach ihm Ausschau, als mich jemand von hinten an den Armen packt. Ehe ich schreien kann, werde ich umgedreht und sehe direkt in die stechenden, hellen Augen.
„Was willst du von mir?“, herrscht er mich an. Ich bemerke ein kunstvoll gefertigtes Amulett, das, von einer schweren goldenen Kette gehalten, auf seiner Brust hängt. Als er meinem Blick folgt, stopft er es hastig mit einer Hand unter sein Gewand, ohne den Griff der anderen Hand zu lockern, die immer noch hart meinen Oberarm umspannt hält.
„Ich ... ich weiß nicht. Ich wollte nur ... sehen, wo du hingehst“, stottere ich. Er mustert mich mit seinem durchdringenden Blick.
„Gut. Das kannst du haben“, sagt er lässig.
Mit langen Schritten stürmt er los und zerrt mich hinter sich her. Ich versuche, mich loszureißen, aber vergeblich, er ist viel kräftiger, als ich vermutet hatte. Passanten werden auf uns aufmerksam. Langsam bekomme ich es mit der Angst zu tun. Schließlich bin ich unberechtigt in diesen Stadtbezirk eingedrungen. Was würden die Wachen wohl mit jemandem wie mir anstellen? Also lasse ich mich widerstrebend mitziehen.
An einem vornehm wirkenden Haus hält er inne und betätigt den Türklopfer. Ein Diener öffnet uns, ein weiterer wartet neben der Tür auf seine Befehle. Die lassen auch nicht lange auf sich warten.
„Hier! Ihr wisst ja Bescheid.“
Er schiebt mich den Dienern zu, die mich wie selbstverständlich packen und mich quer durch die Eingangshalle in den hinteren Teil des Hauses zerren. Zu meinem Entsetzen werde ich ausgekleidet und in einen Waschzuber gesteckt. Mein halbherziger Protest scheint sie nicht zu kümmern, mit ernsten, ausdruckslosen Gesichtern erledigen sie ihre Arbeit. Eine ältere Frau bringt Handtücher und ein Wäschebündel. Sie stopfen mich in neue Kleider. Ich bekomme eine weite Hose, eine Art Unterhemd, ein lockeres Obergewand und sogar aus Stroh geflochtene Sandalen. Ich habe niemals Schuhe besessen! Dann führen sie mich durch einen Gang und schieben mich in einen großen, hellen Raum.
Ich erkenne mehrere Lager mit Polstern und Decken. Einige andere Jungen, alle ein wenig älter als ich, haben sich darauf ausgestreckt und scheinen ihre Mittagsruhe zu halten. Ein paar weitere hocken in einer Ecke zusammen, in ein Würfelspiel vertieft. Bei meinem Eintreten heben sie die Köpfe.
„Hannis!“, ruft einer der Diener. Einer der Jungen erhebt sich; den Würfelbecher noch in der Hand schlendert er zu uns herüber.
„Du hast zurzeit niemanden zu betreuen, nicht wahr? - Dann gehört er dir. Er ist ein bisschen widerspenstig. Zeig ihm alles! Du bist heute Nachmittag vom Unterricht befreit.“
Die Diener wenden sich um und verlassen den Raum. Der Junge kommt auf mich zu. Aber ich warte nicht, bis er mich erreicht hat. Ich schnelle herum, stürze zur Tür und rüttele wild am Türknauf. Es ist abgeschlossen. Ich bin eingesperrt!
Mir wird nicht bewusst, dass die anderen Jungen ebenfalls gefangen sind. Ich trete so fest gegen das massive Holz, dass mir die Sandalen von den Füßen fallen. Ich trommele mit den Fäusten gegen die Tür und brülle. Ich bettele und schluchze. Aber die Diener haben sich wohl längst in einen anderen Teil des Hauses zurückgezogen und die anderen Jungen beachten mich kaum. Nur der Junge, den der Diener zu uns herangerufen hat, hat sich einige Meter von mir entfernt auf ein Polster gesetzt und sieht mir aufmerksam zu. Schließlich sacke ich schwitzend und erschöpft am Türpfosten in mich zusammen. Meine Kehle ist wie ausgedörrt vom Schreien und Weinen und ich spüre jeden Muskel im Leib.
Der Junge kommt vorsichtig näher, als fürchte er, ich könne wieder beginnen, um mich zu treten. Er grinst mich an.
„Bist du nun soweit? Dann zeige ich dir jetzt deinen Schlafplatz.“
Er hilft mir auf die Füße und zieht mich zu einem der Lager hin. Ich lasse mich auf die Polster fallen und vergrabe den Kopf in der Decke.
Ich hatte niemals zuvor bemerkt, dass ich glücklich war. Ich hatte alles in meinem Leben stets als selbstverständlich betrachtet. Ich glaube nicht, dass ich ein besonders liebevoller Sohn war. Ich verbrachte meine Zeit lieber draußen, in den verwinkelten Gassen, als in der engen stickigen Hütte in der Gesellschaft meiner Eltern. Ich beobachtete gern die Handwerker bei der Arbeit, vertrödelte Stunden in der Schmiede oder sah den Nachbarsfrauen dabei zu, wie sie aus Ton Schüsseln oder Krüge formten. Meine beiden kleinen Schwestern waren mitunter eine rechte Plage und mein Vater konnte sehr streng und aufbrausend sein ... Aber nun ist mir mit einem Schlag alles genommen worden und ich weine den ganzen Nachmittag über diesen unerträglichen Verlust.
Ich bemerke kaum, wie die anderen Jungen zum Unterricht abgeholt werden. Der Junge, der mich betreuen soll, harrt an meiner Seite aus und versucht mir von den Regeln und Gebräuchen im Haus zu berichten, wie es ihm aufgetragen worden ist. Aber ich bin unfähig, auch nur ein Wort seiner Rede aufzunehmen. Schließlich überlässt er mich meinem Kummer, hockt sich an den flachen Tisch und macht sich an den zurückgelassenen Würfeln zu schaffen. In der nächsten Zeit wird er der unbestrittene König des Würfelspiels und viele der anderen Jungen müssen sich von ihren Schätzen oder Leckerbissen trennen, um ihm seine Gewinne auszahlen zu können.
Erste Bestrafung
Am nächsten Morgen bleibe ich auf meinem Lager liegen. Ich höre die anderen Jungen aufstehen, herumgehen, miteinander sprechen und schließlich den Raum verlassen. Keiner beachtet mich und ich rühre mich nicht, stelle mich tot. Meine Augen brennen, sind geschwollen vom Weinen. Ich muss gerade wieder eingedöst sein, als jemand an meiner Schulter rüttelt.
„Komm, steh auf! Der Meister will dich sehen.“
Es ist der Junge, der mir gestern den Schlafplatz gezeigt hat. Welcher Meister? Der Alte, dem ich gestern gefolgt bin vielleicht?
„Nun mach schon!“ Er zieht mich hoch und grinst mich an. „Ich heiße Hannis. Hast du auch einen Namen?“
„Joshua.“ Meine Stimme klingt heiser. Warum habe ich überhaupt geantwortet? Er zieht mich durch den Schlafraum.
„Joshua. Jossi. Das ist gut“, sagt er. „Ich hasse es, wenn Namen doppelt vorkommen bei uns. Ewig diese Erklärungen: ‚Meinst du den großen Joshua oder den kleinen? Den dicken oder den dünnen? Den Joshua mit den reichen Eltern oder den Joshua, der letztes Jahr als Sklave verkauft wurde?‘ Aber Joshua ist gut, das hatten wir noch nicht!“
Er plappert und plappert, während er mich durch die Tür auf einen langen Gang zerrt. Das Haus scheint überhaupt nur aus Gängen zu bestehen. Der Eindruck, den ich gestern schon hatte, verstärkt sich, wird mich durch meine ganze Kindheit und Jugend begleiten: Endlose Gänge, durch die ich gehe, geführt, gezerrt, geschleift, getragen werde ...
Ich verscheuche das Bild aus meinem Kopf. Noch laufe ich selbst! Ich sehe die Lichtreflexe auf dem Steinboden. Das Sonnenlicht fällt durch holzgeschnitzte Gitter vor den Fenstern. Kunstvoll gefertigt, aber sehr stabil, halte ich im Geiste fest. Keine leichte Fluchtmöglichkeit.
„Wir sind da!“
Er schiebt mich durch die Tür, zwei Schritte weit in den Raum hinein und zieht sich schnell zurück. Ich höre die Tür hinter mir zufallen.
Ich stehe in einem großen Raum; Säulen teilen ihn in mehrere Abschnitte. Weiter hinten erkenne ich einen mit Vorhängen abgeteilten Bereich, vielleicht der Durchgang zu weiteren Räumen. Halbhohe Säulen, auf denen seltsame Figuren oder Steine stehen, säumen die rechte Wandseite. An der linken Wand lagern, sorgfältig aufgereiht, eine Reihe von Gegenständen, deren Funktion ich nicht kenne. Auch hier vergitterte Fenster.
In der Mitte des Raumes, vor einigen Sitzpolstern, erwartet mich der Mann, der mich gestern hierher gebracht hat. Er trägt heute ein weißes Gewand, die weiten langen Ärmel verbergen die Verletzung an seinem Arm. Ich kann keinerlei Schmuck ausmachen, nicht einmal das schimmernde Amulett, das ich gestern an ihm gesehen habe, ist zu entdecken. Wieder trifft mich der kalte Raubvogelblick.
„Ich hoffe, du hast dich schon ein bisschen eingelebt.“ Jetzt lächelt er sogar. Ich nehme mir vor, kein Wort zu sagen.
„Du wirst dich schon daran gewöhnen“, fährt er ruhig fort. „Alle leben sich ziemlich schnell ein. Du wirst die nächsten Jahre in meinem Haus verbringen. Wenn du hier wieder rauskommst, wirst du fast ein erwachsener Mann sein.“
Ich will nicht glauben, was ich höre. Das kann nicht sein! ‚Der Joshua, der letztes Jahr als Sklave verkauft wurde ...‘ Hannis‘ Worte gellen in meinem Kopf. Die Angst schnürt mir die Kehle zusammen. Die Rede des Alten rauscht an mir vorbei. Er spricht davon, dass ich mich glücklich schätzten könne, so eine Chance zu bekommen. Dass viele sich um eine Ausbildung bei ihm bewerben und abgewiesen werden, dass ich es aber schaffen könnte, weil ich meine erste Prüfung bereits bestanden hätte.
Ich verstehe nicht, wovon er redet.
„Weißt du nicht, dass dies die beste Schule der Magie ist von hier bis zum Rande des Gebirges? Dass Schüler über mehr als zwanzig Tagesreisen zu mir gebracht werden, damit ich sie ausbilden soll, und die Eltern jahrelang gutes Geld dafür bezahlen? Die beste Magierschule, weil der beste Magier sie leitet! Und du hast mich gestern in der Kunst der Magie fast übertroffen.“
Er sieht meinen verständnislosen Blick, tritt näher zu mir heran. „Versteh doch, Junge! Vor Jaroks Haus hatte ich dich gestern noch gesehen und dann erst wieder am Stadttor. Du musst so dicht hinter mir hergeschlichen sein, dass ich deinen Atem im Genick hätte spüren müssen, ohne einen einzigen Gedanken an magische Kräfte zu verschwenden.
Aber ich habe dich nicht bemerkt! Seit ich vier Jahre alt bin, habe ich immer noch jeden wahrgenommen, der sich mir dichter als dreißig Meter näherte. Und du folgst mir einfach so quer durch die halbe Stadt! - Wie alt bist du? Acht Jahre, würde ich schätzen. Wenn aus dir nicht der beste Magier im Umkreis von tausend Meilen wird, soll mein Haus über mir zusammenbrechen! Und darum wirst du hierbleiben.
Man wird dir alles erklären, was du wissen musst. Du wirst noch eine Woche um deine Eltern weinen, dann wirst du sie vergessen haben. Du wirst mit den anderen Jungen zusammen leben und lernen. Sie sind alle ein wenig älter als du, aber das macht nichts. Du wirst dich anpassen und unterordnen ...“
Sein Redefluss scheint kein Ende nehmen zu wollen. Verwirrt schüttele ich den Kopf. Magie! Ich erinnere mich an einen Wahrsager und Heiler, den meine Mutter einmal aufsuchte, als eine meiner Schwestern krank war, an die Schutzamulette, die er fertigte ... Aber was habe ich damit zu schaffen? Ich hatte nichts Besonderes getan. Ich hatte mir gewünscht, dass er mich nicht sehen sollte, das schon. Aber weiter nichts!
Ich werde langsam ungeduldig. Ich will nach Hause. Ich stelle mir vor, wie meine Mutter weinend vor unserer Hütte sitzt, wie eine der Nachbarinnen tröstend den Arm um sie legt, während mein Vater mit ein paar anderen Männern die umliegenden Gassen durchstreift und nach mir ruft ... Ich schlucke und blinzele die Tränen aus meinen Augenwinkeln.
„Warum lässt du mich nicht wieder nach Hause? Ich will nichts mit deiner Magie zu tun haben!“
Ich vergesse meinen Vorsatz, nicht mit ihm zu sprechen. Meine Angst beginnt sich in Wut zu verwandeln. Wer gibt ihm das Recht dazu, mich einfach so von der Straße wegzufangen und hier einzusperren?
„Du kannst mich hier nicht festhalten!“, schleudere ich ihm entgegen.
„Doch, das kann ich.“ Seine Stimme klingt ruhig. Aber ich spüre den Willen und die Macht, die hinter diesen Worten stehen. Und ich spüre meine Auflehnung dagegen. Nie und nimmer kann er mich zwingen! Für einen Augenblick scheint es, als hätten wir beide vergessen, dass ich nichts als ein kleiner Junge bin. Wir stehen uns gegenüber wie ebenbürtige Gegner, starren uns an, Auge in Auge, Wille gegen Wille.
„Du kannst mich nicht zwingen, hierzubleiben!“, sage ich noch einmal, ohne den Blick von den kalten Augen zu wenden. „Und schon gar nicht dazu, mich dir unterzuordnen!“
Er bleibt ganz ruhig. „Deine Haltung gefällt mir nicht“, sagt er langsam. „Ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Jungen gleich am ersten Tag, beim ersten Gespräch bestrafen muss. - Aber du bist wohl auch in dieser Beziehung etwas Besonderes“, fügt er mit gleichmütiger Stimme hinzu.
Ich höre ihn kaum. Meine Gedanken rasen. Wie kann ich hier raus? Wie kann ich ihn überwältigen, ihn unschädlich machen? Ein Weg aus dem Haus heraus würde sich dann schon finden lassen. Er ist ja schon alt, sicher weit über fünfzig Jahre. Ein schwerer Gegenstand, etwas werfen ...
Er folgt meinem Gedankengang oder meinem suchenden Blick. Sein Lächeln wirkt nur leicht spöttisch, fast verständnisvoll. Beinahe so, als ob er mich mag. Und ich glaube nicht, dass er mir jemals wieder so ein Lächeln geschenkt hat.
„Glaub mir, du bist nicht schnell genug für mich! - Ist es so etwas, was du suchst?“ Er zeigt auf einen faustgroßen Stein, der auf einer dieser halbhohen Säulen liegt, drei Schritte weit entfernt von uns. Ich weiß, dass er mich durchschaut hat, dass er meine Absicht erkennt und nur sein Spiel mit mir treibt, aber meine Wut ist inzwischen übermächtig. Ich kann mich nicht mehr stoppen. Ein Sprung, und ich greife den Stein, hole aus, will ihn dem verhassten Zauberer an den Kopf schleudern ...
Aber der Stein ist heiß! Oder er wird plötzlich heiß. Schmerz durchzuckt meinen Arm bis zur Schulter. Ich will den Stein loslassen, doch es geht nicht mehr, meine Finger haben sich darum verkrampft. Ich nehme die andere Hand zu Hilfe, will das Teufelsding von mir schleudern ... Auch durch den linken Arm rast nun der Schmerz wie eine Stichflamme. Er ergreift den ganzen Körper, fährt wie ein Blitz ins Rückrad und wie gleißendes Licht ins Gehirn. Ich sehe nichts mehr. Ich breche zusammen, dort wo ich stehe. Meine Beine zucken in Krämpfen, meine Finger gehorchen mir nicht mehr, umkrallen immer noch den unscheinbaren kleinen Felsbrocken. Hölle des Schmerzes! Ewigkeiten vergehen, bis der Stein endlich abkühlt und meinen Händen entgleitet.
„Ich denke, das reicht für dieses Mal.“
Die Stimme des Magiers klingt immer noch ruhig, ein wenig fragend, fast als solle ihm jemand bestätigen, dass es wirklich gereicht habe.
Das Nächste, was ich fühle, ist der Schmerz in meinem Körper, als zwei der Diener mich zurück zu unserem Schlafsaal schleifen. Jeder Muskel scheint gezerrt, jeder Nerv überreizt, sodass jede Berührung zur unerträglichen Qual wird. Der Griff der beiden Männer an meinen Oberarmen, das Polster des Lagers unter meinem Rücken, das Gewicht der Decke, in die sie mich einhüllen - alles schmerzt und brennt. Mein Bewusstsein entgleitet mir, will sich in Fieberfantasien zurückziehen.
Dann spüre ich Hände, die meinen Kopf anheben und einen Becher an meine Lippen führen. Ein kühles, leicht bitteres Getränk wird mir eingeflößt und noch während ich den Kopf zurück auf das Polster lege, spüre ich, wie der Schmerz verebbt. Zurückweichende Wellen, die immer kleiner werden. Ich sinke in tiefen Betäubungsschlaf.
Hat er in die Zukunft gesehen oder nur meinen Charakter so gut erkannt? Oder hatten die Worte Hazrads solche Suggestivkraft, dass ich nicht anders konnte, als mich danach zu richten?
Ich gewöhne mich wirklich schnell ein. Ich vergesse tatsächlich meine Familie nach und nach, wenn auch nicht gerade in einer Woche. Und ich lerne leicht und schnell, als hätte irgendetwas in mir nur darauf gewartet, dieses Wissen in Empfang zu nehmen. Nur in einem Punkt irrte der Magier sich: Ich sollte mich niemals leicht oder gar freiwillig unterordnen und diese erste Bestrafung sollte nicht meine letzte gewesen sein.
„Er machte das öfter mit dir?“, unterbrach Rayko den Erzähler, dessen Name ‚Joshua‘ war, wie er inzwischen erfahren hatte. Er hatte versäumt, ihn danach zu fragen, stellte er verwundert fest.
Ein bitteres Lachen war die Antwort auf seine Frage.
„Das – und Schlimmeres. Manchmal glaube ich, meine ganze Kindheit bestand nur aus Schmerz und Qual. – Aber es gab auch schöne Dinge dort. Den Unterricht zum Beispiel. Ich sog das Wissen auf wie ein Schwamm das Wasser. Ich ging völlig auf in diesen neuen Erfahrungen.“
„Was lerntet ihr dort?“, erkundigte Rayko sich skeptisch. „Was heißt das überhaupt: ‚Magie‘? Du meinst doch nicht, du kannst wirklich zaubern oder so was? Und diese Sache mit dem Stein, das war doch ein Trick, oder?“
Ein Lächeln huschte über die eingefallenen Gesichtszüge des Fremden. Er blickte ruhig in Raykos Augen, schien die Tiefe seines Misstrauens ausloten zu wollen. Rayko spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss.
‚Ich ertrage sein Lächeln nicht‘, dachte er verwirrt. ‚Wenn er mich noch länger so ansieht, fange ich noch an, an seine Zauberkräfte zu glauben!‘ Aber schon lehnte der andere sich wieder zurück und wandte den Blick ab.
„So ähnlich dachte ich damals auch. Nur ein Trick!“, murmelte er. „Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was mich in diesem Unterricht erwarten könnte. Vieles erwies sich dann auch als lästig oder langweilig. Es gab stundenlange Konzentrationsübungen, komplizierte Körperhaltungen, die den Körper kräftigen und den Energiefluss verstärken sollten. Wir bekamen eine ausgewählte Ernährung, die gesund und leicht verdaulich war, sich aber leider nicht immer als ausreichend sättigend erwies. Wir erhielten ein umfassendes Wissen über Heilmethoden und Heilpflanzen.
Das ist natürlich noch keine ‚Magie‘. Für mich beginnt die Magie dort, wo normales menschliches Denken oder Können versagt. Wo die offensichtlichen, natürlichen Methoden nicht mehr ausreichen, das Leben zu meistern.
Der Magier dringt in Bereiche des Bewusstseins ein, die anderen verschlossen sind. Du kannst aus dem Verhalten eines Menschen auf seinen Charakter schließen, aber du kannst auch im Zustand der Meditation in seinen Geist eindringen, und alle seine Beweggründe, alle seine Stärken und Schwächen, liegen plötzlich vor dir ausgebreitet. Dann kannst du in seiner Seele lesen wie in einem offenen Buch.
Du kannst mit deinem Geist nicht nur die jetzige Situation erfassen, sondern ihn in Vergangenheit oder Zukunft ausdehnen. Die Schicksalswege der Menschen entfalten sich vor deinem inneren Auge, ihr Werdegang rollt vor dir ab, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie du weißt, dass ein junger Trieb aus einem Samen wächst und später Blüten bildet und Früchte trägt. Du kannst einen Gegenstand berühren und siehst auf einmal die Gesichter oder sogar die Schicksale seiner früheren Besitzer.
Es sind Vorgänge, als bildete sich deine Wahrnehmung neu, als stünde ein zusätzliches Sinnesorgan zu deiner Verfügung, den meisten anderen Wesen verborgen und unbekannt. Du erkennst, welche Menschen zueinander passen, welche Orte welchen Menschen gut tun, welcher Beruf welchem Menschen Erfüllung bringen wird ...
Die Menschen suchen deinen Rat in schwierigen Lebenssituationen und vor wichtigen Entscheidungen und manche scheuen weder Kosten noch Mühe, um einen wirklich fähigen Magier zu finden, der ihnen die Zukunft voraussagt und ihnen dabei hilft, ihr Glück zu finden.
Manchmal glaube ich, bis zu diesem Punkt könnte es ein Jeder bringen. Jeder Mensch, der die gleichen Anweisungen und Übungen ausführen würde wie wir damals, könnte diese Hellsichtigkeit in sich entwickeln. Jeder könnte es lernen, die Dinge zu erspüren, die ihm gut tun und die Dinge zu meiden, die ihm schaden, wenn er vor jeder dringenden Entscheidung nur aufmerksam und intensiv genug in sich selbst hineinhorchen würde. Wenn er ebenso wachsam und gläubig, wie er an den Lippen des Wahrsagers hängt, seinen eigenen, tiefsten Gefühlen und Überzeugungen folgen würde.
Aber der Magier geht noch einen Schritt weiter. Er bleibt nicht beim Erkennen und Beschreiben der Welt stehen. Er will sie beeinflussen. So wie mein unbewusster Wille es damals zustande brachte, dass Hazrad mich nicht entdeckte, kann der gerichtete Wille des Magiers die Menschen und Dinge um ihn herum verändern, sie in seinem Sinne lenken und gestalten.
Diese Fähigkeit wird von dir gefordert, wenn jemand nicht nur wissen will, ob der auserwählte Liebespartner gut zu ihm passt, sondern von dir ein Mittel erbittet, das den anderen ohne jeden Zweifel an ihn binden wird. Sie können dich bitten, den günstigsten Zeitpunkt für ein Geschäft zu nennen, aber sie können auch von dir fordern, ihre Geschäftspartner zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Oder sie gar zu schwächen oder krank zu machen – wenn sich der Magier auf solche Anforderungen einlässt.
Es gibt Rituale, die die eigenen Kräfte steigern, die dir Erfolg und neuen Lebensmut bescheren - oder dir die Manneskraft bis ins hohe Alter erhalten. Hazrad lehrte uns die unmöglichsten Zaubersprüche und Beschwörungen, vom Verschwinden lassen einer Warze bis hin zum Erscheinen lassen eines scheußlichen Ungeheuers. Er beeindruckte uns mit der ganzen Palette der magischen Möglichkeiten, vom Bewegen eines Gegenstands mit bloßer Geisteskraft, dem Erkennen und Zeichnen der magischen Symbole bis hin zur Herstellung von Amuletten, die ...“
Joshua hielt mitten in seiner Rede inne und griff nach seiner Brust. Seine Gesichtszüge erstarrten, sein Atem stockte. Rayko vermutete eine Art Anfall, fuhr hastig hoch, um ihn zu stützen, aber noch ehe er nach ihm greifen konnte, entspannte sich der Fremde wieder und ein Ausdruck der Erleichterung breitete sich auf seinen Zügen aus.
„Was ist los?“, wagte Rayko schließlich zu fragen.
„Bitte ... Ich dachte für einen Moment ...“, hauchte der andere kaum hörbar. Dann hob er mühsam den Kopf.
„Bitte. Gib mir mein Bündel. Schnell!“





























