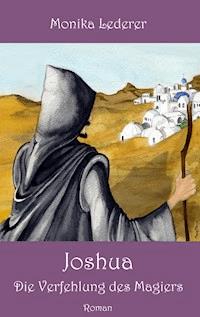Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrtausenden herrschen Harmonie und Frieden auf dem Planeten Trokis. Eine sorgfältig geschulte Gruppe von Priester-Magiern sendet Tag für Tag heilende Energien über den ganzen Planeten und bewahrt damit das empfindliche Gleichgewicht. Im Laufe der Zeit sind jedoch Teile des alten Wissens verloren gegangen und die Bräuche der Priester sind zu Dogmen und falsch verstandenen Riten erstarrt. Als dann noch der Priester Raki, enttäuscht von seinem Liebhaber Hari, beginnt, statt der heilenden nun zerstörerische Energien um sich herum zu verbreiten, gewinnen negative Einflüsse die Übermacht. Die Bewohner des Planeten, vorher friedliebende Bauern, werden von Streit und Hass, Krankheit und Krieg heimgesucht, fallen schließlich in einen Zustand der Barbarei zurück. Die Klöster und heiligen Stätten der Priester werden zerstört. Kann es noch eine Möglichkeit geben, das scheinbar unabwendbare Schicksal des kleinen Planeten aufzuhalten? Wird es noch eine Chance geben für die Liebe zwischen Hari und Raki? Kann das freundliche Geistwesen, das sich von einer anderen Dimension aus für das Schicksal des zerstörten Planeten einsetzt, noch etwas ausrichten, oder kommt letztendlich jede Hilfe zu spät?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn man einmal tot ist, wird die Zeit lang -
ihr werdet alle in so kurzer Zeit bei mir dort sein,
wie Wasser in einem Kessel braucht, bis es kocht.
Derek Jarman1)
1) Derek Jarman: „Auf eigene Gefahr. Vermächtnis eines Heiligen“, Seite 139, 1996, PVS Verleger Wien.
Ra-ki
Inhaltsverzeichnis
Buch 1
Anfang
Findelkind
Priesterschüler
Tänzer
Geliebter
Lehrer
Verwirrung
Prüfung
Jungpriester
Heiler
Entscheidung
Wanderung
Berg
Chaos
Prinz
Tod
Buch 2
Zwischenspiel
Wüste
Heimkehr
Wahnsinn
Liebe
Hohepriester
Seuche
Visionen
Trennung
Schrift
Herausforderung
Abschied
Ende
Buch 1
Anfang
Samtene Dunkelheit umgibt mich. Ich treibe dahin. Leicht. Frei.
Ist das der Tod?
Aber die Bilder lassen mich nicht los, quälen mich, verfolgen mich.
All das Leid! Ich habe versagt!
Unendliche Trauer, die sich wandelt in die drängende Sehnsucht, etwas bewirken zu können. Es wieder gut zu machen.
„Ich möchte das Heilen lernen!“, formt sich der Wunsch in meinem Innern.
All diesen Wesen helfen können. Dinge wieder in Ordnung bringen.
Nie wieder diese Hilflosigkeit erleben müssen, wenn um mich herum Wesen leiden, verletzt sind, krank sind und ich nichts für sie tun kann ...
Erst jetzt bemerke ich, dass ich nicht mehr allein bin.
Jemand hält sich an meiner Seite. Ich spüre ihn mehr, als ich ihn sehe. Auch meinen eigenen Körper kann ich nicht mehr wahrnehmen.
„Wer bist du?“, formuliere ich meine Gedanken.
„Ich bin für die nächste Zeit dein Begleiter. Du hast einen Wunsch geäußert.“
„Ich möchte das Heilen lernen!“, wiederhole ich im Geiste.
„Deine Bitte ist gehört worden. Folge mir!"
‚Ist das der Tod?‘, möchte ich ihn fragen, aber er zieht mich eilig mit sich fort.
Er sah auf die grün-graue Kugel hinunter, die, umgeben von leichtem Dunst, unter ihnen schwebte. Dann zog sein Begleiter seine Aufmerksamkeit wieder auf sich.
„Das ist Trokis. Der Planet Trokis. Unser Ziel. Dein Ziel!“
Er versuchte sich über seine Gefühle klar zu werden, aber schon fuhr die Stimme fort:
„Du hast den Wunsch geäußert, das Heilen zu lernen. Hier kannst du es.“
Sie waren in die Atmosphäre des Planeten eingetaucht. Er begann Einzelheiten wahrzunehmen: Wüstengebiete. Berge. Wälder. Seen. Bäche. Eine grün-graue Vegetation, teilweise ins Violett spielend, die dem Planeten seine typische Farbe gab. Das sanfte Licht einer rötlichen Sonne.
Es war die Zeit des Sonnenuntergangs. Sie überflogen einen Gebirgszug, tauchten ein in die Schluchten und Täler an seinem Rand. Sein Begleiter hielt inne.
„Dort! Das ist dein Körper.“
Auf einem flachen Felsen, von einer schäbigen Decke bedeckt, lag der schmale, längliche Körper eines Säuglings. Die großen, schrägstehenden Augen geschlossen, schien er zu schlafen. Es war keine Bewegung wahrzunehmen, kein Atem, kein Lebenszeichen.
„Aber er ist tot!“
„Nein.“
Der Begleiter zog ihn näher heran. „Das Wesen, das ihn benutzen sollte, hat ihn verlassen. So gesehen, ist er tot. Aber der Körper ist in Ordnung. Du kannst ihn übernehmen.“
‚Und die Eltern?‘, wollte er fragen.
Dunkle Erinnerungen stiegen in ihm auf: der Vorgang der Geburt. Unzählige Gesichter, verschwommen, ineinanderfließend. Mutter. Vater. Die Wesen, die einen als erste begrüßen sollten. ‚Eine Mutter ist das Tor, durch das man in die materiellen Welten hineingeht‘, klang ein Satz in ihm.
Der Begleiter drängte. „Eltern sind hier nicht für dich vorgesehen. Du musst dich beeilen. Noch ist der Körper in Ordnung, aber du hast nicht mehr viel Zeit.“
Er wollte sich seinem Begleiter noch einmal zuwenden, noch Fragen stellen, sich verabschieden wenigstens, aber er spürte schon den heftigen Sog, der seine Wahrnehmung für einen Moment aussetzen ließ. Nach einem kurzen Schwindelgefühl fand er sich auf dem Rücken liegend wieder.
Sein erster Eindruck war – Durst. Schrecklicher Durst. Dieser kleine Körper war völlig ausgetrocknet! Seine Lippen klebten, er konnte nicht schlucken. Dann erst spürte er die Härte und Unebenheit des Felsens, auf dem er lag.
Viel Hoffnung darauf, dass ihr Kind lebend gefunden werden könnte, hatte die Eltern offenbar nicht bewegt. Sie hatten nicht einmal etwas Weiches unter den bloßen Rücken gelegt, nur dieses schäbige, dünne Tuch über den Säugling gedeckt, das kaum den Wind abhielt.
„Nein!“
Seine erste Reaktion war Entsetzen. Verzweifelt versuchte er, den Körper wieder zu verlassen. Jede Bewegung schmerzte. Jeder Atemzug brannte in den Lungen.
„Beruhige dich!“
Die Stimme des Begleiters tönte in seinem Kopf, fast wie ein eigener Gedanke. „Vertraue mir. Es braucht noch eine Weile, bis Hilfe kommt. Aber du beherrschst diesen Körper! Du kannst diese Empfindungen beruhigen. Gehe in deinen Atem. Beruhige ihn. - So ist es besser.
Jetzt der Herzschlag. Langsamer. Noch langsamer! - Jetzt suche das Zentrum des Schmerzes. Geh dort hinein mit deinem ganzen Bewusstsein. Entspanne es!“
Ohne genau zu wissen wie es geschah, hatte er die Anweisungen befolgt, war tiefer und tiefer in diesen gequälten Körper eingedrungen, bis er das Netz der Nerven erfasste, die Energiebahnen durchdrang, Stück für Stück jeden Schmerz und jede Empfindung darin betäubte, alle Lebensfunktionen nach und nach zurücknahm, bis nur noch das Gefühl der Erstarrung übrigblieb.
Gefangen, bewegungslos, alle Aufmerksamkeit auf das Festhalten all dieser Lebensfunktionen gerichtet verharrte er, nicht mehr bei Bewusstsein als der Felsen, auf dem er lag.
Findelkind
„Ein langer Weg, Meister. Ich glaube, sie hätten besser einen anderen ausgewählt für diesen Auftrag. Die Reise wird Euch sehr anstrengen.“ Der Priesterschüler blickte missmutig zum wolkenverhangenen Himmel auf.
‚Vor allem mich wird sie sehr anstrengen!‘, ergänzte er in Gedanken. Einen blinden, alten Mann bei diesem schlechten Wetter über die steinigen Gebirgspfade zu führen, war nicht gerade das, was er gern tat, auch wenn es sich in diesem Fall um einen besonders ehrwürdigen Diener der Alten Götter handelte.
Nur einige Male hatte Ran-ti in den drei Jahren seiner Ausbildung das Kloster verlassen dürfen und das hatte er seinem Ruf als ‚Bergführer‘ zu verdanken. Eigentlich der Beruf seines Vaters. Der hatte den Jungen früher auf unzähligen Wanderungen bei sich gehabt, sodass er jeden Weg und Steg der Gegend kannte.
‚Eigentlich ein Glück für mich!‘, dachte er. ‚Die anderen Jungen hocken die ganze Zeit über dort drin. Erst nach der Prüfung lassen sie sie wieder in die Außenwelt.‘
Aber bei seinen früheren Ausflügen hatte er nur beim Transport irgendwelcher Waren helfen müssen, in Begleitung anderer, kräftiger Männer. Dieses Mal hatte er allein die Verantwortung für diesen Blinden zu tragen, der schon so alt war, dass er nicht mehr unterrichtete und am allgemeinen Klosterleben kaum noch teilnahm. Der Junge konnte sich nicht erklären, warum die Wahl des Hohepriesters ausgerechnet auf ihn gefallen war. Seufzend griff er nach dem Arm des Alten und zog ihn sanft weiter.
„Wir müssen bald einen Unterschlupf für die Nacht finden. Es zieht schon wieder ein Sturm auf. Ich glaube, wir schaffen es nicht bis zum nächsten Dorf. Außerdem ...“
„Still!“, unterbrach der Alte seinen Redefluss.
Aufmerksam hielt er inne, der hagere, hochaufgeschossene Körper verharrte angespannt und reglos, nur das weiße, dünne Haar flatterte im Wind. Das Gesicht mit den leeren Augen zur Seite gedreht, schien er trotz seiner Blindheit etwas erspähen zu wollen.
„Dort!“
Er streckte den Arm aus in Richtung einiger verstreuter Felsbrocken. Auf dem ersten von ihnen – er war fast mannshoch und oben abgeflacht - entdeckte der Schüler eine kleine Erhebung. Zögernd trat er näher – und zuckte wieder zurück.
„Bei den Göttern! Ein totes Kind!“
Der Alte schüttelte den Kopf. „Er ist nicht tot!“, sagte er.
Ohne die Hilfe des Jüngeren in Anspruch zu nehmen, trat er langsam auf den sandfarbenen Felsen zu. Der Wind hatte die schäbige Decke fast völlig von dem ausgemergelten Körper des Säuglings hinuntergezerrt. Er lag steif und reglos, die Augen verklebt und verkrustet, der ausgetrocknete Mund stand weit offen. Feiner Sand klebte überall am Körper.
Die Bewegungen des Alten wurden jetzt schneller, sicherer. Für einen Moment richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und streckte die Arme über dem Kind aus, um die rituellen Worte zu sprechen: „... der du den Göttern geopfert wurdest, ... jetzt Teil von uns, zu uns gehörig, ... den Alten Göttern zu dienen, unter ihrem Schutz ...“
Erstaunt verfolgte der Schüler den Vorgang. Seit in den letzten Jahren die Stürme etwas sanfter und die Ernten etwas ergiebiger geworden waren, hatten die Bewohner von Trokis kaum noch von ihrem Recht Gebrauch gemacht, männliche Säuglinge, die niemand in der Lage war angemessen aufzuziehen, ‚den Göttern zu opfern‘. Der Priesterschüler, der mit seinen fünfzehn Jahren kurz vor der Einweihungsprüfung stand, hatte von diesem Brauch gehört, aber ihm war kein wirklicher Fall bekannt geworden.
„Ran-ti, komm her!“
Der Alte war mit dem Gebet fertig und winkte den Jungen ungeduldig zu sich.
„Wir schieben unsere Reise auf. Du musst jetzt auch mein Bündel tragen.“
Er reichte es ihm hinüber, trat dann dicht an den Felsen heran. Vorsichtig hüllte er das Kind in die Decke und verbarg es unter seinem weiten Gewand.
„Wir kehren zum Kloster zurück.“
Ran-ti hatte sich schon genug von seinem Schock erholt, um Einwände zu erheben: Es seien mehrere Wegstunden, es sei schon Abend und ein Sturm stehe unmittelbar bevor ...
Aber der Alte ließ sich nicht beirren. Er setzte sich mit seiner seltsamen Last in Bewegung, strebte wieder dem Klosterbezirk zu.
„Warum nimmst du das tote Kind mit?“, brach es nach einer Weile aus Ran-ti heraus. Der Gedanke ließ ihm keine Ruhe und Schweigen war ohnehin nicht seine Stärke - schon die tägliche Stunde der Schweigezeit im Kloster war ihm ein Gräuel.
„Er ist nicht tot!“, wiederholte der Alte.
„Außerdem“, fuhr er fort, „müssten wir ihn ohnehin mitnehmen. Der Brauch verlangt es. Ihr habt es im Unterricht behandelt. Erinnere dich! Die, die den Göttern geopfert werden, gehören zu uns, zur Priesterkaste. Von dem Moment an, wenn die Eltern sie an die Wanderwege der Heilpriester legen und die rituellen Worte sprechen: ‚Ich gebe dich frei und in die Obhut der Götter!‘, gehört das Kind den Alten Göttern, tot oder lebendig. Ebenso wie jeder von uns hat er Anrecht auf einen Namen, einen eigenen Schrein und auf ein Grab vor den Klostermauern, bei denen, die uns vorangingen. Er hat jetzt keine Verwandten mehr, keine Verpflichtungen an die Welt draußen. Er gehört den Göttern und wird ihnen eines Tages als ihr Priester dienen. Wie auch wir es tun, bis zu unserem Tod.“
Dem Jungen verging die Lust auf weitere Fragen, er wollte sich nicht noch einmal die Blöße geben, im Unterricht nicht richtig aufgepasst zu haben. So legten sie den Rest des Weges schweigend zurück.
Nach drei Stunden hatten sie den letzten Bergkamm überquert und die Hochebene von Ran-kohr lag vor ihnen. Ran-ti stand einen Moment still, um den Anblick der heimatlichen Klosteranlage auf sich wirken zu lassen. Das weite Areal dehnte sich unter ihnen, umschlossen von einer kräftigen, hohen Mauer aus ziegelähnlichen, rötlichen Steinen. Sie war von mächtigen Holztoren durchbrochen, die, dunkel und verwittert vom jahrhundertelangen Gebrauch, vom hohen Alter der Klosteranlage Kunde gaben.
‚Das Klostergelände ist so viel größer als die Dörfer dort draußen, obwohl wir nur noch so wenige sind‘, zog es Ran-ti durch den Kopf, als sein Blick über die zahlreichen verlassenen Nebengebäude schweifte.
Das Kloster hatte einmal bessere Zeiten gesehen. Einst lebten hier fast dreimal so viel Priester wie heute – es mochten jetzt noch etwa hundert sein ohne die Priesterschüler – und damals hatte sich das Kloster weitgehend selbst mit allem versorgt. Doch die alten Häuser der Handwerker mit den angrenzenden Werkstätten und den dazu gehörigen Lagerhäusern lagen jetzt verwahrlost.
Nur die Nahrung wurde nach wie vor selbst angebaut. Die Obstgärten und Felder innerhalb und außerhalb der Klostermauern brachten gute Erträge und verhalfen vor allem den Priesterschülern zu ausreichender Bewegung.
Ran-tis Mundwinkel zogen sich nach unten bei der Erinnerung an schmerzende Muskeln und aufgeschürfte Hände zu Zeiten der Ernte – und es gab fast immer etwas zu ernten, da das Klima zu jeder Jahreszeit Pflanzenwuchs zuließ.
Ran-tis Blick schweifte über den verwilderten Streifen Brachland, der sich innen an der Klostermauer entlang zog, und schwenkte dann hinüber zu den Wohn- und Unterrichtshäusern. Die waren ordentlich gehalten und von gepflegten Wegen und künstlich angelegten Plätzen umgeben, die dem Unterricht im Freien dienten oder für Versammlungen genutzt werden konnten. Dahinter erhob sich der Tempelbezirk, der das Kern- und Schmuckstück des Klosters bildete.
Die hellen Gebäude des Tempels drängten sich ringförmig um den runden Turm, der im obersten Geschoss das eigentliche Heiligtum barg: die Kultstätte mit den Heiligen Steinen der Alten Göttern.
Wie lange war es her, dass sie den Bewohnern von Trokis diese Steine gebracht hatten und mit ihnen all die Sitten, Gebräuche und Rituale, denen die Priester heute noch folgten? Zweitausend Jahre? Oder dreitausend? Es blieb nicht mehr viel Zeit bis zur Prüfung, Ran-ti würde bis dahin noch einige Wissenslücken auffüllen müssen!
Der Junge schreckte erst aus seinen Grübeleien über vergangene Zeiten und bevorstehende Prüfungsfragen auf, als sie das Tor erreicht hatten. Der Pförtner ließ sie ein. Ohne Ran-ti noch zu beachten, eilte der alte Priester sofort weiter zum Tempelbezirk.
„Manchmal denke ich, er ist gar nicht blind!“
Der Pförtner hatte sich schon wieder seiner Arbeit zugewandt, dem Ausbessern einer Decke. Stirnrunzelnd blickte er auf.
„Ha-jo-tah? Der ist blind wie eine neugeborene Flugmaus, glaub‘ mir, Kleiner. Aber er kennt ja hier jeden Stein. – Warum rennt er überhaupt so?“
Das war Ran-tis Stichwort. Hastig begann er von dem toten Kind zu erzählen. Und da der Pförtner ein ebenso offenes Ohr für alle Neuigkeiten, wie ein offenes Herz für die Bedürfnisse der Priesterschüler und Jungpriester hatte, wurde Ran-ti im Pförtnerhaus noch mit einer Tasse Kräutertee versorgt, während er seine Geschichte zum Besten gab. Als er sich endlich nach langer Diskussion zu seiner ungemütlichen Unterkunft aufmachte, war es schon dunkel und der erwartete Sturm brach gerade los.
Schmerz! Schmerz? Nein, nur Erschütterung, Rütteln, Schaukeln.
Das Bewusstsein im Körper des steifen Säuglings begann sich zu regen, streckte vorsichtig seine Fühler aus. Es kam und ging in Wellen. Obwohl der alte Priester behutsam auftrat, ruckte jeder Schritt deutlich durch die verkrampften Muskeln, ließ die Angst vor dem Schmerz wieder auftauchen. Immer von Neuem spürte er nach, ob alle Nerven- und Energiebahnen des Körpers noch unter seiner Kontrolle seien. Dann tauchte er wieder ein ins Vergessen, in die Bewusstlosigkeit. Endlose Wiederholung, endloser Weg. Endlich trat Ruhe ein.
Sobald er den Tempelbezirk erreicht hatte, rief Ha-jo-tah ungeduldig nach den diensthabenden Tempeldienern. Als die beiden endlich herbeieilten, verwirrt von der ungewohnten Autorität und Strenge in seiner Stimme, hatte er schon das schwere Reisegewand abgestreift, den Tisch mit sauberen Tüchern bedeckt und das seltsame Kind darauf gebettet.
„Beeilt euch! Warmes Öl! Und Wasser! Bereitet ein Bad vor!“
Hastig riss er ein weiteres Tuch in breite Streifen. Endlich kam Bewegung in die beiden Männer, die beim Anblick des verkrampften, kleinen Körpers zunächst entsetzt erstarrt waren, und sie brachten das Verlangte.
Immer wieder neue Stoffstreifen tauchte der alte Priester in das warme Öl und wickelte sie sorgsam um den Körper des Säuglings, dabei leise Gebete vor sich hin murmelnd. Nur das Gesicht ließ er frei. Hier rieb er das Öl sanft mit den Händen ein, ebenso wie auf den Lippen, im Innern des Mundes, der immer noch weit offen stand, und auf den verkrusteten Augenlidern. Dann legte er seine Hände über den Leib des Kindes und begann behutsam die Heil- und Lebensenergie in den Körper zu lenken.
„Atme! - Atme! Alles ist in Ordnung. Du bist da, wo du hinsolltest. Du kannst wieder loslassen! Atme!“
Die Stimme des Begleiters zog ihn wieder ins Bewusstsein. Gleichzeitig hörten auch seine körperlichen Ohren die Worte des alten Priesters. Verschwommen registrierte er, dass die Sprache ihm fremd war. Aber dann wurde ihm der Sinn des Wortes bewusst, das der Priester ihm immer wieder wie einen Ball zuwarf, synchron mit der Stimme des Begleiters in seinem Kopf:
„Atme! – Atme!“
Er fing an zu begreifen, lockerte vorsichtig die Sperren im Energiekörper. Ein Beben lief durch den Körper des Kindes, als er der Aufforderung endlich Folge leistete.
Für zweimal neun Tage wich der alte Priester kaum von der Seite des Knaben. Dann erst schien ihm sein Zustand stabil genug, um ihn für einige Zeit der Betreuung der Tempeldiener zu überlassen, und er begab sich zum Hohepriester.
Das Arbeits- und Audienzzimmer des Hohepriesters lag im Tempelbezirk. Aufrecht und ruhig durchschritt der alte Priester den großen Raum. Nach der rituellen Verbeugung nahm er gesammelt auf dem würfelförmigen Block Platz, der den Besuchern als Sitzgelegenheit diente, dem Sitz des Hohepriesters gegenüber. Für Versammlungen gab es ein erhöhtes Podest für den Leiter des Klosters, aber bei Einzelgesprächen nahm er auf gleicher Höhe mit seinem Gesprächspartner Platz.
Ha-jo-tah erinnerte sich noch gut an das Aussehen Ran-ta-nors, sein Augenlicht hatte sich erst in den letzten Jahren getrübt. Der Hohepriester hatte die gleiche schmale, hochaufgeschossene Gestalt, wie sie fast allen Mitgliedern der Priesterkaste zu Eigen war. Die langen, offen getragenen Haare mochten inzwischen von weißen Strähnen durchzogen sein und die klaren, hellblauen Augen ruhten jetzt wahrscheinlich ebenso ruhig und aufmerksam auf seinem Gegenüber wie früher.
Ha-jo-tah war sich sicher, dass Ran-ta-nor, ebenso wie er selbst, in der beherrschten, aufrechten Haltung der Priester auf seinem Sitzblock verharrte, jeder Muskel des Körpers unter der Kontrolle des Willens, wie es Generation um Generation den Priesterschülern mühsam antrainiert wurde.
Er spürte die vollkommene Ausstrahlung Ran-ta-nors, das Wissen um die Würde des Amtes, das er innehatte und den Willen, es mit seinem ganzen Wesen auszufüllen.
‚Vielleicht etwas zu viel Würde‘, dachte der Alte bedauernd.
Ran-ta-nor hatte zu seinen Schülern gehört, zur letzten Schülergruppe, die er durch die Prüfung geführt hatte, ehe er für andere Aufgaben eingesetzt wurde. Er war ein eifriger, fröhlicher Junge gewesen. Der Alte sah noch die Szene nach der Prüfung vor sich, wo er, außer sich vor Freude, den Lehrer lachend umarmt hatte.
In ihrer jetzigen Situation waren Umarmungen nicht mehr denkbar, seine Auffassung von seinem Amt verbot dem Hohepriester fast jede körperliche Berührung. Ruhig saßen sie sich gegenüber.
„Ich brauche einen Namen“, eröffnete der Alte schließlich das Gespräch. Ran-ta-nor runzelte die Stirn.
„Für dein Findelkind? Ich habe davon gehört. - Aber wird er überleben?“
„Die Wahrscheinlichkeit steigt von Tag zu Tag“, äußerte sich der Alte unbestimmt.
„Wie ernährst du ihn?“
„Bis jetzt bekam er Brei aus zerdrückten Wasserbohnen.“ Ha-jo-tah zögerte. „Ich hörte, dass morgen früh ein Bote zu den Dörfern aufbricht. Vielleicht könnte man nach einer Amme fragen, die bereit wäre...“
„Ich will keine Frau hier im Kloster!“
Die Stimme des Hohepriesters klang ungewohnt scharf. Der Alte wusste sehr wohl, wie schwer es manchen Priestern fiel, die völlige sexuelle Enthaltsamkeit einzuhalten, die die Regeln der Alten Götter ihnen vorschrieben.
Aber eine Frau mittleren Alters, die einen Säugling stillte? Die vielleicht ein eigenes Kind mitbrachte? Sie hätte die Kinder aufziehen und den Tempeldienern ein wenig bei der täglichen Arbeit helfen können. Der winzige Säugling hätte mit einem Spielkameraden zusammen aufwachsen können. Sollte das wirklich die Moral des Klosters gefährden?
Aber der Hohepriester duldete keinen Widerspruch. „Er wird überleben oder nicht. Wir müssen es akzeptieren, wie es geschieht.“
Das Gesicht des alten Priesters schien ein wenig müder und eingefallener. „Aber einen Namen braucht er ohnehin“, beharrte er.
Der Hohepriester richtete sich noch etwas mehr auf. „Einen Namen braucht er schon, aber kein feierliches Ritual mit dem ganzen Kloster, da sein Überleben nicht sicher ist. Nenne ihn: ‚Ha-run-jah‘ – ‚Einer, der durch Akzeptieren seinen Weg findet.‘ So sei es!“
„Ha-run-jah“, wiederholte der Alte ernst. „Hari.“ Er stand auf, neigte sich zur rituellen Verbeugung. „Ich werde gehen, ihm von seinem Namen Mitteilung zu machen.“
Stirnrunzelnd sah Ran-ta-nor ihm nach. Hatte so etwas wie Ironie aus der Stimme des Alten geklungen? War etwas nicht in Ordnung mit dem Namen? Aber das Gesicht Ha-jo-tahs war ernst gewesen. So wandte der Hohepriester seine Aufmerksamkeit wieder seinen anderen Aufgaben zu. Die Einweihungsprüfung der Priesterschüler stand unmittelbar bevor. Die neuen Schüler wurden bald erwartet, es waren Vorbereitungen zu treffen ...
Der Alte war inzwischen zu seinem Schützling zurückgekehrt, der im großen Tempelvorraum in einer Art Hängematte schlief, während die Tempeldiener ihren täglichen Verrichtungen nachgingen.
‚Recht auf einen Namen, Recht auf einen Schrein, Recht auf ein Grab – oder auf ein Leben im Dienst der Alten Götter! – Aber kein Recht auf Hilfe, kein Recht auf ...‘
Der alte Priester atmete tief durch. Die lebenslang geübte Disziplin gewann wieder die Oberhand, verdrängte die aufschäumende Bitterkeit, die seinen Geist zu überfluten drohte. Er hatte dieses kleine Wesen liebgewonnen, spürte das Ungewöhnliche, Besondere seines Schicksalswegs. Aber in einem Punkt hatte der Hohepriester Recht: Er hatte ihn diesem Schicksal anzuvertrauen, ihn loszulassen, alles zu akzeptieren, was geschah, wenn er selbst erst sein Bestes getan hatte, ihm zu helfen.
„Dein Name sei ‚Ha-run-jah‘ “, flüsterte er dem Säugling ins Ohr.
Seufzend richtete er sich auf, um die Tempeldiener zu rufen, um in ihrem Beisein die Namensgebung mit den rituellen Worten und Gesten zu wiederholen, damit sie Zeugen seien, dass dieses Kind, ein den Göttern Geopferter, von nun an zu ihnen gehörte.
Er ritzte das Zeichen des Namens in die Tür eines freien Schranks, der später die Arbeitsgeräte des Priesters bergen sollte, berührte Stirn, Mund und Herz des Jungen und gab in seinem Namen das Versprechen ab, den Alten Göttern zu dienen.
Dann gab er Hari in die Obhut der Tempeldiener. Sie würden für die nächsten Jahre eine Herausforderung darin finden, ihn aufzuziehen.
So wuchs Hari in seinen ersten Lebensjahren, fast unbemerkt vom sonstigen Klosterbetrieb, im Tempelbezirk auf.
Haris Herz klopfte bis zum Hals, die Angst schnürte ihm die Kehle zusammen. Seine Hände hatten sich in die raue Filzdecke gekrallt.
Was für ein Traum!
Er blickte wild um sich, erkannte erleichtert die vertraute Umgebung: das kahle, kleine Zimmer, Tisch und Sitzpolster, die hölzerne Truhe, darauf seine Kleidung für den nächsten Tag. Genauer gesagt: Für diesen Tag, verbesserte sich der Knabe. Die Sonne war gerade aufgegangen und Geräusche von draußen zeigten an, dass das Kloster bereits erwachte.
Hari sprang auf, streifte das Obergewand über und mühte sich mit der Verschnürung ab, die die Fingerfertigkeit eines Fünfjährigen auf eine harte Probe stellte. Ohne die Waschschüssel, den Wasserkrug oder sein zerwühltes Lager eines Blickes zu würdigen, schob sich Hari vorsichtig durch die Tür und stellte aufatmend fest, dass keiner seiner Betreuer in Sicht war. Schnell huschte er durch den langen Gang und durch den Vorraum des Tempels. Minuten später schloss sich die Tür des Tempelbezirks hinter ihm.
Der magere Junge jagte, so schnell er konnte, auf das nahe gelegene Wäldchen zu und verschwand zwischen den Büschen. Erst zwei Stunden später, als er Ha-jo-tah, den alten, blinden Priester, auf dem Hauptweg zum Tempelbezirk erblickte, erinnerte sich Hari wieder an seinen Traum.
Ha-jo-tah verließ inzwischen kaum noch seinen Raum, in dem er fast den ganzen Tag in stiller Meditation verbrachte. Jedes Mal, wenn Hari ihn irgendwo entdeckte, stürzte er auf ihn zu und berichtete von seinen Erlebnissen, so weit die Zeit und die Situation es zuließen. Denn der Alte verließ seinen Raum ja meist in einer bestimmten Absicht und kaum noch nur aus dem Grund, um Hari zu sehen, wie es früher gewesen war.
Trotzdem nahm er sich jedes Mal die Zeit, wenigstens die wichtigsten Dinge anzuhören, von denen der Knabe zu berichten hatte. Meist setzten sie sich einige Minuten lang auf eine Bank oder einen der würfelförmigen Sitzblöcke aus Stein oder verwittertem Holz, die überall im Gelände zu finden waren. Manchmal ließ er sich sogar von Hari zu einem seiner Lieblingsplätze führen, wenn das auch früher oft in Enttäuschungen gemündet hatte.
Hari hatte den Priester weder dazu bewegen können, auf Bäume zu klettern, noch dazu, in den baufälligen, verlassenen Werkstätten nach vergessenem Werkzeug oder anderen interessanten Gegenständen zu suchen. Inzwischen war er aber längst alt genug, um zu verstehen, was es bedeutete, blind zu sein, und er beschränkte sich darauf, seine Erlebnisse in den glühendsten Farben zu schildern.
Vor allem verstand er die Diskretion des Alten zu würdigen. Niemals hatte er etwas von ihren Gesprächen den Tempeldienern wiedererzählt, niemals das Vertrauen des Jungen missbraucht, niemals Anlass zu Bestrafungs- oder Erziehungsmaßnahmen gegeben.
Als Hari nun den alten, blinden Priester erspähte, stürzte er sofort auf ihn zu und hielt ihn am Gewand fest.
„Meister! Warte! Ich habe geträumt!“
Wie immer lächelte der alte Mann trotz des plötzlichen Überfalls und tastete mit seiner Hand nach dem Kopf des Knaben.
„Hari. Komm, wir setzen uns.“
Aufgeregt zog der Junge ihn zu zwei nahe gelegenen Sitzblöcken und begann hastig zu erzählen:
Es war alles ruhig und still gewesen in seinem Traum, aber er schwebte an einem unbenennbaren Ort und konnte seinen Körper nicht wahrnehmen. Unter ihm hing, im leichten Dunst verborgen, eine grün-graue Kugel, die bei längerem Hinsehen sanft zu glühen und zu leuchten begann, als sei sie lebendig. Es schien Hari, als sei sie sogar das Lebendigste, das er je gesehen hatte. Und ein unerklärliches, heftiges Gefühl hatte ihn bei diesem Anblick ergriffen.
Hari erwähnte nichts von dem Angstschweiß, der beim Aufwachen auf seiner Stirn gestanden hatte, gab es doch nichts in dem Traumbild, das eine solche Reaktion zu rechtfertigen schien.
Als Hari geendet hatte, fragte Ha-jo-tah nach:
„Wie, sagtest du, sah die Kugel aus?“
„Grün-grau. Und leuchtend! Und es waren seltsame Wirbel zu sehen, von denen so was wie ... Wind ausging. Etwas, das sich ausbreitete über die ganze Kugel. Bis sie anfing zu glühen.“ Erwartungsvoll blickte der Knabe zu dem Alten auf.
„Du hast unsere Heimat gesehen“, antwortete der endlich. „Das ist Trokis. Unsere Heimat. Unser Planet. So sieht er aus, von außen. Wenn du ganz weit hochfliegen könntest, würde er so aussehen. Diese Wirbel, die du gesehen hast - das sind wir. Unsere Klöster. Und die Stationen auf den Bergen. Dafür sind wir hier, Hari, um dieses Planetenwesen mit heilender, ordnender Energie zu versorgen. Das ist unsere Aufgabe als Priester von Trokis, als Diener der Alten Götter.“
Hari blickte ein wenig ungläubig. Dann seufzte er.
„Er war so schön!“
„Ja“, sagte der Priester nach einer Pause. „Ja. Er ist schön.“
Dann schwieg er lange. Hari begann schon unruhig auf seinem Sitz hin und her zu rutschen, als er sich endlich wieder bewegte, in sein Gewand griff und aus einem Beutel einen glatten, flachen Stein hervorzog.
„Ich gebe dir jetzt etwas, das musst du gut verwahren. Du musst gut darauf aufpassen. Kannst du das? Traust du dir das zu?“ Die Stimme des alten Priesters klang eindringlich.
Hari dachte: ‚Was soll schwierig daran sein, auf einen Stein aufzupassen?‘
„Ja, sicher“, erwiderte er.
Daraufhin gab der Lehrer ihm den Stein. Er übergab ihn ganz deutlich, legte beide Hände des Jungen um ihn herum, hielt sie für einen Moment in dieser Haltung fest.
„Dieser Stein gehört jetzt dir. Du musst ihn gut aufheben, bis zu dem Tag, an dem dich jemand danach fragt. - Hast du schon einen Beutel am Gürtel?“
„Ja. Sicher.“ Fast beleidigt zog Hari ihn hervor. Jeder im Kloster trug so einen Beutel bei sich und verwahrte darin Dinge für den täglichen Gebrauch. Hari transportierte darin all die Schätze, die er auf seinen Streifzügen durch das Klostergelände fand. Er bettete den Stein zwischen einige vertrocknete Pflanzenreste und die Scherben eines zerbrochenen Tongefäßes.
Dann verneigte er sich und wurde entlassen. Das Gespräch hatte ihm seine Angst genommen, wenn er auch die Erklärung des alten Lehrers nicht ganz verstand. Aber er hatte schon viel zu lange stillsitzen müssen und rannte erleichtert und dankbar davon.
Erst am Abend kam er dazu, den Stein in Ruhe zu betrachten. Er konnte nichts Besonderes an ihm erkennen. Die Heiligen Steine im Tempel hatte er noch nie zu Gesicht bekommen, aber die viel kleineren Steine der Priesterschüler, sieben an der Zahl, mit denen sie im Unterricht lernten, die Energien zu spüren und zu lenken, kannte er gut. Sie waren durchsichtig, von verschiedenen Farben und Formen, und es war ihm streng verboten, sie anzufassen.
Diesen Stein jedoch durfte Hari berühren, mehr noch: Er gehörte ihm sogar. Er lag glatt und kühl in seiner Hand, erinnerte, hell-schimmernd und undurchsichtig wie er war, eher an einen der einfachen Kieselsteine, die überall auf den Wegen zu finden waren. Hari fühlte auch nichts Besonderes.
‚Es ist doch nichts dabei, auf einen Stein aufzupassen!‘, dachte er und verstaute ihn in seinem Beutel.
„Ra-ra-ra!“ Hari schwang sich mit schnellen, sicheren Griffen zwischen den dicken Ästen nach oben, wo der kleine Korb mit zwei Seilen am Baumstamm befestigt war. Flink öffnete er den Deckel und zog das winzige Tierchen hervor, dem der Ruf gegolten hatte.
Der Name zeugte nicht gerade von Einfallsreichtum, aber die Vorsilbe ‚Ra‘ war sehr verbreitet auf Trokis und immerhin hatte er drei Silben, wie alle gebräuchlichen Namen, zweisilbig abgekürzt wurden sie nur zu Kosenamen oder Spitznamen.
Und für eine Flugmaus würde es allemal reichen.
Seit Hari befohlen worden war, das Tier aus dem Tempelbezirk fortzuschaffen, gestaltete sich die Versorgung etwas schwieriger und er wagte kaum noch, es am Körper mit sich herumzutragen.
In den Dörfern waren Flugmäuse bevorzugte Spielgefährten der Kinder - wenn man geschickt genug war, sie einzufangen und geduldig genug, sie zu zähmen. Einer der Priesterschüler hatte einmal so ein Tier ins Kloster geschmuggelt und es fast ein Jahr lang bei sich versteckt halten können. Von ihm hatte Hari alles gelernt, was nötig war, und nicht eher geruht, bis er selbst ein Exemplar dieser Gattung in seinen Besitz gebracht hatte.
Nach einigen gewagten aber vergeblichen Klettertouren auf verschiedene Bäume des Klosterbezirks, wobei er des Öfteren die Grenzen der Vorsicht überschritt, die ein Fünfjähriger vielleicht besser noch hätte einhalten sollen, fand er zufällig ein verirrtes Tierchen auf einem großen, verlassenen Speicher. Es war völlig geschwächt von den Versuchen, wieder ins Freie zu gelangen, ausgehungert und fast verdurstet und insofern ganz leicht zu greifen.
Den Korb hatte besagter Schüler ihm geschenkt, nachdem der illegale Insasse von den Lehrern entdeckt und freigelassen worden war. Kein privater Besitz für Priesterschüler! Und lebende Tiere schon gar nicht!
Es hatte viel Aufregung gegeben und einen strengen Verweis und Hari hatte zum ersten Mal einen der großen Jungen weinen sehen. Natürlich nicht vor den Lehrern und den anderen Schülern, aber nach der Abendmahlzeit, als er Hari auf dem Gelände aufgespürt hatte, um ihm den Korb zuzustecken.
„Wie du weißt, kann ich ihn nicht mehr brauchen. Meine Schwester hat ihn mir gemacht damals. Du musst ihn ab und zu mit Öl einreiben, damit er nicht brüchig wird.“
Hari hatte nur stumm genickt. Er hätte gern etwas getan, um den anderen zu trösten, aber er fand weder Gesten noch Worte dafür.
Die Priesterschüler erschienen ihm im Allgemeinen wie fremde, anbetungswürdige Wesen. Sie kamen aus der Welt draußen, die er nur aus Erzählungen kannte, und durften alles lernen über die Welt der Priester, von der er ebenfalls noch ausgeschlossen war.
„Geh lieber weg, du bist noch zu klein!“
„Was willst du schon wieder hier?“
„Verschwinde, du störst den Unterricht!“
Diese und ähnliche Sätze hatte Hari in den letzten zwei Jahren, seit sie ihm erlaubt hatten, den Tempelbezirk zu verlassen, zur Genüge gehört.
Richtig gehörte er nirgendwo hin. Die Tempeldiener sorgten nach wie vor für ihn, sofern es um Essen und Kleidung ging. Aber er gab ihrer viele, die sich beim Dienst im Tempel abwechselten, er hatte keinen festen Ansprechpartner. Und die meiste Zeit waren auch sie, wie alle anderen Priester und Priesterschüler, in den strengen Tagesablauf des Klosters eingebunden und hatten ihre Pflichten zu erfüllen.
Es gab keine anderen Kinder. Und Kontakte mit den großen Jungen, die erst mit zwölf Jahren den Unterricht im Kloster aufnahmen, waren für Hari schwierig und selten. Entweder beachteten sie ihn nicht oder sie ärgerten und verspotteten ihn oder sie hatten ebenfalls keine Zeit für ihn.
Nun hatte er auch diese Freundschaft wieder verloren. Ohne dass es ausgesprochen wurde, wusste Hari, dass dem Jungen nicht nur der Besitz der Flugmaus, sondern auch das Zusammentreffen mit ihm in den kurzen, unterrichtsfreien Zeiten des Tages verboten worden war. Individualität war anscheinend nicht gefragt, auch die Freizeit sollte gemeinsam mit den anderen Schülern verbracht werden. Oder zumindest mit nützlicheren Beschäftigungen, als mit kleinen Jungen die Flugmausjagd zu üben und von der Welt da draußen zu erzählen.
Es wurde Hari nicht bewusst, dass er von diesem Jungen mehr über die Außenwelt gelernt hatte als von den Tempeldienern und Priestern zusammen. Aber diese Informationen kamen von einem heimwehkranken Zwölfjährigen, dem er für kurze Zeit die Familie und den zurückgelassenen kleinen Bruder ersetzt hatte, und sie waren durchsetzt mit all den Übertreibungen und Flunkereien, die einem nur über die Lippen kommen können, wenn man einen kleinen Bruder beeindrucken will.
So wurden die Berge immer höher und unzugänglicher, die seltenen Waldhirsche immer riesiger – obwohl Ran-to-nik nur einmal im Leben einen gesehen hatte, und zwar von sehr weiter Entfernung - die Schluchten immer tiefer, die Brücken und Wege immer schmaler.
Eine Zeit lang waren Haris Träume geprägt von schrecklichen Stürmen und Unwettern, die ganze Gruppen argloser Dorfbewohner auf Nimmerwiedersehen in unabsehbare Felsschluchten schleuderten, während riesige, wiederkäuende Waldhirsche mit tellergroßen, rotleuchtenden Augen das tragische Geschehen aus ihren sicheren Verstecken beobachteten ...
Immer noch saß Hari auf dem dicken Baumast und fütterte die Flugmaus mit winzigen Fruchtstückchen, die er von seiner eigenen letzten Mahlzeit aufgehoben hatte. Wie alle Bewohner von Trokis war das Tierchen nicht wählerisch, das erleichterte die Haltung in Gefangenschaft. Wie alle anderen ernährte sich auch die Flugmaus ausschließlich von Pflanzenkost und auch die Früchte, die sie sich in Freiheit niemals hätte beschaffen können, vertrug sie erstaunlich gut. Sogar die Wasserbohnen, die in Kanälen und sumpfähnlichen Feldern rings um das Kloster herum gezüchtet wurden, oder jene dunkelblauen Beeren, die an flachen Büschen zwischen langen, spitzen Dornen wuchsen, nahm sie gern an. Letztere brachten den Priesterschülern bei der Ernte manche üble Verletzung bei, für die winzigen Tiere – Hari konnte die Maus bequem mit einer Hand umfassen – war das Dornengestrüpp undurchdringlich.
Hari beobachte gebannt, wie das Tier sein Mahl verspeiste, hastig, ruckartig schlingend, ohne auch nur einen winzigen Krümel übrig zu lassen. Zur Not hätte er sie sogar mit jener grün-braunen Flechte ernähren können, die außerhalb der Dörfer ganze Berghänge überwucherte und jedem Sturm und jeder Überschwemmung trotzte. Nur bei längeren Schönwetterperioden nahm sie ihre typische dunkelviolette Farbe an.
„Das Geschenk von Trokis an seine Bewohner!“
Wie oft hatte Hari diesen Satz schon gehört! Jedes Mal, wenn er sich über den strengen, leicht bitteren Geschmack der Flechte beschwert hatte, der, gleichgültig bei welcher Zubereitungsart, immer durchschlug. Und stets folgte dann noch die ausführliche Erklärung: Dass nicht nur alle notwendigen Nährstoffe in dieser Pflanze enthalten seien, sondern dass sie auch die vielfältigsten Möglichkeiten der Zubereitung böte – als Salat, als gedünstetes Hauptgericht, getrocknet zu brotähnlichen Fladen gebacken, auf Wanderungen einfach nur roh – was sie zum unentbehrlichen Nahrungsmittel der ersten Wahl machte.
„Vor allem nach Missernten und den folgenden Hungersnöten!“
Alle Lobreden milderten jedoch nicht den strengen Geschmack und Hari hörte nie auf sich zu fragen, warum, um aller Götter Willen, auch in den Zeiten bester Ernten und fern jeder Hungersnot kein Tag verging, wo die Pflanze nicht mindestens in einer der drei Hauptmahlzeiten enthalten war. Seine Flugmaus würde er jedenfalls damit verschonen!
Immer noch haderte er mit seinem Schicksal, das ihn gezwungen hatte, Ra-Ra-Ra auf diesem Baum zu verstecken.
Einige Tage lang war alles gut gegangen. Er trug den Korb mit sich herum, wo er nur konnte, das Tier war schon fast zahm und saß schon kurze Zeit frei auf seiner Schulter oder auf seinem Arm. Das war der eigentliche Reiz bei diesem Spiel: Ein Wesen, das jederzeit wegfliegen könnte, so zu zähmen, dass es freiwillig bei einem blieb, ohne Korb, frei sitzend oder verborgen in der Kleidung, und nach kurzen Ausflügen stets zu einem zurückkehrte.
Aber noch war es nicht ganz so weit und in einem Augenblick der Unachtsamkeit war das Tier entflohen. Eine wild flatternde Flugmaus im heiligen Tempelbezirk, wenn es auch nur im Vorraum des großen Versammlungsraums war, konnte nicht geduldet werden. Zumal einer der älteren Priester vor Schreck fast eines der kostbaren, unersetzlichen Geräte zerbrochen hätte, die die Götter selbst vor wer-weiß-wie-vielen Jahren den Priestern für ihren heiligen Dienst überlassen hatten!
Es gab viel Geschrei und Geschimpfe, bis Hari den Übeltäter endlich erwischt hatte, und er sah zum ersten Mal in seinem Leben einen Priester innerhalb des Tempelbezirks die vorgeschriebene, rituelle Haltung aufgeben.
Statt ruhig und aufrecht, mit konzentrierten, beherrschten Bewegungen sein wichtiges Arbeitsgerät zu bergen, sprang, zuckte und hüpfte der Mann herum, dass es eine Freude war. Er duckte sich unter der flatternden, wild kreisenden Flugmaus hinweg, mit einer Gelenkigkeit, die Hari ihm niemals zugetraut hätte, und die Worte, die dabei von seinen Lippen strömten, passten auch nicht so ganz an diesen heiligen Ort.
„Schaff sofort dieses Tier hier weg!“
Der Befehl war deutlich, aber nicht völlig frei von der Möglichkeit des Missverstehens. Er war jedenfalls nicht aufgefordert worden, Ra-ra-ra freizulassen. So hatte er sie auf dem Baum versteckt, um sie den Nachstellungen seiner Erzieher zu entziehen. Hätte er nur besser aufgepasst!
Hari verscheuchte seine Erinnerungen und wandte sich wieder seiner Flugmaus zu. Das Tier hatte inzwischen die Mahlzeit beendet und schlief satt und zufrieden in seiner Armbeuge. Auch er selbst war ein wenig müde geworden, ließ seine Augen verschlafen über das Klostergelände schweifen.
Eine ungewöhnliche Unruhe und Bewegung im Umkreis des Tempels erregte seine Aufmerksamkeit: Aus den Gebäuden ringsum strömten Priester und Priesterschüler dem Tempelbezirk zu.
Was konnte das bedeuten?
Das Halbjahresritual war gerade gefeiert worden und die Begrüßungszeremonien für die Heilpriester, wenn sie nach ihrer Wanderung ins Kloster zurückkehrten, fanden stets am Abend statt. Jetzt aber war Mittagszeit, wo sonst die Aktivitäten im Kloster ruhten. Neugierig geworden verstaute Hari sein Tier im sicheren Korb, schwang sich flink vom Baum hinunter und folgte den anderen.
Der Tempelvorraum lag ruhig und leer, die Stimmen der Priester, die rituelle Gebete zitierten, drangen aus dem großen Versammlungsraum. Hier hatten sich alle eingefunden. Von vier Seiten aus blickten die Zuschauer auf die freie Mittelfläche. Hari schob sich an den Sitzbänken vorbei nach vorn, um zu sehen, was es war, das der Hohepriester dort, Gebete murmelnd, umschritt, das Gefäß mit dem Räucherwerk aus den heiligen Kräutern schwenkend. Erst verdeckte der Körper des Hohepriesters Hari die Sicht, dann hatte er die Umrundung des erhöhten Tisches beendet und Hari blickte in das Gesicht seines alten, blinden Lehrers. Reglos und starr, die Augen geschlossen, schien er zu schlafen.
Nur einmal bisher war der Tod Hari begegnet, als er einen der Tempeldiener zum Begräbnisplatz des Klosters begleiten durfte. Es war sein erster und einziger Ausflug gewesen, das erste Mal, dass er das riesige Tor durchschritten hatte und die Klostermauern von außen sah. Der Tag stand klar in seinem Gedächtnis: Die langen Reihen der Gräber, die er aufmerksam betrachtet hatte, in denen unter flachen, grauen Steinplatten die Überreste der Priester ruhten, die ihnen vorausgegangen waren. Wohin? Zu den Alten Göttern vielleicht? Hari hatte nicht richtig zugehört, zu sehr war er damit beschäftigt gewesen, eine Lücke zwischen den Steinplatten zu erspähen, um einen Blick auf die Verblichenen erhaschen zu können. Aber die Ritzen waren sorgfältig verstopft, er blieb erfolglos.
Immer noch starrte Hari auf den ausgestreckten Körper seines alten Lehrers. War das der Tod? Die rituellen Worte des Hohepriesters gaben ihm die Antwort:
„Der Tod ist zu uns gekommen!
Der Tod ist zu uns gekommen,
dieses Mal ist er nicht vorbeigegangen.
Dieses Mal ist er nicht vorbeigegangen,
er nahm Ha-jo-tah mit sich.
Er nahm Ha-jo-tah mit sich,
ihm die Wohnstätten der Götter zu zeigen.
Er zeigte ihm die Wohnstätten der Götter ...“
Die Beine versagten Hari den Dienst, er sank neben der Sitzbank in die Knie, seine Finger krallten sich in das verwitterte Holz. Die Worte der Gebete zogen an ihm vorbei ebenso wie der betäubende Duft des Räucherwerks. Wie im Traum blickte er um sich, suchte in den Gesichtern der anderen den Widerhall des brennenden Schmerzes, der ihn ergriffen hatte, aber er fand nur Leere. Kaum jemand hatte den alten Priester noch gekannt. Zu viele Jahre hatte er in der Abgeschiedenheit des Tempelbezirks seinen Dienst getan. Die Teilnahme am Totenritual war ihnen nicht heiliges Bedürfnis, sondern lästige Pflicht.
Nur bei einigen der alten Tempeldiener, denselben, die sich darin abwechselten, ihn aufzuziehen, und im Gesicht des Hohepriesters entdecke der Junge Anzeichen von Gemütsbewegung.
Hari schreckte auf, als sich alle von ihren Sitzen erhoben und dem Ausgang zustrebten. Die Träger ergriffen die Enden der Stangen, die, verbunden mit dem üblichen, robusten Filzstoff, eine Tragbahre formten, und folgten dem Zug der Priester. Der Hohepriester bildete den Abschluss.
Hari ließ sich vom Strom der Menge treiben. Niemand achtete auf den Knaben, alle schritten schweigend und gesammelt, in der rituellen Haltung der Priester, dem Begräbnisplatz zu. Erst dort schlugen sie den steifen Körper des alten Mannes in dicke Filzdecken ein. Viel zu kurz schien Hari der letzte Blick, den er vom Gesicht seines Meisters noch erhaschen konnte. Sie schichteten die Steinplatten um ihn, die, kunstvoll ineinandergefügt, den Leichnam bewahren und schützen würden. Das Namenszeichen, mit schwungvoller Handbewegung vom Hohepriester in den letzten Deckstein eingeritzt, gab Kunde und Zeugnis, dass hier ein geweihter Priester von Trokis ruhte, Diener der Alten Götter, im Leben und im Tod.
Schon hatte sich die Versammlung zerstreut, in kleinen Gruppen strebten die Priester wieder dem Klostertor zu. Hari stand vor dem Grab, dumpfen Schmerz und Verzweiflung im Herzen. Der Tod war endgültig und unwiderruflich. Die Erzählungen der Tempeldiener beschrieben es und die Geste der Endgültigkeit, vollzogen vom Hohepriester als Abschluss der Zeremonie, hatte es Hari bestätigt: Er würde Ha-jo-tah niemals wiedersehen.
Eine Bewegung hinter ihm ließ ihn aufhorchen. Auch der Hohepriester war noch zurückgeblieben, um von seinem einstigen Lehrer Abschied zu nehmen. Einen Augenblick lang verharrten sie Seite an Seite, jeder den Schmerz des anderen mitfühlend. Ran-ta-nor regte sich als Erster, berührte sacht Haris Schulter, beugte sich, um nach seiner Hand zu greifen und ihn zum Kloster zurückzuleiten.
Unversehens erwachte die Wut in Hari, verbrannte Schmerz und Verzweiflung wie in einer Stichflamme.
Nein! Keinen Trost! Jetzt nicht mehr!
Sein Lehrer war tot, der Einzige, dem er etwas bedeutet hatte, und sie hatten ihn nicht einmal gerufen, an seiner Totenfeier teilzunehmen!
‚Wo war dein Trost eben, auf dem Weg hierher oder vorhin im Versammlungsraum?‘, brüllte es in ihm auf.
Er duckte sich, wich der Hand des Hohepriesters aus und rannte davon wie von allen Berggeistern gehetzt. Verwirrt blieb Ran-ta-nor zurück. Was war plötzlich in den Jungen gefahren? Der kurze Moment der Verbundenheit war vorbei und vergessen. Kopfschüttelnd wandte sich der Hohepriester dem Kloster zu. Doch schon nach ein paar Schritten wanderten seine Gedanken ihm voraus und seine täglichen Pflichten und Aufgaben nahmen seine Aufmerksamkeit wieder völlig gefangen.
Erst lange nach Sonnenuntergang kehrte Hari in seinen Schlafraum zurück. Seine Abendmahlzeit stand unberührt. Die Tempeldiener versorgten noch die heiligen Gefäße und Geräte, die nach der Zeremonie wieder gesäubert und sorgsam verstaut werden mussten. Sie hatten sein Fehlen nicht bemerkt.
Priesterschüler
Die Jungen schienen am Ende ihrer Kräfte zu sein. Der Sturm zerrte an ihren Kleidern und an ihren Haaren, als sie sich durch das Klostertor drängten; der neue Lehrer folgte dicht hinter ihnen.
Der Lehrer Ran-gho-ra war mit dem Knaben Ra-ki vor drei Wochen vom Nachbarkloster aufgebrochen. Unterwegs hatten sie, von Dorf zu Dorf wandernd, nach und nach die anderen sieben Jungen aus ihren Elternhäusern abgeholt, der letzte war vor fünf Tagen zu ihnen gestoßen. Keiner von ihnen hatte sich jemals zuvor weiter als zwei bis drei Tagesreisen von seinem Heimatdorf entfernt.
Sie alle waren die neuen Priesterschüler. Bereits als Säuglinge von den wandernden Priestern für diese Aufgabe ausgewählt, sollten sie jetzt, im Alter von zwölf Jahren, ihre Ausbildung im Kloster beginnen. Entsprechend aufgeregt und laut waren die Tage der Wanderung vergangen.
Nur Ra-ki hielt sich abseits, beteiligte sich weder an den wilden Spekulationen über das kommende Klosterleben, noch an den abstrusen Befürchtungen über die möglichen Gefahren des Weges. Das Leben im Kloster war ihm bestens vertraut. Seit Jahren schon hatte er vorzeitig am Unterricht der älteren Priesterschüler teilgenommen. Die lange Wanderung erschien ihm kaum als gefährlich, sondern vielmehr als eine Gelegenheit zum befreiten Aufatmen, als eine willkommene Abwechslung von der jahrelangen Klosterdisziplin.
Hari verbarg sich seitlich des Tors und beobachtete mit finsterem Blick wie die Neuankömmlinge sich nass und zerzaust am Pförtnerhaus vorbeischoben.
Bisher hatten Veränderungen in seinem Leben nichts Gutes bedeutet. Der Tod seines alten, blinden Lehrers hatte ihm noch mehr Einsamkeit beschert und einige neue Verstecke im Gelände, wo es ihm mehr oder weniger erfolgreich gelungen war, sich vor den Erziehungsversuchen der verschiedenen Tempeldiener in Sicherheit zu bringen.
Im Alter von neun Jahren hatten sie ihn zu den Priesterschülern in den Unterricht gesteckt, ihn aber weder besonders gefördert noch getadelt, weil er die Prüfung in dem Alter ohnehin noch nicht ablegen durfte. Bei der Arbeit mit den Energiesteinen hatte er alle in Erstaunen versetzt, den Rest des Unterrichts hatte er lustlos über sich ergehen lassen, wie alle anderen Anordnungen der Priester auch, um anschließend so schnell wie möglich irgendwo im Gelände unterzutauchen. Die Priesterschüler hatten ihn entweder wie ein Maskottchen behandelt oder ihn aufgezogen und gehänselt.
Lange schon fieberte er dem Tag entgegen, an dem endlich der richtige Unterricht für ihn beginnen würde, der ihn zur Einweihungsprüfung der Priester führen würde und damit zu dem, was er von klein auf als sein Ziel ansah: zu den Heiligen Steinen der Alten Götter. Jetzt aber, als er die fremden Jungen endlich erspäht hatte, spürte er nichts als dumpfes Unbehagen.
„Hari! Komm her, du kannst ihnen gleich den Weg zeigen!“
Der Priester, der das Amt des Pförtners versah, hatte ihn entdeckt. Hastig sprang Hari in den Schatten der Büsche, schob sich ein Stück an der Klostermauer entlang, rannte, sobald er außer Sichtweite war, in Richtung der Lagerhäuser und tauchte unter das schräge Dach in eines seiner Verstecke.
Ein Rascheln ließ ihn aufschrecken. Einer der neuen Jungen schob sich hinter ihm durch den schmalen Durchgang, den er mit einer alten Filzdecke abgedichtet hatte. Beide keuchten vom hastigen Laufen, starrten sich an.
Der andere stand ruhig und aufrecht, das Wasser des Regens tropfte aus seinen Haaren. Ein langsamer, bewusster Blick ringsum, ein spöttisches Aufleuchten in den großen, schrägen Augen. Ein tiefes Blau, so blau wie ein ...
Hari riss sich zusammen. Warum, bei den Göttern, sollte man die Augenfarbe eines Jungen mit irgendetwas vergleichen? Der nächste Blick galt ihm selbst. Für einen Moment versank Hari in diesem Blau.
„Aha!“, sagte der fremde Junge und Hari wusste nicht, ob das ihm galt oder dem engen, mit allen möglichen Dingen vollgestopften Raum.
Der Fremde öffnete die Verschnürung des dicken, feuchten Reiseumhangs, machte Anstalten, ihn abzulegen.
„Werden sie dich nicht vermissen, deine Freunde?“ Hari zeigte mit einer Kopfbewegung in Richtung des Tors.
Ein kurzes, abfälliges Lachen. „Freunde!“
Dann wieder der intensive Blick zu ihm hin. „Ich denke eher, dich werden sie vermissen. Dich hat man doch eben gerufen, nicht wahr?“
Sie lachten beide. Kurze Zeit später fand Hari sich im angeregten Gespräch wieder, beantwortete Fragen, zeigte die Dinge, die er hier untergebracht hatte, führte dem anderen schließlich sogar seine Übungssteine vor. Der betrachtete sie interessiert, ohne jedoch besonderes Erstaunen zu zeigen.
„Meine musste ich zurücklassen“, sagte er schließlich. Jetzt war es an Hari zu staunen.
„Du bist auch in einem Kloster aufgewachsen?“
„So könnte man es nennen.“
Die Antwort kam kurz und abweisend und Hari ließ es dabei bewenden.
Beinahe hätten sie die Abendmahlzeit verpasst. Hari führte den Neuen auf einigen Abkürzungen zum Küchengebäude und in den Speiseraum. Sie mischten sich unter die anderen, die gerade dabei waren, ihre Plätze auf den langen Bänken links und rechts der reichlich gedeckten Tische einzunehmen. Erst jetzt fiel Hari auf, dass er noch nicht einmal den Namen des Jungen wusste. Aber gleich würde ja die offizielle Einführung und Vorstellung der neuen Priesterschüler stattfinden. Gelangweilt ließ Hari die Stimme des Priesters an sich vorbeiziehen, der nach einer kurzen Begrüßung zunächst die Klosterregeln erklärte:
„Nach dem Wecken: Persönliche Hygiene und Aufräumen der Schlaf räume.
Bei Sonnenaufgang: Körperübungen und Meditation.
Morgenmahlzeit
Danach: Vormittagsunterricht.
Manchmal stattdessen auch Arbeitseinsatz in der Küche, im Gelände oder bei der Ernte.
Mittagessen, anschließend Mittagsruhe.
Nachmittagsunterricht.
Anschließend eine Stunde Schweigezeit, zu nutzen für innere Sammlung und Meditation.
Freizeit bis zum Abendessen ...“
Hari sagte die Aufzählung nichts Neues. Was die anderen Jungen dabei empfinden mochten, konnte er sich nicht vorstellen. Er nahm nicht einmal richtig ihre Erschöpfung wahr von der langen Wanderung. Er wartete ungeduldig auf die namentliche Vorstellung.
Ra-ki hingegen beobachte seine Reisegefährten sehr genau. Mit der ihm eigenen Fähigkeit, alle Gefühle und Empfindungen der Wesen um ihn herum deutlich wahrzunehmen, ertastete er all die Ängste und Befürchtungen, die sie bewegten: Heimweh und Trennungsschmerz, Müdigkeit und Hunger ... Sein wacher Blick wanderte stetig von einem zum anderen, als wolle er sortieren, wem welches Gefühl zuzuordnen sei.
„Ran-gho-ra!“
Die Vorstellung begann mit dem neuen Lehrer. Hari streifte ihn nur mit einem kurzen Blick. Bedeutend jünger als die anderen Lehrer hier, registrierte er. Aber genau darum war er angefordert worden: Der bisherige Lehrer wurde langsam zu alt und unter den Jungpriestern im Kloster schien keiner für diese Aufgabe geeignet zu sein. Ran-gho-ra sollte die Gruppe in der eigentlichen Energiearbeit unterrichten, dem Kernstück der Priesterausbildung, der Arbeit mit den Heiligen Steinen.
Es folgten die Namen der anderen Lehrer, die für die Körperübungen, den Tempeltanz und die rituellen Gesten und Gebete zuständig waren. Hari kannte sie schon aus den Vorjahren, seine Aufmerksamkeit war nur auf die neuen Priesterschüler gerichtet.
„Bo-rho!“
Ein unscheinbarer Junge, der vor Müdigkeit kaum noch die Augen offen halten konnte.
„Ron-ko!“
Er schien sich in den Tagen der gemeinsamen Reise eine Art Anführerstatus erworben zu haben, er ergriff häufig das Wort und erntete für seine zynischen Bemerkungen beifälliges Gelächter.
„Ran-to!“
Er saß neben Ron-ko, immer bestrebt seine Aufmerksamkeit zu erregen.
„Sa-ti!“
Ein lebhafter, kleiner Kerl, der entweder redete oder pausenlos auf seinem Sitz hin und her rutschte.
„Ke-ma!“
Ernst und still. Der Einzige von ihnen mit dunklen Haaren, eine Seltenheit auf Trokis.
„Ra-ki!“
Das war er!
Die anderen zwei Namen, To-ran und Ma-rho, hörte Hari nicht mehr.
Ra-ki hatte seine Mahlzeit schweigend verzehrt. In Haris Augen war er der Einzige von ihnen, der sich zu benehmen wusste. Gespräche beim Essen waren zwar erlaubt und üblich, aber das unruhige Scharren und Herumwackeln der anderen Jungen, begleitet von Tuscheln und Kichern, machte Hari nervös. Ra-ki dagegen saß ebenso aufrecht wie er selbst, griff mit ebenso ruhigen, beherrschten Bewegungen nach den Schüsseln. Es schien zu stimmen, dass auch er im Kloster aufgewachsen war.
Hari ertappte sich bei der Überlegung, was er seinem neuen Freund nach dem Essen als erstes zeigen wollte.
Freund!
Das Wort hatte sich wie von selbst in seine Gedanken geschlichen, Hari schob es erst einmal wieder von sich. Er hatte niemals einen Freund gehabt, mit Ausnahme der kurzen Begegnung vor Jahren, die ihm letztlich die Flugmaus beschert hatte. Inzwischen war das Tier längst gestorben und fast vergessen.
„Hari!“
Er zuckte zusammen, neun Augenpaare starrten ihn an. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass auch er den anderen vorgestellt werden musste. Er fühlte sich unbehaglich unter den prüfenden Blicken. Das leicht spöttische Lächeln Ra-kis ließ ihn seine Haltung wiederfinden, er hielt sich gerade und reckte das Kinn vor.
Zu Haris Enttäuschung gab es an diesem Abend keine Freizeit mehr, die Jungen sollten nur noch ihre Schlafräume beziehen und zu Bett gehen. Hari wurde angehalten, seine Sachen aus seinem bisherigen Quartier in den Gemeinschaftsschlafraum zu schaffen. Verdrossen wollte er sich auf den Weg machen, als ihn kurz vor der Tür der neue Lehrer aufhielt. Er war noch jünger, als Hari gedacht hatte, vielleicht etwas über dreißig Jahre, schätzte er.
Ebenmäßige, klare Gesichtszüge. Kalte Augen. Schönheit gepaart mit Kälte! Die perfekte Haltung des Priesters.
„Wie ist dein voller Name?“ Klare, harte Stimme.
„Ha-run-jah.“
„Und gerufen wirst du Haari?“ Er betonte übertrieben den langgezogenen Selbstlaut.
Die Namen auf Trokis wurden stets abgehackt gesprochen mit deutlich voneinander getrennten Silben. Schon die zweisilbige Abkürzung, die man im Kloster meist benutzte, wies auf Verwandtschaft oder engere Bekanntschaft hin. Zu einem Wort verbunden und langgezogen sprach man nur Spitznamen und Kosenamen aus, bei kleinen Kindern oder bei Personen sehr vertrauten Umgangs. Sie hatten es bei Hari einfach so beibehalten. Jetzt errötete er unter dem Blick des fremden Priesters.
„Ich war ein ... Ich bin ein Findelkind.“
Der andere nickte. In der kurzen offiziellen Begrüßung im Audienzraum des Hohepriesters war er schon mit einigen Gepflogenheiten des Klosters vertraut gemacht worden. Diesen, hier im Kloster erzogenen, angeblich so begabten Jungen, hatte man ihm besonders ans Herz gelegt.
Jetzt musterte er sein Gegenüber kritisch, nahm jede Einzelheit in sich auf: den schmalen, hochaufgeschossenen Körper. Die angespannten, feinen Gesichtszüge. Hellblaue, schräge Augen wie jedermann auf Trokis. Die feinen, weißblonden Haare, in der Sitte der Priester lang und offen auf die Schultern herabfallend.
In Ran-gho-ras Augen wirkte der Junge viel zu zart für das harte Klosterleben. Wahrscheinlich hatten die alten Männer ihn ein wenig verhätschelt. Nun, ein paar Ernteeinsätze extra würden das vielleicht in Ordnung bringen. Er würde schon herausfinden, was an diesem Wunderkind wirklich dran war!
„Ich habe schon von dir gehört.“ Es klang gelangweilt, fast verächtlich. „Wir sehen uns dann im Unterricht.“
Ran-gho-ra wandte sich ab, mit der offiziellen Geste, die anzeigte, dass Hari entlassen sei. Ra-ki, der sie offenbar beobachtet hatte, schob sich an Haris Seite.
„Nun, hat er sich schon bei dir eingeführt?“
Hari schüttelte die Benommenheit ab, die das kurze Gespräch bei ihm hinterlassen hatte, und zuckte die Achseln.
„Lehrer sind alle gleich!“, sagte er betont lässig.
„Der nicht!“, kam prompt Ra-kis Antwort. „Der ist schlimmer!“
Nur noch ein Lager in der hintersten Ecke des zweiten Schlafraums war frei, als Hari mit seinem Bündel eintraf. Er schob sich durch den Durchgang, der die beiden Räume verband, tastete sich vorsichtig zwischen den herumliegenden Sachen der Jungen hindurch. Ra-ki hatte im Nachbarraum eine der drei Hängematten gewählt und sich schon darin ausgestreckt. Hari richtete schweigend sein Lager und ging zu Bett, während die anderen noch herumkramten und ihre Eindrücke austauschten. Endlich forderte die Anstrengung des Tages ihren Tribut und es trat Ruhe ein.
Nur Ke-ma, der stille, dunkelhaarige Junge, konnte noch keinen Schlaf finden, bewegte ständig die Bilder der vergangenen Tage in seinem Kopf. Immer wieder sah er die Gesichter seiner Eltern vor sich und den aufmunternden Blick seiner Großmutter, als sie ihn zum Abschied umarmt hatte. Unter den spöttischen Bemerkungen der anderen Priesterschüler hatte er versucht, seine Tränen zurückzuhalten - vergeblich.
Im Alter von sechs Jahren hatte er seine Mutter – anlässlich einer Hochzeitsfeier im Dorf - gefragt, ob er schon jemandem versprochen sei und erfahren, dass die Priester ihn ausgewählt hatten für den Dienst an den Alten Göttern.
Jetzt würde also der große Traum seiner Eltern wahr werden: Ihr einziger Sohn würde aufgenommen in die geheimnisvolle, mächtige Priesterkaste, in deren Händen das Schicksal des ganzen Planeten ruhte. Daran, dass er die Einweihungsprüfung bestehen würde, bestand für seine Verwandten kein Zweifel. Er selbst war sich da gar nicht so sicher und die strenge, kühle Art des Lehrers Ran-gho-ra war auch nicht gerade dazu geeignet, seine Ängste zu zerstreuen.
Von klein auf hatten sie ihm beigebracht, was für eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe ihn später erwarten würde, nun gab es kein Zurück mehr. Erst vorhin, als das große Klostertor mit dumpfem Laut hinter ihnen ins Schloss gefallen war, war Ke-ma das richtig klargeworden.
Er hatte Li-lia nicht mehr sprechen können.
Am Tag vor seiner Abreise hatte sie es ihm angedroht: Jede Abschiedsszene sei ihr ein Gräuel, er solle nicht mit ihr rechnen. Verständlich, nachdem im letzten Jahr ihr Vater von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war. Sie hatten ihn erst Wochen später in einer Schlucht gefunden, eine Gerölllawine hatte ihn erfasst und mit sich in die Tiefe gerissen.
Wenn Ke-ma auch vorhatte zu überleben, so war es doch unwahrscheinlich, dass er sie jemals wiedersehen würde. Und falls doch, so wäre es nie mehr das Gleiche ... Er würde dann eines der hellen Priestergewänder tragen, malte Ke-ma sich aus. Würde sie sich auf dem Dorfplatz vor ihm verbeugen und ihren Namen nennen, wie es Sitte war?
‚Mein Name ist Li-lia. Ich kannte einmal einen Jungen namens Ke-ma, hast du ihn vielleicht irgendwo gesehen ...?‘
Heftig warf sich Ke-ma auf die andere Seite und vergrub das Gesicht in der kratzigen Decke. Er vermisste Li-lia mehr als seine Eltern! Er selbst hatte keine Geschwister, so hatte er viel Zeit im Nachbarhaus verbracht, wo gleich vier Kinder für Aufregung und Abwechslung sorgten. Li-lia war die Älteste von ihnen, nur ein Jahr jünger als er selbst. Sie hatten Li-lias Mutter geholfen, Schüsseln und Krüge aus Ton zu formen, oder hatten gemeinsam ihre jüngeren Geschwister betreut.
Vier Kinder zu haben war ein seltenes Geschenk der Götter. Nur einmal in drei Jahren schien es den Frauen auf Trokis möglich zu sein, ein Kind zu empfangen, und es gab keine deutlichen Merkmale, um die Zeiten der Fruchtbarkeit festzustellen. Aber auch wenn alle Kinder erwünscht und willkommen waren, so brauchten sie doch viel Zeit und Aufmerksamkeit und Li-lias Mutter war froh, wenn sie wenigstens den kleinen Ba-ti für eine Weile beschäftigten.
Ke-ma schien es, als könne er immer noch die winzigen Finger des Jungen in seiner Hand spüren und sein prustendes Lachen hören, wie bei ihren unzähligen Spaziergängen durch die Felder und Obstgärten.
Ba-ti hatte ihm vom Arm seiner Mutter aus fröhlich zugewinkt, als er mit seinem Reisebündel über der Schulter dem Lehrer und den anderen Jungen gefolgt war. Aber Li-lia hatte sich nicht blicken lassen. Auch hinter den Fensteröffnungen des Nachbarhauses hatte er keine Bewegung entdecken können, so sehr er sich auch den Hals verrenkte.
Es war wohl Sa-ti gewesen, der ihn schließlich sacht an der Schulter gepackt und ihm gutmütig zugeflüstert hatte:
„Heh, du! Willst du den ganzen Weg bis zum Kloster rückwärts laufen?“
Erst da gab Ke-ma auf.
Am nächsten Tag gab es noch keinen Unterricht. Die Jungen sollten sich erst mit der neuen Umgebung ein wenig vertraut machen. Zunächst aber wurden sie aus dem Lagerhaus des Klosters neu eingekleidet.
Mit einem großen Stapel Kleider im Arm betrat Hari hinter dem Priester die Schlafräume der Jungen. Hari und Ra-ki trugen schon die Gewänder der Priesterschüler, sollten aber ebenfalls neu ausgestattet werden. Mit eintöniger Stimme rief der Verwalter des Lagers die Namen der Jungen auf und nahm Hari, der ernst vor sich hinsah, jeweils ein Kleiderbündel ab.
Hari grollte! Wieder hatten sie es geschafft, ihn für eine Sonderarbeit heranzuziehen. Keinen Schritt konnte er auf dem Gelände tun, ohne dass einer der Priester oder Tempeldiener auf ihn zustürzte, um ihm irgendeinen Auftrag zu erteilen. Seit seinem fünften Lebensjahr war das so gewesen; das war auch der Hauptgrund für seine zahlreichen Verstecke, in die er sich meist erfolgreich zurückziehen konnte. Heute war er wieder unvorsichtig gewesen.
Die Jungen hatten beim Eintreten der beiden ihre Gespräche unterbrochen, nun blickten sie erstaunt auf Hari, der ebenso wie der Priester, den er begleitete, in der fast perfekten rituellen Haltung dort ausharrte, als sei er Mitgestalter einer bedeutungsvollen Zeremonie. Ra-kis Mundwinkel kräuselten sich spöttisch. Dann erst nahm er das Unbehagen des anderen wahr und seine Züge wurden sanfter.
Hari erwiderte seinen Blick mit der gequälten Andeutung eines Lächelns, ohne ansonsten einen Muskel zu rühren.
‚Warum macht er nur so eine Aktion aus der Sache? Er teilt diese Kleider aus, als sei er der Hohepriester beim Halbjahresritual!‘, dachte Ra-ki ratlos. Er schämte sich für seinen neuen Freund und ärgerte sich über die anderen Jungen, die unverhohlen kicherten und spöttische Bemerkungen austauschten.
Ra-ki kam nicht in den Sinn, dass hier nur eine jahrelange Gewohnheit abrollte. Schon bei seinen ersten Spielen im Tempel hatten Haris Betreuer ihm ein bestimmtes Verhalten antrainiert. Zu wertvoll waren die unersetzlichen Geräte und Gefäße im Tempelbezirk, die Geschenke der Alten Götter, um sie dem Spieltrieb eines Kleinkinds zu opfern. So lernte Hari, sobald er laufen konnte, den ruhigen, gemessenen Schritt der Tempeldiener nachzuahmen.
Damals hatte er noch oft darum gebettelt, seinen Betreuern bei ihrer täglichen Arbeit helfen zu dürfen. So sah man ihn mitunter ernsthaft beim Sortieren der Kräuter oder hingebungsvoll mit dem Reinigen einer Schüssel oder Schale beschäftigt, die sie ihm anvertraut hatten. Vieles war ihm seit dieser Zeit zur zweiten Natur geworden, so auch der Wechsel vom normalen Laufen zum rituellen, beherrschten Schritt der Priester, wie es die Vorschrift verlangte, wenn man die Tür zum Tempelvorraum durchschritt. Unzählige Male hatte er mit älteren Priestern zusammen diesen Wechsel ganz selbstverständlich mitgemacht. Der heutige Auftrag war für ihn nur einer von vielen und wie gewöhnlich war er in die rituelle Haltung gefallen, mit der Absicht, darin zu verbleiben, bis der Priester ihn wieder entlassen würde.