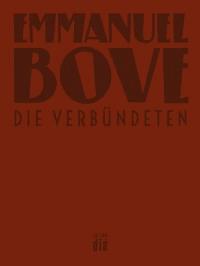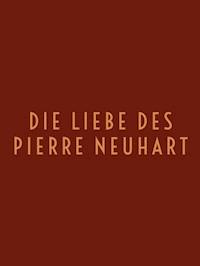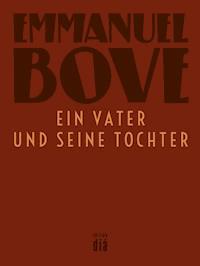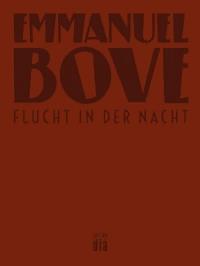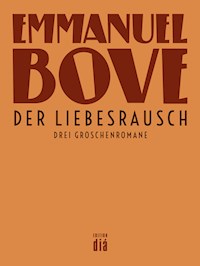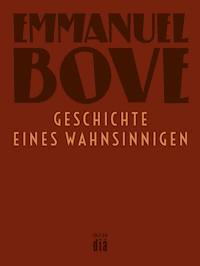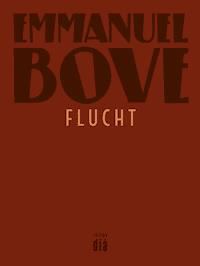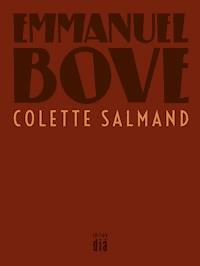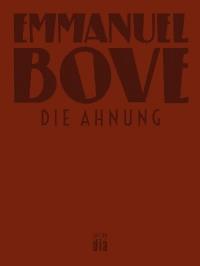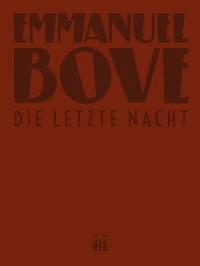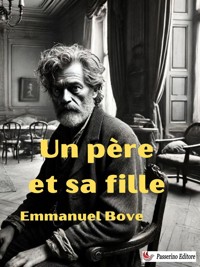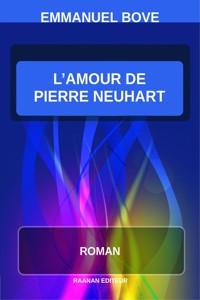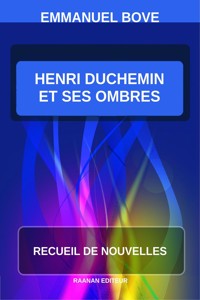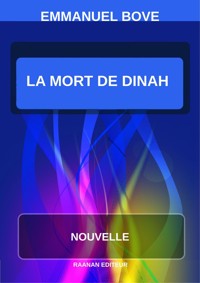Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werkausgabe Emmanuel Bove
- Sprache: Deutsch
In tagebuchartigen Einträgen notiert der Erzähler seine Sticheleien gegen seine Frau Madeleine, um mit fast wissenschaftlicher Genauigkeit deren und seine eigenen Reaktionen zu untersuchen. Dabei werden die tiefen Abgründe dieser Beziehung eindringlich aufgedeckt. Die drastischen Selbstversuche und Reflexionen kehren sich jedoch unvermittelt gegen den Protokollanten selbst und führen zum Auseinanderbrechen der Beziehung. "Die Ehe als kriegerisches Schauspiel. Emmanuel Bove […] ist ein Meister der Schlachtbeschreibung." [Quelle: Manuela Reichart, Berliner Zeitung] Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
In tagebuchartigen Einträgen notiert der Erzähler seine Sticheleien gegen seine Frau Madeleine, um mit fast wissenschaftlicher Genauigkeit deren und seine eigenen Reaktionen zu untersuchen. Dabei werden die tiefen Abgründe dieser Beziehung eindringlich aufgedeckt. Die drastischen Selbstversuche und Reflexionen kehren sich jedoch unvermittelt gegen den Protokollanten selbst und führen zum Auseinanderbrechen der Beziehung.
»Die Ehe als kriegerisches Schauspiel. Emmanuel Bove […] ist ein Meister der Schlachtbeschreibung.« (Manuela Reichart in der Berliner Zeitung vom 9. Januar 1999)
Mehr zum Autor und seinem Werk unter www.emmanuelbove.de
Der Autor
1898 als Sohn eines russischen Lebemanns und eines Luxemburger Dienstmädchens in Paris geboren, schlug sich Emmanuel Bove mit verschiedenen Arbeiten durch, bevor er als Journalist und Schriftsteller sein Auskommen fand. Mit seinem Erstling »Meine Freunde« hatte er einen überwältigenden Erfolg, dem innerhalb von zwei Jahrzehnten 23 Romane und über 30 Erzählungen folgten.
Nach seinem Tod 1945 gerieten der Autor und sein gewaltiges Œuvre in Vergessenheit, bis er in den siebziger Jahren in Frankreich und in den achtziger Jahren durch Peter Handke für den deutschsprachigen Raum wiederentdeckt wurde. Heute gilt Emmanuel Bove als Klassiker der Moderne.
Die Übersetzerin
Gabriela Zehnder, geboren 1955, ist freiberufliche literarische Übersetzerin aus dem Französischen und Italienischen und lebt in der italienischen Schweiz. Sie übersetzte Autoren wie Ignacio Ramonet, Jean-Luc Benoziglio, Muriel Barbery, René Laporte, Adrien Pasquali, Etienne Barilier, Giuliana Pelli Grandini, Corinna Bille u. a.
Journal –geschrieben im Winter
Roman
Aus dem Französischenvon Gabriela Zehnder
Edition diá
7. Oktober
Madeleine tut gerne so, als höre sie von einer Schmeichelei zum ersten Mal. Berichtet man ihr, eine ihrer Freundinnen finde sie schön, heuchelt sie Überraschung. Madeleine scheint nicht glauben zu können, dass es wahr ist, während man ihr in Wirklichkeit das Gesagte schon am Vortag zugetragen hat. Sie fürchtet nicht, der andere könnte argwöhnen, ihr Nichtwissen sei nur gespielt. Als sei sie absolut aufrichtig, geht sie sogar so weit, Einzelheiten zu erfragen. Genau das ist heute geschehen. Am Abend kam uns Jacques Imbault besuchen. Im Laufe der Unterhaltung sagte er meiner Frau, er habe ihre Fotografie in einer Zeitschrift gesehen. »Ich habe nicht gewusst, dass man Sie als Modell verpflichtet hat«, fügte er ironisch hinzu. Jacques Imbault hält sich für außerordentlich geistreich, und damit man das auch merkt, spricht er unter anderem ständig von irgendwelchen Anstellungen. So bin ich ihm vor einigen Tagen bei der Garderobe eines Theaters begegnet. Ich hatte meine Nummer verlegt, und als er mich sah, wie ich zerstreut wartete, bis alle ihre Sachen erhalten hatten, um die meinen wiederzubekommen, ein wenig so, als sei ich beauftragt worden, den reibungslosen Ablauf der Verteilung zu überwachen, sagte er lachend: »Ich möchte wetten, die Direktion hat Sie als Aufseher engagiert!«
Obgleich mir Madeleine die Zeitschrift gestern gezeigt und dabei über die Fotografen geschimpft und sogar gedroht hatte, den Herausgeber zu verklagen, wobei sie übrigens eine gewisse Genugtuung nicht hatte verhehlen können, schützte sie Erstaunen vor. »Aber Jacques, sagen Sie mir, was ist das für eine Zeitschrift? Ich muss sie mir unverzüglich besorgen.« Und was das Beste ist: Nachdem sie unserem Freund zahllose Fragen gestellt hatte, erinnerte sie sich plötzlich wieder an alles. Es war vor allem dieses wiedererlangte Erinnerungsvermögen, das mir lächerlich erschien. Dass jemand Erstaunen vortäuscht, wenn ihm ein Freund sagt, er habe von seiner großzügigen Geste erfahren, mag ja noch angehen; dass er sich dann aber gleich darauf wieder an jene Geste erinnert, ist unerträglich. Wenn sie das Vergnügen, das ihr die Betrachtungen der anderen zu ihrer Person bereiten, gebührend ausgekostet hat, hält Madeleine es nicht mehr für nötig, ihr Spiel fortzusetzen. Sie gesteht dann, im Bild zu sein, ohne auch nur eine Sekunde lang daran zu denken, der andere könnte diesen Wandel merkwürdig finden. Denn für meine Frau ist es gänzlich unmöglich, sich vorzustellen, dass jemand ihre Gedanken errät. Was immer sie den andern vorgaukelt, nie und nimmer käme ihr die Idee, man könnte ihre Beweggründe entdecken. Gerade in diesem Punkt ist sie das genaue Gegenteil von mir. Während ich aus Angst, einen eigennützigen, kleinlichen oder selbstgefälligen Gedanken bloßzulegen, stets aufs Äußerste bemüht bin, meine Worte abzuwägen, glaubt Madeleine, sie sei so undurchschaubar, dass sie sich ohne das geringste Risiko die unwahrscheinlichsten Kapriolen erlauben könne. Als sie sich heute daran erinnerte, dass ihre Fotografie tatsächlich in einem Wochenblatt erschienen war, nachdem sie zuerst vorgegeben hatte, nichts davon zu wissen, kam ihr nicht der Gedanke, Jacques könnte vermuten, sie habe sich schon vorher daran erinnert. Und was mich betrübt, ist die Tatsache, dass sie zornig wird, wenn ich versuche, sie darauf hinzuweisen und ihr begreiflich zu machen, warum ein solches Verhalten ironische Reaktionen provoziert, gerade so, als sehe ich in ihr nur die niedrigen Seiten. Sie beschuldigt mich, eifersüchtig zu sein, zu glauben, die Welt sei böse, ohne dass sie dabei eine Sekunde lang erkennt, inwieweit meine Beobachtungen zutreffen, und ohne die tiefe Zuneigung zu spüren, die aus meinem Wunsch spricht, sie möge sich nicht zum Gespött unserer Freunde machen. Sie versteht nicht, dass ich sie nur verteidigen will. Sie glaubt im Gegenteil, ich bemühe mich, in ihr etwas Schlechtes zu entdecken, das sonst niemand bemerkt.
12. Oktober
In meiner Kindheit hatte ich Angst vor allem, sehr zum Ärger meiner Mutter, zu deren Prinzipien es gehörte, niemals die Hand gegen ein Kind zu erheben. Sie verstand nicht, dass ich furchtsam war, obschon sie mich doch nie geschlagen hatte. Dies war ihr umso unangenehmer, als man angesichts solcher Furcht annehmen konnte, sie schlage mich tatsächlich. »Aber sei doch nicht so ängstlich, Kind. Alle Leute meinen, man quäle dich.« Und dadurch, dass man mir ständig vorwarf, Angst zu haben, fürchtete ich mich schließlich davor, Angst zu haben, was mich doppelt zaghaft machte und mich wegen nichts und wieder nichts in Schluchzen ausbrechen ließ. Denn im tiefsten Innern, ohne mir dessen bewusst zu sein, schien mir, die Tränen versteckten alles, als wären sie eine Tarnung. Nun waren es meine Tränen, die meine Mutter gegen mich aufbrachten. Man warf mir nicht mehr vor, ängstlich zu sein, sondern zu weinen, als ob ich unglücklich wäre, während in Wirklichkeit die Furcht es war, die mich in diese Zustände versetzte. Ich zitterte wegen jeder Kleinigkeit. Doch diese Kleinigkeiten kamen nie von außen; sie kamen aus meinem Innern. Stieß ich einen Gegenstand um, glaubte ich sogleich, etwas Schreckliches begangen zu haben. Vergaß ich, meinen Vater zu küssen, traute ich mich nicht mehr unter seine Augen. Dauernd schien mir, als habe ich etwas Tadelnswertes getan, wofür er mich bestrafen würde, obschon man mich noch nie bestraft hatte. Die Furcht vor Strafe und Zurechtweisung lähmte mich. Wenn ich mich beim Spiel mit andern Kindern meines Alters so weit vergaß, zu lachen oder herumzutollen, kam es sogar vor, dass ich mich plötzlich an etwas Unbedeutendes erinnerte, das ich gemacht hatte – einen Fleck auf meinem Hemd, einen Kratzer an meinem Bein –, und schon zitterte ich, als ob man mich dafür bestrafen würde, dass ich mich schmutzig gemacht hatte oder gefallen war. Statt sich zu verlieren, wuchs diese Ängstlichkeit, je älter ich wurde.
Als ich fünfzehn geworden war, beschloss mein Vater, mich in ein Internat zu schicken, um meinen Charakter zu stählen und mich fürs Leben zu rüsten. Eines Morgens fuhr er mich selbst nach Oloron. Am Tag zuvor hatte man alles vorbereitet. Während meine Mutter in heller Aufregung war aus Angst, etwas zu vergessen, hatte ich schon eine Ahnung von Alleinsein verspürt; denn nichts lässt das Gefühl von Einsamkeit stärker aufkommen, als wenn bei jenen, die einem lieb sind, der Schmerz der Trennung in den Hintergrund zu treten scheint, um den Vorbereitungen, der Fürsorge und der Ergebenheit Platz zu machen, obschon diese doch nur Ausdruck der Liebe sind. Ich schaute dem geschäftigen Hin und Her meiner Mutter zu und dachte: »Was kümmert sie sich so sehr um die Dinge und so wenig um mich.« Da ich nur untätig herumstand, tadelte sie mich von Zeit zu Zeit milde. Sie hatte mich so manches Mal zuvor mit den gleichen Worten getadelt, doch immer mit der anschließenden Drohung: »Du wirst schon sehen, wie du dich ändern wirst, wenn du erst einmal in Oloron bist«, dass ich an diesem Abend unwillkürlich dachte, man sei nur nett zu mir, weil dies der letzte Tag sei. Wenn man eine Wohnung für eine andere verlässt und zusieht, wie die Zimmer sich leeren, die Möbel aus verschiedenen Wohnräumen nebeneinander zu stehen kommen, ein Objekt, das einem lieb ist, aus Platzmangel plötzlich in einen unpersönlichen Koffer gleitet, überkommt einen eine gewisse Traurigkeit; und aus diesem ganzen Durcheinander, dieser Wohnung, die unversehens leersteht, während die nächste noch nicht bewohnt ist, entsteht ein schmerzlicher Eindruck des Verlorenseins. Wenn aber alles bleibt, wenn nur wir selbst weggehen, wenn unsere Sachen, die man aus den verschiedenen Zimmern zusammenträgt, keine Leere hinterlassen und wir spüren, dass das Leben nach unserem Weggang auch ohne uns wie bisher weitergehen wird, verstärkt sich das Gefühl von Traurigkeit noch. Ich rührte mich nicht, doch am Abend, als ich allein in meinem Zimmer im Bett lag, vor leerem Tisch und leeren Schränken, fühlte ich mich so unglücklich, dass ich zu weinen anfing. Ich weinte still vor mich hin, den Kopf unter den Laken versteckt, ohne an meine Tränen zu denken, die ich unter anderen Umständen hätte trocknen wollen. Als ich mich so gehenließ und dabei nur darauf achten musste, dies lautlos zu tun, was sogar eine angenehme Erregung in mir hervorrief, empfand ich eine Art heitere Verzweiflung. Ich dachte an nichts, und wenn ich mitunter spürte, dass ich mich langsam beruhigte, dachte ich: »Ich werde unglücklich sein«, und schon schluchzte ich von neuem los. Doch plötzlich hörte ich, wie sich die Tür zu meinem Zimmer öffnete. Ich hob die Lider und sah durch das Laken hindurch ein blassgelbes Licht. Da empfand ich ein solches Schamgefühl, ertappt worden zu sein, dass ich wie versteinert dalag, was ohne mein Dazutun den Anschein erwecken mochte, als schliefe ich, und ich hegte dabei die unsinnige Hoffnung, man merke nichts. Mein Körper, der mich unter den Betttüchern durch seine zuckenden Bewegungen verriet, bedeckte sich mit Schweiß. Über mir hörte ich die Stimme meines Vaters. Ich erinnere mich noch, dass sie in mir jene seltsame Angst vor dem Gnadenstoß auslöste, die man empfindet, wenn man hingefallen ist und sich alle rettend um einen drängen. Sie sagte sanft: »Weine doch nicht so, Louis, du bist jetzt ein großer Junge. Was würden deine Kameraden denken, wenn sie dich sähen?« Mein Vater tat als außerordentlich nachsichtiger Mann gerne so, als sei es ihm wichtiger, dass sein Kind sich gegenüber seinen Kameraden gut benehme als ihm selbst gegenüber. Im selben Augenblick beschlich mich ein seltsames Gefühl, das ich erwähnen muss, damit man meinen Charakter besser verstehe. Als ich jene Worte hörte, erstarrte mit einem Schlage das Blut in meinen Adern. Denn merkwürdigerweise fragte ich mich in meiner Kinderseele immerfort, wie man erraten konnte, was ich machte. Ich lag unter den Laken versteckt, und doch wusste mein Vater, dass ich weinte. Das erschütterte mich, ähnlich, wie wenn ich jeweils über einen Umweg heimging und mein Vater zu mir sagte: »Weißt du, Louis, ich sehe es gar nicht gern, dass du durch diese Straße nach Hause kommst«, wobei er nicht im Geringsten eine Entdeckung zu machen schien; er wusste ganz einfach, dass es gewisse Geschäfte gab, die die Kinder zu diesem Weg verlockten. Ich aber war wie vor den Kopf geschlagen, dass er es erraten hatte. Und immer wieder gab es solche hellsichtigen Bemerkungen, die mich in Staunen versetzten. Indem mein Vater an jenem Abend sagte: »Weine nicht …«, obwohl mein Gesicht für ihn unsichtbar war, hatte er einmal mehr nach diesem Muster gehandelt. Das war es, was ich nicht ertrug. Mit geröteten, im Licht flatternden Augenlidern und mit noch feuchten Wangen setzte ich mich im Bett auf und sagte in einem Zug: »Ich weine gar nicht … ich weine gar nicht …« – »Aber weinen ist doch nicht schlimm«, antwortete mein Vater. »Weine ruhig. Ich mache dir keinen Vorwurf daraus.«
Heute ist all das vorbei. Aber ich bin noch immer kein Mann wie die andern Männer, obschon ich bei gegebenen Ereignissen gleich handle wie sie. Ich fürchte nicht mehr, meine Freiheit zu verlieren. Und doch passierte es mir noch vor einigen Jahren, bevor ich verheiratet war, dass ich einer Frau, die ich kaum kannte, einen Heiratsantrag machte, genau wie ein junger Mann. Trotz meines Alters besitze ich keinerlei Vorsicht und keinerlei Erfahrung. Ich weiß genau, dass ich einen Entwicklungsrückstand habe und ein wenig einem Kind gleiche und dass ich die schlimmsten Übel wohl auf meine alten Tage ansammle. Ist es mein Fehler? Muss ich die Verantwortung dafür jemandem zuschieben? Meinem armen Vater etwa, der alles daransetzte, aus mir einen für den Lebenskampf gerüsteten Mann zu machen, und der darin sogar so weit ging, mich eine Stunde pro Tag bei einem Schreiner arbeiten zu lassen, während ich meinen Universitätsabschluss vorbereitete?
Dieses Bedürfnis zu besitzen, was andere besitzen, und sie nachzuahmen, diese Überzeugung, nur weil jemand etwas macht, täten es alle außer mir, all das gehört eindeutig zum Verhalten eines jungen Mannes. Die Festtage zum Beispiel sind für mich eine Qual. Alles lockt mich, und mir scheint, als entgehe mir alles, da ich doch nur eine einzige Sache tun kann. Es kommt mir nicht in den Sinn, dass all jene, die ich betrachte und beneide, in der genau gleichen Lage sind wie ich und auch sie nur eine Sache auf einmal tun. Alle zusammen lassen mich glauben, sie machen alles. Sie machen auch alles, das stimmt, aber sie müssen Tausende sein, um es zu tun. Und ich betrachte sie immer noch alle gemeinsam, statt einen Einzigen unablässig mit dem Blick zu verfolgen, ihn aufmerksam zu beobachten, um herauszufinden, wie sehr er mir ähnlich ist.
Doch kommen wir zu meinem früheren Leben zurück. Wenn ich die heutigen jungen Leute sehe, bin ich erstaunt über ihre Frühreife. Vielleicht kommt es daher, dass ich sie wiederum alle zusammen sehe, statt sie einzeln zu betrachten. Ich bin verblüfft über ihre Lebhaftigkeit, über die Kraft, die von ihnen ausgeht und vor allem über die Ordnung, die schon in ihnen steckt. Wenn ich bedenke, was ich mit achtzehn, mit zwanzig und sogar mit fünfundzwanzig Jahren war, erröte ich gelegentlich vor Scham. Ich frage manchmal einen Mann meines Alters, ob er sich an seine Kindheit erinnere, an seine Jugend, und wenn einer die Hände gegen den Himmel ausstreckt, wie um zu sagen, wie dumm er doch damals gewesen sei, empfinde ich tiefe Erleichterung. Aber wie viele trauern ihren einstigen Qualitäten nach! Ja, wenn ich mir vorstelle, wie ich als junger Mann war, frage ich mich, wie es überhaupt möglich ist, dass ich heute einigen Verstand besitze, und durch welches Wunder mir eine Katastrophe erspart geblieben ist. Mit zwanzig wusste ich nichts vom Leben, und ich versuchte auch gar nicht, etwas von ihm zu verstehen. Das geringste Ereignis bewegte mich. Das Böse existierte in meinen Augen nicht. Ich lebte auf dieser Welt, als sei ich unvergänglich, als würde der Tod nie kommen. Mich gegen die anderen zu verteidigen schien mir unter meiner Würde. Ich habe diese Einstellung sehr lange beibehalten. Kämpfen, feilschen, nicht glauben, was irgendjemand mir erzählt, all das erschien mir lange Zeit unmöglich. Ich war völlig unbedarft und dafür geschaffen, allen zu vertrauen. Ich dachte weder daran zu lieben noch geliebt zu werden. So war es um mich bestellt, als ich ins Alter kam, in dem die meisten jungen Männer ihre erste Geliebte haben. Dann wurde ich allmählich härter. Wenn ich davon träumte, zu heiraten und ein Heim zu gründen, geschah es eher aus dem Bedürfnis, es meinem Vater gleichzutun, Familienoberhaupt zu werden wie er, als aus einer echten Neigung heraus. Der Familiengedanke war in mir so stark verwurzelt, dass ich jahrelang nicht glauben konnte, dieses Ziel könnte sich verwirklichen lassen. In meinen Gedankengebäuden gab es nie alles, was es in meiner Jugend gegeben hatte. Ich versuchte zum Beispiel, die Freunde, die ich haben würde, mit denen zu vergleichen, die meine Eltern gehabt hatten. Von den meinen ging etwas weniger Beständiges aus. Alles, was ich besaß, schien blasser als das, was meinen Eltern gehört hatte. Und dieses Unvermögen, an die Ereignisse der Gegenwart zu glauben, diese Gewissheit, die Vergangenheit sei viel besser und wichtiger, diese Unfähigkeit zu begreifen, dass Monsieur Guizot zum Beispiel, der Freund meines Vaters, diesem nicht mehr bedeutet hatte, als mein teurer Kamerad Etienne einmal mir und meiner Frau bedeuten würde – gehört das alles nicht ebenfalls zum Verhalten eines jungen Mannes?
13. Oktober
Da Madeleine nach dem Abendessen über Migräne klagte, bat ich sie um die Erlaubnis, André Mercier und seine Frau zu besuchen. »Geh, wohin dir beliebt, mein armer Junge«, gab sie zur Antwort. Wenn ich meine Frau am Abend auf diese Weise verlasse, weiß ich, dass ich ihr keinerlei Kummer bereite. Um trotzdem ihre Eifersucht zu erregen, gehe ich so weit, Freude über den Ausgang vorzuspielen und ihr damit wenigstens einen Schrei zu entlocken, irgendetwas, das mir zeigen würde, dass ich ihr nicht völlig gleichgültig bin. Doch das hat dazu geführt, dass sie mit der Zeit zu der Überzeugung gelangt ist, ich hege für sie keine tieferen Gefühle, und weit davon entfernt, sich gegen mich aufzulehnen, scheint sie sich damit abzufinden; das ist es, was mich ärgert und mich dazu bringt, meine Haltung noch zu übertreiben. Doch lassen wir meine Sorgen beiseite. Monsieur Mercier ist ein ehrenwerter Geschäftsmann, zu dem ich eine freundschaftliche Beziehung unterhalte, obschon ich eher ungesellig bin. Ich habe nur sehr wenige Freunde, und ich tue bestimmt nicht gut daran, das zu erwähnen und mich noch damit zu brüsten. Mercier und ich spielen ein amüsantes Spiel. Während wir uns gegenseitig mit Aufmerksamkeiten überschütten, gestehen wir uns bei jeder Begegnung, in niemanden Vertrauen zu haben, ohne dass je einer von uns den andern zu fragen wagte, ob unsere Freundschaft eine Ausnahme bilde.
Ich war gerade erst vor einigen Minuten bei den Merciers eingetroffen, als man Maud Bringer hereinführte. Diese junge Frau war vor etwa zehn Jahren ein ganz und gar entzückendes Geschöpf gewesen. Stellen Sie sich ein schönes junges Mädchen voll Frische, Einfallsreichtum und Charme vor, die durch das Leben schritt, ohne der Aufmerksamkeit gewahr zu werden, die sie auf sich zog. Sie konnte mit noch so vielen Huldigungen und Schmeicheleien überhäuft werden, sie maß ihnen nicht die geringste Bedeutung bei. Sie war allem, was von außen kam, unzugänglich und ausschließlich damit beschäftigt, ihre Anmut auszustrahlen. Wir liebten uns damals sehr, und wenn ich ihr Kummer bereitete, kam ihr nicht einmal der Gedanke, mir deswegen zu grollen, noch dachte sie daran, all den jungen Männern, die sie umringten, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und es war rührend, dieses junge Mädchen zu sehen, das mich mit einer einzigen Geste zum unglücklichsten Mann hätte machen können: Sie kannte ihre Macht nicht und litt einzig meinetwegen. Dabei war meine Eifersucht teuflisch gewesen. Sie zeigte sich in den kleinsten Einzelheiten, und obgleich ich mir ihrer bewusst war, unternahm ich nichts, um sie zu bekämpfen. Ich machte Maud alles zum Vorwurf: dass sie mit ihrem Vater sprach, mit ihrem Bruder ausging, einen männlichen Vornamen aussprach, wusste, dass mein Cousin sich mit einem Kameraden überworfen hatte oder immer im Spiel gewann, dass sie bestimmte Dichter oder Maler verehrte. Ich ließ nicht locker. Es genügte, dass sie etwas liebte – Blumen, eine Stadt –, damit ich diese verabscheute und noch Wochen später dauernd über sie herzog, wobei ich sehnlichst darauf wartete, dass Maud nachgebe und aufhöre, jene Blumen oder jene Stadt zu lieben. Doch sie duldete meine Eifersucht als einen Liebesbeweis. Und ich zitterte beim Gedanken, sie könnte erfahren, dass ich mit Frauen, die mir gleichgültig waren, genauso tyrannisch verfahren war. Sie ertrug meine ausgefallensten Wünsche und Ansinnen mit einer außerordentlichen Geduld, und wenn ich mich nach einem Wutausbruch an die Worte erinnerte, mit denen sie mich zu beruhigen versucht hatte, staunte ich ob so viel Nachsicht und Besonnenheit.
Diese Momente der Ruhe waren jeweils von kurzer Dauer. Beim kleinsten Anlass fing ich von neuem an. Allmählich nahmen meine Forderungen solche Ausmaße an, dass ich mich heute frage, wie Maud darauf eingehen konnte. Eines Tages flehte ich sie an, ihren Vater nicht mehr zu küssen. Ich weiß nicht mehr, welche Komödie ich ihr vorspielte, um ihr begreiflich zu machen, wie unerträglich mir der Gedanke sei, dass ein Mann seine Lippen auf ihre Wangen drücke, und sei es auch ihr Vater. »Aber das ist unmöglich!«, antwortete sie. Ich war mir durchaus bewusst, dass es unmöglich war, doch das hinderte mich nicht daran, auf meinem Ansinnen zu bestehen, und ich ging sogar so weit zu schwören, ich werde sie nie wiedersehen, wenn sie mir nicht gehorche. Ich erpresste sie dauernd. Wenn sie sich nicht fügen wollte, drohte ich ihr wegen jeder Lappalie, wegzugehen in irgendein fernes Land. Sie erbleichte. Ich spürte, dass sie in ein schreckliches Dilemma geriet. Und doch hielten mich jene Bosheit und Härte in mir, die ich noch immer nicht vollkommen zu verbannen vermocht habe, davon ab, sie zu beruhigen. Grausam beharrte ich auf meinem Standpunkt. Sie begann zu weinen. Erst wenn sie sich von sich aus beruhigt hatte, flehte ich sie an, mir zu verzeihen. Doch schon am nächsten Tag konnte ich nicht anders und begann mit derselben Szene von vorn. Nach einer köstlichen Stunde in ihrer Gesellschaft erinnerte ich mich unvermittelt an ihre Weigerung, ihren Vater zu bitten, sie nicht mehr zu küssen. Eine unbestimmte Wut stieg in mir auf; wieder bedrängte ich sie erbarmungslos, bis sie weinte.
Einige Monate bevor ich Maud Bringer kennenlernte, hatte ich mit einer ihrer Freundinnen geflirtet, Simone Charavel, der Schwester eines Kameraden, die im Gegensatz zu Maud kokett und herausfordernd war. Mit sechzehn erfand sie Geschichten, um sich nach den Unterrichtsstunden mit Jungen treffen zu können. Obgleich die Gefühle, die sie in mir weckte, bei weitem nicht so tief waren wie jene, die ich dann für Maud hegte, quälte ich sie auf die gleiche Art. Ich liebte sie weniger, und doch litt ich mehr. Sie machte sich über meine Forderungen lustig. Eines Tages sagte ich zu ihr: »Sie werden sehen, Simone, dass ich der Stärkere sein werde und dass der Tag kommen wird, an dem ich Ihnen sogar verbieten werde, Ihren Vater zu küssen.« Sie brach in Gelächter aus. So wenig Einfluss auf sie zu haben bewirkte, dass ich mich von ihr löste. Damals lernte ich Maud kennen.
Nach einer ungewöhnlich heftigen Auseinandersetzung erschien Maud am nächsten Tag nicht zum Rendezvous. Meine Kühnheit verflog mit einem Schlag. Ich hatte Angst, sie zu verlieren, zu weit gegangen zu sein. Ich rief sie unter einem fadenscheinigen Vorwand an. Ihre Mutter kam ans Telefon, doch sie war schroff. Einen ganzen Tag lang postierte ich mich vor ihrem Haus. Sie kam nicht heraus. Ich war in panischer Aufregung, hatte nur noch einen Wunsch: sie zu sehen. Ich rief wieder an. Diesmal antwortete ihr Bruder. Er erklärte mir freundlich, Maud fühle sich nicht sehr wohl, und sie werde nicht vor drei, vier Tagen aus dem Haus gehen. Das beruhigte mich, und ich eilte heim in der Hoffnung, einige Zeilen von ihr vorzufinden. Doch da war nichts. Ich verbrachte jene Tage angsterfüllt. Obwohl es mir peinlich war, einer Familie gegenüberzutreten, über die ich so viel Schlechtes gesagt hatte, konnte ich mich nicht länger zurückhalten und ging zu ihr nach Hause. Nachdem sie mich lange hatte warten lassen, erschien sie schließlich. Ihr Gesicht war verändert, abgezehrt. Sie schaute mich traurig an und sagte dann, als ich schwieg: »Wir werden uns später wiedersehen, wenn wir beide frei sind. Es ist viel besser so, sowohl für Sie, Louis, als auch für mich.« Ich war erschüttert. Ich bat sie leise um Verzeihung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, um sie wiederzugewinnen. Doch so geduldig sie vorher gewesen war, so entschlossen war sie jetzt geworden. Ich habe sie nicht mehr wiedergesehen. Alles, was ich über sie erfahren habe, ist, dass sie geheiratet hatte.
Als ich ihr bei den Merciers plötzlich gegenüberstand, war ich zutiefst bewegt. Sie unterschied sich nicht von dem jungen Mädchen, das ich gekannt hatte. Bei meinem Anblick ließ sie sich nicht die geringste Verwirrung anmerken. Doch als ich mich einen Moment lang etwas abseitshielt, trat sie zu mir. Nachdem wir einige belanglose Worte gewechselt hatten, fragte sie mich, ob ich mich an unsere einstige Freundschaft erinnere. Dann fügte sie mit leicht zitternder Stimme hinzu: »Glauben Sie nicht, dass ich Ihnen noch böse bin, Louis. Ich mache im Gegenteil mir selbst Vorwürfe; ich war ungerecht zu Ihnen.« Bei diesen Worten überkam mich ein bitteres Gefühl. Sie sprach bewegt, als sei sie noch ganz von der Vergangenheit erfüllt, während ich überrascht feststellte, dass ihre Stimme nicht das geringste Bedauern in mir hervorrief. Sie wandte sich an den jungen Mann, der ich einst gewesen war, als ob nicht Jahre dazwischen gelegen wären. Mir schien, als hätte sie diese Worte ebenso gut eine Woche nach ihrem großen Entschluss aussprechen können. Sie hatte alles unversehrt in sich bewahrt. Die Heirat hatte nichts ausgelöscht. Und vielleicht noch trauriger war, dass sie nun glaubte, ungerecht gewesen zu sein, und beim Gedanken, dass ich ihretwegen gelitten hatte, Gewissensbisse empfand, während ich, der wahre Schuldige, alles vergessen hatte.
16. Oktober
Wir haben heute Abend im Restaurant gegessen. Wenn Madeleine vor einigen Jahren an einem Ort war, wo man sie bediente, hatte sie jeweils die fixe Angewohnheit, dem Servicepersonal zu helfen. Als aber einmal ein perfekter Kellner ihre Hilfe zurückwies, war sie so beschämt und errötete dabei so sehr, dass sie sich seither dem Dienstpersonal gegenüber völlig distanziert verhält. Seit jener Lehre scheint es für sie sogar ein Ausdruck distinguierten Benehmens zu sein, einem Bedienten nie zur Hand zu gehen, ja ihn sogar in seiner Arbeit zu behindern. Ich könnte übrigens tausend ähnliche Kleinigkeiten anführen, die alle von ihrer Erziehung herrühren. Madeleine verteilte zum Beispiel mit Vorliebe übertrieben hohe Trinkgelder und gab sie vornehmlich jenen, die nicht gewohnt waren, ein Trinkgeld zu erhalten, und bei denen ich immer befürchtete, sie könnten es zurückweisen. Weiter fand sie Gefallen daran, die Leute bei ihrer Berufsbezeichnung zu nennen. Als wir nach Nizza fuhren, sagte sie: »Schaffner, belegen Sie uns zwei Plätze.« Möglich, dass ein Schaffner sich dadurch nicht beleidigt fühlt, mich aber stört es ungeheuer. An geschlossenen Orten hatte sie glücklicherweise einige Hemmungen. Doch auf der Straße kam es nicht selten vor, dass sie auf einen Schutzmann zuging und zu ihm sagte: »Können Sie mir erklären, Schutzmann, wo die Straße X ist?« Das erinnert mich an unseren Aufenthalt in Nizza. In jedem »Luftkurort« gibt es eine Fassade und eine Rückseite, nur ist diese dort viel sichtbarer als in einer großen Stadt. Hinter der Hotelfront zum Meer hin gibt es immer eine Rue des Belges, eine Rue des Serbes. In dieser Kulisse richten sich die bescheidenen Wintergäste ein. Ich hätte ein gutes Hotel im Stadtzentrum vorgezogen, doch Madeleine beharrte darauf, wir sollten eine jener Pensionen wählen. Als sie mich geheiratet hatte, war ihr nicht der Gedanke gekommen, ihr Leben könnte sich verändern, und sie wollte, dass wir in Nizza zu zweit genau gleich lebten, wie sie es allein hätte tun müssen. Madeleine mochte gerade jene Orte, wo man aufgrund der Zwanglosigkeit, die sie an den Tag legte, erraten konnte, dass sie der Wunsch dorthin geführt hatte, sich wie in einer Familie zu fühlen, dass sie zwar eine Dame von Welt war, sie aber die Ruhe dieses abgeschiedenen Winkels den lauten Erstklasshotels vorzog. Die Gewohnheiten der Pensionäre schienen sie zu ergötzen. Bei jeder Gepflogenheit, die von den ihr vertrauten abwich, stieß sie Rufe des Erstaunens aus, als bestehe in ihrer Vorstellung der einzige Unterschied zwischen einer Pension und einem Erstklasshotel nicht so sehr im Luxus und im perfekten Service als vielmehr in der Ruhe, als seien die neuen Gewohnheiten nicht schlechter als die ihren, nur anders. Und doch konnte man erkennen, dass sie diese für schlechter hielt, und sei es nur an ihrem Erstaunen. Liebenswürdig beugte sie sich strengen Vorschriften, wobei sie sich kaum anmerken ließ, dass sie wusste, anderswo war es nicht so. Die Pensionäre ihrerseits schienen sich von ihrem Verhalten täuschen zu lassen. Sie kamen schließlich zu der Überzeugung, wir seien klug und zögen, abgesehen von allen Preisbetrachtungen, die Mittags- und Abendmahlzeiten bei Mademoiselle Davis jenen in einem Erstklasshotel vor. Mademoiselle Davis förderte diesen Glauben übrigens noch und versäumte es nie zu erzählen, wie im letzten Winter ein gewisser Prinz das Hôtel des Anglais angewidert verlassen habe, um in ihre Pension zu ziehen. Wenn man sie so hörte, hätte man meinen können, all ihre Gäste hätten es anderswo weniger gut gehabt und hätten, nach so manchem Verdruss, endlich zu ihr gefunden.
Ich weiß nicht, warum ich gerade jetzt daran denke, dass mir Madeleine damals sagte, falls wir eines Tages ein Kind haben sollten, müssten wir ihm Möbel, eine Badewanne und ein Fahrrad kaufen, die auf seine Größe zugeschnitten wären. Der Gedanke, dass Kinder eine Welt nach ihren Proportionen hätten, entzückte sie. Unnötig zu sagen, dass ich das lächerlich finde. Ich denke auch an unsere Spaziergänge am Meer. Madeleine, die keinerlei Urteilsfähigkeit besitzt und sich dem besten Menschen der Welt gegenüber wähnt, während dieser in Wirklichkeit ein Taugenichts ist, glaubte plötzlich den erstaunlichsten Spürsinn bei sich zu entdecken, wenn es darum ging, das lasterhafte Benehmen eines Badenden aufzudecken, der sich selbstgefällig am Strand auszieht. »Man muss die Männer beobachten«, sagte sie, »wenn sie im Badeanzug herumlaufen, sich zehnmal die Beine abtrocknen, sich an ihren Kleidern zu schaffen machen, ohne sie anzuziehen, und man muss sehen, mit welchem Bedauern sie sich schließlich dazu durchringen, sich anzukleiden.« Denn es genügte, dass sich durch Zufall eine unschickliche Szene unter ihren Augen abspielte, und schon war sie überzeugt, die Akteure hätten es absichtlich getan. Wenn sie sich zum Beispiel in der Tür geirrt hätte und in ein Zimmer getreten wäre, in dem sich ein Mann befand, hätte sich in ihrem Kopf umgehend die Idee festgesetzt, der Mann habe die Tür absichtlich schlecht geschlossen in der Hoffnung, jemand werde sie öffnen. Ich erinnere mich noch, wie ich Madeleine in sprachloses Erstaunen versetzte, als ich ihr eine Badende gezeigt hatte. »Siehst du«, hatte ich gesagt, nachdem ich sie aufgefordert hatte, herauszufinden, was die Unbekannte an Unharmonischem und an Schönem besaß, »siehst du, sie hat spitze Ellbogen, was sehr hässlich ist. Aber schau nur, wie hübsch ihre Füße sind. Die zweite Zehe ist länger als die große, wie bei den griechischen Statuen.« Und Madeleines Verblüffung hielt lange Zeit an, denn in ihrer Vorstellung mussten die Zehen, um hübsch zu sein, von der großen zur kleinen hin regelmäßig kleiner werden.
18. Oktober
Gestern Abend beging ich den Fehler, Madeleine zu Désiré Durand zu führen, einem Freund, oder eher einem Bekannten, dem man keine Einladung abschlägt, da es nur zu offensichtlich ist, dass einzig deswegen an einen gedacht wurde, um die Zahl der Gäste zu vergrößern. Ein Besuch bei diesem Geschäftsmann kommt dem Besuch eines unterhaltsamen Spektakels gleich.