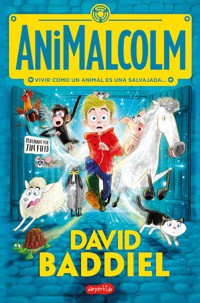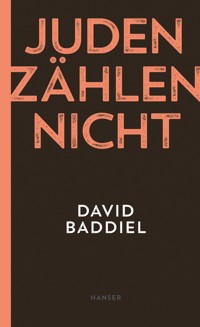
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Wer gegen Rassismus und gegen Antisemitismus ist, wer keine blinden Flecken mag, aber dafür gute Sachbücher, sollte dieses Buch lesen“. So schrieb 2021 Nele Pollatschek nach dem Erscheinen dieses Buches unter anderem Titel. „Jews don’t count“ – „Juden zählen nicht“ ist nach dem 7. Oktober auch in Deutschland zum geflügelten Wort geworden – und eine bittere Wahrheit von Nahost- bis zu Aiwanger-Debatten. Hanser veröffentlicht das bedeutende Buch darum neu mit dem übersetzten Original-Titel und einem aktuellen Vorwort David Baddiels. Dieses Buch richtet sich an alle Menschen mit gutem Gewissen. Natürlich sind sie gegen Homophobie, Rassismus und andere Arten der Diskriminierung. Sicher sind sie auch gegen Antisemitismus in jeder Form. Aber zählen Juden wirklich genauso in den Debatten der Gegenwart? David Baddiel ist in Großbritannien berühmt als politischer Kommentator und Comedian. Als prominente jüdische Stimme stellt er bohrende Fragen: Gelten Juden wirklich als handfest bedroht, genau wie andere Minderheiten? Und falls nicht – warum?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Wer gegen Rassismus und gegen Antisemitismus ist, wer keine blinden Flecken mag, aber dafür gute Sachbücher, sollte dieses Buch lesen«.So schrieb 2021 Nele Pollatschek nach dem Erscheinen dieses Buches unter anderem Titel. »Jews don’t count« — »Juden zählen nicht« ist nach dem 7. Oktober auch in Deutschland zum geflügelten Wort geworden — und eine bittere Wahrheit von Nahost- bis zu Aiwanger-Debatten. Hanser veröffentlicht das bedeutende Buch darum neu mit dem übersetzten Original-Titel und einem aktuellen Vorwort David Baddiels.Dieses Buch richtet sich an alle Menschen mit gutem Gewissen. Natürlich sind sie gegen Homophobie, Rassismus und andere Arten der Diskriminierung. Sicher sind sie auch gegen Antisemitismus in jeder Form. Aber zählen Juden wirklich genauso in den Debatten der Gegenwart?David Baddiel ist in Großbritannien berühmt als politischer Kommentator und Comedian. Als prominente jüdische Stimme stellt er bohrende Fragen: Gelten Juden wirklich als handfest bedroht, genau wie andere Minderheiten? Und falls nicht — warum?
David Baddiel
JUDEN ZÄHLEN NICHT
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
Hanser
Für meine Mutter Sarah Fabian-Baddiel, die stets dafür gesorgt hat, dass sie zählt.
Vorwort zur neuen deutschsprachigen Ausgabe
Stellen wir uns einmal eine Welt vor, in der Bücher nicht nur im Internet erworben, sondern in Buchhandlungen von kaufinteressierten Menschen durchgeblättert werden. Sollten Sie zu diesen Menschen gehören, denken Sie jetzt womöglich: Moment mal … gab es da nicht ein anderes Buch von diesem britischen Schriftsteller … zum selben Thema … aber mit einem anderen Titel? Um mit offenen Karten zu spielen und nicht gegen irgendwelche deutschen Gesetze zu verstoßen, indem wir diesen Band als neues Material auszugeben versuchen: Dies ist dasselbe Buch. Als mein Buch in englischer Sprache erschien, trug es den Titel Jews Don’t Count. Doch dann bekam ich eine E-Mail meines deutschen Verlags Hanser, in der stand, man könne das Buch nicht Juden zählen nicht nennen. Der Verlag schrieb, man könne »in Anbetracht unserer Geschichte diese Worte nicht in großen Lettern auf ein deutsches Buch drucken«.
Das ist keine linguistische Frage. Auch auf Englisch könnte der Titel als anstößig begriffen werden. Aber letztlich war ich — und war auch mein englischer Verlag — zuversichtlich, dass die Leserinnen und Leser (und selbst Menschen, die in der U-Bahn Seitenblicke auf die Lektüre anderer werfen) verstehen würden, dass der Titel ironisch gemeint war; dass er eine Einstellung zum Ausdruck brachte, die das Buch hinterfragt und seziert, nicht empfiehlt. Jews Don’t Count ist eine Enthüllung, keine Handlungsanweisung.
Warum also sollte sich dieses Verständnis nicht auf den deutschen Titel übertragen? Ist es eine Frage der Einstellung? Womöglich — und mir ist bewusst, dass ich hier selbst in den Bereich eines britischen Stereotyps vordringe — haben es die Deutschen nicht so mit der Ironie. Oder, und das ist wahrscheinlicher, man kann in Deutschland nicht Ironie voraussetzen, wenn es um Antisemitismus geht. Vielleicht kann man in Deutschland gar nichts voraussetzen, wenn es um Antisemitismus geht. Hanser schrieb mir auch:
Meldet sich ein Jude in einer Debatte zu Wort und bringt seine Meinung zum Ausdruck, verfallen die Menschen wie in einem Theater in Schweigen; es gibt nichts Schlimmeres, als Antisemit genannt zu werden.
In Deutschland will niemand als Antisemit gelten, und wenn man bei diesem Buch nicht von Ironie ausgehen kann, zumal in der Übersetzung, dann ist der Titel Juden zählen nicht zu riskant. Daher erschien es im Herbst 2021 unter dem Titel Und die Juden?, was in meinen englischen Ohren eher noch verstörender als Jews Don’t Count klang, stellte ich mir doch immer vor, die Frage (»Und … die Juden?«) käme aus dem Mund eines höhnisch grinsenden Nazi-Kommandanten, ehe sich die Leinwand verdunkelte.
Ich war mir stets unsicher, was die Vorstellung einer — um die Sache beim Namen zu nennen — von Schuld getriebenen Rücksichtnahme auf jüdische Befindlichkeiten angeht. Wenn in Deutschland alle dem Antisemitismus gegenüber — gestatten Sie mir an dieser Stelle etwas Jiddisch — on shpilkes sind, wenn alle Deutschen ständig Sorge tragen, die Juden nicht aufzuregen, dann braucht es vielleicht gar kein Buch darüber, dass Juden nicht zählen.
Das Problem daran ist, dass das der aktiven Einbeziehung jüdischer Identitäten in die Debatte um Diskriminierung und Rassismus wohl nicht förderlich ist. Natürlich ist das Lebendighalten der Erinnerung an Gräueltaten nötig und gut, aber es kann — vor allem, wenn all die Menschen, derer gedacht wird, sowie die meisten ihrer möglichen Nachkommen nicht anwesend sind — leicht in Erstarrung und Ritualisierung kippen.
In diesem Buch stelle ich der progressiven Linken die Frage: Warum habt ihr die Juden vergessen? In Deutschland können die Juden offenbar nicht vergessen werden, aber es ist möglich, dass die deutsche Art der Erinnerung selbst eine Abwesenheit herstellt. Wie in einem Theater in Schweigen verfallen: Das hat etwas Gestelztes und Förmliches, etwas Unbewegliches. Schweigen, zumal eines, das von übermäßigem Respekt hervorgerufen wird, ist nichts Verbindliches. Das Schweigen im Rahmen von Gedenkveranstaltungen dauert im Normalfall eine Minute, und dann geht das Leben weiter.
Jetzt aber erscheint die Buchübersetzung neu, mit dem ursprünglichen Titel. Warum? Nun, zuerst einmal war Hanser im Irrtum — aber in aufschlussreicher Weise. Es war ein Fehler, das Buch nicht Juden zählen nicht zu nennen, denn ehrlich gesagt ist das für dieses Buch der beste Titel. Aber die Titeländerung war aufschlussreich, weil sie die Behutsamkeit verdeutlicht, die in Deutschland bis zu jenem Zeitpunkt sämtliche Äußerungen begleitete, die als antisemitisch wahrgenommen werden könnten.
Bis zu jenem Zeitpunkt. Wenn Sie weiterlesen, werden Sie feststellen, dass es in diesem Buch nicht darum geht, jüdische Identität oder auch Antisemitismus auf Grundlage des Konflikts zwischen Israel und Palästina zu definieren. Ich vertrete auf diesen Seiten vielmehr die Position, dass der gegenwärtige Reflex, dies zu tun, nicht nur reduktiv — der Antisemitismus ist eine jahrhundertealte Art der Voreingenommenheit, die bis weit vor die Gründung des Staates Israel zurückreicht —, sondern in seiner stärksten Ausprägung auch rassistisch ist. Tatsächlich findet sich im Buch gar nicht viel zum Nahen Osten, woraus bereits meine Weigerung spricht, zu akzeptieren, dass dieser Konflikt das Gespräch über Juden zu bestimmen hat.
Aber in den Sozialen Medien gibt es einen Spruch: Life comes at you fast, es kann ganz schnell bergab gehen. Und seit dem 7. Oktober ging es für die Juden rasant bergab. In Deutschland scheint das Kraftfeld des Respekts, das sie umgab, genauso zersplittert zu sein wie sonst überall. Der Angriff der Hamas wurde augenblicklich auf den Straßen gefeiert. Am Tag darauf teilte ein Berliner Kurator auf Instagram ein Meme, das vor den Terroristen fliehende Festivalbesucher zeigte, begleitet von den Worten »Poetic Justice«. In den nächsten Tagen wurden etwa Wohnhäuser mit Hakenkreuzen oder Davidsternen markiert, und seitdem haben sich solche und ähnliche Ereignisse vielfach wiederholt.
Ich hatte also womöglich recht damit, dass der deutsche Respekt, den Hanser mir vor zwei Jahren schilderte, nicht so real war, wie er schien: dass sich im Angesicht einer wahren Bedrohung, eines Ausbruchs antijüdischer Regungen, der Schutzschild der lebendig gehaltenen Erinnerung als dünn wie Papier erweisen würde. Es ist einfach interessant, dass eine nach dem 7. Oktober in Universitäten wie auf Demonstrationen zu hörende Parole lautete: »Free Palestine from German Guilt«, »Befreit Palästina von der deutschen Schuld«.
Von der deutschen Schuld: derselben Schuld, mit der man mir gegenüber nur kurze Zeit vorher begründet hatte, dass der Titel Jews Don’t Count zu provokativ sei. Denken Sie bitte über etwas nach: Denken Sie darüber nach, ob deutsche Juden, wenn sie all das sehen und hören, wohl das Gefühl haben, zu zählen. Der Standpunkt, der deutschen Juden eine Zeit lang Halt bot — dass es in Deutschland »nichts Schlimmeres« gebe, »als Antisemit genannt zu werden« —, könnte womöglich in Schieflage geraten sein. Vielleicht hören sie ein anderes Schweigen als das, das mir Hanser erläuterte, das Schweigen, in das Deutsche verfallen — oder eben verfielen —, wenn sich ein Jude zu Wort meldete. Es ist vielmehr das ohrenbetäubende Ausbleiben des üblichen mitleidigen Aufschreis, der in den Sozialen Medien und überall sonst losbricht, wenn die meisten anderen Minderheiten angegriffen werden.
Tatsächlich stimme ich mit jenen überein, die sagen, Deutschland dürfe nicht vor Schuld erstarren. Deutsche sollten sich zu allen Themen äußern können, zum gesamten Lauf der Welt, ohne von der Geschichte mundtot gemacht zu werden. Aber das heißt nicht, dass die Geschichte nicht zählt. Für die Juden ist sie stets präsent. Man kann durchaus argumentieren, dass Deutsche frei von Schuld sein sollten. Aber nicht, dass sie frei von Erinnerung sein sollten. Oder auch von Mitgefühl, von dem Gefühl, das Juden haben, wenn ein Pogrom im besten Fall nicht verurteilt und im schlimmsten Fall bejubelt wird.
Sie könnten sagen, ich wisse nicht, wovon ich rede. Ich sei kein Deutscher. Das Problem ist, ich bin es doch. Meine Mutter wurde 1939 in Deutschland geboren. Sie kam nur um Haaresbreite davon. Diese Geschichte wird in diesem Buch nur am Rande erzählt, aber sie steckt überall in ihm, auf jeder Seite. Dieses Buch muss Juden zählen nicht heißen, denn zu manchen Zeiten tun sie es wirklich nicht, und diese Zeiten sind nicht auf die Vergangenheit beschränkt.
David Baddiel, 2023
Ich werde Ihnen einige Beispiele für ein wiederkehrendes Phänomen nennen.
Dieses Buch hier ist ursprünglich im Verlag des Times Literary Supplement erschienen, also beginnen wir doch mit einem literarischen Beispiel. Im August 2020 veröffentlichte die britische Zeitung The Observer, neben ihrer Schwesterzeitung The Guardian das progressivste Mainstream-Nachrichtenorgan des Landes, eine Rezension von Ameisig, dem ersten Roman des Drehbuchautors Charlie Kaufman, aus der Feder einer Kritikerin namens Holly Williams. In ihrer nicht sehr positiven Besprechung kritisierte sie das Buch vor allem dafür, dass der Autor aus einer von Williams so genannten »Weiß-männlich-cis-hetero-Perspektive« heraus schreibe. Mit anderen Worten offenkundig weiß, männlich und weniger offenkundig einem Geschlecht zugehörig, das weder trans noch nonbinär ist, und von heterosexueller Orientierung. Jeder, der einen Platz innerhalb dieses Gevierts von Eigenschaften besetzt, wird von jenen, nach deren Ansicht alle gesellschaftlichen Strukturen auf Macht basieren, als privilegiert betrachtet. Weiße männliche cis Heteros starten mit einem vierfachen Vorsprung ins Leben. Ein aus einer Weiß-männlich-cis-hetero-Perspektive geschriebenes Buch wird von einer Zeitung wie dem Observer, die stets darauf aus ist, den kulturellen Diskurs von diesem Geviert wegzuverlagern, routinemäßig hinuntergestuft werden.
Nun heißt der Erzähler von Ameisig allerdings B. Rosenberger Rosenberg. Zu Beginn des Textes schildert er, er habe einen »rabbinischen« Bart, ein »jüdisches Aussehen«; noch verräterischer ist vielleicht die Tatsache, dass er im Buch einmal eine Krawatte mit dem Slogan 100% Koscher trägt. In mehreren Fällen verhalten sich andere Figuren ihm gegenüber antisemitisch, setzen voraus, dass seine Verhaltensweisen mit jüdischen Stereotypen übereinstimmen, flüstern verstohlen »Jude«, wenn er einen Raum verlässt, oder schreien ihm ganz unverhohlen »Fick dich, du Hebräer!« entgegen. Doch in der Rezension des Observer wird weder sein Jüdischsein noch die allgemeine Frage des Jüdischseins im Roman angesprochen, obwohl er — danke, Kindle — siebenundneunzigmal das Wort »Jude« und sechzigmal das Wort »jüdisch« enthält. Und natürlich ist Charlie Kaufman selbst Jude.
Aber für Holly Williams hat offenbar nichts davon irgendwelche Auswirkungen auf B. Rosenberger Rosenbergs Weiß-männlich-cis-hetero-Perspektive; keine Auswirkungen also auf seine privilegierte Position.
Hier ein weiteres Beispiel, diesmal von der dänischen Komikerin Sofie Hagen. In ihrem — sehr guten — Kurzfilm über Body Positivity aus dem Jahr 2019 stellt Hagen eine Liste der »am stärksten unterdrückten Menschen in der Gesellschaft« auf, eine Liste, die umfasst: »Schwarze Menschen und People of Colour, queere und trans Menschen, Muslime und Menschen mit Behinderungen«. Was in der Tat einen guten Versuch darstellt, das Terrain derer abzustecken, die viele Progressive als die am stärksten unterdrückten Gruppen, als die innerhalb unserer Gesellschaft am stärksten verfolgten Minderheiten betrachten würden.
Bloß fehlt eine verfolgte Minderheit, eine der am stärksten verfolgten Minderheiten der Geschichte. Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, die Hauptfigur von Ameisig gehörte irgendeiner der von Hagen erwähnten Minderheiten an. Die zentrale Prämisse der Rezension im Observer — das Problem an Ameisig sei, dass es aus einer Weiß-männlich-cis-hetero-Perspektive verfasst wurde — fiele in sich zusammen, und mit ihr der Großteil der Negativität dieser Rezension. Was bedeutet, dass es trotz der Geschichte ihrer Verfolgung nur eine Minderheit gibt, die in den Augen der Privilegienkritiker auf Seiten des Gevierts der Privilegien stehen bleibt.
Zeit für ein Beispiel aus der Hochliteratur: Am Neujahrstag 2017 übertrug BBC Radio 4 Jeremy Irons’ Lesung nahezu sämtlicher Gedichte von T. S. Eliot. Jeder, der Eliots Gedichte kennt, wird wissen, dass eine Lesung aller seiner Gedichte unvermeidlich auch diese Zeilen aus Gerontion beinhaltet:
Mein Haus ist ein verfallnes Haus,
Und der Jude hockt auf dem Fenstersims, der Eigentümer,
Gelaicht in Antwerpen, in irgendeiner Schwemme,
Lädiert in Brüssel, genesen und geleimt in London.
Und aus Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar:
Die Ratten unterwühln den Bau
Der Jude unterläuft das Gros.
Ich weiß noch, wie ich zuhörte und mich fragte, wie die BBC darum herumkommen würde. Als die besagten Gedichte an der Reihe waren, nahm man die Hilfe von Anthony Julius in Anspruch, einem jüdischen Rechtsanwalt und Verfasser des Buchs T. S. Eliot, Anti-Semitism and Literary Form von 1995, der der Lesung seine These voranstellte, der überall anzutreffende, modische Antisemitismus von Eliots Zeit habe dessen Werk durchdrungen und womöglich sogar bereichert. Grob vereinfacht könnte man sagen, in Julius’ Augen war Eliot ein so großer Dichter, dass es ihm — beinahe im Alleingang, wobei da natürlich noch der Kaufmann von Venedig wäre — gelang, Antisemitismus in Kunst zu verwandeln.
Daraufhin schrieb ich Anthony Julius, weil ich diese Position für falsch halte. Ich bin ein Fan von Eliot, aber ich glaube, dass keine Poesie den Hass aufwiegen kann. Einige Zeit später aßen wir gemeinsam zu Mittag und redeten drei Stunden lang darüber (eine, wenn ich das so sagen darf, sehr jüdische Reaktion auf die ganze Sache).
Bloß dass das nicht das Gefühl vertreiben konnte, das ich am Neujahrstag des Jahres 2017 gehabt hatte: dass die BBC, ganz gleich wie großartig der Schriftsteller und wie großartig seine Texte gewesen wären, keine andere gesellschaftliche Gruppe mit Ratten verglichen oder als irgendein ähnlich negatives rassistisches Stereotyp gezeichnet hätte. Es ist nicht unvorstellbar, dass die BBC am Neujahrstag ein ganzes Buch von Agatha Christie vorlesen ließe. Unvorstellbar ist allerdings, dass irgendjemand jemals hören wird, wie Jeremy Irons sagt: »Und nun: Zehn kleine N***rlein.«
Mitte 2020, im Anschluss daran, dass im Rahmen der Black-Lives-Matter-Proteste reihenweise Statuen umgestürzt wurden, sprühte unterdessen ein Demonstrant weit entfernt von Minneapolis — in Broadstairs, Kent — die Worte »Dickens war Rassist« an die Wand des Dickens Museum. Der Demonstrant hieß Ian Driver, und als Inspiration diente ihm ein Brief, in dem Dickens den antikolonialen Indischen Aufstand von 1857 verächtlich gemacht hatte. Der Brief ist ohne Frage rassistisch. Allerdings ist sonderbar, dass Ian Driver auf ein relativ obskures Schreiben von Dickens zurückgreifen musste, um sich über dessen Rassismus zu erregen, wo es doch in Oliver Twist seit Ewigkeiten den widerwärtig aussehenden jüdischen Hehler Fagin gibt.
Aber der zählt womöglich nicht.
Die zeitgenössischen kulturellen Debatten über die Neubeurteilung großer Autorinnen und Autoren der Vergangenheit im Licht des gegenwärtigen politischen Verständnisses verlaufen jedoch nicht immer negativ. Im Fall von Edith Wharton etwa, die ihre Romane im frühen zwanzigsten Jahrhundert schrieb, drehte sich die Neubeurteilung darum, ihre Position im Kanon zu stärken, verbunden mit der Wahrnehmung, sie sei als Frau bislang vernachlässigt worden. In der zweiten Jahreshälfte 2020 kürte der Online-Lesezirkel des Guardian Whartons Roman Zeit der Unschuld zum Buch des Monats September. In der Times schrieb gleichzeitig Anna Murphy über ihre Liebe zu Das Haus der Freude und vor allem darüber, wie sehr es sie freue, dass Wharton endlich als »Gegenstück« zu Henry James anerkannt werde.
Es trifft gewiss zu, dass Autorinnen mit wenigen namhaften Ausnahmen kulturell nicht in gebührender Weise berücksichtigt wurden, weshalb mich die Neubewertung Edith Whartons dazu brachte, mir Das Haus der Freude zu besorgen. Ich erfreute mich so lange an den Abenteuern der Heldin Lily Bart, bis nach einigen Seiten eine Figur namens Mr. Rosedale — »dieser kleine Jude«, der »ja wohl, soweit sie sich erinnern konnte, bereits ein dutzend Mal der Gesellschaft serviert und von ihr zurückgewiesen worden war« — eingeführt wird. Das Problem ist natürlich nicht, dass Wharton in ihrer Zeit und ihrem Kontext Dinge schrieb, die wir heute als antisemitisch betrachten würden. Das Problem ist, dass dieser Umstand für ihre gegenwärtige Wiederentdeckung aus feministischer Perspektive keinerlei Schwierigkeit darstellt. Dagegen tun das andere Ausformungen von Rassismus, die in ihrer Literatur womöglich zum Ausdruck kommen, für einige durchaus. In einem Essay auf der feministischen Internetseite Jezebel schreibt die Expertin für viktorianische Literatur Rachel Vorona Cote: »Einmal davon abgesehen, was Whartons Figuren — oder in der Tat auch Wharton selbst — über meine jüdische Familie zu sagen gehabt hätten, bin ich durch mein Weißsein mit bequemen Scheuklappen ausgestattet, die die verunglimpfenden Details verdecken. Richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Darstellung von People of Colour im Roman — flüchtig, geringschätzig —, kann ich ihn nicht mehr auf dieselbe unproblematische Weise genießen.«
Es ist gut, dass Vorona Cote Whartons Anschauung kritisch hinterfragt. Müsste ich aber ihre eigene hinterfragen, wäre meine Frage folgende: Warum davon absehen, was Whartons Figuren oder Wharton selbst über Juden zu sagen hatten?
Ein weiteres Beispiel.
Im Jahr 2019 sollte in London das auf Alice Walkers gleichnamigem Roman beruhende Musical Die Farbe Lila aufgeführt werden. Etwa vier Wochen vor der Eröffnung kam heraus, dass Seyi Omooba, die Darstellerin der Hauptfigur Celie, 2014 homophobe Inhalte auf Facebook gepostet hatte. Omooba entstammt einem Umfeld evangelikaler Christen, und ihre Facebook-Mitteilungen waren recht gewöhnliche evangelikale Botschaften von der Sündhaftigkeit gleichgeschlechtlichen Begehrens. Sie verweigerte eine Entschuldigung und wurde gefeuert.
Ich habe nicht vor, mich in diesem Buch mit dem Für und Wider von Cancel Culture auseinanderzusetzen. Aber durchaus von Bedeutung für dieses Buch ist der Umstand, dass Omooba hinsichtlich des Musicals wegen Homophobie gecancelt wurde.
Denn Alice Walker hatte im Jahr 2017 ein Gedicht veröffentlicht, sein Titel: To Study the Talmud. Der Talmud enthält Auslegungen des Alten Testaments, die im vierzehnten Jahrhundert festgeschrieben wurden und die Grundlagen der Regeln und Gesetze des Judentums bilden. Er wurde hauptsächlich von Rabbinern verfasst und ist von Antisemiten, die suggerieren wollten, Juden würden das Blut von Christen trinken und Pädophilie propagieren, ausgiebig falsch wiedergegeben worden.
Alice Walker dichtete Folgendes:
Sollen die Gojim (wir) die Sklaven der Juden sein und nicht nur
Das, sondern auch noch Freude daran haben?
Sind drei Jahre (und einen Tag) alte Mädchen freigegeben für Heirat und Geschlechtsverkehr?
Sind junge Knaben Freiwild für Vergewaltiger?
Müssen selbst die besten Gojim (wieder wir) getötet werden?
Haltet einen Augenblick lang inne und überlegt, was das bedeuten könnte
Oder bereits bedeutet hat
Im Laufe unseres Lebens.
Wie Omooba hat Walker religiöse Überlieferungen instrumentalisiert, um Stereotype und Diskriminierungen gegen eine Minderheitengruppe aufrechtzuerhalten und zu befördern. Omooba sagt: »Im 1. Korinther 6, 9—11, ist klar ersichtlich, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Ich glaube nicht, dass man schwul geboren werden kann, und ich glaube nicht, dass homosexuelle Praktiken richtig sind.« Das ist eine anti-schwule Position. Walker sagt: Juden glauben, dass Pädophilie, Sklaverei und der Mord an Nichtjuden durch ihre Religion gebilligt werden. Das ist eine antijüdische Position. Es ist meiner Ansicht nach auch die nachdrücklicher formulierte der beiden Positionen (»Ich glaube nicht« ist eine Meinungsäußerung; »Juden glauben« die Behauptung einer — unwahren — Tatsache). Omooba wurde gecancelt. Bei Alice Walker deutete niemand auch nur an, dass sie gecancelt werden könnte. Und das Musical zu Die Farbe Lila wurde selbstverständlich aufgeführt.
Wir leben in äußerst politisierten Zeiten. In den Jahrzehnten meines Aufwachsens, den 1970ern und 1980ern, lautete ein Mantra, das Persönliche sei politisch, aber die Politisierung von allem und jedem im Zuge der durch die sozialen Medien vorangetriebenen Identitätspolitik stellt diese Zeit dennoch in den Schatten. Deutlich wurde das in einer kürzlich auf BBC ausgestrahlten Dokumentation über die Theaterreihe Play for Today. Die Sendung Play for Today, die von 1970 bis 1984