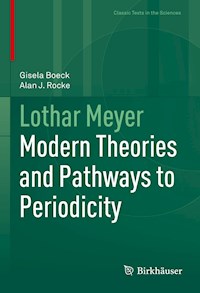Jüdische kulturelle und religiöse Einflüsse auf die Stadt Rostock und ihre Universität E-Book
Gisela Boeck
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte
- Sprache: Deutsch
Die Texte wurden auf einer Veranstaltung vorgestellt, die dem Andenken an die Opfer der Novemberprogrome des Jahres 1938 gewidmet war. Im Zentrum stand der Wunsch der Erinnerung an jüdische kulturelle und religiöse Spuren in Stadt und Universität. Der Band enthält den Text von Michael Busch über das seinerzeit höchst fortschrittliche jüdische Emanzipationsedikt von 1813 für Mecklenburg und stellt die Frage nach der Rolle des Rostocker Orientalisten Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815) bei seiner Vorbereitung. Steffi Katschke diskutiert die Frage von jüdischen Studenten an der Universität Rostock im 18. Jahrhundert. Melanie Lange stellt ein wertvolles Buch aus den Beständen der Universitätsbibliothek vor, die Hebräisch-Grammatik von Elia Levita (1469-1549) und dessen Übersetzung durch den christlichen Kosmographen und Hebraisten Sebastian Münter (1488-1552). Malgorzata Anna Maksymiak unterzieht die Sammlung von jiddischen und hebräischen Privatbriefen des schon erwähnten Gelehrten Tychsen einer kritischen Prüfung und entwickelt die Frage nach der Herkunft von Tychsens Interessen und kommunikativen Verflechtungen, die sie in einem Zusammenhang von Kolonisierung und Kulturkontakt diskutiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Michael Busch
Oluf Gerhard Tychsen und das jüdische Emanzipationsedikt von 1813 in Mecklenburg
Steffi Katschke
Jüdische Studenten an der Universität Rostock im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur jüdischen Bildungs- und Sozialgeschichte
Melanie Lange
Rostock lernt Hebräisch. Die Hebräisch-Grammatik Elia Levitas (1469–1549) in der Übersetzung des christlichen Kosmographen und Hebraisten Sebastian Münster (1488–1552) aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Rostock
Małgorzata Anna Maksymiak
Korrespondenz – Macht – Verflechtung Oluf Gerhard Tychsen (1734–1815) und seine Sammlung von jiddischen und hebräischen Privatbriefen
Über die Autoren
Vorbemerkung
Die 20. Sitzung des Arbeitskreises „Rostocker Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Max-Samuel-Haus der Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur in Rostock gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Sie war dem Andenken an die Opfer der Novemberpogrome 1938 gewidmet. Thematisch ging es um die Suche nach jüdischen kulturellen und religiösen Spuren in Stadt und Universität. Auf dem Programm standen sechs Beiträge, von denen leider krankheitshalber nur vier vorgetragen werden konnten, diese werden nun publiziert. Der Historiker Frank Schröder, der sich mit dem Schriftsteller Arnold Zweig als Student an der Universität Rostock beschäftigen wollte, war bereits so krank, dass er den Vortrag weder halten noch verschriftlichen konnte. Den Abschluss des Programms am 26. Oktober 2013 bildete ein Besuch der Ausstellung „Die Synagoge und ihre Rabbiner. Rostock 1902–1938“ im Max-Samuel-Haus in Rostock, durch die die Kuratorin Steffi Katschke führte.
Es ist bereits zu einer angenehmen Pflicht geworden, an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Kersten Krüger für das große Entgegenkommen Dank zu sagen, unsere Beiträge in seiner Reihe zu veröffentlichen. Darüber hinaus fühlen wir uns Magister Christoph Wegner und Alex Hintze verpflichtet, die sich mit der bekannten Akribie um das Layout bzw. das Korrekturlesen gekümmert haben. Sollten jetzt noch Fehler in den Texten sein, dann gehen sie zu Lasten von uns beiden.
Rostock, im November 2014
Hans-Uwe Lammel und Gisela Boeck
Michael Busch
Oluf Gerhard Tychsen und das jüdische Emanzipationsedikt von 1813 in Mecklenburg
Im November des Jahres 1806 wurde Mecklenburg von französischen Truppen besetzt, die französischen Intendanten quartierten sich auf dem herzoglichen Schloss in Schwerin ein und die herzogliche Familie floh nach Altona. Nach der Rückkehr des Herzogs im Juli 1807 und dem Beitritt beider Herzöge zum Rheinbund im Februar und März 1808 herrschte auch in Mecklenburg der Einfluss Napoleons.1
Kam es in Mecklenburg nach 1808 zu Veränderungen? Setzte, wie in anderen Territorien, mit dem Rheinbundbeitritt verstärkt eine Reformpolitik ein, die allgemein wegen eines Reformstaus und der veränderten Rahmenbedingungen auch als erforderlich angesehen wurde, beschritt man den Weg hin zur modernen Staatlichkeit und zur Staatsbürgergesellschaft?2 Wurde eine Reform der Verfassung, der repräsentativen Elemente, des Finanz- und Justizwesens in Betracht gezogen, ging man gar an die Beseitigung der Leibeigenschaft, der Lehnsverfassung und – das war in Mecklenburg am Schwierigsten – an die Beseitigung altadeliger Privilegien? Um es kurz zu beantworten: Ja, zumindest als Absichtserklärung. Im August 1808 erschien im Pariser Journal de l’Empire unter der Überschrift „Rostock 5 août“, man plane in Mecklenburg ein neues Justizsystem, die Errichtung eines obersten Gerichtshofes, die Aufhebung der Leibeigenschaft und der Steuervorteile der Ritterschaft, kurzum, es handele sich um „les bases de la nouvelle constitution.“3 Und wirklich hatten beide Herzöge – trotz einiger Differenzen wegen des ungleichzeitigen Rheinbundbeitritts – Vorschläge für Reformen ausarbeiten lassen. Friedrich Franz ließ den Schweriner Ständen, die er zu einem Konvokationstag zusammenrufen ließ, am 22. August 1808 mitteilen, es beständen dringende „jetzige notwendige Veränderungen der bisherigen Verhältnisse in Rücksicht der inneren Landesverfassung.“4 Als zusammengefasstes Ergebnis des Konvokationstages läßt sich konstatieren, dass die Stände einen Großteil der Schulden übernahmen, die gewünschte Justizreform jedoch wurde vertagt und die Aufhebung der Leibeigenschaft, bzw. anderer ritterschaftlicher Privilegien kamen überhaupt nicht mehr zur Sprache. Aber immerhin erklärten sich die Stände bereit, „Mängeln der Verfassung nachzuspüren und Fehlerhaftes und Unzeitgemäßes abzuändern.“5
Nach dem Ende der Rheinbundzeit beriefen beide Mecklenburger Herzöge im Januar 1813 die Stände zu einem gemeinsamen Landtag nach Schwerin zusammen. Friedrich Franz hatte es sich ausbedungen, und das war neben dem neuen Landtagsort eine weitere ungewohnte Änderung im Procedere, die Eröffnung persönlich vorzunehmen. Der Herzog zog alle Register der symbolischen Herrschaftssprache, um seine Ansprüche und seine neue Position deutlich zu machen – zusammen mit dem gesamten Hofstaat, dem Regierungspersonal, mit Militär, mit Pauken und Trompeten, mit allen Insignien der Macht also, saß er den im Halbkreis um ihn versammelten Ständen erhaben auf einem Thron gegenüber, eine für beide Mecklenburg außergewöhnliche Situation. Welch ein Unterschied zu den bisherigen Landtagseröffnungen in Sternberg oder Malchin, bei denen die Herzöge gar nicht zugegen sein durften und lediglich zwei herzogliche Kommissare die landesherrliche Seite vertraten!6 Zum Zwecke einer schnelleren und effizienteren Regierung und Administration verlangte Friedrich Franz von den Ständen, auf dem Landtag solle für eine kleinere Gruppe von Repräsentanten der Ritter- und Landschaft
„eine gehörige Vollmacht entworfen werde[n], welche solche Männer verpflichtet und berechtigt, in allen Fällen wo verfassungsmäßig Unsere Landstände zu Landes-Gesetzen und Verordnungen concourrieren, oder Wir ihre Meinung zu vernehmen für gut finden, ihre Stimme im Namen ihrer Committenten bestimmt und mit der erforderlichen Kraft und Würckung abzugeben.“
Das hieß, ein Gremium ähnlich dem Engeren Ausschuss sollte künftig mit allen Befugnissen versehen sein, die sonst nur der schwerfällige und einmal pro Jahr zusammentretende Landtag besaß. Darüber hinaus sollte diese Regierungsgruppe ständig präsent sein und in allen nötigen Fällen ohne eine Spezialvollmacht entscheiden können. Das hieß wiederum, das Imperative Mandat, das so manche Entscheidung auf den Landtagen ganz verhindert oder zumindest dazu geführt hatte, das von Landtag zu Landtag prorogiert – verschoben – wurde, sollte abgeschafft werden.7
Weiterhin forderte der Herzog die Eröffnung eines Oberappellationsgerichtes, die Abschaffung der für ihn lästigen jährlichen Kontributionsbewilligung und die alternative Einführung einer regulären Steuerzahlung, die Aufhebung der bisherigen ritterschaftlichen Amtseinteilung und eine Beibehaltung der Einteilung „Unserer Herzogfürstentümer und Lande nach den bisherigen Rechts-Militair-Recrutierungsdistrikten sowohl in polizeilicher als auch in administrativer Hinsicht.“8
1813 bestanden noch immer ähnliche Forderungen wie 1808, es schien sich nichts Wesentliches geändert zu haben. Auf dem Landtag folgte ein (schriftlicher) Abtausch von Meinungen zwischen Herzog und Ständen, bis am 9. Januar 1813 ein Votum Consultativum durch den Rostocker Bürgermeister Zoch die Ergebnisse zusammenfasste:9 Man teilte dem Herzog nicht ohne Süffisanz mit, dass der gegenwärtige Zeitpunkt sich keineswegs für irgendeine Änderung oder gar Reformen der mecklenburgischen Verhältnisse eigne. Die Stände zeigten sich völlig unbeeindruckt von herzoglicher Machtsymbolik und realem Machtanspruch. Einziges Ergebnis des Landtags im herzoglichen Sinn war die Bildung einer weiteren Deputation, die nach dem Landtag ein Gutachten über die Proposition erarbeiten sollte. Die Rheinbundzeit brachte Mecklenburg also vermeintlich keine durchgreifenden Reformen, ein Oberappellationsgericht wurde erst 1818 in Parchim errichtet und die Leibeigenschaft wurde im herzoglichen Domanium erst 1820, auf einigen ritterschaftlichen Gütern erst 1866 abgeschafft – auf einem Gebiet allerdings wurde Mecklenburg in diesen Jahren zum fortschrittlichsten und modernsten deutschen Territorium seiner Zeit.
Im Verlauf der französischen Expansion in Mecklenburg kam es, wie auch in anderen deutschen Territorien, zu erheblichen politischen Veränderungen in der Rechtsstellung der Juden. 1874 formulierte der jüdische mecklenburgische Historiker Leopold Donath euphorisch, „wo die Soldaten Frankreichs erschienen, brachen die Sklavenketten der Juden.“10 Im Folgenden soll die Frage im Vordergrund stehen, ob das Diktum gültig bleiben kann, dass sich in den am äußersten Rand des Rheinbundes gelegenen Staaten, dem Königreich Sachsen und den Herzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz „die Rechtslage der Juden am wenigsten änderte.“11
Nach der Verbannung aller Juden aus Mecklenburg im Jahre 1492 wegen einer angeblichen Hostienschändung in Sternberg, gab es wahrscheinlich nahezu 200 Jahre keine Juden in Mecklenburg. Vor dem Hintergrund schwerer Verwüstungen, hoher Bevölkerungsverluste und einer Schwächung des wirtschaftlichen Lebens, vor allem durch den Dreißigjährigen Krieg, wurden im Jahre 1679 vom Mecklenburg-Schwerinschen Herzog Christian I. Ludwig (Louis) die ersten jüdischen Hoffaktoren ins Land gerufen. Abraham Hagen und Nathan Benedix aus Hamburg erhielten am 1. Juni 1679 ein Privilegium und Tobacks-Monopol und ein Niederlassungsrecht in Schwerin auf der Schelfe.12 Von ihnen wissen wir durch den Orientalisten der Bützower und nach 1789 der Rostocker Universität, Oluf Gerhard Tychsen (1734−1815), der umfangreiche Studien zur Geschichte der Mecklenburger Juden hinterlassen hat. 1766 bis 1769 verfasste er die Bützowischen Nebenstunden, die sich mit der Geschichte der Juden Mecklenburgs auseinandersetzten und für ihre Zeit einzigartig blieben. Tychsen benutzte zeitgenössische jüdische Quellen und übersetzte wichtige hebräische Dokumente, er führte einen für seine Zeit ungewöhnlichen Dialog mit Juden, wovon die rund 1000 Korrespondenzen zeugen, die er mit jüdischen Gelehrten führte.13 Durch Tychsen wurden Generationen Mecklenburger Hofjuden namentlich bekannt.
Die mecklenburgischen Herzöge waren den Ständen, die zum größten Teil gegen eine Ansiedlung von Juden in Mecklenburg waren, im Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich vom 18. April 1755 insofern entgegengekommen, als er im § 377, der den Juden gewidmet war, bestimmte:
„In Ansehung der Aufnahme der Juden versprechen Wir Unseren Ständen dergestalt Maß zu halten, daß sie keine Ursache über deren gar zu große Anzahl zu klagen haben sollen. Wie denn auch den Juden hiemit untersagt sein soll, liegende Gründe eigenthümlich an sich zu bringen.“14
Der Paragraph war allgemein und zweideutig gehalten; schon bald sollten die Klagen der Stände erneut die Diskussion über die Lage der Juden bestimmen: Was hieß „Maß halten“ und was waren „liegende Gründe?“ 1763 allerdings kam es zu einem Erfolg der Politik der Judenschaft Mecklenburgs: Der Schweriner Herzog ernannte Jeremias Israel zum Landesrabbiner von Mecklenburg-Schwerin, und in Mecklenburg-Strelitz wurde mit Genehmigung des Herzogs Adolf Friedrich IV. am 5. September 1763 in Altstrelitz eine neue Synagoge eingeweiht.15 Die Ordnung und Statua für die in den Herzoglich Mecklenburgischen Lande wohnenden Schutzjuden wurden auf dem Judenlandtag im Februar 1764 in Schwaan beraten und vom Herzog am 12. Oktober desselben Jahres landesherrlich genehmigt. Die 66 Paragraphen regelten fortan die Gliederung und Organisation der Gemeinde, Kassenführung und Steuererhebung, die rabbinische Gerichtsbarkeit und sanktionierte eine innere Selbstregulierung: Die Gemeinde haftete nun für „die gute Aufführung“ wie die „Erlegung des Schutzgeldes“ neu aufgenommener Schutzjuden (§ 24), und sollte als verlängerter Arm der herzoglichen Behörden den unkontrollierten Zuzug armer Juden verhindern helfen.16 Noch im März 1764 erging ein herzogliches Mandat wegen der „häußlichen Niederlassung des jüdischen Gesindels in den Städten, ohne eine Schutzbrief erlangt zu haben“, in dem die Städte aufgefordert wurden, genaue Listen über die Anzahl der Schutzjuden und der Unvergleiteten anzulegen. Bürgermeister und Rat der Stadt Sternberg konnten dem Herzog am 28. Mai mitteilen, man sei „hier in unserer Stadt bis Dato von Juden und deren Familien Gottlob! annoch ganz rein und frey…“17 Dieser Brief ist ein Beispiel von vielen, wie die Landstände, vor allem die Städte, auf die Zunahme der Juden in Mecklenburg reagierten – feindselig und keinesfalls gleichgültig, sie entsprang landesherrlichen und nicht ihren Interessen.
1781 war auf Anregung Moses Mendelssohns der erste Teil der programmatischen Schrift des preußischen Staatsrates Christian Wilhelm Dohm Über die bürgerliche Verbesserung der Juden erschienen, die zwar unmittelbar keine praktischen Verbesserungen brachte, aber breit rezipiert wurde, große Resonanz fand und später als Bibel der Emanzipation bezeichnet worden ist.18 Dohm gelangte zur generellen Schlussfolgerung, dass alles, was man den Juden vorwerfe, durch die geltende politische Verfassung bewirkt werde und worden sei. Er wollte die rechtlichen und gesellschaftlichen Umstände verbessern, um zu einer „Verbesserung der Juden“ auch in Form der bürgerlichen Gleichstellung zu gelangen und sie zu nützlichen Mitgliedern des Staates zu machen. Ausgehend von der aufgeklärten Prämisse der natürlichen Gleichheit der Menschen, argumentierte Dohm sowohl menschen-, naturrechtlich aufgeklärt als auch stark utilitaristisch – kein Widerspruch in den Augen der Aufklärer, und im spezifisch historischen Kontext der Zeit ein übliches philosophisches Argumentationspaar.19
In beiden Mecklenburg ließ sich eine grundlegend andere Haltung und Einstellung von Herzog auf der einen und Ständen, Ritterschaft und Städten, auf der anderen Seite beobachten, wenn es um die ‚Judenpolitik’ ging: In ersten Ansätzen zeichnet sich hier das grundsätzliche Dilemma der deutschen Aufklärung ab, vor allem in Hinblick auf die Emanzipation der Juden. Die großen Hoffnungen sollten enttäuscht werden, da sie nicht einmal in den eigenen Reihen überzeugen konnten, und die Masse der christlichen Bevölkerung, die weder literarische Salons besucht noch Traktate der philosophes las, diese nicht teilte und wollte, oder gar vehement ablehnte.20 Die Versuche einiger Mecklenburger Juden, die starren Schranken und Behinderungen jüdischen gesellschaftlichen Lebens zu lockern, scheiterten noch an der städtischen und ständischen Bürokratie.21 Doch einzelne Stimmen beschworen vorsichtig den ‚Geist der Zeiten’ und sannen langfristig auf Abhilfe.
Im Jahre 1802 erschien in Berlin eine kleine Schrift mit dem Titel Über Aufnahme und Concessionierung der fremden und einheimischen Juden, in rechtlicher und staatswirtschaftlicher Hinsicht, mit besonderer Beziehung auf Mecklenburg-Strelitz, die von „einem Mitbürger dieses Staats“ verfasst worden war. Dahinter soll sich laut zeitgenössischem Bericht der Strelitzische Justizrat und spätere Bürgermeister von Neubrandenburg, Friedrich Andreas Müller, verborgen haben.22 Die 96-seitige Schrift war schon in der Zeit, in der sie geschrieben wurde, „weniger bekannt, als sie es verdient“, dann scheint sie völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Im kleinen Mecklenburg-Strelitz besaßen zu Beginn des 19. Jahrhunderts einige Juden auf den herzoglichen Domänen Loh- und Papiermühlen, in Alden war der Lohmüller sogar in die Müllerzunft aufgenommen worden; in Alt-Strelitz besaßen Juden eine Leder- und eine Tabaksfabrik sowie eine Bierbrauerei. Insgesamt entwickelten sich die Verhältnisse in eine den allgemeinen Verhältnissen nach durchaus liberale Richtung, so dass einige jüdische Familien nach Mecklenburg-Strelitz zogen, unter ihnen die Familie des verstorbenen Moses Mendelssohn.23
In seiner Schrift stellte der Verfasser zu Beginn fest, dass „Einheimische alle diejenigen Personen sind, deren Heimat im Lande ist.“ Hierzu zählte der Verfasser auch die mecklenburgischen Juden. Eine wie auch immer geartete Aufnahme Einheimischer mache keinen Sinn und sei ein Widerspruch in sich.24 Fremde würden in der Regel gern aufgenommen, wenn „sich hoffen lässt, dass sie gute und nützliche Mitglieder des Staates werden.“25 Nach diesen allgemeinen, einführenden Seiten kommt der Autor zum Verhältnis der Juden und Christen, das dadurch bestimmt werde, „dass fanatische Christen gegen die Juden harte Gesetze und Verfügungen erwirkten, wodurch diese immer mehr in den Zustand der Niedrigkeit und Verachtung herabsanken,“ und schließlich eine eigene Absonderung wählten.26 Es sei an der Zeit, so der Verfasser, dass „die Juden endlich die Rechte aller übrigen Bürger genießen!“27 Der praktizierte Ausschluss der Juden geschehe lediglich aufgrund der Eigenschaft „oder soll ich sagen Stand als Jude“, bloß als solcher scheine er vielen unter allen Ständen der Christen zu stehen.28 Auch in Mecklenburg bildete ein Großteil der Juden die unterste Klasse, Grund dafür sei vor allem die mangelnde Schulbildung: Nur wenige Juden brächten ihre Kinder in die christlichen Schulen, so dass der Kenntnisstand „wie bei vielen … Einwohnern des platten Landes sei.“29 Insgesamt aber sei kein Zweifel vorhanden, dass die Juden „gleich anderen Menschen, gute und nützliche Bürger und Unterthanen des Staates seyn können,“30 wobei der Verfasser nicht nur die einheimischen Schutzjuden im Blick hatte, sondern auch die „einheimischen nichtconcessionierten als Angehörige, Mitgenossen und Unterthanen des Staates“ betrachtet sehen wollte.31
Ausländische Juden sollten, so der Verfasser weiter, eine gewisse Summe Geldes mitbringen, um „erkennen zu lassen, daß sie glücklich einem Gewerbe nachgehen können,“32 eine Regelung übrigens, die noch heute für Menschen aller Konfessionen in den meisten Staaten der Welt gilt. Einschränkungen sah der Verfasser lediglich bei der Heirat vor, hier sollten einheimische Juden, ähnlich wie Gesellen und andere gesellschaftliche Gruppierungen, nachweisen, dass sie eine Familie ernähren können, bevor eine Heiratserlaubnis erteilt werde.33 Zum Schluss seiner Abhandlung forderte der Verfasser, dass die Juden ohne Gegenleistungen endlich „in den Genuss gleicher Rechte kämen.“34 Diese vergessene Schrift zur Judenemanzipation in Mecklenburg, die sich auch auf Dohm bezieht, und durchaus zum Kanon seiner Nachfolgeschriften gerechnet werden kann,35 war durchaus ein gewichtiges Zeichen für ein aufgeklärtes Umdenken kleiner Kreise in Mecklenburg. Das Büchlein gehört mit seiner Forderung nach der bürgerlichen Gleichstellung der Juden ohne die üblichen Vorbedingungen sicher zu den prononciert freiheitlichsten seiner Zeit und zeichnete das, was schließlich 1813 erreicht werden sollte, vor: Eines der liberalsten Emanzipationsgesetze auf deutschem Boden, das durch seinen egalitären Inhalt stark beeindruckte.36
Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg, und die Diskussionen über Reformansätze in den Bürokratien, die sich nach den gedruckten Emanzipationswünschen in einigen Territorien des Alten Reichs entwickelten, fehlten im Ständestaat Mecklenburg zunächst völlig.37 Erst durch die Veränderungen der Napoleonischen Zeit kam es in Mecklenburg zu Reformen. Den Stein ins Rollen brachten die Ältesten der Schweriner jüdischen Gemeinde, Michel Ruben Hinrichsen und Nathan Mendel, die im Auftrag der mecklenburgischen Judenschaft Herzog Friedrich Franz am 22. Februar 1811 eine Petition überreichten, die konsequent die Erteilung des Bürgerrechts für alle Juden vorsah. Der Augenblick war geschickt gewählt, waren viele deutsche Teilstaaten doch unter dem Eindruck militärischer Niederlagen und der französischen Reformgesetzgebung zu Zugeständnissen bereit. Nach Eintritt in den Rheinbund gelte das Recrutierungsreglement