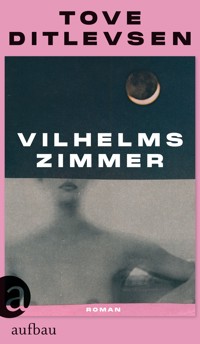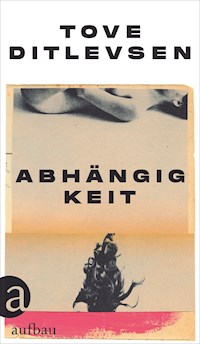9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kopenhagen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das Porträt einer jungen Frau, die furchtlos und entschieden ins Leben zieht.
„Ein Mädchen kann nicht Dichter“ werden, hatte der Vater zu Tove gesagt. In „Jugend“ zeichnet Tove Ditlevsen das Porträt einer jungen Frau, die ihren eigenen Weg geht – kraftvoll, wild, lebendig erzählt. Im Kopenhagen der 1930er stürzt sich Tove voller Energie ins Leben. Mit 14 Jahren verlässt sie die Schule, beginnt ohne weitere Ausbildung eine Reihe von kleinen Jobs anzunehmen, arbeitet als Dienstmädchen und Bürogehilfin, sie schlägt sich durch. Sie lernt Herrn Krogh, einen älteren wunderlichen Antiquar kennen, der ihr immer wieder Bücher leiht. Mit 17 zieht Tove bei den Eltern aus, geht tanzen und die Möglichkeit, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, rückt in greifbare Nähe.
„Von atemberaubender Intensität und Schönheit. Aus dem Staub ihres Lebens leuchtet dieses Werk.“ Elke Heidenreich, Spiegel Online.
„Eine Stimme, deren Kraft wie Dynamit ist.” The Times Literary Supplement.
„Das Porträt einer Frau, die ihr Leben entschieden zu ihrem eigenen macht. Ein Leben, so frei und ungestüm, ich bin versunken in Tove Ditlevsens Büchern.“ Nina Hoss.
„Eine monumentale Autorin.“ Patti Smith.
„Großartig, von hypnotischer Qualität.“ The New York Times.
„Tove Ditlevsens Kopenhagen-Trilogie, so viel steht jetzt schon fest, ist eines der großen literarischen Ereignisse des Jahres." Süddeutsche Zeitung.
„Was Autorinnen wie Annie Ernaux, Rachel Cusk und Deborah Levy heute tun, hat Tove Ditlevsen schon vor über 50 Jahren getan. Autobiographisches Schreiben, vor dem man sich verneigen möchte. Endlich, endlich ist Ditlevsens Trilogie auf Deutsch zu lesen!” Emilia von Senger, She said.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Ein Mädchen kann nicht Dichterin« werden, hatte der Vater zu ihr gesagt. In »Jugend« zeichnet Tove Ditlevsen das Porträt einer jungen Frau im Kopenhagen der 1930er, die ihren eigenen Weg geht – kraftvoll, wild, lebendig erzählt.
»Eine Stimme, deren Kraft wie Dynamit ist.« The Times Literary Supplement.
»Das Porträt einer Frau, die ihr Leben entschieden zu ihrem eigenen macht. Ein Leben, so frei und ungestüm, ich bin versunken in Tove Ditlevsens Büchern.« Nina Hoss.+
»Eine monumentale Autorin.« Patti Smith.
Über Tove Ditlevsen
Tove Ditlevsen (1917–1976), geboren in Kopenhagen, galt lange Zeit als Schriftstellerin, die nicht in die literarischen Kreise ihrer Zeit passte. Sie stammte aus der Arbeiterklasse und schrieb offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Heute gilt sie als eine der großen literarischen Stimmen Dänemarks und Vorläuferin von Autorinnen wie Annie Ernaux und Rachel Cusk. Die »Kopenhagen-Trilogie« mit den drei Bänden »Kindheit«, »Jugend« und »Abhängigkeit« ist ihr zentrales Werk, in dem sie das Porträt einer Frau schafft, die entschieden darauf besteht, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Die »Kopenhagen-Trilogie« wird derzeit in sechzehn Sprachen übersetzt.
Ursel Allenstein, 1978 geboren, studierte Skandinavistik und Germanistik in Frankfurt und Kopenhagen. Sie ist Übersetzerin aus dem Dänischen, Schwedischen und Norwegischen von u.a. Christina Hesselholdt, Sara Stridsberg und Johan Harstad. Für ihre Übersetzungen wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Jane-Scatcherd-Preis der Ledig-Rowohlt-Stiftung.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tove Ditlevsen
Jugend
Zweiter Teilder Kopenhagen-Trilogie
Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Impressum
Eins
Ich blieb nur einen Tag an meinem ersten Arbeitsplatz. Morgens ging ich um halb acht von zu Hause los, um überpünktlich dort zu sein, denn am Anfang müsse man sich Mühe geben, meinte meine Mutter, die in sämtlichen Haushalten, wo sie in ihrer Jugend eine Stelle angenommen hatte, selbst nie über den Anfang hinausgekommen war. Ich trug das Festtagskleid für die Zeit nach der Konfirmation, das Tante Rosalia für mich genäht hatte. Es war aus hellblauer Wolle und vorne gerafft, weshalb ich darin nicht ganz so platt aussah wie sonst. Ich ging im dünnen, grellen Sonnenschein die Vesterbrogade entlang und fand, dass alle Menschen frei und glücklich aussahen. Sobald sie die Haustür in der Pile Allé passiert hatten, die mich gleich verschlucken würde, wurde ihr Gang tänzerisch leicht, als wohnte das Glück irgendwo auf der anderen Seite des Valby Bakke. Im dunklen Flur roch es so stark nach Angst, dass ich fürchtete, Frau Olfertsen könnte es auch bemerken und denken, ich hätte diesen Geruch ins Haus gebracht. Mein Körper und meine Bewegungen waren steif und beklommen, während ich ihrer flatterhaften Stimme lauschte, die mir tausend Dinge erklärte und zwischen den Erklärungen wie eine leere Spule weiterlief, in einem ununterbrochenen Strom von nichts und wieder nichts plappernd – dem Wetter, ihrem Sohn, wie groß ich doch für mein Alter sei. Sie fragte, ob ich eine Schürze dabeihätte, und ich zog die meiner Mutter aus meiner leeren Schultasche. Sie hatte neben der Naht ein Loch, denn irgendetwas war immer mit ihren Sachen, und der Anblick rührte mich. Meine Mutter schien weit weg, und ich würde sie erst in acht Stunden wiedersehen. Ich befand mich unter Fremden, die mich lediglich als eine Person ansahen, deren Arbeitskraft sie jeden Tag für eine bestimmte Anzahl von Stunden und für einen bestimmten Lohn gekauft hatten. Der ganze Rest von mir war einerlei. Als wir in die Küche gingen, kam der kleine Junge in seinem Schlafanzug angerannt. »Guten Morgen, Mami«, flötete er liebreizend, schmiegte sich an das Bein seiner Mutter und warf mir einen feindseligen Blick zu. Die Dame des Hauses befreite sich behutsam und sagte: »Das ist Tove, sag ihr fein Guten Tag!« Zögernd streckte er mir seine Hand hin, und als ich sie ergriff, sagte er drohend: »Du musst alles machen, was ich dir sage, sonst erschieße ich dich.« Die Mutter lachte laut, dann zeigte sie mir ein Tablett mit einer Teekanne und Tassen und bat mich, das Getränk zuzubereiten und ins Wohnzimmer zu bringen. Sie nahm den Jungen an der Hand und trippelte auf ihren hohen Absätzen mit ihm dorthin. Ich kochte das Wasser und goss es in die Teekanne, auf deren Boden die Teeblätter lagen. Ich war mir nicht sicher, ob das korrekt war, weil ich noch nie Tee getrunken oder zubereitet hatte. Ich stellte fest, dass die Reichen Tee tranken und die Armen Kaffee. Dann drückte ich mit dem Ellenbogen die Türklinke hinunter und trat ins Wohnzimmer, wo ich erschrocken stehen blieb. Frau Olfertsen saß auf dem Schoß eines Mannes namens Onkel William, dessen Existenz ich völlig vergessen hatte, und auf dem Boden lag Toni, der Junge, und spielte mit einer Eisenbahn. Die Hausherrin sprang hastig auf und fing an, im Zimmer auf und ab zu schreiten, so dass ihre weißen Arme das Sonnenlicht in kleine grelle Blitzlichter zerschnitten. »Seien Sie so gut und klopfen Sie an, bevor Sie zur Tür hereinkommen«, fauchte sie. »Ich weiß ja nicht, wie Sie das kennen, aber bei uns ist es so üblich, und daran sollten Sie sich besser gewöhnen. Gehen Sie noch einmal hinaus!« Sie deutete auf die Tür, und ich stellte verwirrt das Tablett ab und verließ das Zimmer. Aus irgendeinem Grund versetzte es mir einen Stich, dass sie mich siezte. Das hatte ich noch nie erlebt. Als ich den Flur erreicht hatte, rief sie: »Und jetzt klopfen Sie an!« Ich tat es. »Herein!«, ertönte es. Diesmal saßen die Hausherrin und der wortkarge Onkel William auf verschiedenen Stühlen. Die Demütigung trieb mir die Schamesröte ins Gesicht, und ich beschloss auf der Stelle, dass ich keinen von ihnen ausstehen konnte. Das half ein bisschen. Nachdem sie ihren Tee getrunken hatten, gingen sie beide ins Schlafzimmer und zogen sich um. Dann verließ Onkel William das Haus, nachdem er Mutter und Kind die Hand gegeben hatte. Ich war anscheinend niemand, von dem man sich verabschieden musste. Die Dame überreichte mir eine lange, maschinengeschriebene Liste mit Tätigkeiten, die ich zu verschiedenen Tageszeiten erledigen sollte. Anschließend verschwand sie wieder im Schlafzimmer und kehrte mit einem harten und strengen Ausdruck im Gesicht zurück. Mir fiel auf, dass sie stark geschminkt war und eine künstliche Frische ohne Lebendigkeit ausstrahlte. Vorher war sie in meinen Augen hübscher gewesen. Sie kniete sich hin und küsste den noch immer spielenden Jungen, stand auf, nickte mir kaum merklich zu und verschwand zur Haustür hinaus. Das Kind erhob sich augenblicklich, zupfte an meinem Kleid und blickte mich schmeichlerisch an. »Toni will Sardellen haben«, sagte er. Sardellen? Ich war sprachlos, wusste aber im Grunde nichts über die Essgewohnheiten von Kindern. »Das darfst du nicht. Hier steht …«, ich studierte den Zeitplan, »10 Uhr: Brotsuppe für Toni, 11 Uhr: ein weichgekochtes Ei und eine Vitamintablette, 13 Uhr …« Er hatte keine Lust, sich die Fortsetzung anzuhören. »Hanne hat mir immer Sardellen gegeben«, unterbrach er mich ungeduldig, »alles andere hat sie selbst gegessen, das kannst du genauso machen.« Hanne musste meine Vorgängerin gewesen sein, und auch ich sah mich außerstande, eine Menge Essen in ein Kind hineinzustopfen, das nichts als Sardellen haben wollte. »Na gut«, sagte ich, schon weitaus besser aufgelegt, nachdem die Erwachsenen gegangen waren. »Wo stehen denn die Sardellen?« Er kletterte auf einen Küchenstuhl, holte ein paar Konservenbüchsen herunter und kramte auch einen Dosenöffner aus einer Schublade hervor. »Aufmachen«, befahl er gierig und reichte mir beides. Ich öffnete eine Büchse und setzte ihn, wie er es verlangte, auf den Küchentisch. Dann ließ ich eine Sardelle nach der anderen in seinem aufgesperrten Mund verschwinden, und als keine mehr übrig waren, bat er darum, zum Spielen in den Hof gehen zu dürfen. Ich half ihm beim Anziehen und schickte ihn die Küchentreppe hinunter. Vom Fenster aus würde ich ihn beaufsichtigen können. Jetzt musste ich putzen. Einer der Punkte lautete: »Mit dem Kehrgerät über die Teppiche.« Ich holte das schwere Ungetüm hervor und bugsierte es auf den großen roten Teppich im Wohnzimmer. Versuchsweise schob ich es über ein paar Flusen, die allerdings nicht verschwinden wollten. Ich schüttelte das Gerät ein wenig und fummelte am Mechanismus herum, woraufhin sich der Deckel öffnete und ein Haufen Dreck auf den Teppich rieselte. Es gelang mir nicht, das Gerät wieder zusammenzubauen, und da ich nicht wusste, wohin mit dem Dreck, schob ich ihn mit dem Fuß unter den Teppich und trampelte ein wenig darauf herum, um den Haufen zu verteilen. Nach all diesen Strapazen war es bereits zehn Uhr, und ich hatte Hunger. Ich aß die erste von Tonis Mahlzeiten und stärkte mich mit ein paar Vitamintabletten. Dann folgte der nächste Punkt: »Alle Möbel mit Wasser abbürsten«. Verwundert starrte ich erst auf den Zettel, dann auf die Möbel ringsherum. Das schien merkwürdig, aber so war es hier wohl üblich. Ich nahm eine Bürste mit schönen harten Borsten, ließ einen Eimer mit kaltem Wasser volllaufen und begann erneut im Wohnzimmer. Ich scheuerte energisch und gründlich, bis ich die Hälfte des Flügels bearbeitet hatte. Erst in dem Moment dämmerte mir, dass etwas haarsträubend schiefgelaufen war. Die Bürste hatte auf der feinen, glänzenden Oberfläche hunderte feiner Risse hinterlassen, und ich wusste nicht, wie ich sie wieder zum Verschwinden bringen sollte, bis die Dame des Hauses nach Hause kam. Die Furcht kroch über meine Haut wie kalte Schlangen. Ich nahm den Zettel und las erneut: »Alle Möbel mit Wasser abbürsten.« Wie ich die Anweisung auch drehte und wendete, sie blieb unmissverständlich und nahm den Flügel nicht aus. Galt er womöglich gar nicht als Möbel? Inzwischen war es dreizehn Uhr, und Frau Olfertsen würde um siebzehn Uhr wiederkommen. Ich verspürte eine so brennende Sehnsucht nach meiner Mutter, dass ich keine weitere Zeit verlieren konnte. Hastig zog ich mir die Schürze über den Kopf, rief aus dem Fenster nach Toni und behauptete, wir würden jetzt in ein paar Spielzeugläden gehen. Er kam sofort hoch, und ich zog ihm Jacke und Schuhe an und stürzte so eilig mit ihm die Vesterbrogade hinab, dass er kaum mithalten konnte. »Wir gehen jetzt zu meiner Mutter«, erklärte ich atemlos, »und essen Sardellen.« Meine Mutter war sehr erstaunt, mich schon so früh wiederzusehen, doch als wir hereingekommen waren und ich ihr von dem zerkratzten Flügel erzählte, brach sie in Gelächter aus. »Um Himmels Willen«, sagte sie, »hast du den Flügel wirklich mit Wasser abgebürstet? Oh nein, wie kann man nur so dumm sein!« Dann wurde sie plötzlich ernst. »Hör mal«, sagte sie, »es hat keinen Zweck, dass du noch mal dorthin zurückgehst. Wir finden sicher eine andere Stelle für dich.« Ich war dankbar, aber nicht besonders verwundert. So war sie, und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte auch Edvin seine Lehrstelle wechseln dürfen. »Ja«, sagte ich, »aber was ist mit Vater?« »Ach«, sagte sie, »dem erzählen wir einfach die Geschichte mit Onkel William, so was kann dein Vater nicht gut ertragen.« Wir gerieten in eine ausgelassene Stimmung wie in alten Tagen, und als Toni weinend nach Sardellen verlangte, nahmen wir ihn mit in die Istedgade und kauften ihm zwei Büchsen. Um kurz vor vier brachen meine Mutter und der Junge wieder zu Frau Olfertsen auf, wo meine Mutter auch die Schürze und die Schultasche ausgehändigt bekam. Ich erfuhr nie, was die Dame des Hauses zu dem ramponierten Flügel gesagt hatte.
Zwei
Ich bin in einer Fremdenpension in der Vesterbrogade angestellt, nahe der Freiheitssäule. Für meine Mutter wäre es genauso undenkbar, mich in einen anderen Stadtteil zu schicken wie nach Amerika. Ich trete jeden Morgen um acht Uhr den Dienst an und arbeite zwölf Stunden in einer rußigen und fettigen Küche, wo niemals Ruhe einkehrt. Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich so müde, dass ich direkt ins Bett falle. »Diesmal«, mahnt mein Vater, »hast du auf deiner Stelle zu bleiben.« Auch meine Mutter findet, ein wenig Beschäftigung täte mir gut, und außerdem können wir den Coup mit Onkel William nicht wiederholen. Ich denke unablässig daran, wie ich diesem trostlosen Dasein entkommen kann. Ich schreibe keine Gedichte, weil mich nichts in meinem Alltag dazu inspiriert. In die Bibliothek schaffe ich es ebenfalls nicht mehr. Mittwochs habe ich zwar schon um zwei Uhr nachmittags frei, doch auch dann gehe ich schnurstracks nach Hause und ins Bett. Die Pension gehört Frau Petersen und Fräulein Petersen. Die beiden sind Mutter und Tochter, obwohl sie meiner Meinung nach fast gleich alt aussehen. Außer mir ist noch ein sechzehnjähriges Mädchen namens Yrsa dort angestellt. Sie steht in der Rangordnung weit über mir, denn wenn die Pensionsgäste speisen, zieht sie ein schwarzes Kleid, eine weiße Schürze und eine weiße Haube an und huscht mit den schweren Schüsseln hin und her. Sie ist das Zimmermädchen und darf auch die Gäste bedienen. In zwei Jahren, versprechen die Damen, dürfe ich ebenfalls servieren und bekäme wie Yrsa vierzig Kronen im Monat. Jetzt verdiene ich dreißig. Ich bin dafür zuständig, dass immer ein Feuer im Küchenherd brennt, und ich muss die Zimmer der drei Pensionsgäste, die Toilette und die Küche putzen. Obwohl ich alles im Eiltempo erledige, gerate ich ständig ins Hintertreffen. Fräulein Petersen schimpft mich aus: »Hat Ihre Mutter Ihnen denn nicht beigebracht, wie man einen Lappen auswringt? Haben Sie noch nie eine Toilette geputzt? Warum verziehen Sie das Gesicht? Ich hoffe sehr für Sie, dass Sie in Ihrem Leben niemals mit etwas Schlimmerem konfrontiert werden!« Yrsa ist klein und dünn und hat ein schmales, blasses Gesicht mit einer Stupsnase. Wenn die Damen ihren Mittagsschlaf halten, trinken wir am Küchentisch eine Tasse Kaffee, und sie sagt: »Wenn du nicht immer schwarze Ränder unter den Nägeln hättest, dürftest du bestimmt auch servieren. Ich habe gehört, wie Frau Petersen das gesagt hat.« Oder: »Wenn du dir öfter die Haare waschen würdest, dürften dich die Gäste auch zu Gesicht bekommen, da bin ich mir sicher.« Für Yrsa gibt es keine Welt außerhalb der Pension und kein höheres Ziel, als bei jeder Mahlzeit um die Tische zu rennen. Ich reagiere nicht auf die Bemerkungen, die immer wie aus einer Zwille geschossen kommen und doch nie richtig treffen. Während Yrsa und ich abwaschen und die Damen hinter uns am Herd in den großen Töpfen das Essen zubereiten, reden sie über ihre Krankheiten, die sie von einem Arzt zum nächsten führen, weil keiner es ihnen recht macht. Sie leiden unter Gallensteinen, verkalkten Arterien, zu hohem Blutdruck, Schmerzen am ganzen Körper, geheimnisvollen inneren Leiden und düsteren Warnsignalen aus der Magengegend, wann immer sie etwas gegessen haben. Sonntags gehen sie am Behindertenheim auf der Grønningen vorbei, um sich am Anblick der Invaliden zu erquicken, und auch sonst würdigen sie mit einer geradezu unheimlichen Wollust alles und jeden herab. Vor allem an ihren eigenen Gästen haben sie viel auszusetzen. Sie sind genauestens über deren Privatleben im Bilde und diskutieren intime Details, während sie das Essen in Yrsas Schüsseln füllen und darüber jammern, welche Unmengen diese Menschen doch verschlingen. Manchmal habe ich das Gefühl, ihre bösartigen, niederen Gedanken dringen durch die Haut in mich hinein und rauben mir die Luft zum Atmen. Die meiste Zeit über finde ich dieses Leben aber einfach nur unerträglich langweilig und denke voller Melancholie zurück an meine abwechslungs- und ereignisreiche Kindheit. In dem schmalen Streifen des Tages, wenn ich wach genug bin, um mich ein bisschen mit meiner Mutter zu unterhalten, frage ich sie aus, was im Haus und in der Familie passiert und sauge gierig jede wohltuende Neuigkeit in mich auf. Gerda arbeitet jetzt bei Carlsberg, und ihre Mutter bleibt zu Hause und passt auf das Kleine auf. Ruth treibt sich neuerdings mit Jungs herum, und das hätte man auch absehen können, meint meine Mutter, man solle eben nie anderer Leute Kinder adoptieren. Edvin hat seine Arbeit verloren und kommt wieder häufiger zu Besuch. »Deswegen brauchst du dir aber keine Sorgen zu machen«, sagt meine Mutter, »denn jetzt hustet er wenigstens nicht mehr so schlimm.« Trotzdem bin ich ein wenig erschüttert, weil mein Vater immer gesagt hat, Handwerker könnten nicht arbeitslos werden. »Mein Gott«, ruft meine Mutter im nächsten Moment begeistert, »ich hätte fast zu erzählen vergessen, dass Onkel Carl ins Krankenhaus gekommen ist! Er ist ganz furchtbar krank, was natürlich niemanden wundert, bei seinem Lebenswandel. Tante Rosalia besucht ihn jeden Tag, aber für sie wäre es ja nun wirklich besser, wenn er das Zeitliche segnen würde. Und dann ist die Margarine bei Irma zwei Öre teurer geworden, ist das nicht allerhand?« »Dann kostet sie jetzt 49 Öre«, sage ich, denn ich hatte die Preise immer genau im Blick, weil ich entweder zusammen mit meiner Mutter oder allein zum Einkaufen ging. »Ich hoffe nur, dass Vater im Ørstedswerk bleiben kann«, fährt sie fort, »jetzt ist er schon drei Monate dort. Obwohl die Nachtschichten natürlich nicht schön sind.« In der zunehmenden Dunkelheit lullt mich ihre plaudernde Stimme ein, bis ich mit dem Kopf auf den Armen am Tisch einschlafe.
Eines Abends erwache ich wie so oft vom Klirren der Tassen und dem Duft des Kaffees aus dieser Haltung. Während ich schläfrig meinen Kopf hebe, fällt mein Blick auf einen Namen in der Zeitung: Redakteur Brochmann. Plötzlich hellwach, starre ich darauf, und erst dann geht mir langsam auf, dass es eine Todesanzeige ist. Sie trifft mich wie ein Peitschenhieb. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er sterben könnte, bevor ich ihn wiedersehe. Es ist ein Gefühl, als hätte er mich im Stich gelassen, und ich bliebe ohne die geringste Hoffnung für meine Zukunft allein auf der Welt zurück. Meine Mutter schenkt mir Kaffee ein und stellt die Kanne auf seinen Namen. »Jetzt trink schon«, fordert sie mich auf und setzt sich auf die andere Seite des Tischs. Sie sagt: »Schön-Ludvig ist in der Anstalt. Seine Mutter ist ja gestorben, und dann sind sie einfach gekommen und haben ihn abgeholt.« »Ja«, sage ich und habe schon wieder das Gefühl, wir wären unendlich weit voneinander entfernt. Sie sagt: »Wie schön das für dich wird, wenn du ein Fahrrad bekommst. Nur noch zwei Monate.« »Ja«, sage ich. Ich gebe meinen Eltern im Monat zehn Kronen ab, weitere zehn zahle ich fürs Alter auf die Bank ein und die übrigen zehn habe ich zu meiner eigenen Verfügung. Gerade ist mir das Fahrrad egal, alles ist mir egal. Ich trinke meinen Kaffee, und meine Mutter fragt: »Du bist so still, es wird doch wohl nichts sein?« Sie sagt es mit scharfer Stimme, denn sie mag mich nur, wenn meine Seele ganz in der ihren ruht und ich keinen heimlichen Winkel davon für mich behalte. »Wenn du nicht aufhörst, so seltsam zu sein, wirst du nie heiraten«, sagt sie. »Das will ich sowieso nicht«, erwidere ich, obwohl ich just in diesem Moment dasitze und eine Hochzeit als verzweifelten Ausweg in Betracht ziehe. Ich denke an das Gespenst meiner Kindheit: den soliden Handwerker. Ich habe nichts gegen Handwerker, es ist das Wort solide, das all meine lichten Zukunftspläne blockiert. Es ist grau wie ein Regenhimmel, durch den kein munterer Sonnenstrahl hindurchdringen kann. Meine Mutter steht auf. »Wie auch immer«, sagt sie, »das Bett ruft. Wir müssen ja früh raus.« Sie wünscht mir vom Türrahmen aus eine gute Nacht und sieht misstrauisch und beleidigt aus. Nachdem sie gegangen ist, stelle ich die Kaffeekanne beiseite und lese die Todesanzeige noch einmal. Über dem Namen prangt ein schwarzes Kreuz. Ich sehe sein freundliches Gesicht vor mir und höre seine Stimme: »Kommen Sie in ein paar Jahren wieder, meine Liebe.« Meine Tränen tropfen auf die Buchstaben, und ich finde, dies ist der schwerste Tag meines Lebens.
Drei
Ich versank in eine lang anhaltende Apathie, die mir jede Initiative raubte. »Sie schlafen ja mit offenen Augen«, sagten die Damen, deren Vorwürfe mich weniger denn je beeindruckten. Ich verlor auch die Lust, mit meiner Mutter zu sprechen, und als Edvin eines Abends mit einer Einladung von Thorvald kam, lehnte ich ab. Ich hatte keine Muße, mit dem jungen Mann tanzen zu gehen, dem meine Gedichte so gut gefallen hatten. Vielleicht kannte sein Vater einen anderen Redakteur, der dann ebenfalls sterben würde, bevor ich alt genug war, um richtige, erwachsene Gedichte zu schreiben. Inzwischen war ich überempfindlich und wagte es nicht, mich weiteren Enttäuschungen auszusetzen. Es war Sommer geworden. Wenn ich abends nach Hause ging, kühlte die frische Luft meine Küchenherdwangen wie ein Seidentuch, und junge Mädchen in hellen Kleidern spazierten Hand in Hand mit ihren Liebsten vorbei. Ich fühlte mich sehr allein. Von den Mädchen neben den Mülltonnen kannte ich jetzt nur noch Ruth, die mir immer noch »Tach« zurief, wenn ich den Hof durchquerte. Von Leben und Erinnerungen überschwemmt, blickte ich zur Mauer des Vorderhauses auf, dieser Klagemauer meiner Kindheit, hinter der Menschen speisten und schliefen und sich stritten und schlugen. Dann ging ich die Treppe hinauf in meinem roten Kleid mit den blauen Punkten und Puffärmeln, dem einzigen Sommerkleid, das ich besaß. Manchmal saß Jytte oben im Wohnzimmer und rauchte Zigaretten, die sie auch meiner Mutter anbot. Meine Mutter rauchte linkisch und unbeholfen und bekam ständig Rauch in die Augen. Mittlerweile arbeitete Jytte in einer Tabakfabrik. Mein Vater sagte, sie würde die Zigaretten stehlen, aber das war meiner Mutter egal. Sie brauchte immer eine bedeutend jüngere Freundin, weil sie selbst so jugendlich war. Doch in ihrem schwarzen Haar zeigten sich graue Strähnen, und sie hatte um die Hüften zugelegt. Aus diesem Grund besuchte sie oft das Dampfbad der Badeanstalt in der Lyrskovgade, und wenn sie nach Hause kam, erzählte sie begeistert, wie fett die anderen Frauen waren.
Eines Abends klingelte es an der Küchentür der Pension, und als ich öffnete, stand Ruth davor. »Tach«, sagte sie lächelnd, »gehst du bald nach Hause? Es gibt etwas, das ich dir erzählen möchte.« »Ja«, antwortete ich, »warte kurz draußen.« Ich schüttete das letzte Spülwasser weg, zog meine Schürze aus und schlüpfte zu ihr hinaus, als wäre sie eine heimliche Verbindung, von der niemand erfahren durfte. Was wollte sie von mir? Es hatte schon lange niemand mehr etwas von mir gewollt. Sie trug ein weißes Leinenkleid mit kurzen Ärmeln und einem breiten schwarzen Lackgürtel um die Taille. Sie benutzte Lippenstift, und ihre Augenbrauen waren gezupft wie die meiner Mutter. Obwohl sie immer noch klein war, wirkte sie in meinen Augen sehr erwachsen. Wir sagten nichts, bis wir die Straße erreicht hatten, dann aber redete Ruth drauflos, als hätten wir uns nie voneinander entfernt. Sie erzählte, Minna sei mit der Schule fertig und wohne jetzt in Østerbro, in dem Haushalt, wo sie auch arbeite. »Østerbro?«, fragte ich verblüfft. »Ja«, sagte Ruth, »aber sie hatte ja auch schon immer