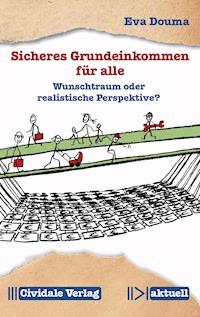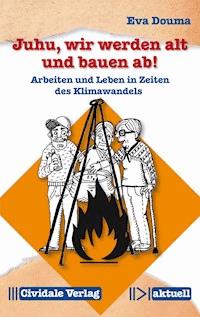
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cividale Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Klimakrise, Eurokrise, Glaubenskrise … und dann auch noch der demographische Wandel! Welche Katastrophe. Oder? Eva Douma, Optimistin durch und durch, zeigt in ihrem kurzweiligen Buch vielmehr, welche Chancen in dieser Konstellation stecken. Lasst Deutschland wärmer werden und uns ärmer und älter. Das ist eine Perspektive, kein Horrorszenario. Douma hat ein "Anti-German-Angst-Buch" geschrieben. Das ist hier und da lustig, zeigt aber auch ganz ernsthaft, welche Chancen und Potenziale sich dem Einzelnen und der Gesellschaft bieten, wenn wir alle älter werden. Und wenn Wachstum vielleicht nicht mehr das alleralleroberste Ziel ist. Lebensqualität und Produktivität müssen in einer alternden Gesellschaft neu gedacht werden. Wie sichern wir Innovation und Weiterentwicklung auch ohne grotesken Ressourcenverbrauch? Welche Bedingungen brauchen wir, damit Menschen in jedem Alter in der Mitte der Gesellschaft stehen? Wie also lässt sich ein würdevolles Leben für möglichst viele Menschen dauerhaft sicherstellen? Lust auf außergewöhnliche Antworten? Antworten, die dabei durchaus für eine reale Zukunft taugen? Dann freuen Sie sich auf Eva Doumas "Juchu!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Douma
Juhu, wir werden alt und bauen ab!
Arbeiten und Leben in Zeiten des Klimawandels
1. Auflage
© Cividale Verlag Berlin, 2015
Kontakt: [email protected]
www.cividale.de
ISBN 978-3-945219-07-2
Umschlaggestaltung: Nina und Christoph von Herrath, www.cvh-graphic-design.de
Lektorat: Kristina Frenzel, www.textarbeit-redaktion.de
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Einführung
1. Teil: Die Deutschen, eine alternde Gesellschaft, im Klimawandel – eine Bestandsaufnahme
1. Wir werden weniger und immer älter
a. Szenarien einer alternden Gesellschaft
b. Das Alter vor dem Alter – Altern als langfristiger Prozess
c. Die Lebenszufriedenheit wächst mit den Jahren
d. Politisches Engagement im Alter
e. Und die Jungen?
2. Deutschland wird wärmer – spürbare Folgen des Klimawandels
a. Soziale und wirtschaftliche Folgen
b. Was wir tun müssten
3. Schrumpfende Lebensqualität – wie wir uns derzeit zugrunde wirtschaften
a. Ein Blick zurück
b. Und wie sieht es heute aus?
c. Kurzfristige Kostenoptimierung statt langfristiger Qualität
d. Mehr Flexibilisierung: Segen oder Fluch?
e. Die Arbeit wird unpersönlicher und mehr
f. Arbeit macht immer mehr Menschen krank
g. Wirtschaftliche Folgen unseres Handelns
h. Warum nichts geschieht
2. Teil: Fröhlicher Aufbruch ins Weniger
1. Verzicht als Lebensform?
2. Vom Warenwachstum und dem wahren Glück
3. Abbau statt Aufbau – Schrumpfen als Perspektive?
4. Miteinander, füreinander – eine Wachstumsperspektive
3. Teil: Vom Wachstums- in den Schrumpfmodus schalten – wie wir uns fit machen für eine altersgerechte, klimaneutrale Zukunft
1. Bedingungsloses Grundeinkommen – mit Sicherheit leben in unsicheren Zeiten
a. Wer soll das bezahlen?
b. Kommt das Grundeinkommen für alle?
c. Soziale Folgen eines bedingungslosen Grundeinkommens
2. Neue Ideen für unser Land
3. Anders wirtschaften in Zeiten des Klimawandels
a. Gutes Wirtschaften umfasst mehr, als Geld zu verdienen
b. Cradle to Cradle
c. Lokale Dienstleistungen statt global produzierter Konsumgüter
4. Anders unternehmen – alternative Betriebsformen
a. Mitarbeitende entscheiden mit
b. Politische Mission als Unternehmensziel
c. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam entscheiden
5. Veränderungen in der Arbeitswelt
a. Immer weniger arbeiten immer mehr?
b. Die Jungen machen sich rar
c. Migranten bieten Potenzial
d. Arbeiten im Alter
e. Tragfähige Arbeitsformen für Jung und Alt
aa. Flexible Arbeitszeitmodelle
bb. Individuelle Personalentwicklung
cc. (Ältere) Arbeitende fit halten
dd. Vielfalt managen
ee. Die Bedeutung von Arbeit relativiert sich
6. Leben und Wohnen in einer alternden und sich klimatisch verändernden Welt
a. Alten- und klimagerechte Wohnungen
b. Lebensformen für ältere Menschen mit Handicap
aa. Gesundheit und Pflegebedürftigkeit
bb. Die Betreuung demenziell Erkrankter
cc. Versorgungsperspektiven
c. Technische Alltagshilfen – eine hoffnungsvolle Perspektive?
d. Im Alter von Familie und Netzwerken profitieren
e. Private Versorgung ist herausfordernd – wie freundschaftliche Netzwerke langfristig tragen könnten
f. Veränderte soziale Beziehungen
g. In Gemeinschaft leben
h. Stadtplanung mit und für die Zukunft
7. Geteiltes Gut – doppelter Nutzen
a. Tauschen und Teilen kann dem Klima nutzen
b. Die Abkehr vom Besitzdenken
c. Ehrenamtliches Engagement – vom Teilen des Menschlichen
d. Verteilungsgerechtigkeit als Schlüssel zum Zugang in eine bessere Welt
8. Bildung für alle – wo wir Wachstum wirklich brauchen
9. Durch Handeln zum Wandel
Fazit: Keine Angst vorm Schrumpfen
Danksagung
Literatur
Endnoten
Einführung
Energiekrise, Klimakrise, Sozialstaatskrise: Eine Hiobsbotschaft jagt die andere – in immer kürzeren Abständen. Straßen und Schulen zerbröckeln in unserem Land, weltweit versiegen die Ressourcen, wirtschaftliche Krisen nehmen ebenso zu wie Klimaextreme. Hierzulande sorgt man sich, dass Deutschland immer älter, ärmer und international unbedeutender wird.
Die Generation der Babyboomer, der zwischen 1955 und 1965 Geborenen, kommt langsam in die Jahre. Als es nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich wieder aufwärts ging, erblickten sie zahlreich das Licht der Welt. Insbesondere wenn sie der Mittelschicht im Westen der Republik entstammen, sind sie es gewöhnt, dass es für sie im Großen und Ganzen immer weiter voranging und - geht. Einige von ihnen sitzen mittlerweile an den Schalthebeln der Macht, andere in den Feuilletons der tonangebenden Medien, und was auch immer sie taten und noch tun, der Zenit ihrer Karrieren ist zumeist erreicht. Die Ersten streben schon dem Vorruhestand entgegen, ein Teil kümmert sich um die Enkel, während andere dieser Altersgruppe erst unlängst Eltern geworden sind.
Mehr oder minder plötzlich sieht sich diese Generation, die sich selbst als jung und dynamisch erlebt, damit konfrontiert, dass auch ihnen ewige Jugend nicht gegeben ist. Und weil sie so viele und dementsprechend „überall“ sind, rückt das Thema Alter zunehmend in den Fokus – ganz individuell, aber auch generell. Die Aussichten und Erwartungen sind gemischt und nicht immer ganz klar. Deutlich zeichnet sich hingegen ab, dass es in unserer Gesellschaft immer mehr Ältere und Alte gibt, Tendenz steigend.
Diese demographischen Veränderungen, aber auch der Kampf um die Ressourcen der Welt und die Folgen des Klimawandels scheinen unser Wachstum, unsere Wirtschaft und letztlich unser aller Wohlstand zu bedrohen. So oder so ähnlich lauten einige der kursierenden Angstszenarien, insbesondere der gut situierten Mittelschicht.
Doch ist das wirklich so? Müssen wir uns nicht nur vor einem Wirtschafts- und Klimawandel, sondern auch vor einer alternden Gesellschaft fürchten? Steht uns ein trauriges Grau in Grau bevor? Werden wir künftig in verfallenen Städten freudlos unser Leben fristen oder sogar vor den immer häufigeren Hochwasserfluten und Hitzewellen von Ort zu Ort flüchten?
Zukunftsprognosen sind immer schwierig. Wer hätte nach dem NATO-Doppelbeschluss von 1979 gedacht, dass zehn Jahre später die Mauer fällt, sich kurze Zeit danach die Sowjetunion auflöst, vor den Toren Österreichs ein Krieg stattfindet und sich nicht nur Europa an vielen Stellen neu sortiert?
Wer die aktuellen Gegebenheiten einfach fortschreibt, handelt hoch spekulativ. Weil die Zukunft ohnehin ungewiss ist, könnten wir uns natürlich mit Konrad Beikircher auf das Rheinische Grundgesetz „Et kütt wie et kütt“ beziehen und alles auf uns zukommen lassen. Finden wir uns in einer Sackgasse wieder, stehen wir irgendwann mit dem Rücken zur Wand, bleiben uns weniger Handlungsoptionen.
Damit wir nicht in einigen Jahren unentrinnbar in einer ausweglosen Situation gefangen sind, sollten wir frühzeitig bisher Selbstverständliches in Frage stellen. Dieses Buch will dazu anregen, den eigenen Lebensstil, Wertehorizont und zahlreiche Selbstverständlichkeiten zu überdenken.
Im Zentrum des Buches stehen die alternde Gesellschaft und der Klimawandel. Auf den ersten Blick scheinen beide Themen nichts miteinander gemein zu haben. Doch gerade wenn sie miteinander verbunden betrachtet werden, lassen sich Optionen für ein besseres Leben entdecken, so eine der Kernthesen dieses Buches. Der Klimawandel macht es notwendig, zu schrumpfen und Alternativen zum Wachstum zu entwickeln. Eine alternde Gesellschaft verfügt über viele Menschen, die aufgrund persönlicher Erfahrung wissen, dass Rückbau nicht in jedem Fall im Schrecken enden muss. Weniger zu haben und zu sein, kann auch das Bewusstsein für das Vorhandene schärfen und neue Freiheiten bringen.
Wie wir mit einem anderen Lebensstil, der sich durch weniger Wachstum und mehr Verzicht auszeichnet, dennoch ein gutes Leben führen können, steht im Zentrum dieses Buches. Nach einem Aufriss der sich aktuell abzeichnenden Schwierigkeiten werden im Hauptteil des Buches Konzepte und Vorstellungen dargelegt, die die Basis für ein zukunftsfähiges Leben und Handeln bilden könnten. Anhand zahlreicher Beispiele und Projekte wird dargestellt, wie Arbeit und Leben in einer alternden Gesellschaft klimakompatibel in Balance gebracht werden können. Dabei geht es letztlich nicht um die detaillierte Darstellung aller Optionen. Auch ist nicht jede vorgestellte Idee ausgereift und erprobt. Doch statt verängstigt auf die gern skizzierten Horrorszenarien zu blicken, möchte diese durchaus persönlich gefärbte Streitschrift dazu ermuntern, sich – bei aller Prognoseunsicherheit – schon heute damit auseinanderzusetzen, wie wir in Zukunft arbeiten und leben könnten, welche Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen es in einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft zu entdecken gibt. Denn schließlich weiß nicht nur die im Rheinland aufgewachsene Autorin: „Et bliev nix wie et wor.“
1. Teil: Die Deutschen, eine alternde Gesellschaft, im Klimawandel – eine Bestandsaufnahme
In den folgenden Kapiteln wird der allgemeine Handlungsrahmen, in dem wir uns derzeit bewegen, dargestellt. Wie der Klimawandel und die Alterung der Gesellschaft sich in Zukunft voraussichtlich entwickeln und wie sie unser Leben künftig beeinflussen werden, wird skizziert. Unser derzeitiger auf Wachstum ausgerichteter Lebens- und Arbeitsstil wird einer kritischen Betrachtung unterzogen und es wird der Frage nachgegangen, warum bisher wenig geschehen ist, wiewohl die Probleme doch offensichtlich erscheinen.
1. Wir werden weniger und immer älter
Die demographischen Veränderungen, die wir in unserem Land in den nächsten Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten haben, zeigen sich schon jetzt hier und da. In den angesagten Bezirken von Berlin, Frankfurt am Main, Köln oder Hamburg mag einem unsere Gesellschaft noch recht jung oder zumindest altersgemischt erscheinen. Doch ein Spaziergang durch die Stadt Goslar im letzten Jahr führte es mir deutlich vor Augen: Unsere Gesellschaft altert. Die Cafés des schmucken Fachwerkortes waren gut besucht, die Gassen im Zentrum durchaus bevölkert, aber Menschen unter 30 Jahren waren an dem sonnigen Samstagnachmittag kaum unterwegs. Selbst mit Anfang 50 konnte man sich in dieser Stadt noch zu den Jüngeren zählen.
Es ist nicht nur ein subjektives Gefühl, dass sich in unserem Land ein demographischer Wandel vollzieht. Das Statistische Bundesamt prognostiziert auf seiner Webseite für das Jahr 2038, dass voraussichtlich von dann noch insgesamt 74,6 Millionen Bundesbürgern immerhin knapp 24 Millionen 65 Jahre und älter sein werden und jeder zweite das 50. Lebensjahr überschritten haben wird.
Die Alterung der Gesellschaft kommt weniger durch niedrige Geburtenraten als vielmehr durch die rasant steigende Lebenserwartung zustande. Diese nahm allein im 20. Jahrhundert in Deutschland um 30 Jahre zu, und sie steigt weiter: Ein Kind, das heute geboren wird, hat eine 50-prozentige Chance, 100 Jahre alt zu werden. Was individuell erstrebenswert ist – ein langes, gesundes Leben –, führt zu einer strukturellen Veränderung des Landes.i
Um die Bevölkerungszahl und vor allem das statistische Durchschnittsalter in Deutschland bis zum Jahr 2030 stabil zu halten, müssten jährlich 350.000 Menschen einwandern, schrieb Elisabeth Niejahr schon vor einigen Jahren in ihrem Buch „Alt sind nur die anderen“. Seit Mitte der 1990er Jahre sind diese Zahlen jedoch kaum erreicht worden. In den Jahren 2008 und 2009 war der Einwanderungssaldo Deutschlands sogar negativ: Mehr Menschen verließen das Land, als sich ansiedelten. Erst in den Jahren 2012 und 2013 kamen laut Statistischem Bundesamt wieder mehr als 350.000 Menschen nach Deutschland – bedingt durch die Wirtschaftskrisen in Südeuropa. Doch die unter hoher medialer Aufmerksamkeit zugewanderten jungen und qualifizierten Fachkräfte bleiben häufig nur kurz. So manche spanische Krankenschwester ist entsetzt über die Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen in deutschen Krankenhäusern. Anstatt den Pflegenotstand und Fachkräftemangel in unserem Land langfristig zu mildern, kehrten einige dieser Einwanderer trotz hoher Arbeitslosigkeit in ihr Heimatland zurück oder zogen weiter.
Damit sich gut qualifizierte Ausländer dauerhaft bei uns ansiedeln und zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes beitragen, wäre eine langfristige Einwanderungs- und Integrationspolitik notwendig. Hierzu zählen die Überwindung von Sprachbarrieren, die Anerkennung von Abschlüssen, eine offene Arbeits-, Unternehmens- und Lebenskultur. Die deutsche Sprache ist jedoch kompliziert, der bürokratische Aufwand hoch, die Willkommenskultur nicht ausgeprägt.
Auch Aufenthalts- und Zuzugsbestimmungen für Arbeitnehmer und ihre Angehörigen werden in Deutschland restriktiv gehandhabt. Bisher existiert nur in wenigen deutschen Großstädten der Ansatz einer international geprägten kulturellen und sozialen Infrastruktur. Englischsprachige Studiengänge sind immer noch die Ausnahme. Fremdenfeindliche Kampagnen, wie die erst Anfang 2014 von der CSU gegen Bulgaren und Rumänen initiierte, schrecken nicht Armutsflüchtlinge, sondern insbesondere die so händeringend gesuchten Fachleute aus dem Ausland ab.
Die lange an der Einwanderung gehinderten Polen, für die in Deutschland erst seit 2011 die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt, sind nicht, wie insbesondere von den Konservativen befürchtet, in Scharen nach Deutschland gekommen. Nach der EU-Osterweiterung sind sie nach Großbritannien abgewandert, das sich offener zeigte. Qualifizierte, junge und mobile Menschen zieht es nicht unbedingt nach „Good Old Germany“. Schweden, Österreich, Großbritannien und Belgien sind für sie attraktiver, so das Ergebnis einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2011. Und die in Deutschland aufgewachsenen, hier gut ausgebildeten Nachkommen der älteren Arbeitsmigranten verlassen zum Teil unser Land. Istanbul und Warschau bieten ihnen derzeit bessere Perspektiven als Berlin.
Und selbst wenn wir künftig eine attraktivere Einwanderungspolitik gestalten sollten, bleibt es schon aufgrund globaler demographischer Entwicklungen fraglich, ob die erwarteten Fachkräfte nach Deutschland kommen werden. Mehr oder minder gut qualifizierte Arbeitskräfte werden auch in anderen Staaten dringend benötigt.
Die Alterung der Gesellschaft ist kein deutsches Phänomen. Nicht nur Japans Bevölkerung altert rapide, auch der Aufstieg ehemals armer Staaten wie Malaysia und Thailand – und unter etwas anderen Vorzeichen auch China – geht mit einem Geburtenrückgang einher. In den urbanen Zentren der Zweiten und Dritten Welt wird die Fruchtbarkeit, wie schon in den Industrieländern, mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahrzehnten ebenfalls abnehmen.ii Weltweit hat sich von 1970 bis heute die Geburtenrate von 4,7 Geburten auf 2,5 pro Frau nahezu halbiert. Der Club of Rome erwartet, dass sich das weltweite Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2040 abschwächen und die Menschheit auf maximal 8,1 Milliarden anwachsen wird.
Und selbst wenn es Deutschland im globalen „Kampf um die besten Köpfe“, wie McKinsey die Suche nach qualifizierten, leistungsfähigen Menschen nennt, wider Erwarten gelingen sollte, sich erfolgreich durchzusetzen, gehen damit auch ökonomische Risiken einher. Diese bestehen weniger darin, dass die deutschen Sozialkassen belastet werden. Sie profitierten bisher von den Migranten. Die ökonomischen Risiken sind globaler und weitreichender.
Was im Einzelfall als Lösung erscheinen mag, kann gesamtwirtschaftlich durchaus zu einem Minusgeschäft werden. Wo die gut Qualifizierten weggelockt werden, fehlen sie für die dortige Entwicklung. Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis 2050 die Bevölkerung zum Beispiel in Bulgarien um 43 Prozent, in Rumänien um 20 und in Ungarn um 25 Prozent schrumpfen wird.iii Der Brain-Drain ist aber nicht nur ein Problem der Entwicklungsländer. Auch Absatzmärkte für den „Exportweltmeister“ Deutschland bauen sich auf diese Weise nicht auf.
Dementsprechend empfahl die OECD in ihrer Skills Strategy 2012, nicht nur auf die Zuwanderung gut qualifizierter Fachkräfte zu setzen, sondern auch in die Kompetenzentwicklung im Ausland zu investieren. Mittelbar werde es für gut Qualifizierte so attraktiver, in der Heimat zu bleiben, was wiederum der Landesentwicklung und auch deutschen Tochterfirmen in diesen Ländern zugutekommen könnte.
Stellen wir uns darauf ein, dass es mit der „Frischzellenkur“ aus dem Ausland langfristig wahrscheinlich nichts wird. Rechnen wir damit, dass viele alte Menschen künftig unser Land bevölkern werden und nicht genügend Fremde aus der Ferne kommen, um uns zu helfen, weiterhin so zu wirtschaften, wie wir es bisher gewohnt sind. Aber ist Deutschland beziehungsweise die deutsche Wirtschaft deshalb dem Untergang geweiht?
a. Szenarien einer alternden Gesellschaft
Die Altersdebatte in Deutschland ist auch von Extremen bestimmt. Filme wie „2030 – Aufstand der Alten“, der im Jahr 2007 im ZDF lief, suggerieren: Alte überschwemmen das Land, das Geld reicht nicht mehr für die Versorgung.iv In diesen oder ähnlichen Szenarien fristen die alten Menschen ein trostloses Leben und werden von den wenigen verbliebenen Jungen in den Tod gemobbt. Dass es zu derartigen Konflikten zwischen Alt und Jung kommen könnte, dafür gibt es, obwohl wir schon fleißig altern, derzeit allerdings keine Anzeichen. Den Älteren geht es so gut wie selten zuvor. Größere Generationenkonflikte sind momentan kaum erkennbar.
Andere Katastrophen-Szenarien sehen ab 2020, wenn die Generation der Babyboomer langsam ins Rentenalter kommt, die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme gefährdet. Die Verfechter dieser Szenarien unterstellen, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Alten alles dominieren, Investitionen in die Zukunft nicht interessieren und sämtliche gesellschaftlichen Ressourcen für die Rentenzahlung und Gesundheitsversorgung der Alten verbraucht werden, sodass kein Geld mehr für Bildung, Forschung und die weitere gesamtgesellschaftliche Entwicklung bleibt. Doch 70 Prozent der Gesundheitskosten, die ein Mensch im Durchschnitt in seinem Leben verursacht, fallen erst in den letzten zwei Lebensjahren an – unabhängig davon, ob die Lebenserwartung bei 60 oder 80 Jahren liegt. Die Alterung der Bevölkerung gefährdet zumindest das Gesundheitssystem nicht.
Anders sieht es natürlich bei der Rentenkasse aus. Hier macht es schon einen Unterschied, ob jemand 65 oder 85 Jahre alt wird und mehr oder minder lange Rentenzahlungen erhält. Wer im Jahr 1960 in den Ruhestand ging, konnte im statistischen Mittel damit rechnen, zehn Jahre lang Zahlungen der Rentenkasse zu bekommen, bevor Gevatter Tod sich seiner annahm. Heute dauert ein Rentnerdasein im Durchschnitt fast 20 Jahre.v
Steigt die Lebenserwartung der Rentenbezieher weiter an, bleibt das Renteneintrittsalter konstant und entwickelt sich die Bevölkerung wie derzeit prognostiziert, dann werden unter diesen Voraussetzungen im Jahr 2060 durchschnittlich 1,5 Beitragszahler für den Unterhalt eines Rentners aufkommen – oder anders ausgedrückt 100 Beitragszahler für etwa 67 Rentner. Heute sichern immerhin noch drei Arbeitnehmer den Lebensabend eines Ruheständlers, wie Björn Schwentker und James W. Vaupel, Bevölkerungswissenschaftler am Max-Planck-Institut für demographische Forschung, in ihrem Artikel „Eine neue Kultur des Wandels“ erläutern.
Der mögliche Kollaps des gesetzlichen Rentensystems wird jedoch zumeist unter der Prämisse diskutiert, dass das Renteneintrittsalter starr bei 65 Jahren bleibt und lediglich die Lebenserwartung steigt. Gestaltet man die Altersgrenze flexibel und passt sie der demographischen Entwicklung an, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Schon eine konsequente Umsetzung der Rente mit 67 könnte dazu führen, dass im Jahr 2060 die 100 Beitragszahler nur noch für 60 Rentner aufkommen müssen. Stiege die Rentenaltersgrenze proportional zur Lebenserwartung, so müssten die 100 Einzahler sogar nur 40 Rentner finanzieren.
Ein Blick auf die deutsche Alterspyramide auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zeigt zudem, dass sich nach 2050 die Lage langsam wieder entspannen wird.vi Sind die Babyboomer erst einmal tot und werden die ihnen nachfolgenden Alterskohorten alt – die Generation Pillenknick –, wird sich das Zahlenverhältnis von Jüngeren zu Älteren voraussichtlich wieder zugunsten der Jüngeren verschieben. Am Ende des 21. Jahrhunderts könnten mehr Junge für einen Alten aufkommen als zu Beginn, prognostizieren Schwentker und Vaupel. Die Überalterung der deutschen Gesellschaft ist, falls überhaupt, vor allem ein Problem der Babyboomer-Generation. Auf längere Sicht könnte es sich um ein Übergangsphänomen handeln.
b. Das Alter vor dem Alter – Altern als langfristiger Prozess
Die meisten Altersszenarien unterstellen, dass die Phase des Alters vor allem durch Defizite geprägt ist. Die Perspektiven einer alternden Gesellschaft werden immer noch vor allem anhand von Pflegebedürftigkeit, Demenz und Unterstützungsbedarf thematisiert. „Es gibt aber ein Alter vor dem Alter“, wie es Frank Junghänel in seinem Artikel „Die Ungehorsamen“ so schön formulierte.
Im Alltag sind die heutigen Alten längst weiter, als es die zum Teil hysterisch geführte Debatte zur Alterung der Gesellschaft suggeriert. Sie fühlen sich nicht nur jünger als die Generation vor ihnen, sie verhalten sich auch so. 1985 probierte nur jeder fünfte 65- bis 74-Jährige gern Neues aus. Heute ist es jeder dritte. Die derzeit 80- bis 85-Jährigen fühlen sich im Durchschnitt knapp zehn Jahre jünger, als sie es tatsächlich sind, und ein Drittel von ihnen würde sich selbst auch nicht als alt bezeichnen. Im Vergleich zu den 1980er Jahren sind die Alten heute wesentlich mobiler, gesünder und reiselustiger, so die Ergebnisse der Generali Altersstudie 2013.
Die Angehörigen der Generation 50 plus sind zudem in ihrem Habitus vielfach jugendlicher als ihre eigenen Kinder. Familie, Eigenheim und sicherer Job waren die Werte der Eltern der Babyboomer. Heute sind es die Werte ihrer Kinder. Die Babyboomer selbst brettern derweil mit dem Mountainbike durch den Wald, gehen weiterhin auf Anti-AKW-Demonstrationen und wehren sich gegen Großbauprojekte. Hat das seit einiger Zeit in den deutschen Medien so verbreitete Thema der vergreisenden Gesellschaft unter Umständen nur deshalb Konjunktur, weil die Babyboomer, die derzeit gesellschaftlich tonangebende Generation, selbst nicht alt werden wollen? Tote Hosen und Stones. Forever young. So viel Jugend über 50 war nie. Alles eher eine Frage des Bewusstseins denn des gesellschaftlichen Seins?
c. Die Lebenszufriedenheit wächst mit den Jahren
„Das Altwerden ist aus der Mode geraten“, schreibt Judith von Sternburg im Frühjahr 2014 in der Frankfurter Rundschau. Trotzdem altern wir letztendlich alle, und zu altern heißt auch abzubauen. Für die meisten Menschen ist ab dem 50. Lebensjahr die „wartungsfreie“ Zeit vorbei. Die krankheits- und verschleißbedingten Einschränkungen nehmen zu. Der Meniskus zwickt, die Bandscheibe drückt. Jede durchgemachte Nacht hinterlässt deutliche Spuren. Der Regenerierungsaufwand steigt und die Lesebrille wird zum steten Alltagsbegleiter. Die Bewegungen werden langsamer und mühsamer, der Aktionsradius schrumpft.
Doch längst nicht jeder Alte wird automatisch zum Pflegefall. Eine Studie des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2013 ergab, dass selbst Hundertjährige sich vielfach selbst helfen. 88 Prozent von ihnen leiden zwar unter Seh- und Hörstörungen, doch immerhin 21 Prozent beziehen keine Leistungen der Pflegeversicherung. 59 Prozent der Hundertjährigen leben noch zu Hause, ein Drittel sogar allein. Unterstützung wird insbesondere im Alltag beim Putzen und der Haushaltsführung benötigt. Pflegedienste werden nur selten und erst dann in Anspruch genommen, wenn gar nichts mehr geht. Wer pflegerische Unterstützung braucht, erhält sie meist von seinen Kindern, die dann allerdings oft auch schon jenseits der 70 sind.vii
Selbst wenn die körperlichen und geistigen Einschränkungen mit dem Alter objektiv zunehmen, senkt dies nicht automatisch die allgemeine Lebenszufriedenheit und Aktivität der älteren Generation, so die Ergebnisse der Generali Altersstudie 2013. Zwar gibt es vielfältige Formen der Demenz, doch nicht jeder von dieser Krankheit Betroffene erscheint unglücklich. Auch Trauer und Rückzug erfolgen nicht zwangsläufig. Stärker als das biologische Alter beeinflussen Schulbildung, Einkommen und familiäre Beziehungen die Lebenszufriedenheit.
Ob ein Mensch zufrieden ist, hängt auch von individuellen Wertvorstellungen und dem eigenen Anspruchsniveau ab. Und im Alter verändern sich für zentral erachtete Werte, Ziele und Vorhaben sowie die Zeitperspektive für das eigene Leben. Persönlicher Erfolg und Leistung verlieren an Bedeutung. Das Schicksal anderer Menschen, die Erhaltung der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung rücken in den Vordergrund. Intensiver wird die Verbundenheit mit nachfolgenden Generationen empfunden. Die Todesfurcht sinkt und die mystische Dimension des Lebens wächst. Ein beachtlicher Anteil der Alten empfindet das eigene Altern durchaus als positiv. Nichts mehr leisten zu müssen, aber durchaus zu können, weniger Verantwortung für andere tragen zu müssen, aber zu dürfen, bringt eine „späte Freiheit“, die durchaus genossen wird. So werden die späteren Lebensphasen eher von jungen als von alten Menschen als problembehaftet angesehen; Alte sind in der Regel zufriedener als Junge.
d. Politisches Engagement im Alter
Die Babyboomer sind seit ihrer Jugend kampf- und demonstrationserprobt. Als es gegen Wackersdorf und die Startbahn West ging, waren sie jung, sägten Strommasten ab und bauten Hüttendörfer. Heute sind sie etabliert und kämpfen, gut vernetzt als Bürgermeister, PR-Berater, Ingenieure, Rechtsanwälte und Oberstudienräte, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die für schädlich gehaltenen gesellschaftlichen Entwicklungen und Großprojekte. Kreative Demonstrationsformen mischen sich mit verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Schadensersatzforderungen. Im Ergebnis machten immer höhere Sicherheitsauflagen schon so manches Großprojekt unwirtschaftlich und ließen es scheitern.
Auch die schon in die Rentenjahre gekommene Generation der Alt-68er verfügt vielfach über wirtschaftliche und soziale Ressourcen, weiß, wie politische Erfolge gestaltet werden können, und ist nicht bereit, sich mit einer verordneten Funktionslosigkeit abzufinden. So besetzten im Sommer 2012 einige Rentner im Alter zwischen 67 und 76 Jahren über mehrere Monate eine Begegnungsstätte in Berlin-Pankow, die wegen fehlender Finanzmittel des Bezirks geschlossen werden sollte. Sie erreichten, dass die soziale Einrichtung nun langfristig gesichert ist und nicht wie ursprünglich geplant verkauft wurde. Die Aktion der Pankower Rentner erfuhr hohe internationale Aufmerksamkeit, weil Hausbesetzungen immer noch eher mit 20- als mit 70-Jährigen assoziiert werden.viii Dies könnte sich in den nächsten Jahren jedoch ändern. Der demographische Wandel lässt erwarten, dass die „renitenten Alten“, die effizient Formen des Protestes nutzen, um sich für ihres Erachtens gesellschaftlich notwendige Veränderungen zu engagieren, in Zukunft mehr werden. Die im Herbst 2011 gestarteten Montagsdemonstrationen gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens finden auch 2014 weiterhin wöchentlich statt. Die dort vorherrschende Haarfarbe ist grau und nicht mehr (henna-)rot.
Deutlich erkennbar sind die Älteren an einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung der Gesellschaft über ihr eigenes Leben hinaus interessiert, fand das Allensbach-Institut in seiner Generali Altersstudie 2013 heraus. Im statistischen Mittel sind die derzeitigen Rentner gut abgesichert, und so ist nur für ein Fünftel der über 65-Jährigen materieller Wohlstand erstrebenswert. Für 69 Prozent von ihnen ist soziale Gerechtigkeit eine zentrale Wertvorstellung. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Verringerung der Staatsschulden, die Familienpolitik sowie Umwelt- und Klimaschutz sehen die 65- bis 85-Jährigen als vorrangige Aufgaben an. Politische Prioritäten liegen bei den Älteren durchaus nicht nur auf den Interessen der eigenen Generation. 22 Prozent halten eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der jüngeren Generationen für wichtig. Ein Drittel der Älteren will Verantwortung für andere übernehmen.
e. Und die Jungen?
Im Vergleich zur Dynamik der von Älteren dominierten Demonstrationen gegen Großprojekte wie Stuttgart 21 oder den Berliner Flughafen wirken die Proteste der Jüngeren, zum Beispiel gegen Studiengebühren, fast harmlos. Auch währt das politische Engagement der nachwachsenden Generation manchmal nur einen Sommer. Das Frankfurter Occupy-Camp aus dem Jahr 2012 befand sich 2013 schon im Fundus des Historischen Museums der Stadt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als fehle es den derzeit Jungen im Vergleich zu ihren Eltern und Großeltern an Durchhaltevermögen, Impertinenz und Durchsetzungsfähigkeit. So beklagte sich die junge Journalistin Anita Blasberg im Frühjahr 2013 in ihrem Zeit-Essay „Die schon wieder“ darüber, dass die Macht der Alten (der Babyboomer) ihr keine Luft zum Leben lasse. Wenig Verständnis erhielt sie für ihre Klage von dem Journalisten Jens Jessen, der ihr in seiner Replik „Warum so verzagt?“ entgegenhielt, dass „die Sache der Jungen“ von diesen selbst in die Hand zu nehmen sei. Sie müssten „auch mental von zu Hause ausziehen“.
Als Generation Y werden, mit mehr oder minder starken Abweichungen nach oben und unten, im Kern die zwischen 1980 und 1990 Geborenen bezeichnet. Die Bezeichnung „Y“ – englisch wie „Why“ („Warum“) ausgesprochen – deutet schon auf ein wesentliches Merkmal dieser Generation hin: Sie stellt erst einmal alles in Frage. So, wie sie in manchen Medien gern dargestellt wird, scheint das Anpacken nicht ihre Sache zu sein. Die „Boomerang Kids“ ziehen wieder bei ihren Eltern ein oder gar nicht erst aus dem „Hotel Mama“ aus.
Muss ein Kind das Elternhaus doch irgendwann verlassen, weil Studienplatz und/oder neuer Job nicht um die Ecke liegen, so sind es häufig die gut situierten Mittelklasse-Eltern, die die Wohnung suchen, finanzieren und einrichten. Sie, die es selbst nicht erwarten konnten, das Elternhaus zu verlassen, sind von ihrer Jugend an darin geübt, Umzüge zu organisieren. Dank ihrer hohen Vitalität managen sie heute das Leben ihrer erwachsenen Kinder. Der Nachwuchs lässt es sich gern gefallen und genießt den Service, derweil die „Helicopter Mum“ das Bewerbungsgespräch klarmacht und Papa die durch ihn finanzierte Einbauküche für den Sprössling zusammenschraubt.
„Wollen die auch arbeiten?“, fragten Kerstin Bund, Uwe Jean Heuser und Anne Kunze im Frühjahr 2013 provozierend und kamen in ihrem ausführlichen Generationenporträt zu dem Ergebnis, dass die heutige Jugend „faul und schlau“ sei. Von ihren Mittelklasse-Eltern immer gefördert und gefeiert, hätten diese jungen Erwachsenen auch weiterhin deren völlige Aufmerksamkeit. Und die erwarteten sie nun auch von ihren Arbeitgebern, ebenso wie Fürsorge, Mitspracherecht und ständiges positives (!) Feedback. Der Chef soll wie Papa und Mama jederzeit vollständig auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Die Generation Y legt viel Wert auf ihre persönliche Entfaltung und ringt schon im Einstellungsgespräch mit ihren potenziellen Arbeitgebern um eine gute Work-Life-Balance. Sie vertraut nicht auf zukünftige positive Entwicklungen und fordert dementsprechend den Lohn für ihren Einsatz sofort. Und der besteht nicht nur aus Geld. Die Jungen seien durchaus weltoffen und kreativ, ist in dem Generationenprofil der drei Journalisten zu lesen. Aber sie würden alles vermeiden, was für sie persönlich keinen Sinn ergibt und wo der Spaß sich in übersichtlichen Grenzen hält.
Ihren Arbeitgebern fühlen sich die jungen Arbeitnehmenden weniger verbunden als ihre Eltern vor 30 Jahren. Während 1984 die unter 30-Jährigen im Schnitt 814 Tage bei einem Arbeitgeber blieben, sind es heute nur noch 536 Tage. Nicht immer ist dies den zunehmend befristeten Arbeitsverhältnissen geschuldet. Stimmen die Bedingungen nicht (mehr), sind die Jungen schnell wieder weg. Zwar fand die Shell-Jugendstudie bereits im Jahr 2010 heraus, dass Ehrgeiz und Fleiß durchaus auch zu den Werten der Generation Y zählen. Aber die Mischung sei eine andere als noch in der Elterngeneration, erklärten Bund, Heuser und Kunze. Die jungen Arbeitnehmer wollen nicht um jeden Preis weiterkommen und Karriere machen. Sie wollen auch Spaß und Sinn in der Arbeit finden, möchten insbesondere gestalten können. Soziale Beziehungen und Selbstverwirklichung sind ihnen wichtig. Quälen wollen sie sich auf keinen Fall und auch Verantwortung ist nicht immer ihr Ding.
Diese Einstellungen und Verhaltensweisen könnten in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft, die sich wieder mehr an sozialen als an materiellen Gütern orientiert, durchaus Zukunft haben. Dass die Jungen wirklich weniger leisten, ist empirisch nicht nachgewiesen. Und so sieht der Jugendforscher Klaus Hurrelmann in dieser Generation Potenzial. Seine Forschungen ergaben, dass sie durchaus die Gesellschaft gestalten will. Es gibt sie durchaus, die engagierten Jungen. Im Unterschied zu ihren Eltern und Großeltern definieren sie ihr politisches Engagement nur nicht als solches, sondern sehen es eher als ein individuelles Projekt.
Zu erwarten ist, dass die künftigen Alten die Zeit, die Kompetenzen, das kreative Potenzial und den Willen haben werden, sich um die Lösung der anstehenden gesellschaftlichen Probleme zu kümmern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Jungen es ihnen gleichtun werden – in anderer Weise mit anderen Mitteln, aber gegebenenfalls für durchaus dieselben Ziele.
2. Deutschland wird wärmer – spürbare Folgen des Klimawandels
Typischerweise messen Ökonomen das Wirtschaftswachstum eines Landes anhand der gesamtwirtschaftlichen Produktion oder der Produktionsleistung pro Kopf.ix Und so, wie bei einer Geldanlage der Zinseszins nicht zu unterschätzen ist, steigt auch bei geringem prozentualen Anstieg des Wirtschaftswachstums die absolute Menge der produzierten Güter und Dienstleistungen immer weiter und über die Jahre kommt einiges zusammen. In Deutschland hat sich auf diese Weise die materielle Gütermenge pro Kopf seit dem Jahr 1950 verfünffacht.x Doch für all diese Güter, für unsere Heizungen, unsere Autos, aber auch die industrielle Produktion – für alles benötigen wir Ressourcen. Und je nachdem, was wir tun und wie wir konsumieren, wächst unser Energiebedarf. Der CO2-Ausstoß wird zum Maßstab unseres Handelns, und diese CO2-Produktion ist es, die das Weltklima verändert und die Erderwärmung steigen lässt.
Zwei, drei, vier Grad Erderwärmung – die politischen Diskussionen erscheinen abstrakt, die Temperaturunterschiede nicht hoch. Schließlich haben wir im Winter auch mal minus 20 Grad und im Sommer steigt das Thermometer auf über 30 Grad. Was sollen da die paar Grad Erderwärmung schon bewirken, fragt sich mancher und schaltet gelangweilt den Fernseher aus, wenn vermeintliche Klimahysteriker Zukunftsszenarien entwickeln.
Sonnenanbeter und Rotweinliebhaber mögen im Temperaturanstieg sogar eine Verbesserung sehen. Doch eine um wenige Grad erhöhte Durchschnittstemperatur ist nicht zu unterschätzen. In der Schule lernten wir, dass vor vielen Millionen Jahren eine Eiszeit zum Artensterben und wohl auch zum Aussterben der Dinosaurier beitrug. Vielleicht stellen wir uns die Eiszeit als ein Leben im Kühlfach vor. Doch die durchschnittliche Temperaturdifferenz zwischen Eiszeit und „Normalzeit“ betrug nur fünf Grad – und veränderte das Leben auf der Welt dennoch gravierend. Zwei Grad Erderwärmung haben wir schon in den letzten 100 Jahren realisiert, weitere Erhöhungen kämen einer „Heißzeit“ gleich, wie es Joachim Wille im Frühjahr 2014 in seinem Artikel „Es ist fünf vor zwölf“ formulierte. Die zu erwartenden Folgen dürften ähnlich einschneidend wie bei einer Eiszeit sein, nur unter umgekehrten Vorzeichen.
Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen werden mehr, heftiger und folgenreicher, so die Prognosen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen. In vielen Regionen der Erde ist mit Änderungen des Wasserkreislaufs durch veränderte Niederschläge sowie Eis- und Schneeschmelze zu rechnen. Dies hat Einfluss auf die Wasserverfügbarkeit und -qualität, das Hochwasserrisiko und das Energiegewinnungspotenzial. Der Klima-Ausschuss geht in seinem Bericht vom Frühjahr 2014 davon aus, dass sich die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 – abhängig vom zukünftigen Anstieg der Emissionen – um weitere zwei bis vier Grad erhöhen wird. In der Folge sei damit zu rechnen, dass Lebensräume für Mensch und Tier verschwinden, Anbauzonen sich verschieben und die Nahrungsversorgung immer schwieriger wird. Der Klimawandel werde die Biodiversität und die Artenzusammensetzung weiter beeinträchtigen. Erhöhte Wassertemperaturen und die Versauerung der Ozeane können zu sehr starken Schäden an Korallenriffen führen. In den arktischen Polarregionen kann der Klimawandel die Lebensräume einiger Arten sowie die Produktion von mariner Biomasse und damit die Nahrungsketten beeinträchtigen. In Europa können ökologisch wertvolle Feuchtgebiete in Küstenregionen und Pflanzengesellschaften in den Alpen zerstört werden. Während eine Erhöhung um maximal zwei Grad derzeit noch als tragbar eingeschätzt wird, sind darüber hinausgehende Temperatursteigerungen mit gravierenden Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft verknüpft, so die Einschätzung des IPCC.
Einen Teil der Folgen spüren wir schon heute. Die Anzahl der extremen Wetterereignisse hat sich bereits in den letzten drei Jahrzehnten verdoppelt und der Trend hält an, mahnt Joachim Wille. „Jahrhundertfluten“ finden mittlerweile nicht nur in Brandenburg alle zehn Jahre statt, Spanien leidet schon heute unter Trockenheit und die romantischen Südseeinseln erfahren immer häufiger „Land unter“. Der Smog, durch Heizkraftwerke und Autos ausgelöst, wird insbesondere in Asien immer dichter und gefährdet die Gesundheit vieler. Den durch Atembeschwerden beeinträchtigten Kindern und Alten bleibt derzeit nichts anderes übrig, als sich mit primitiven Schutzmasken durch den Verkehrssmog zu kämpfen oder sich in die Häuser zurückzuziehen. In den hoch belasteten Regionen sterben die Menschen früher als erwartet. Umweltverschmutzung ist mittlerweile selbst in China ein Politikum. Aber auch in Deutschland ist die Luft – vor allem in Ballungsgebieten – weiterhin durch krebserregende Feinstäube und Stickoxide belastet. In Regionen mit intensiver Landwirtschaft ist das Grundwasser durch Nitrate und Pestizide verseucht, die Risiken in der Trinkwasserversorgung steigen.
Im Frühjahr 2014 erschien der Bericht zur Lage der Natur in Deutschland. Umweltschutzbehörden und Naturschutzverbände haben hierfür gemeinsam die Landschaft kartographiert und bundesweit 12.000 Stichproben gesammelt. Das Ergebnis der Studie ist niederschmetternd: In 70 Prozent des Bundesgebietes ist die Erhaltung des Lebensraums für Tiere unzureichend oder schlecht. Dementsprechend ist fast jede dritte Tierart bedroht.xi Die Veränderung der Welt ist nicht nur eine abstrakte Prognose. Den Jüngeren unter uns und den nachfolgenden Generationen könnten diese Lebewesen fehlen.
Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wahrnehmen oder nicht: Der Klimawandel ist in vollem Gange und er wird wesentlich umfassender als der demographische Wandel unser Leben verändern. Alle demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie Konzepte zu ihrer Gestaltung sind ohne eine Berücksichtigung der klimatischen Determinanten nicht sinnvoll denkbar. Die Folgen des Klimawandels bestimmen die Rahmenbedingungen und den Handlungsspielraum bei der Gestaltung unseres Lebens – für Jung und Alt.
a. Soziale und wirtschaftliche Folgen
Die Menschen werden wohl überleben, aber das Leben wird sich ganz anders als heute gestalten. „Das Wasser wird knapper“, vermeldete die dpa Ende 2013. Allein durch die Zunahme der Welttemperatur um zwei Grad, die praktisch nicht mehr zu verhindern ist, werden voraussichtlich 15 Prozent der Weltbevölkerung mehr von dieser Wasserknappheit betroffen sein. Deutlich trockener wird es im Mittelmeerraum, im Nahen Osten, im Süden der USA und in Südchina. Gleichzeitig ist nicht nur in Europa mit einer steigenden Nachfrage nach Wasser zu rechnen, beispielsweise für die Landwirtschaft oder den privaten Gebrauch. Ist künftig aber weniger Wasser aus Flüssen und erneuerbaren Grundwasserressourcen verfügbar, so kann dies dazu führen, dass der Wasserbedarf nicht gedeckt werden kann.
In seinem Artikel „Es ist fünf vor zwölf“ prognostiziert Joachim Wille, dass Hitzewellen zu Ernteausfällen führen werden. Wärmeliebende Parasiten, landwirtschaftliche Schädlinge und Krankheitserreger werden sich ausbreiten. Millionen von Menschen werde dadurch in den nächsten Jahrzehnten ihre bisherige Lebensgrundlage entzogen. Zu erwarten sei, dass die Ernteerträge bei Getreide im Durchschnitt pro Jahrzehnt um 2 Prozent sinken werden, der Bedarf im selben Zeitraum jedoch um 14 Prozent steigen werde. Der höhere Strombedarf für Klimaanlagen lasse zudem den CO2-Ausstoß weiter steigen, was wiederum die Klimaerwärmung fördere – ein Teufelskreis.
Steigen die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts nur um zwei Grad an, ist damit zu rechnen, dass die Nahrungsmittelproduktion und -sicherheit in Afrika sowie Mittel- und Südamerika gefährdet werden. Die landwirtschaftlichen Erträge von Weizen, Reis und Mais in den tropischen und mittleren Breiten werden sinken und in der nahen Zukunft zu negativen Folgen für die Nahrungsmittelversorgung und letztlich zur Verschärfung von Hungerkrisen führen, befürchtet der IPCC in seinem Bericht vom Frühjahr 2014. Insgesamt können die erwarteten Folgen des Klimawandels die Gesundheit der Menschen in ärmeren Gesellschaften stark beeinträchtigen und für viele sogar den Tod bedeuten. In reicheren Gesellschaften sei vor allem mit ökonomischen Einbußen zu rechnen, so die ernüchternden Prognosen des IPCC. Doch selbst in Europa könnten Hitzewellen künftig zu größeren gesundheitlichen Problemen und erhöhter Sterblichkeit führen.
Es ist nicht nur die Natur, die leidet, und es sind nicht nur erhöhte Sachschäden, mit denen wir rechnen müssen. Der Klimawandel wirkt auch als Katalysator für soziale Ungleichheit, ist Bernd Sommer vom Interdisziplinären Institut für Umwelt-, Sozial- und Humanwissenschaften an der Universität Flensburg überzeugt. Die Folgen des Klimawandels wie eine geänderte Niederschlagsverteilung, die Versauerung der Ozeane, das Artensterben, regional eingeschränkte Wasserverfügbarkeit und zunehmende Erosionsgefährdung können die ohnehin schon vorhandene soziale und wirtschaftliche Ungleichheit verschärfen, schreibt er in seinem Artikel „Zu heiß für die Armen“. Der Klimawandel hat auch soziale Konflikte, Armut und Hunger zur Folge und könnte eine nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen, so die Einschätzung des IPCC. Und das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie prognostiziert in seiner Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“, dass die Kämpfe um fehlende Nahrungsmittel, der Mangel an Wasser und schrumpfende Überlebensräume die geopolitischen Konflikte um die Verteilung knapper Ressourcen verschärfen werden.
Auslöser für Hungerkrisen sind aber nicht nur Dürren, Überschwemmungen und Missernten, sondern auch steigende Lebensmittelpreise. Sie werden zusätzlich angeheizt durch den Biosprit-Anbau und den wachsenden Konsum von Fleisch und Milch in Schwellenländern, die sich an unserem westlichen Ernährungsverhalten und Lebensstil orientieren. Die aufstrebenden Länder pochen schon heute auf ihre Ansprüche zur Teilhabe, die Etablierten wollen nicht verzichten. Da wir seit einigen Jahren weltweit mehr Ressourcen verbrauchen, als regeneriert werden können, werden auch die alten Industrieländer von einem Wachstumsrückgang mit Verteilungskämpfen und sozialen Unruhen nicht verschont bleiben, ist der Club of Rome überzeugt.xii
Letztlich sind es vor allem die Armen, die unter den Auswirkungen des Klimawandels zu leiden haben, wie Bernd Sommer in seinem Artikel „Zu heiß für die Armen“ erläutert. So sind zum Beispiel zahlreiche Staaten Afrikas und Asiens besonders schlecht in der Lage, sich auf die derzeitigen und künftigen Folgen des Klimawandels einzustellen. Obwohl sie zur Klimaerwärmung bisher wenig beigetragen haben, führen fehlende ökonomische Ressourcen und/oder mangelnde staatliche Kapazitäten dazu, dass insbesondere sie unter den Folgen der Klimaveränderungen leiden. Während wir in Deutschland durch Hochwasserschutz und eine gute technische Infrastruktur die Folgen von Naturkatastrophen noch halbwegs auffangen können, führen Überschwemmungen, Hurrikane und Epidemien in diesen Ländern zu einer weiteren Verschärfung der Armut und der sozialen Ungleichheit. Und auch in wohlhabenden Ländern sind die Armen von den Klimafolgen stärker betroffen als die Reichen: Extreme Hitzewellen führen in Stadtteilen mit wenig Parks, Schwimmbädern und Gärten, schlechter Bausubstanz, höherer Verkehrsbelastung und fehlender Frischluftzufuhr dazu, dass die Gesundheit der Bewohner hier stärker beeinträchtigt wird. Reiche können sich besser als Arme vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen. In der Folge vergrößert sich die soziale Kluft weiter – in unserem Land und weltweit. Früher oder später werden wir jedoch alle die sozialen Folgen spüren und sie werden mehr oder minder auch das Leben der Wohlhabenden beeinträchtigen.