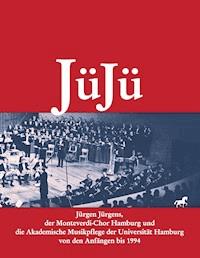
JüJü E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einem Glücksfall ist es zuzuschreiben, dass die Akademische Musikpflege der Universität Hamburg und der ihr zugehörige Monteverdi-Chor sehr schnell eine Wertschätzung erlangten, die noch immer weit über den universitären Bereich und über die Grenzen der Hansestadt hinausreicht. Der Glücksfall hat einen Namen: Jürgen Jürgens. Das Besondere der Lebensleistung des späteren Universitätsmusikdirektors Prof. Jürgen Jürgens (1925-1994) liegt darin, dass er sich schon früh um die Aufführungspraxis "Alter Musik" mit dem Schwerpunkt der Wiederaufnahme Claudio Monteverdis in das Konzertprogramm unserer Zeit verdient gemacht hat, aber auch die Werke anderer Epochen bis in die Moderne nicht vernachlässigte. Und er hat die von ihm gegründeten vokalen und instrumentalen Ensembles der Universität Hamburg zu musikalischen Höhenflügen geführt, wie sie nur in seltenen Fällen von Amateuren erreicht werden. Neben Einblicken in die Chor- und Orchesterarbeit und in den Lebensweg Jürgen Jürgens‘, einer Diskographie, seinen Editionen sowie den umfangreichen Repertoirelisten seiner Ensembles vermittelt dieses Buch ein spezifisches Stück Zeit- und Kulturgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abb. 1 Universitätsmusikdirektor Professor Jürgen Jürgens im Dezember 1974
Jürgen Jürgens, der Monteverdi-Chor Hamburg und die Akademische Musikpflege der Universität Hamburg von den Anfängen bis 1994
Inhalt
Ein Geleitwort
Vorwort
Jürgen Jürgens und die Monteverdi-Renaissance
Der Mensch Jürgen Jürgens und sein Lebensweg
Annäherung an die Persönlichkeit
Kindheit und Jugend
Militärdienst
Nachkriegszeit und Studium
Beginn in Hamburg und Gründung des Monteverdi-Chores
Schneller Aufstieg
Auf der Höhe des Erfolges
Gastdirigate, Seminare und Jurorentätigkeit
Persönliche Beziehungen und Freundschaften
Eigenheiten und Skurrilitäten
Die Kräfte lassen nach
Rückzug und Abschied
Gedenkrede des Präsidenten der Universität Hamburg
Die musikalische Entwicklung des Monteverdi-Chores
Grundzüge der Entwicklung
Das Repertoire
Die Konzerte
Die Chorwettbewerbe
Mitwirkung bei Feierlichkeiten und Festveranstaltungen
Rundfunk und Fernsehen
Die Schallplatten und CD-Aufnahmen
Die Akademische Musikpflege
Chronologischer Überblick
Chor und Orchester der Universität
Die Camerata Accademica
Persönliche Erinnerungen eines Orchestermitglieds
Mitwirkende Ensembles, Instrumental- und Gesangssolisten
Wie andere Jürgen Jürgens erlebten
Jürgen Jürgens der Familienmensch
Die Sicht der Chor- und Orchestermitglieder
Die Sicht Außenstehender
Jürgen Jürgens in Texten und Sprüchen
Die Chorrundschreiben
Zeugnisse der Jürgens'schen Dichtkunst
Ein Gaudio ist's mit dem Claudio (Faksimile-Abdruck des Originals)
Kaiserwalzer 1979
Aussprüche während der Probenarbeit
Die Chorgemeinschaft der Claudioten
Entstehung und Entwicklung der Chorgemeinschaft
Von Anfang an dabei
Der Sunderhof
Die Chorproben
Eindrücke eines japanischen Gastes
Die „Baumblütenkonzerte“ in Altenwerder 1979 – 1994
Was ziehen wir an?
Neu im Monteverdi-Chor
Aus dem Alltagsleben eines Monte-Choristen
Chor-Kinder
Die großen Chorfeste
Abschied vom Monteverdi-Chor
Organisation und Finanzen des Monteverdi-Chores
Die Reisen
Singend und musizierend die Welt erleben
Das legendäre Arezzo
Wien 1966
Griechenland, Türkei und Vorderer Orient 1969
Der Empfang im Weißen Haus – USA 1972
Mit Chor und Orchester in die USA 1975
Der Schlafwagenschaffner – Bonn 1979
25 Tage Lateinamerika-Tournee 1979
Philippinen 1981
Israel 1982
USA 1982 – Reisesplitter
Polen 1983
Australien 1986
Israel 1987
Der Tag des Gerichts in der Wüste bei Beer Sheva
Südamerika 1988 – eine Konzertreise mit Hindernissen
Ungarn 1991
Die musikalischen Ableger des Monteverdi-Chores
Die „Montevideo Swingers“
„Elysium-Quartett“ und „Hamburger Vokal-Quartett“
Anekdoten und Episoden
Chor- und andere Mucken
Zu besonderem Humor neigte immer der Tenor
Chorgeschichte – Weltgeschichte
Bunte Geschichtchen
Das Ende der Ära Jürgens
Nachruf
Lieber Monteverdi-Chor
40 Jahre Monte-Chor – ein Rückblick in Versen
Selige Erinnerungen
Nachklänge
Anhang
CHRONOLOGIE
DAS REPERTOIRE DES MONTEVERDI-CHORES
DAS REPERTOIRE VON UNIVERSITÄTS-CHOR UND -ORCHESTER
DISKOGRAFIE
EDITIONEN JÜRGEN JÜRGENS
VERZEICHNIS DER INFORMATIONSQUELLEN
VERZEICHNIS DER FOTOGRAFEN
VERFASSERVERZEICHNIS
Peter Fischer-Appelt1
Über das Gaudio mit dem Claudio
Ein Geleitwort
Dieses Buch ist ein Werkstattbericht im Rückblick auf die Arbeit des Monteverdi-Chors Hamburg in den ersten vierzig Jahren seines Bestehens. Wer sich von dem Kaleidoskop der hier zusammengestellten Beiträge mehrerer Chor- und Orchestergenerationen faszinieren lässt, wird bemerken, welche Anziehungskraft von dem gemeinsamen musikalischen Unternehmen auf die singenden und spielenden Mitglieder selbst, aber auch auf die mitwirkenden Gesangs- und Instrumentalsolisten allererster Provenienz ausgeht. Man gewinnt ein mehr als oberflächliches Verständnis für die musikalischen Ansprüche, den immensen Zeiteinsatz und die erheiternden Umstände, unter denen dieses aus der Akademischen Musikpflege einer Universität immer neu rekrutierte Amateurensemble einen Spitzenplatz im internationalen Musikleben erworben hat und behaupten kann.
All diese Beiträge sind eine Hommage an den Gründer und ersten Leiter des Monteverdi-Chors Jürgen Jürgens (1925-1994). Mit seiner vielseitigen künstlerischen Persönlichkeit, ihren inspirierenden Stärken und einnehmenden Schwächen, übte er eine Führungskraft und Bindungswirkung ohnegleichen auf seine Choristen aus; doch so, dass er diese Beziehung gleichsam aufhob in den Gesang und aufleuchten ließ in Herzen und Sinnen als das bewegende Humanum der Musik. Mit dieser denkwürdigen Transparenz, die das singende und sagende Klangereignis des Chorgesangs zu Gehör eines faszinierten Publikums brachte, leitete er, gestützt durch akribische Studien von Originaldrucken der Madrigalliteratur, vor fünfzig Jahren die Renaissance des bis dahin nur Kennern vertrauten Komponisten Claudio Monteverdi (1567-1643) ein. Dieses musikgeschichtliche Ereignis par excellence, das von Silke Leopold im ersten Beitrag des Bandes beschrieben wird, verschaffte dem Monteverdi-Chor Hamburg mit einem Schlag weltweite Beachtung und Anerkennung auf dem Gebiet der Alten Musik.
Jürgen Jürgens, hervorgegangen aus dem Musischen Gymnasium Frankfurt, schon früh ein Meister des lyrischen Umgangs mit der Sprache, studierte in Freiburg und wurde dort zum Verfasser von Libretti für Opern und Kantaten, von Schauspielen und Schulfunk-Manuskripten und von zahllosen Gedichten. Seinen Traum von der Leitung eines eigenen Ensembles erfüllte er sich mit der Gründung des „Chors der italienischen Sprachkurse“ der Universität Freiburg, mit dem er acht Rundfunkaufnahmen des Südwestfunks Baden-Baden produzierte. Er musste diese Arbeit indes abbrechen und aus familiären Gründen nach Hamburg wechseln. Im Gründermetier bereits erfahren hob er hier alsbald den Chor des Istituto Italiano di Cultura di Amburgo aus der Taufe und trat am 14. März 1955 erstmals vor die Sängerinnen und Sänger des Ensembles: Gründungsdatum und Urzelle des „Monteverdi-Chors Hamburg“: der Name, den er kurze Zeit später erhielt.
Als die Ergebnisse nicht ausblieben, 1959 im Chorwettbewerb von Arezzo der 1. Preis in der Kategorie „Gemischte Chöre“, große Erfolge bei Konzertauftritten in und um Hamburg, vertraute die Universität Hamburg dem Leiter des Monteverdi-Chors den Aufbau der „Akademischen Musikpflege“ neuerer Provenienz an. Im Jahre 1961 erhielt Jürgen Jürgens hierfür einen Lehrauftrag, wurde 1966 zum „Universitäts-Musikdirektor“ im Angestelltenverhältnis und 1973 in dieser Funktion zum beamteten „Professor der Universität“ ernannt. Damit konnte zugleich ein Ruf zur Leitung des RIAS-Kammerchors abgewendet werden. Die Früchte dieser Aufbauarbeit bestanden, technisch gesehen, in der Arbeit mit vier Ensembles: Chor und Orchester der Universität, die zu großen, leistungsfähigen Klangkörpern herangebildet wurden, bei den Semesterkonzerten ergänzt durch den Monteverdi-Chor und die 1968 gegründete Camerata Accademica sowie durch professionelle Gesangs- und Instrumentalsolisten.
Ich deutete bereits an, dass Andacht und Aufklärung, diese zwei geschiedenen Geister unseres Daseinsverständnisses, in der Musik Monteverdis erstmals zu einer einzigen bewegenden Einsicht in das Geschick des Menschen verbunden sind. Es war die für den weiteren Weg seiner Interpretationen entscheidende Leistung von Jürgen Jürgens, dass er diese beiden Charaktere mit seinem Chor und den Solisten in der legendären ersten Aufnahme von „Il Vespro della Beata Vergine“ aus dem Jahre 1966 als die Essenz dieser Musik in ihrer Bedeutung für das zerbrochene zwanzigste Jahrhundert zum Klingen brachte. Unter seiner Stabführung erlebte die „Marien-Vesper“ von 1966 bis 1993 insgesamt 42 Aufführungen, zehn allein auf der grandiosen Konzertreise 1975 in die Vereinigten Staaten, neun in der Hamburger Musikhalle und der Hauptkirche St. Michaelis; Aufführungen, die in die bekanntesten Konzertsäle der Welt wie die Berliner Philharmonie und die New Yorker Carnegie Hall, nach Schloss Nymphenburg oder in das Opernhaus von Sydney führten.
Wie sollte, wie konnte es nach dem Tod von Jürgen Jürgens am 4. August 1994 weitergehen, nach tausend Konzerten, Schallplatten-Produktionen, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in aller Welt, nach zahllosen Auslandsreisen und Mitwirkungen bei Musikfestivals und Chorwettbewerben? Wie weitergehen nach einer so symbiotischen Verflechtung von vier Klangkörpern der Hamburger Akademischen Musikpflege bei den semesterlichen, dann jährlichen Universitäts-Konzerten, deren musikalisches Gipfelereignis in den Jahren 1986 und 1989 die zweimalige Aufführung der Achten Symphonie von Gustav Mahler, der „Symphonie der Tausend“, im Hamburger Congress Centrum gewesen war?
Die Trennung der Ensembles vollzog sich auf amtliche, für Mitglieder, die im Laufe ihres Lebens allen vier Gruppierungen angehört hatten wie der Afrikanist Ludwig Gerhardt, auf schmerzliche Weise. Als Vorsitzender der Berufungskommission konnte er dem aus 92 Bewerbern und Bewerberinnen erwählten niederländischen Dirigenten Bruno de Greeve gratulieren, der am 1. Januar 1994 zum Universitäts-Musikdirektor ernannt wurde. Bruno de Greeve führte mit beständig gutem Zulauf, ja begeistertem Interesse neuer studentischer Generationen annähernd zwanzig Jahre lang den Chor und das Orchester der Universität Hamburg in der Programmatik selten aufgeführter Werke der Spätromantik zu beachtlichen, von einem treuen Hamburger Publikum umjubelten semesterlichen Erfolgen.
In diesem Buch wird die Geschichte des Monteverdi-Chors nicht weitererzählt, weil die Beiträge seiner Chronisten ganz auf ihre nahezu lebenslange Zusammenarbeit mit dem für sie überragenden Gründer und Maestro Jürgen Jürgens konzentriert bleiben sollen, dessen Geburtsdatum sich am 5. Oktober 2015 zum neunzigsten Mal jähren wird. Das ist nur allzu verständlich, und es verdient Respekt, an diese außergewöhnliche Zeit zu erinnern, die aus vielen Gründen über das Lokalkolorit der Hamburger Universitätsmusik hinausgeht. Gerade deswegen ist es zu begrüßen, dass ihr durch eine öffentliche Publikation der gebührende Platz in der Geschichte der neueren Chor- und Universitätsmusik gesichert wird. Doch nicht nur das musikgeschichtliche Interesse verdient Beachtung. Es ist zugleich die Tatsache, dass Tausende von Studentinnen und Studenten aller Fächer, Hunderte von berufserfahrenen Menschen unterschiedlichster Professionen über gefährdete Jahrzehnte hinweg der Idee der Universität eine neue, zugkräftige und sinnliche Realität gaben, ohne dass eigentlich jemals davon die Rede war: der Idee des freien und heiteren Gelingens eines ernsthaft bemühten Studiums.
Auf die Erprobung dieser Idee mag jede nächste Generation von Studierenden einen Anspruch haben, solange es die Universität gibt. Wenn indes die Geschichte des Monteverdi-Chors der Universität Hamburg eine Fortsetzung gefunden hat, so nur durch den glücklichen Umstand, dass der ausgebildete Konzertsänger und hocherfahrene Chor- und Orchesterdirigent Gothart Stier, ein Kirchenmusiker aus der Leipziger Bachtradition, seinen Kollegen Jürgen Jürgens während dessen Krankheit bei Konzerten in St. Petersburg und Hamburg vertrat. Die gemeinsame Probenarbeit sowie der große Erfolg des A-cappella-Konzerts und der Aufführung von Händels Messias verbanden von nun an den alsbald erwählten Nachfolger des Gründers und die beharrlichen Chormitglieder zu einer musizierenden Einheit, wie sie auch früher bestanden hatte.
Der Monteverdi-Chor gewann unter Gothart Stier, der zuvor den Dresdner Kreuzchor sowie den Münchner Bachchor und das Münchner Bachorchester des verstorbenen Karl Richter geleitet hatte, seine Präzision zurück und an Professionalität hinzu. Er stellte sich den erweiterten Aufgaben kirchenmusikalischer Werke, die unter den veränderten Bedingungen des Konzertbetriebs allein große Auditorien und damit die Finanzierbarkeit der Aufführungen zu garantieren vermögen. Mit diesem Trend zur Professionalisierung einerseits und der geographischen Spannweite in der Verbindung der Hamburger und der Leipziger Musiktradition andererseits hängt es auch zusammen, dass im Laufe der Zeit Klangkörper aus dem mitteldeutschen Raum zu musikalischen Partnern des Chores wurden wie das Philharmonische Staatsorchester Halle, das Mitteldeutsche Kammerorchester, das Neue Bachische Collegium Musicum Leipzig und auch das Gewandhausorchester Leipzig: am Ende eine unvorhergesehene, glückhafte Realisierung der deutschen Einheit in der Musik. Hamburg musste aus sich herausgehen, um Hamburgs Ausstrahlung zu sichern.
Zweihundert Konzerte gab der Monteverdi-Chor in den vergangenen zwanzig Jahren, die teilweise auf CD dokumentiert sind. In seiner Chorarbeit setzte Gothart Stier in fünfzig Auftritten im In- und Ausland die Tradition seines Vorgängers Jürgen Jürgens mit europäischer A-cappella-Musik von der Renaissance bis zu Dallapiccola fort. Siebenmal war die Marien-Vesper zu hören, doch nie der Orfeo, weil die Kosten der Solisten von einem auf sich selbst gestellten Doppelensemble bei weitem nicht eingespielt werden können. Dagegen stand zum ersten Mal Mozarts Requiem KV 626 mit acht Aufführungen, darunter in St. Petersburg und Kaliningrad, in Shanghai sowie in Guatemala, und die große Messe c-moll KV 427 mit fünf Aufführungen auf dem Programm. Der Chor studierte so gut wie alle bedeutenden sinfonischen Chorwerke von Bachs h-moll-Messe über Beethovens Missa solemnis bis zu Regers Requiem neu ein, brachte in einer Erstaufführung die von Gothart Stier und Ursula Jürgens wieder entdeckte „La Passione di Gesú Cristo“ von Johann Friedrich Reichardt in Hamburg und Berlin zu Gehör und glänzte mehrfach bei den Bachfesten in Leipzig und bei anderen Musikfestivals.
Während der Monteverdi-Chor in diesen zwei Jahrzehnten etwa fünfzigmal in Hamburg auftrat, ist sein annähernd gleich hohes Engagement als Botschafter Deutschlands sowie Hamburgs und seiner Universität ebenso bewunderungswürdig, wie es in früheren Jahrzehnten der Fall war. Der Chor gastierte mit zehn Auftritten in Israel und ebenso vielen Aufführungen in Russland, darunter im Oktober 2014 mit Haydns Schöpfung in der Moskauer Tschaikowsky Hall, dankbar umjubelt von einem großen russischen Publikum angesichts der Krise des Ost-West-Verhältnisses. Er eroberte sich mit zwölf Auftritten in China (unter Einschluss der Nationalhymne) durch landesweite Ausstrahlungen einen Stammplatz in den Herzen von Millionen Chinesen. In Lateinamerika (Argentinien, El Salvador, Guatemala, Nicaragua und Uruguay) erwärmte er die alten hamburgischen Beziehungen. Weitere Konzertreisen führten nach Italien und Polen.
Immer war es so, dass seine wunderbaren Solistinnen und Solisten nichts mehr schätzten als die Auftritte mit einem derartigen Ensemble. Ich erinnere mich, dass mir anlässlich eines großen Chorfestivals zum 25jährigen Bestehen des Monteverdi-Chors Matti Salminen am 7. Juni 1980 im Foyer vor Saal 1 des Hamburger Congress Centrums in Erwartung seines Auftritts in Verdis Requiem sagte: „Am liebsten singe ich mit diesen großartigen Amateurchören, denn sie machen nichts aus Routine.“ Das ist am Ende das eine Geheimnis, warum der Monteverdi-Chor Hamburg nach sechzig Jahren seiner Existenz noch immer auf der Höhe aller musikalischen Ansprüche singt. Das andere trägt einen Namen und heißt Ursula Jürgens, Meisterin aller organisatorischen und finanziellen Logistik eines internationalen Spitzenchors, der wie sein Dirigent von der stolzen Heimatstadt nur die allerschönsten Ehrenmedaillen erhielt. So groß ist das Gaudio mit dem Claudio.
1 Prof. Dr. Dr. hc. mult. Peter Fischer-Appelt, Präsident der Universität Hamburg 1970-1991
Robert Schomacker
Vorwort
Einem Glücksfall ist es zuzuschreiben, dass die Akademische Musikpflege der Universität Hamburg und der ihr zugehörige Monteverdi-Chor sehr schnell eine Wertschätzung erlangten, die noch immer weit über den universitären Bereich und über die Grenzen der Hansestadt hinausreicht. Der Glücksfall hat einen Namen: Jürgen Jürgens.
Wir, die Herausgeber der vorliegenden Veröffentlichung, wie auch die meisten Verfasser der Textbeiträge, gehörten den genannten Institutionen über viele Jahre an oder waren ihnen eng verbunden und sind somit Zeitzeugen ihrer Entwicklung. Es erfüllt uns mit Freude, die Mehrheit der von Jürgen Jürgens aufgebauten Ensembles weiterhin blühen zu sehen, auch wenn jener, dem sie ihr Leben verdanken, und fast alle aus unserer Generation inzwischen selbst nicht mehr daran mitwirken. Was uns bleibt, ist die Erinnerung an eine lange, einmalig schöne Zeit der aktiven Teilhabe an musikalischen Höhenflügen, wie sie nur in seltenen Fällen auch Amateuren gewährt wird. Dem, der es uns möglich machte und der unserem Leben auf diese Weise eine tiefgreifende musikalische wie außermusikalische Prägung gab, soll die hier vorliegende Arbeit gelten – ein spätes Dankeschön an JüJü.
Tatsächlich kommt der Dank, der mit diesem Buch verbunden ist, sehr spät. So spät, dass die Akademische Musikpflege und der Monteverdi-Chor inzwischen nach Jürgen Jürgens' Tod über zwei Jahrzehnte weiterer erfolgreicher Geschichte unter anderen Leitern vorweisen können. Prof. Bruno de Greeve (Chor und Orchester der Universität 1993-2011) und Gothart Stier (Monteverdi-Chor seit 1994) haben den jeweils übernommenen Teil des Lebenswerks ihres gemeinsamen Vorgängers in hervorragender Weise weitergeführt. Dafür gebührt auch ihnen Dank.
Es gibt gute Gründe dafür, dass wir uns auf den Zeitrahmen bis 1994 beschränkt haben. Zum einen lässt der begrenzte persönliche Kenntnishintergrund der Verfasser es nicht zu, über die Zeit nach Jürgen Jürgens in gleicher Ausführlichkeit zu berichten und zu urteilen. Vor allem aber wird damit eine historisch abgeschlossene Periode aufgearbeitet, deren Ende – auch infolge der sich über Jahre hinziehenden Entstehungsgeschichte dieses Buches – weit genug zurück liegt, um hinreichend objektiv wie kritisch darüber schreiben zu können.
Selbsverständlich freuen wir uns über die fortgesetzten Erfolge des Monteverdi-Chores sowie des Chores und Orchesters der Universität Hamburg, deren Entwicklung auch wir mit Interesse verfolgen. Wir hoffen, dass zu gegebener Zeit eine jüngere Generation von Chor- und Orchestermitgliedern eine angemessene Dokumentation über die Zeit nach 1994 schaffen wird.
Schon sehr bald nach Jürgen Jürgens' Tod hatte sich mancher seiner alten Weggenossen im Monteverdi-Chor gefragt, ob man nicht die Erinnerungen an die gemeinsam verbrachten Lebensjahrzehnte in einer Chronik festhalten sollte. Der Gedanke war gut, nichts sprach dagegen, nur fand damals keiner die Zeit, um ihn zu verwirklichen. Der Beruf, die Familie und andere Dinge standen noch im Vordergrund – und letztlich: Wer traute sich so etwas zu?
So schwelte die Idee fast zwanzig Jahre – Jahre, in denen mancher nach dem Ausstieg aus dem Erwerbsleben die Zeit fand, um sich auf diesem neuen Betätigungsfeld zu versuchen. Hinzu kam, dass die technischen Weiterentwicklungen der Text- und Datenverarbeitung und des Buchdrucks inzwischen die Voraussetzungen geschaffen hatten, um ein solches Vorhaben mit vertretbarem finanziellem Aufwand zu verwirklichen.
Es war im Sommer 2011 bei einem der jeden zweiten Monat stattfindenden Treffen der immer noch bestehenden Monteverdi-Chor-„Familie“, als im Gespräch zwischen ein paar „Alt-Claudioten“ der Gedanke an eine Chorgeschichte neuen Antrieb erhielt. Zwar mochte immer noch keiner, auch aus Zeitgründen, solch ein Projekt allein angehen, aber gemeinsam wollte man einen Anfang wagen.
Wir verabredeten regelmäßige Zusammenkünfte und suchten nach einer Konzeption. Die Vorstellungen, wie eine „Chorchronik“ zu gestalten sei, waren noch unkonkret und vielfältig. Sie lagen zwischen einer möglichst umfassenden Darstellung der Chorgeschichte und einer bunten Sammlung mehr oder weniger zufälliger persönlicher Erlebnisse. Trotz aller Erinnerungsseligkeit sollten aber die Grundsätze historischer Aufarbeitung nicht vernachlässigt werden: Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Objektivität. Und weil die Person Jürgen Jürgens im Mittelpunkt stand, war uns die damit verbundene Verantwortung, seinem Wirken gerecht zu werden, bewusst. Bald zeichnete sich ein praktikabler Arbeitsansatz ab: Eine objektive geschichtliche Darstellung, die den genannten Grundsätzen entsprechen musste, sollte von kleineren subjektiv bestimmten Episoden und Anekdoten umrankt und aufgelockert werden. Dieses Grundkonzept wurde zwar später nicht durchgehend eingehalten, aber es durchzieht dennoch als Leitlinie viele der Kapitel. Aus dem Kreis der Initiatoren bildeten wir eine Redaktionsgruppe, die ein Gerüst für den Textaufbau vorgeben, das Projekt steuern und die erhofften möglichst vielen eingehenden Texte redigieren sollte.
In einem allgemeinen Aufruf an alle uns bekannten mit Jürgen Jürgens verbundenen Choristen und anderen Personen warben wir um Textbeiträge. Einzelne „Schlüsselpersonen“ sprachen wir direkt an. Auf diese Weise kam im Laufe von gut drei Jahren eine beachtliche Anzahl von Beiträgen zusammen. Die trotzdem verbliebenen größeren Lücken wurden von einzelnen Redaktionsmitgliedern geschlossen.
Während der Arbeit an den Texten zur Chorgeschichte wurde uns deutlich, dass wir mit dem Arbeitstitel „Chronik des Monteverdi-Chores“ zu kurz gegriffen hatten, denn damit konnte man der zentralen Bedeutung, die Jürgen Jürgens nicht nur als Gründer und Leiter dieses Chores zukam – seiner musikalischen und pädagogischen Lebensleistung und den vielfältigen Impulsen, die von ihm ausgingen, – nicht gerecht werden. Und folglich wurde es unvermeidbar, auch die anderen von ihm ins Leben gerufenen Ensembles – den Chor und das Orchester der Universität Hamburg sowie die anerkanntermaßen äußerst qualifizierte, aber leider nicht mehr existierende Camerata Accademica – einzubeziehen. Glücklicherweise fand sich jemand zur Mitarbeit in der Redaktion bereit, dem dieser Teil der Akademischen Musikpflege durch eigenes Mitwirken vertraut war.
Die Redaktionsgruppe bestand nunmehr aus sechs Personen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund: Horst Burgarth (Mathematiker und IT-Fachmann), Prof. Dr. Ludwig Gerhardt (Sprachwissenschaftler), Holger Hampel (Jurist), Ruth Homeyer (Buchhalterin), Jutta Jürgens (Notenschreiberin) und Robert Schomacker (Diplomingenieur).
Besondere Unterstützung bekamen wir durch Ursula Jürgens, die umfangreiches Aktenmaterial und ihr eigenes unveröffentlichtes Manuskript über den Lebenslauf ihres Mannes zur Verfügung stellte. Außerdem erhielten wir von ihr wertvolle Auskünfte. Dafür bedanken wir uns. Gern hätten wir sie in die Redaktionsarbeit einbezogen, aber leider fehlte ihr dazu die Zeit.
Dem früheren Präsidenten der Universität Hamburg, Herrn Prof. Dr. Dr. hc. mult. Peter Fischer-Appelt danken wir herzlich für sein Geleitwort und die Überlassung seiner Redemanuskripte über Jürgen Jürgens. Unser besonderer Dank gilt auch den nicht zur Redaktion gehörenden ehemaligen Mitgliedern des Monteverdi-Chores, die diese Arbeit maßgeblich unterstützten: der Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Silke Leopold von der Universität Heidelberg, die das Kapitel über „Jürgen Jürgens und die Monteverdi-Renaissance“ schrieb und auch zu anderen Kapiteln hilfreichen Rat erteilte, sowie Dr. Kay F. Roggenkamp für das Kapitel über „Organisation und Finanzen des Monteverdi-Chores“. Weiterhin danken wir für wertvolle Hilfe als kritische Lektoren Dr. Bernd Kappelhoff (Präsident des Niedersächsischen Landesarchivs i.R.) und Dr. Hasko Zimmer (AOR i.R. der Universität Münster). Für die Einbandgestaltung haben wir Nataly Meenen (im Monteverdi-Chor seit 1987) zu danken. Iris Ade (im Monteverdi-Chor seit 2011) danken wir für das gründliche Korrekturlesen.
Und natürlich gilt unser Dank auch allen anderen, die durch ihre zumeist kürzeren Textbeiträge die jetzt vorgelegte Veröffentlichung bereichert haben. Ihre Namen sind im anhängenden Verfasserverzeichnis aufgeführt.
Um die Themen der einzelnen Kapitel dieser Arbeit in sich verständlich abzuhandeln, ließen sich gelegentliche inhaltliche Überschneidungen mit anderen Teilen nicht völlig vermeiden, sie wurden aber auf ein Mindestmaß beschränkt. Sofern in den Texten auf Quellen Bezug genommen wird, weisen Zahlen in eckigen Klammen auf das anhängende Quellenverzeichnis hin.
Abgesehen von den Aufwendungen für den Buchdruck wurden alle mit diesem Werk verbundenen Arbeiten und Textbeiträge ehrenamtlich und ohne irgendwelche Aufwandsentschädigungen geleistet. Auch der Abdruck der Fotos wurde uns von den in Erfahrung gebrachten Inhabern der Urheberrechte kostenlos gestattet. Sponsorengelder oder öffentliche Zuschüsse standen nicht zur Verfügung.
Zur Zielgruppe der Veröffentlichung gehören in erster Linie jene, mit denen wir unsere Erinnerungen an Jürgen Jürgens teilen. Doch mögen vielleicht auch andere an diesem Stück Zeit- und Kulturgeschichte Interesse finden.
Im Laufe der Entstehung der hier vorgelegten Arbeit wurde uns Redakteuren und Herausgebern erneut und in besonderem Maße bewusst (was einst im alltäglichen Miteinander oft in den Hintergrund trat), welch ein in vieler Hinsicht bedeutender Mensch Jürgen Jürgens war. Das Außergewöhnliche seiner Persönlichkeit zeigt sich – zusammenfassend gesagt – in der Entwicklung zu höchster Professionalität, die sich nicht in technischer Perfektion erschöpfte, sondern von instinktiver Stilsicherheit und künstlerischer Genialität geleitet war, und in seinem natürlichen pädagogischen Talent, mit dem er die selbst aufgebauten Stätten seines Wirkens mit reichem Leben erfüllte und zum Blühen brachte. Durch ihn erlangten seine Amateur-Ensembles jene Bedeutung und jenes Ansehen, die als sein verpflichtendes Vermächtnis an die Universität Hamburg gelten können. Das betrifft sowohl den Monteverdi-Chor als auch die anderen Einrichtungen der Akademischen Musikpflege einschließlich der eigens für ihn geschaffenen Stellung eines Universitätsmusikdirektors. Zugleich aber blieb Jürgen Jürgens mit seinen Stärken und Schwächen für uns stets ein Mensch „zum Anfassen“. So haben wir es hoffentlich vermieden, ein die Lebenswirklichkeit außer Acht lassendes Heiligenbild zu schaffen – ganz sicher in Deinem Sinne, lieber JüJü.
Silke Leopold2
Jürgen Jürgens und die Monteverdi-Renaissance
Claudio wer? Selbst in Italien hätte Monteverdi als Namenspatron eines neu gegründeten Chores in den 1950er Jahren eine gewisse Ratlosigkeit hervorgerufen – wieviel mehr in Hamburg, wo man Italien in dieser Zeit des Wiederaufbaus und des beginnenden Wirtschaftswunders wohl eher mit Urlaub an der Adria als mit einem Komponisten verband, der bestenfalls einigen hochspezialisierten Musikhistorikern bekannt war. Dass Claudio Monteverdi, 1567 in Mantua geboren und 1643 in Venedig gestorben, zu den bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten aller Zeiten gerechnet werden muss, konnte man zwar in allen Lehrbüchern über Musikgeschichte lesen; gehört aber hatte in den 1950er Jahren wohl kaum jemand irgendeine seiner Kompositionen. Denn das Madrigal, jenes artistisch komplexe Genre mehrstimmiger Vokalmusik, das Monteverdis Schaffen ein Leben lang begleitet hatte, war eine längst verklungene Gattung, die Oper, an deren Entstehung er maßgeblich beteiligt war, eine Kunstform, die man mit Mozart und Weber, Wagner und Verdi verband, und die Messen und Vesperpsalmen, die Antiphonen und Litaneien aus seiner Feder ohnedies zu katholisch, als dass man sie in den protestantischen Kirchen der Hansestadt hätte aufführen können. Es bedurfte eines gewissen Mutes (und der Rückendeckung einer italienischen Kulturinstitution), sich 1955 „Monteverdi-Chor“ zu nennen, und wenn der Name dieses Komponisten in den kommenden Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung, Bekanntheit und Beliebtheit gewinnen sollte, so war dies auch dem Chor geschuldet, der seinen Namen trug, und vor allem seinem Gründer und Leiter Jürgen Jürgens.
Der Name Monteverdi stand im Jahre 1955 in jeder Hinsicht für einen Neuanfang. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Italien waren zwar seit mehr als tausend Jahren problematisch und spannungsreich gewesen; nach dem Ende von Faschismus und Nationalsozialismus, die jeder für sich ihrem Land den größten denkbaren Schaden zugefügt und sich darüber hinaus in höchst unguter Weise gefunden und verbündet hatten, galt es, das Verhältnis zueinander neu zu überdenken und wieder an den regen kulturellen Austausch anzuknüpfen, der für beide Länder über Jahrhunderte hinweg so fruchtbar gewesen war. Selbst (und gerade) die Musik war in diesem Kampf der Nationen, der seit der Gründung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs getobt hatte, für andere als musikalische Zwecke benutzt worden. Wagner und Verdi etwa wurden als Exponenten einer jeweiligen Nationalkultur ins Feld geführt und je nach Blickwinkel hochgejubelt oder niedergemacht. Monteverdi, dieser unbekannte Komponist, war gleichsam „unschuldig“, weil seine Musik in Zeiten nationaler Vereinnahmung nicht zur Verfügung gestanden hatte. Zwar hatte Gian Francesco Malipiero, Komponist und Musikwissenschaftler, zwischen 1926 und 1942 Monteverdis Musik in einer Gesamtausgabe veröffentlicht – eine Pioniertat, die die praktische Wiederentdeckung der Musik überhaupt erst möglich machte; ohne Pioniere der musikalischen Umsetzung wie Jürgen Jürgens aber, die diese Partituren auch zum Klingen brachten, wäre die Notenedition eine weitere verdienstvolle philologische Arbeit gewesen, wie sie in Scharen in den Bibliotheksregalen dahindämmerten.
Abb. 2 Claudio Monteverdi, Gemälde von Bernardo Strozzi um 1630
Einer der ersten dieser Pioniere war der Cellist und Dirigent August Wenzinger gewesen, dessen Interesse an alter, vergessener Musik und an historischen Spielweisen bis in die frühen 1930er Jahre zurückreichte. Er gehörte zu den ersten Dozenten der 1933 von Paul Sacher in Basel gegründeten, auf Historische Aufführungspraxis spezialisierten Schola Cantorum Basiliensis. Mit der 1954 gegründeten Cappella Coloniensis machte er die Barockmusik in historischer Spielweise auch einem größeren Publikum schmackhaft. Es mag Zufall sein oder nicht – just 1955 ging er bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker, einem kleinen, aber wagemutigen Festival mit dezidiertem Interesse speziell an Alter und Neuer Musik, das Risiko ein, mit Monteverdis Orfeo auch eine Oper in historischer Originalgestalt aufzuführen. Und die ARCHIV-Produktion, das 1949 gegründete, auf Alte Musik spezialisierte Label der Deutschen Grammophon Gesellschaft, brachte eine Aufnahme dieser Produktion auf Schallplatte heraus.
Eigentlich aber standen die musikalischen Zeichen zur Zeit der Gründung des Monteverdi-Chores unter einem ganz anderen Stern. 1950 war der 200. Todestag Johann Sebastian Bachs als großes Bach-Jahr inszeniert worden – auch dies ein Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem Scherbenhaufen des Zweiten Weltkriegs zu ziehen und sich wieder als die Kulturnation zu präsentieren, die Deutschland ja auch einmal gewesen war. Dabei nahm die Idee Fahrt auf, Bach neu zu entdecken, indem man ihn nach den Kriterien jener historischen Aufführungspraxis musizierte, mit der sich die akademische Musikwissenschaft einerseits und ein paar Enthusiasten unter den praktischen Musikern andererseits seit einiger Zeit auseinandersetzten. Sie wirkten vornehmlich in der Schweiz, in den Niederlanden und in Wien, und Gustav Leonhardt, aus einer niederländisch-schweizerischen Familie gebürtig, Cembalist, Organist und Absolvent der Schola Cantorum Basiliensis, war das einflussreiche Bindeglied zwischen diesen drei Zentren, an denen viele Musiker mit alten Spielweisen auf ihren eigenen Instrumenten experimentierten. 1955, im Gründungsjahr des Monteverdi-Chores, konstituierte sich auch das Leonhardt-Consort, ein Instrumentalensemble, das sich speziell der Musik Bachs, aber auch der Musik des 17. Jahrhunderts verschrieb. Zu seinen ersten Mitgliedern gehörten neben zahlreichen niederländischen Musikern auch der Wiener Geiger Eduard Melkus und der Wiener Cellist Nikolaus Harnoncourt. Mit dem Cembalisten Gustav Leonhardt sollte Jürgen Jürgens über Jahre hinweg eine fruchtbare Zusammenarbeit verbinden.
Jürgen Jürgens entstammte zunächst einer anderen als der italienischen Tradition und einem anderen musikalischen Umfeld als dem der Historischen Aufführungspraxis. Geboren 1925 in Frankfurt, besuchte er das dortige Musische Gymnasium. Sein Lehrer Kurt Thomas, dessen Nähe zum Nationalsozialismus notorisch ist, scheint gleichwohl ein großartiger Pädagoge gewesen zu sein, und die Liste seiner Schüler liest sich wie ein Who's Who der bundesdeutschen Musikerszene aller möglichen Sparten von Chorleitung über Komposition bis zum Jazz. Nach dem Krieg aber studierte Jürgens bei Konrad Lechner in Freiburg – eine erste Adresse für junge Musiker auf der Suche nach dem Anderen, dem Unbekannten anstelle des traditionellen Repertoires. Mit Gambe, Fidel und Blockflöte hatte Lechner seit den späten 1920er Jahren als einer der Ersten in Deutschland die alten Instrumente auf professioneller Ebene etabliert. In Salzburg hatte er einen Madrigal-Chor geleitet. Bei Lechner konnte Jürgens all das lernen, was ihm später zum Erfolg mit dem Monteverdi-Chor verhalf. Dabei ist es faszinierend zu beobachten, mit welcher Vorsicht, mit welchem Respekt er sich an diesen großen Komponisten herantastete, für dessen Werke keinerlei Aufführungstradition zur Verfügung stand. Die ersten Kompositionen, die er 1955 mit seinem neu gegründeten Chor einstudierte, waren nur zum Teil jene hochkomplexen polyphonen Madrigalsätze, die Monteverdi schon zu Lebzeiten den Vorwurf des Neutöners eingetragen hatten, dafür aber zahlreiche der dreistimmigen und über weite Strecken homophonen Scherzi musicali von 1607, an denen man das Aufeinanderhören, einen Chorklang und eine gemeinsame Deklamationskultur üben konnte. Außerdem waren diese kleinen, unterhaltsamen strophischen Scherzi auch für ein Publikum, das mit Monteverdis Musik zunächst völlig unvertraut war, leichter zu verstehen.
Das Konzept des Madrigal-Chores ist eigentlich ein Widerspruch in sich – oder zumindest ein Anachronismus. Denn der gemischte Chor heutiger Prägung ist eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts, als sich die neue bürgerliche Gesellschaft auch kulturell positionierte und im gemeinsamen Chorgesang eine eigene musikalische Ausdrucksform fand. Zu Monteverdis Zeiten waren Chöre ausschließlich Kirchenchöre wie etwa der Chor des Markusdoms in Venedig, den Monteverdi die letzten dreißig Jahre seines Lebens geleitet hatte. Mit etwa dreißig professionellen Sängern gehörte dieser Chor zu den größten der Christenheit, und die hohen Stimmen waren selbstverständlich mit Knaben oder Kastraten besetzt, denn Frauen war das Singen in der Kirche nicht erlaubt. Amateure und Frauen hatten erst seit der Zeit um 1800 Zugang zu den Chören, die ihrerseits nun auf zumeist dreistellige Mitgliederzahlen anwuchsen. Die weltliche Vokalmusik dagegen, die Madrigale und Scherzi, war Ensemblemusik und wurde solistisch gesungen. Aus diesem Dilemma schien es, wollte man die Kriterien der Historischen Aufführungspraxis ernst nehmen, keinen Ausweg zu geben – zumindest aber einen Kompromiss. Dieser bestand – und das hat Jürgen Jürgens mit dem Monteverdi-Chor in beispielhafter Weise vorgeführt – zum einen in der Beschränkung auf kleine Mitgliederzahlen, zum anderen und vor allem aber in der Erarbeitung eines Chorklangs, der die Sopranstimmen hell und eher knabenhaft als vollweiblich modellierte und durch eine zuverlässige deklamatorische Präzision die Menge der Chorsänger zu einem wie solistischen Ensemble verschmolz. Es war dieser spezifische Klang, der den Kompromiss zwischen Originalklang einerseits und den Gegebenheiten unseres Musiklebens andererseits möglich machte.
Es sollte nicht lange dauern, bis der Monteverdi-Chor Karriere machte. 1959 gewann er erstmals den Chorwettbewerb in Arezzo und etablierte sich als eines der Spitzenensembles im Bereich der Alten Musik. Es war die Zeit, in der das Interesse an Historischer Aufführungspraxis stetig zunahm. Schallplattenlabels wie die ARCHIV-Produktion der Deutschen Grammophon Gesellschaft und „Das Alte Werk“ bei Telefunken machten es sich zur Aufgabe, neben dem klassischen Konzertrepertoire auch ältere Musik zu dokumentieren. Was zunächst ein ökonomisches Wagnis war, entwickelte sich bald zu einem gänzlich eigenen Markt mit immer neuen Ersteinspielungen von Werken, die zum Teil heute ihrerseits zum klassischen Repertoire gehören – prominentestes Beispiel ist hierbei sicherlich Monteverdis Marienvesper. „Das Alte Werk“ setzte zunächst auf Bach. In der Zusammenarbeit von Jürgen Jürgens und Gustav Leonhardt entstanden Anfang der 1960er Jahre zahlreiche Aufnahmen mit Bach-Kantaten, zunächst mit dem Amsterdamer Kammerorchester unter Leitung von André Rieu (Vater), später mit dem Leonhardt-Consort und Concerto Amsterdam, wobei Jürgens dann selbst die Gesamtleitung hatte. Der Monteverdi-Chor hätte damals leicht ein Spezialensemble für Bachinterpretation werden können. Parallel zu den Bach-Kantaten aber etablierte „Das Alte Werk“ den Monteverdi-Chor auch als Ensemble für Chormusik des 16. und 17. Jahrhunderts in allen denkbaren europäischen Sprachen, namentlich deutsch, italienisch, französisch, englisch, spanisch oder lateinisch, wobei Monteverdi selbst eine zunehmend wichtige Rolle zu spielen begann. Die erste, allein Monteverdi gewidmete Schallplatte mit dem Titel Madrigali e Concerti kam 1963 auf den Markt.
Der Zeitpunkt für eine solche Einspielung war gut gewählt. 1967 sollte sich der Geburtstag Monteverdis zum 400. Mal jähren, und es schien an der Zeit, einen der wichtigsten Komponisten vor Bach wiederzuentdecken, umso mehr, als die praktischen Erfahrungen mit den alten Spiel- und Singweisen inzwischen so weit gediehen waren, dass man sich auch die schwierigsten Instrumental- und Vokalpartien zutrauen konnte. Die Ersteinspielung der Marienvesper, Ende 1966 aufgenommen und im Monteverdi-Jahr 1967 veröffentlicht, war ein von längerer Hand geplantes, großes Unterfangen und ein Höhepunkt in der Karriere Jürgen Jürgens'. Sie gehört bis heute zu den erfolgreichsten Einspielungen des Monteverdi-Chores, und wenn sie trotzdem auch eine schmerzliche Erfahrung werden sollte, so hat das zuallererst mit dem in vielerlei Hinsicht problematischen Werk selbst zu tun, sodann aber auch mit der Art und Weise, wie sich die unterschiedlichen Vorstellungen über diese so rätselhafte Marienvesper und ihre Interpretation in der Einspielung schließlich manifestierten.
An der Marienvesper zeigten sich all jene Probleme, die die Beschäftigung mit älterer Musik so mit sich brachte. Sie ist zwar in einem vollständigen Satz von acht Stimmbüchern überliefert, aber die Besetzung ist dennoch nicht eindeutig, da Monteverdi weder über die Colla-Parte-Besetzungen der Instrumente bis ins Detail Rechenschaft ablegt noch überhaupt klare Anweisungen hinsichtlich der instrumentalen Anteile gibt. Bemerkungen wie „si ponno lasciare“ (kann man weglassen) im Notentext helfen bei der Rekonstruktion einer denkbaren Originalgestalt nicht unbedingt weiter. Doch damit nicht genug: Ob die Marienvesper überhaupt ein zusammenhängendes Werk ist oder nur eine vom Verleger willkürlich zusammengefügte Sammlung unzusammenhängender Kompositionen, ist ein stetiger Quell heftiger Diskussionen um dieses Werk. Monteverdi selbst hat mit dem Titel seines Notendruckes dazu beigetragen, denn dort heißt es: „vespere pluribus decantandae cum nonnullis sacris concentibus ad sacella sive principum cubicula accomodata“ („Vesperpsalmen von mehreren zu singen, mit einigen geistlichen Konzerten, bereitgestellt für Kapellen und fürstliche Kammern). Der Titel „Vespro della Beata Vergine“ erscheint lediglich im Stimmbuch des Continuobasses. Haben die Concerti also etwas mit den Vesperpsalmen zu tun oder nicht? Dagegen spricht, neben dem verwirrenden Titel, auch die unklare liturgische Zuordnung der Concerti. Dafür allerdings spricht die kluge musikalische Anordnung der Concerti mit ihrer wachsenden Anzahl der Stimmen im Gesamtverlauf. Aber ist die Marienvesper überhaupt ein liturgisches Werk? Auch hier bestehen Zweifel, nicht zuletzt wegen der Bemerkung über die fürstlichen Privaträume. Doch selbst wenn man sie als liturgisches Werk anerkennen würde, bliebe die Frage, ob die Concerti die liturgisch vorgeschriebenen Antiphonen ersetzten oder ergänzten. Was hat es mit den zwei Magnificat auf sich, die der Druck präsentiert? Und schließlich: Das Magnificat sowie der Psalm Lauda Jerusalem sind mit einer besonderen Vorzeichnung namens Chiavette geschrieben; müssen sie deshalb nach unten transponiert werden, und wenn ja, um wieviel? Und warum stehen sie in einer anderen Notation als die übrigen Stücke?
Auf alle diese Fragen kann der Wissenschaftler mit einem dezidierten „einerseitsandererseits“ oder „sowohl als auch“ antworten. Mehr könnte er ohnehin nicht tun, weil die Quellenlage nichts anderes hergibt. Der Praktiker aber, der den Notentext in ein klingendes Ereignis umsetzt, muss Entscheidungen treffen; er kann ja nicht mehrere Möglichkeiten im Konzert zum Hören anbieten. Jürgen Jürgens hat eine eindeutige Entscheidung getroffen und dafür plädiert, die Marienvesper als ein zusammenhängendes, nicht primär liturgisches musikalisches Werk aufzufassen und sie in der Form aufzuführen, wie sie im Druck erschienen war, ohne gregorianische Antiphonen, ohne Transposition und mit dem ersten, dem großen Magnificat. Dabei spielte es keine Rolle, ob diese Entscheidung „richtig“ oder „falsch“ war. Dass sie für die Schallplattenaufnahme aber nicht respektiert wurde, war ein großes Ärgernis, auch weil Jürgens die Gesamtleitung des Projekts innehatte und mit seinem Namen für das stand, was als Gesamtergebnis präsentiert wurde. Die gregorianischen Antiphonen in der Aufnahme, von einer zusätzlich engagierten Choralschola gesungen, geben der Einspielung etwas Pseudoliturgisches; sie zerstören aber den Eindruck eines religiösen Gesamtkunstwerks, wie es Jürgens vorgeschwebt hat und wie er später nicht müde wurde, dies zu betonen.
Die Einspielung der Marienvesper, dieser Höhepunkt in der so verheißungsvoll begonnenen Zusammenarbeit zwischen Jürgen Jürgens und Telefunken, war gleichzeitig auch ihr Endpunkt. Fortan wurde die ARCHIV-Produktion die Schallplatten-Heimat des Monteverdi-Chores. Nikolaus Harnoncourt, der bei der Marienvesper-Produktion für die Einstudierung seines Concentus Musicus zuständig gewesen war, blieb bei „Das Alte Werk“ und wurde mit der Gesamteinspielung der Bach-Kantaten berühmt – so berühmt, dass sich Telefunken später sogar entschloss, bei Neuauflagen der erfolgreichen Marienvesper-Einspielung und wohl aus Marketing-Gründen den Namen Jürgens auf dem Platten-Cover in den Hintergrund treten zu lassen und Harnoncourt mit dem Concentus Musicus groß herauszustellen. Bis heute ist diese Einspielung legendär; sie bildete den Ausgangspunkt für zahlreiche weitere Aufnahmen und für einen beispiellosen Siegeszug dieses neuentdeckten geistlichen Werkes, das sich, wie die Bach-Passionen, als abendfüllendes oratorisches Werk ins Konzertrepertoire integrieren ließ. Und auch für den Monteverdi-Chor selbst wurde die Marienvesper zu einem bei Tourneen in aller Welt aufgeführten Markenzeichen; der Mitschnitt einer Aufführung in der Berliner Philharmonie Anfang der 1970er Jahre wird bis heute hin und wieder im Nachtkonzert der ARD gesendet. Mit seiner Entscheidung, die Marienvesper primär als ein musikalisches und nicht als ein liturgisches Werk aufzufassen, trug Jürgens nicht unwesentlich dazu bei, die konfessionellen Probleme, die sie aufzuwerfen imstande war, wenn schon nicht gänzlich zu ignorieren, so aber doch wenigstens an den Rand der Rezeption zu drängen. Denn immer dort, wo sich die Hüter des wahren Bekenntnisses zu Wort meldeten, geriet die Marienvesper in ein durchaus ungutes Kreuzfeuer. Es sei – so konnte man tatsächlich noch in den 1970er Jahren lesen! – einem rechtgläubigen (protestantischen) Chorsänger nicht zuzumuten und seinem Seelenheil abträglich, so etwas Unbiblisches wie „Sancta Maria ora pro nobis“ zu singen.
Die Grundlage aller Monteverdi-Aufführungen bildete die Gesamtausgabe Malipieros. Allerdings kontrollierte Jürgens diese Edition immer wieder und passte sie den Ergebnissen seiner eigenen Studien anhand der Originaldrucke an. Er bekam die Gelegenheit, seine Version der Marienvesper bei dem großen Monteverdi-Kongress 1967 in Mantua zu erläutern, vor einer staunenden Schar der aus aller Welt zusammen gekommenen Monteverdi-Forscher, die nun erfahren konnten, dass sich die Musik, über deren kompositorischen Wert kein Zweifel bestand, tatsächlich auch anhören ließ. 1967 war das noch keineswegs selbstverständlich; der Monteverdi-Boom, der den Cremoneser nach und nach zu einem Repertoire-Komponisten und heute selbst Schulkindern aus dem Musikunterricht bekannten Meister werden ließ, begann just in diesem Gedenkjahr. Liest man heute, fast ein halbes Jahrhundert später, Jürgens' Plädoyer für einen „originalen“ Monteverdi ohne orchestrale Hinzufügungen und vor allem in einem Tempo, das die originalen Vorzeichnungen auch dann noch ernst nimmt, wenn man sie zunächst nicht versteht und nicht für realisierbar hält, dann muten diese Bemerkungen wie die Stimme aus einer anderen Welt an, denn inzwischen sind, nicht zuletzt durch das Beispiel von Interpreten wie Jürgen Jürgens, derartige Überlegungen selbstverständlich geworden. Wie früher bei Kongressberichten üblich, sind auch Jürgens' Vortrag die Diskussionsbeiträge anderer Teilnehmer beigegeben; sie machen deutlich, wie provokant Jürgens' aus einer Mischung von wissenschaftlichem Zugriff und praktischer Umsetzung gewonnenen Erkenntnisse 1967, im Monteverdi-Jahr, noch waren.
Mit der Einspielung der Marienvesper war ein musikalischer Standard gesetzt, der Jürgen Jürgens und seinen Monteverdi-Chor für ein Jahrzehnt von Erfolg zu Erfolg tragen sollte. Die Bedeutung jener Wiederentdeckung dieses so prächtigen wie rätselhaften Werks für die musikalische Praxis kann vielleicht nur mit der Wiederentdeckung der Matthäus-Passion im Jahre 1829 verglichen werden: ein abendfüllendes religiöses Werk allerhöchster kompositorischer Qualität, das wie ein Phönix aus der Asche jahrhundertelangen Vergessens erstieg und das Konzertrepertoire unendlich bereicherte, obwohl – oder weil? – es moderne Interpreten, wie einst die Matthäus-Passion auch, zunächst vor scheinbar unlösbare Probleme stellte. Heute, da die Marienvesper zum Repertoire jedes ambitionierteren Kirchenchores gehört, da es mehr als dreißig Einspielungen gibt, da der Barockgesang und die Beherrschung alter Instrumente wie Zink oder Regal und auch der Umgang mit historischen Spielweisen selbstverständlich geworden sind, ist es kaum mehr vorstellbar, dass dieses Werk noch in den 1970er Jahren heftige Kontroversen auslöste. Wie „Ziegengemecker“ hätten die Zinken geklungen, schrieb ein Kritiker anlässlich einer Aufführung 1973 in Rom, man hätte, so seine Meinung, die Stimmen besser mit den viel klangschöneren Klarinetten besetzt. Zu Beginn der Alte-Musik-Bewegung, als die Kriterien der Historischen Aufführungspraxis ihren Weg noch nicht in das gängige Konzertleben gefunden hatten, spielte es keine Rolle, dass Klarinetten zu Monteverdis Zeiten noch nicht erfunden worden waren. Und der Gesangsstil von Solisten wie Nigel Rogers, dem es als einem der Ersten gelang, jene hochvirtuose Gesangspraxis der Monteverdi-Zeit aus der Vergessenheit zurückzuholen, die mehr auf Beweglichkeit des Kehlkopfs als auf Klangfülle aus den Resonanzräumen setzte, war zunächst nicht minder umstritten.
Jürgen Jürgens hatte ein sehr genaues Ohr für die Qualität von Stimmen, nicht nur was seinen Chor anging, sondern auch bei der Auswahl von Solisten. In dem englischen Tenor Nigel Rogers, der seine Karriere unter anderem mit mittelalterlicher Musik begonnen hatte, fand er einen kongenialen Partner. Schon in der Einspielung der Marienvesper hatte Rogers unter den Solisten buchstäblich den Ton angegeben, hatte mit seinen großen Soli, dem Nigra sum, dem Audi caelum und dem Gloria am Ende des Magnificat der Tenorstimme gänzlich neue Qualitäten jenseits von lyrisch oder heldisch abgewonnen. In der Einspielung von Monteverdis L'Orfeo war Rogers der erste und für lange Zeit der einzige Sänger, der die buchstäblich halsbrecherischen Koloraturen des großen Bittgesangs in der Mitte der Oper in der „richtigen“ Technik und deshalb auch im vorgeschriebenen Tempo bewältigen konnte. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Erfolges dieser 1974 veröffentlichten Aufnahme, die bis heute auf dem Markt ist, dürfte Rogers' Gesangskunst geschuldet sein – und Jürgens, der diese Rolle mit Rogers völlig neu gestaltete.
Rogers und sein nicht minder virtuoser Tenorpartner Ian Partridge dominierten auch die Solistenensembles jener Monteverdi-Einspielungen, die der Marienvesper folgen sollten. Die ARCHIV-Produktion, seit 1949 im Geschäft mit der Alten Musik tätig, bekam durch die Historische Aufführungspraxis seit den späten 1960er Jahren großen Aufwind und machte Projekte auch kommerziell erfolgreich, für die zuvor nicht einmal geeignete Interpreten zur Verfügung gestanden hätten. Zwischen 1971 und 1972 entstanden drei vorbildhafte Monteverdi-Einspielungen – Virtuose Madrigale (1971), Geistliche Konzerte (1972) und Lamento d'Arianna (1972). Interpretationen wie das Tenorduett „Mentre vaga Angioletta“ aus den Virtuosen Madrigalen oder das „Salve Regina“ aus den Geistlichen Konzerten sind bis heute unübertroffen und haben zahlreiche spätere Interpretationen dieser Stücke beeinflusst.
Doch vor allem das fünfstimmig-polyphone Madrigal sollte in diesen Jahren das Markenzeichen des Monteverdi-Chores werden – eine Gattung, die so viele verborgene Schätze preiszugeben in der Lage war, wenn man denn wusste, wo man suchen sollte. Von Monteverdis Madrigalen war erst ein Bruchteil bekannt. Jürgens selbst hatte seit der Gründung des Monteverdi-Chores dafür gesorgt, dass ausgewählte Werke aus allen acht Madrigalbüchern ihre Schönheit in der musikalischen Öffentlichkeit hörbar machen konnten – von dem satztechnisch perfekt ausbalancierten „Ecco mormorar l'onde“ aus dem Jahre 1590 bis hin zu dem schmerzlich zerrissenen, fast ein halbes Jahrhundert später entstandenen „Hor che il ciel e la terra“. Gesamteinspielungen ganzer Madrigalbücher mit gleichsam enzyklopädischem Anspruch, wie sie später Mode wurden, waren Jürgens' Sache nicht. Er bevorzugte Programme, die er aus dem Besten zusammenstellte, das Monteverdi geschrieben hatte – mit Ausnahme des VI. Madrigalbuchs, das er im Konzert komplett aufführte. Monteverdi hatte dieses Buch ohne Unterstützung durch irgendeinen Gönner oder Widmungsträger 1614 auf den Markt gebracht, kurz nachdem er sein Amt als Markuskapellmeister in Venedig angetreten hatte. Darin fasste er eine Reihe von Madrigalkompositionen, die am Mantuaner Hof entstanden waren und auch direkten Bezug zum Mantuaner Musikleben hatten, zusammen – Reminiszenz und Kompendium zugleich, in den Besetzungen ebenso unterschiedlich wie in den Satztechniken. Eröffnet wurde das Buch von jener mehrteiligen fünfstimmig polyphonen Bearbeitung des Lamento d'Arianna, das Monteverdi 1608 ins Zentrum seiner Oper L'Arianna gestellt hatte. Die Klage der Verlassenen war in gewisser Weise das Gegenstück zu Orfeos Bittgesang; Monteverdi hatte sie einer gesangsbegabten Schauspielerin gleichsam auf den Leib geschrieben und in seiner polyphonen Version den Beweis angetreten, dass diese neue Theatermusik durchaus auch die Grundlage für satztechnische Komplexität bilden konnte, dass Sologesang und Polyphonie keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben musikalischen Medaille sein konnten. Mit der Sestina, einem Epitaph für die jung gestorbene Sängerin Caterina Martinelli, die ursprünglich für die Rolle der Arianna vorgesehen gewesen war, schrieb Monteverdi einen weiteren Klagegesang. Diese beiden großen Madrigalzyklen umgab er mit weiteren polyphonen und vor allem auch konzertierenden Madrigalen und beendete das Buch mit einem pastoralen Dialog, in dem sich zwei gleichsam agierende Protagonisten – ein Hirte und eine Hirtin – mit einem fünfstimmig kommentierenden Ensemble zusammenfanden. Indem Jürgens dieses VI. Madrigalbuch komplett und so, wie Monteverdi es konzipiert hatte, zum Konzertprogramm machte, bewies er ein sensibles Gespür für Monteverdis durchdachte Dramaturgie.
Monteverdi war freilich nicht der einzige Komponist, dessen Madrigale ein genaueres Studium lohnten. Von anderen wie etwa Heinrich Schütz wusste man, dass sie italienische Madrigale geschrieben hatten, ohne dass sich bisher jemand ernsthaft darum gekümmert hätte. Schütz, in Italien völlig unbekannt, galt in Deutschland als der Vater der deutschen Musik und als das Urbild des protestantischen Kantors schlechthin, und niemand interessierte sich hierzulande für seine italienischen Hervorbringungen. Die Gesamtaufnahme seiner italienischen Madrigale war 1974 eine Pioniertat; sie machte erstmals deutlich, dass der von der Singbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckte, von den Nationalsozialisten als deutsches Urgestein vereinnahmte, hausväterlich strenge Protestant durchaus leidenschaftliche, mediterran gefühlvolle Seiten hatte. Und schließlich gab es Madrigale, die noch in den Archiven schlummerten, ohne dass sie in neuerer Zeit jemals beachtet worden wären. Von Alessandro Scarlatti, einem der wichtigsten Komponisten an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, war in den 1970er Jahren bestenfalls der Name bekannt, und die Tatsache, dass er mehr als hundert Opern und rund 600 Kantaten komponiert hatte, war noch nicht bis in das aktuelle Musikleben durchgedrungen. Dass Scarlatti aber auch Madrigale geschrieben hatte – ein Jahrhundert nach der Blütezeit dieser Vokalform, war gänzlich unbekannt. Scarlatti, zwischen Rom und Neapel als Hof- und Kirchenkomponist tätig, hatte sich mit dieser aus der Zeit gefallenen Gattung auch nur beschäftigt, weil er sich von einem einflussreichen Gönner, der ein besonderes Interesse an der Musik der Vergangenheit hegte, einen Karriereschub erhoffte. Für die Aufnahme dieser Madrigale Alessandro Scarlattis musste Jürgens die verstreut überlieferten Noten zunächst einmal zusammensammeln, was er in der Festschrift für Luigi Ronga 1973 in einem Aufsatz dokumentierte; sodann musste er sie selbst edieren, und wenige Jahre, nachdem die Einspielung auf den Markt gekommen war, veröffentlichte er dann auch seine Edition – ähnlich wie auch Domenico Scarlattis zehnstimmiges Stabat mater, das er mit dem Monteverdi-Chor 1968 aufführte und das seitdem zu einem beliebten Repertoirestück geworden ist.
Es waren aufregende Jahre, diese Sechziger und Siebziger des vorigen Jahrhunderts, in denen die Alte-Musik-Bewegung einen ungeheuren Boom erlebte, in denen Jahrhunderte der Musikgeschichte für die moderne Praxis wiederentdeckt wurden, in denen Ausgrabung um Ausgrabung das Repertoire bereicherte, in denen dieses neuentdeckte Repertoire auf Schallplatte eingespielt und im Rundfunk aufgenommen wurde und den Schallplattengesellschaften viel Geld einspielte, in denen zahlreiche Festivals um ein nicht unbeträchtlich großes Publikum buhlten, das, des klassischen, aus Beethoven und Brahms bestehenden Konzertrepertoires müde, in der Alten Musik nach Neuem suchte. Jürgen Jürgens und sein Monteverdi-Chor gehörten in vorderster Linie dazu. Es waren aber auch die Jahre, in denen die Alte-Musik-Bewegung sich professionalisierte, aus der eigenen Tradition der Singbewegung heraustrat und sich mehr und mehr um „originale“ Besetzungen kümmerte. Dazu gehörte die Erkenntnis, dass Madrigale, ebenso wie auch Bachs Kantaten, eigentlich Ensemble- und keine Chormusik waren. Die neuen Madrigalensembles, allen voran englischer Provenienz wie etwa The Consort of Musicke, die im Laufe der Jahre eine Gesamteinspielung der Monteverdischen Madrigale vorlegen sollten, entwickelten einen eigenen, auf die historische Aufführungssituation bezogenen Klang, der den Madrigalchören gleichsam den Boden unter den Füßen wegzog. Auch der Monteverdi-Chor mit seinen rund vierzig Sängerinnen und Sängern wurde die Geister der Historischen Aufführungspraxis, die er selbst gerufen und so liebevoll wie kompetent gepflegt hatte, nun nicht mehr los. Irgendwann war es nicht mehr up to date, Madrigale im Chor zu singen, wusste man nun doch, dass dies dem sogenannten Originalklang offenbar zuwider lief. Irgendwann waren auch die Werke, mit denen Jürgen Jürgens Furore gemacht hatte, allen voran L'Orfeo und die Marienvesper, Repertoirestücke geworden und kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Insofern war es nur folgerichtig, dass sich Jürgens in den 1980er Jahren zunehmend anderen Komponisten zuwandte und der oratorischen Literatur des 19. Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit schenkte als zuvor.
Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze – auch dem musikalischen nicht. Heute, da die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts in zahllosen Einspielungen nahezu unbegrenzt verfügbar scheint, fällt es schwer, sich vorzustellen, dass dies noch vor einer Generation fast undenkbar war. Monteverdi ist ein selbstverständlicher Name in Konzert- und Opernprogrammen geworden. Die berühmten Interpreten heißen heute anders, und von den damals sensationellen Einspielungen sind heute kaum noch die eine oder die andere bekannt. Dabei waren sie zu ihrer Zeit wegweisend. Jürgen Jürgens hat mit seinen Aktivitäten als Chor- und Orchesterleiter, als Kämpfer für unbekanntes Repertoire jenseits der ausgetretenen Pfade, als Mittler zwischen musikalischer Praxis und Musikwissenschaft, als Herausgeber von unbekannten Werken nicht nur das Konzertleben über Jahrzehnte hinweg bereichert, sondern auch den musikalischen Weggefährten in seinem Chor, die sich auf dieses Abenteuer einzulassen bereit waren, musikalische Werte vermittelt, die weit über den Spaß am Singen hinausgehen.
Nachwort
Es sei mir gestattet, mit einem persönlichen Statement zu schließen. Ich wurde im Sommer 1969 in meinem ersten Semester an der Universität Hamburg eher durch Zufall Mitglied des Monteverdi-Chores, aber die Bekanntschaft mit diesem Komponisten, der damals für mich trotz Leistungskurses Musik in der Schule noch ein unbekannter Name war, und vor allem mit Jürgen Jürgens, der seine Begeisterung für diese Musik so intensiv vermitteln konnte, dass man ihm darin einfach folgen musste, hat meinem Leben einen völlig neuen Kurs gegeben. Eine Konzertreise zum Flandern-Festival nach Brügge stand vor der Tür, und es wurde noch eine Altistin für den Chor gesucht, die in wenigen Wochen für ein Konzert mit dem VI. Madrigalbuch und eines mit der Marienvesper einspringen konnte. „Wenn du in 14 Tagen die Noten lernst, kannst du mitfahren“ – nie werde ich diesen Satz vergessen, mit dem sich in meinem Leben alles änderte und sich eine musikalische und eine geistige Welt auftat, von deren Existenz ich vorher nicht einmal etwas geahnt hatte. Kann man sich heute, da die Marienvesper zum gängigen Repertoire gehört, noch vorstellen, was es bedeutet, diese Musik zum ersten Mal zu hören? Mich jedenfalls hat sie damals zutiefst beunruhigt und in allerhöchstem Maße fasziniert. Ich beschloss, mein Studienfach zu wechseln und Musikwissenschaft zu studieren, legte meine Pläne, nach Berlin zu gehen, auf Eis und blieb in Hamburg und im Monteverdi-Chor, bis ich dann, nicht zuletzt auch auf Monteverdis Spuren, zum Promovieren nach Italien ging. Monteverdi und seine Zeitgenossen wurden später zu meinem bevorzugten Forschungsfeld, mit dem ich mich heute, fast 45 Jahre später und inzwischen an der Schwelle zur Pensionierung, immer noch und immer wieder neu beschäftige. Das verdanke ich Jürgen Jürgens und seiner so engagierten Liebe zu einer Musik, an deren Wiedergewinnung er als einer der wichtigsten Wegbereiter mitgearbeitet hat.
2 Prof. Dr. phil. Silke Leopold, Universität Heidelberg, Musikwissenschaftliches Seminar Mitglied im Monteverdi-Chor von 1969 bis 1979
Robert Schomacker3
Der Mensch Jürgen Jürgens und sein Lebensweg
ANNÄHERUNG AN DIE PERSÖNLICHKEIT
Wer wäre wohl in der Lage, alle Facetten eines so vielschichtigen Charakters wie den Jürgen Jürgens' auszuleuchten? So kann jemand, der diesen außergewöhnlichen Menschen in seiner besten Zeit erlebte, nur die eigenen Wahrnehmungen wiedergebend, sagen: JüJü – wie ihn die Freunde oft nannten – war über seine musikalische Bedeutung hinaus ein Mann mit vielen liebenswerten Eigenschaften, voller Großmut und Herzlichkeit, die er in seinen persönlichen Beziehungen bewies, und mit einigen Schwächen, die ihm auch selbst zu schaffen machten. Mit seinem Charisma und seiner Energie war er vor allem in den jungen Jahren der Prototyp des Anführers. Im Gespräch war er charmant, einfallsreich und offenherzig, aber, wenn es kontrovers wurde, zuweilen auch hitzköpfig. Arglist war ihm fremd, doch gelegentlich trieb es ihn zu Schabernack und eigenwilligen Späßen. Den Genüssen des Lebens war er stets zugeneigt. Wie in der Musik, so hasste er auch im Umgang mit Menschen alles Aufgesetzte, Gekünstelte. Er konnte sich nur schlecht verstellen und war deshalb, obwohl immer um Höflichkeit bemüht, in seinen unkontrollierten Äußerungen manchmal auch verletzend. War jemand in der Probe unaufmerksam, störte oder stellte sich allzu dusselig an, so konnte er seinen Zorn oft nicht unterdrücken, wurde manchmal auch sarkastisch, aber er schaffte es fast immer, sich schnell zu beherrschen und den jähen Ausbruch seines Unwillens nach kurzem Aufbrausen ins Humorvoll-Freundliche umzulenken. Nur wenn er sich angegriffen oder hintergangen fühlte, war er unversöhnlich, zwang sich kaum zu Diplomatie und opportunem Einlenken. Daran konnten Freundschaften zerbrechen und Geschäftsbeziehungen scheitern. Er war ein Mensch, an dem vielleicht der eine oder andere Anstoß nahm, den aber die meisten gerade wegen seiner Eigenschaften schätzten, den viele verehrten und den nicht wenige Damen anhimmelten.
KINDHEIT UND JUGEND
Jürgen Jürgens wurde am 5. Oktober 1925 in Frankfurt am Main in der Senckenbergstraße (heute Brönnerstraße) geboren und am 12. Oktober in der dortigen Paulskirche (bis 1944 evangelische Hauptkirche Frankfurts) getauft. Der Vater, Walter Jürgens, Ingenieur bei Opel in Rüsselsheim, war bei der Geburt des Sohnes 33 Jahre alt, die Mutter, Herta, geborene Schulder, Hausfrau, war 31 Jahre alt. Neben Jürgens gab es in der Familie seine sechs Jahre ältere Schwester Inge. Jürgens selbst erinnerte sich noch an einen Großonkel mütterlicherseits, Guido Thielscher, einen damals recht bekannten Komödianten, auf dessen Schoß er saß und dessen Stimme auf Schallplatten erhalten blieb. [01]
Ursula Jürgens schreibt: „Jürgens erste musikalische Eindrücke waren zwiespältiger Natur, wie er immer wieder erzählte. Mit zwei oder drei Jahren saß er oftmals spielend unter dem Flügel seiner Mutter und musste ungewollt seinem tremolierend singenden Onkel, einem Tenor des Frankfurter Rundfunkchores, lauschen.“ [02] Glücklicherweise hat dieses Erlebnis seine Beziehung zur Musik nicht nachhaltig beeinträchtigt, aber es hat schon früh sein musikalisch empfindliches Gehör herausgefordert. Vielleicht war es sogar ein Schlüssel zu seinem Erfolg als Musiker, denn das beständige Feilen an der sauberen Intonation war bezeichnend für seine spätere Chorarbeit. Auf jedes Absinken der Stimmen reagierte er beim Dirigieren sofort in der für ihn typischen Weise mit dem nach oben gerichteten Zeigefinger. Hörte er Schallplatten, so bereitete ihm die kleinste Störung im Gleichlauf eines Plattenspielers geradezu körperliche Qualen. Er gehörte zu den wenigen Menschen mit praktisch absolutem Gehör.
Über Jürgens' Grundschulzeit und einen möglicherweise frühen instrumentalen Musikunterricht ist nichts überliefert. Jutta Jürgens berichtet von den Erinnerungen ihres Mannes: „Die Eltern waren zwar keine Berufsmusiker, aber die Mutter spielte Klavier und sang sehr schön, der Vater spielte sehr gut Cello. Als das Musische Gymnasium 1939 in Frankfurt gegründet wurde, war es für die Eltern selbstverständlich, dass der Sohn hier seine musikalische und schulische Ausbildung fortsetzte. Zuvor jedoch hatte dieser sich einer Aufnahmeprüfung zu stellen, die er als einziger Frankfurter bestand. Wie alle seine Mitschüler musste er dann, obwohl ortsansässig, im Internat wohnen.“ [01]
Das Musische Gymnasium Frankfurt ging zurück auf eine Initiative des Sozialisten jüdischer Abstammung Leo Kestenberg, von 1918 bis 1932 Musikreferent im Preußischen Kultusministerium. [03] Es nahm aber erst unter nationalsozialistischer Herrschaft am 6. November 1939 seinen Betrieb mit 115 Schülern auf. Bis 1941 war es das einzige dieser Art in Deutschland. [04] Somit gehörte Jürgen Jürgens, damals gerade vierzehn Jahre alt, zu jenen wenigen auserlesenen Schülern, „die aus allen Teilen des damaligen Deutschen Reiches stammten und alle im Internat lebten. Mädchen und Tagesschüler waren nicht zugelassen. ... Grundlage des musischen Unterrichts sollte das gemeinschaftliche Musizieren in Chor und Orchester sein, begleitet von intensiver Einzelausbildung. ... Während die nationalpolitischen Erziehungsanstalten [NAPOLA] die körperliche, die Adolf-Hitler-Schulen die politische und die normalen Oberschulen die wissenschaftliche Ausbildung betonten, sollte mit dem Musischen Gymnasium ein Schultyp geschaffen werden, der die musische Erziehung in den Vordergrund stellte.“ [04] Das Musische Gymnasium schloss mit einer zu jedem Studium berechtigenden Reifeprüfung ab. Schulleiter vom Beginn bis zum Ende dieser Bildungseinrichtung im Jahr 1945 war Kurt Thomas (1904-1973), der 1933/34, also im Alter von etwa 29 Jahren [!], in die Hitlerjugend eingetreten und ab 1940 Mitglied der NSDAP geworden war. Er soll sich aber auch dem Erbe Kestenbergs verpflichtet gefühlt und noch persönliche Kontakte zu ihm gehabt haben. [03] Andererseits ist Thomas' „Bejahung des nationalsozialistischen Systems“ deutlich belegt. [05] Nach dem Krieg war Thomas von 1957 bis 1961 Thomaskantor in Leipzig. Dann übersiedelte er nach Westdeutschland und war dort noch mehrere Jahre maßgeblich im Musikleben aktiv. Er starb am 31. März 1973. Angemerkt sei, dass Kestenberg später in Israel lebte und dass Jürgen Jürgens noch nach dessen Tod während einer Konzertreise in Israel (es muss 1975 gewesen sein) ein längeres Telefongespräch mit dessen Schwester führte. [01]
Obwohl das Musische Gymnasium zu den nationalsozialistischen Eliteschulen gehörte, nahm es, wie Heldmann in seiner apologetischen Arbeit über Kurt Thomas schreibt, gegenüber den anderen NS-Kaderschulen, zum Beispiel den sogenannten NAPOLA, in mancher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Es musste „den politischen Zielsetzungen von Partei und Staat“ entsprechen, deren (schon zu Kestenbergs Zeiten bestehende) Absicht es unter anderem war, „die Vormachtstellung der kirchlichen Musikschulen (Regensburger Domspatzen, Thomanerchor, Dresdener Kreuzchor, Wiener Sängerknaben) zu brechen.“ Es unterstand „unmittelbar der Dienst- und Fachaufsicht des Reichserziehungsministeriums in Berlin ... Die Schulleitung [hatte] unmittelbare dienstliche Kontakte zu den höchsten Dienststellen der Partei, der SS, der Reichsjugendführung und der Wehrmacht.“ [03] Trotzdem gelang es Kurt Thomas immer wieder, sich durch geschicktes Taktieren und unter Berufung auf den künstlerischen Anspruch einigen Freiraum zu bewahren und „die Schule in ihrem Kernbereich in seinem und Kestenbergs Sinne zu leiten und inhaltlich zu profilieren. Die Ausgestaltung dieses Kernbereichs folgte musikpädagogischen, schulfachlichen und gesamterzieherischen Vorstellungen der Reformpädagogik, Jugendbewegung und Jugendmusikbewegung.“ [03]
Abb. 3 Chor- und Orchesterprobe im Musischen Gymnasium Dirigat Kurt Thomas (* Jürgen Jürgens)
Jürgen Jürgens war der älteste unter den Schülern des ersten Jahrgangs. Zu seinen Klassenkameraden gehörten unter anderen die späteren Dirigenten Horst Stein und Otto-Werner Müller. Letzterer lebte später in den USA; am 24.09.1982 besuchte Jürgens ihn mit einer Gruppe von Chormitgliedern in seinem Haus in New Haven. Weiterhin gehörten zu Jürgens' Mitschülern der Sologeiger Werner Krotzinger, der Komponist Alfred Koerppen sowie Heinz Hennig, der Gründer und Leiter des Knabenchores Hannover. [06] (Heinz Hennig übernahm im März 1991, als Jürgens wegen Erkrankung ausfiel, die Leitung des Monteverdi-Chores bei der Aufführung von Bachs Matthäus-Passion.) Nicht alle Mitschüler wurden später Berufsmusiker, manche sahen eine sicherere Zukunft in anderen Berufen. Einer von diesen war der später als Schauspieler sehr bekannt gewordene Hans Clarin (1929-2005); ein anderer, der Jüngste des ersten Jahrgangs, der später viele Jahre in Jürgens' Monteverdi-Chor sang, war der spätere Zahnarzt Peter Hieber. Dieser erinnert sich, dass am Musischen Gymnasium eine strenge Disziplin herrschte mit Spind- und Fingernagel-Kontrolle, man schlief auf Strohsäcken in Etagenbetten zu acht in einem Zimmer, morgens wurde mit Musik von Blockflöten oder Geigen geweckt.
An den Schulunterricht mit täglich mindestens einer von insgesamt sieben Wochenstunden theoretischen Musikunterrichts schloss sich jeden Nachmittag eine Chor- und Orchesterprobe an. Jürgens, mit seiner Knabenstimme, trat gelegentlich als Solist hervor. [06] Es gibt eine Schellack-Schallplatte, auf der er mit Händels „Oh, hätt' ich Jubals Harf“ (Josua) zu hören ist. [01]
Ursula Jürgens: „Die Jahre im Musischen Gymnasium und das Leben in der stets zu Streichen aufgelegten berüchtigten ‚Stube Dachboden‘ haben nicht nur die musikalische Begabung des nicht besonders fleißigen Schülers Jürgen Jürgens gefördert, sondern auch seine ausgeprägten literarischen Ambitionen. Für ihn, in dessen Elternhaus zwar häufig musiziert, aber keine Bücher gelesen wurden, entwickelte sich Lesen zur großen Leidenschaft. Sehr zum Ärger seines Vaters, der später allerdings auch noch den Weg zur Literatur fand, gab der neugierige Jürgen sein ganzes Taschengeld für Bücher aus. Das Musizieren hingegen war, sieht man vom täglichen Chorsingen und Orchesterspielen als zweiter Geiger am hintersten Pult ab, nebensächliche Pflichtübung, zumal sein solistischer Ehrgeiz durch den stimmlich noch begabteren Mitschüler, den späteren Konzertsänger und Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch aus Leipzig, gebremst wurde. Dafür versah Jürgens das Gymnasium mit Kantaten-Texten und Gelegenheits-Dichtungen aller Art, denn im Dritten Reich gab es viele Anlässe, bei denen Chor und Orchester der Schule mit neuen, dem Anlass entsprechenden Werken auftreten mussten.“
Zwar waren Heldmann zufolge „die Schüler des Musischen Gymnasiums verpflichtet, bei allen öffentlichen Auftritten ... die HJ-Uniform zu tragen“, aber im Schulalltag waren sie, im Gegensatz zu den NAPOLA-Schülern, von der Uniformpflicht befreit. Thomas wehrte sich erfolgreich gegen die Einmischung von Partei und staatlichen Stellen bei der Auswahl seiner Schüler. Dabei verwies er „auf die überragenden Leistungen der Schüler in den Aufnahmeprüfungen. Auch sind von Thomas Halbjuden als Lehrer und Schüler aufgenommen worden. ... In den normalen Oberschulen war das zu dieser Zeit nicht möglich.“ Thomas nahm sich zudem die Freiheit, auch die großen kirchlichen Werke aufzuführen, und es gelang ihm sogar, Händels „Judas Makkabäus“ unter dem von ihm vorgeschobenen Titel „Der Feldherr“ einzustudieren. [03] Nach Jürgens' Erzählung lud Thomas gelegentlich Schüler der Abiturientenklasse in seine Wohnung ein, wo sie erstmals etwas von jener Musik zu hören bekamen, die unter den Nationalsozialisten verpönt und verboten war. [07]
Der Alltag im Knabeninternat, die Ordnungsregeln und Lebensumstände boten den Heranwachsenden wenig Gelegenheit, sich an den zwanglosen Umgang mit Mädchen zu gewöhnen. Einige der Zöglinge, darunter Jürgens, verlegten sich darauf, mit den jungen Küchenhilfen anzubandeln. Als das ruchbar wurde, setzte es für sie eine Tracht Prügel von Kurt Thomas persönlich. [06] Trotz allem blieb dieser für Jürgens immer eine musikalische Autorität und der wegweisende Lehrer.
Nach den Zerstörungen in Frankfurt durch Bombenangriffe im Dezember 1943 und Januar 1944 wurde das Musische Gymnasium in ein enteignetes Kloster in Untermarchtal südwestlich von Ulm verlegt. [03] Die Familie Jürgens fand Unterkunft im 110 km entfernten Königsfeld (Schwarzwald) [01] [02]





























