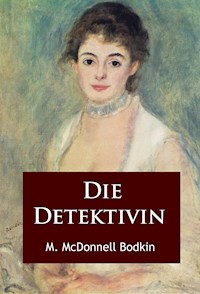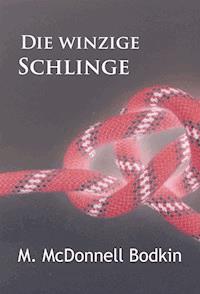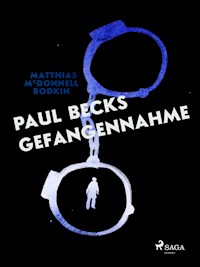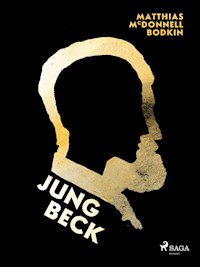
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist dem jungen Lord Kirwood gar nicht recht, als ihm in Cambridge in seinem College der junge Beck zugewiesen wird. Becks Vater hat sich zwar als erfolgreicher Detektiv einen Namen gemacht, aber der junge Beck wirkt demgegenüber blass. Ebenso geht es Kirwoods Schwester Gertrud, die Beck zunächst für ein zartes Muttersöhnchen hält. All dies ändert sich aber in der Folgezeit, in der sich Beck als einer der gescheitesten Menschen erweist. Und es gibt genug Anlässe, in denen Beck seinen Spürsinn unter Beweis stellen kann und die dieses Büchlein zu einer amüsanten Abfolge von Kriminalfällen macht. So gilt es noch im College betrügerischen Mitstudenten auf die Schliche zu kommen, einem großen Diamanten auf den Fersen zu bleiben und verschiedene Mordfälle aufzuklären. Alles in der besten Tradition des Kollegen Sherlock Holmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias McDonnell Bodkin
Jung Beck
Kriminalroman
Saga
Ebook-Kolophon
M. Mc Donnell Bodkin: Jung Beck. - Aus dem Englischen von Alfred Peuker © 1920 M. Mc Donnell Bodkin. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711462133
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
1. Die Zwillinge
In einer Hamletvorstellung hörte ich einst von einer alten Dame die ebenso ergötzliche wie treffende Bemerkung: „Der arme Hamlet hat aber auch wirklich viel Pech in seiner Familie.“ Dasselbe kann man von den Kirwoods sagen, denn es gibt wahrhaftig kaum eine Familie — selbst diejenige Hamlets nicht ausgenommen —, in der so viel Merkwürdiges und Aufregendes vorgefallen ist, und wobei der junge Beck so oft seine Hände im Spiele gehabt hat.
Ab und zu sickerte wohl einmal etwas von all diesen meistens recht unerquicklichen Wirrnissen in die Öffentlichkeit durch, und ich wurde dann im Klub und im Theater von allen Seiten bestürmt und ausgefragt; Beck selbst hielt nämlich dicht wie eine Auster — aus ihm war nichts herauszukriegen. Und legte ich ihm dann nahe, in dem betreffenden Falle die volle, ungeschminkte und unverfälschte, kurzum die lautere, reine Wahrheit an geeigneter Stelle zu veröffentlichen, so sträubte er sich dagegen wie ein störrischer Gaul.
„Ich will mit diesen leidigen Geschichten, die man meiner Ansicht nach am besten totschweigen sollte, nicht in Verbindung gebracht werden,“ pflegte er zu sagen. „Wenn du die Sachen durchaus breittreten musst, so setze wenigstens den Namen meines Alten an Stelle des meinigen; als früherer Detektiv ist er ja auch an so etwas gewöhnt und wird es uns sicher nicht übelnehmen.“
So kam es denn, dass ich in der Zeitung ein paar Skizzen veröffentlichte, deren Hauptheld der alte Beck war. In seiner lässigen Art brummte der alte Herr zwar ein wenig, doch darum kümmerte sich der Sohn nicht viel. Aber die Mutter war mit diesem Verfahren auf die Dauer nicht einverstanden.
„Das dulde ich nicht länger,“ erklärte sie. „Ehre, wem Ehre gebührt! Mein Mann hat sich wahrlich genug eigenen Ruhm erworben, an seines Sohnes Teil braucht er sich nicht zu bereichern.“
Und gegen seine Mutter vermochte der junge Beck nicht aufzukommen. Knurrend und brummend fügte er sich schliesslich und gab mir mit den liebenswürdigen Worten: „Mach zum Henker, was du willst!“ Generalvollmacht.
Das liess ich mir natürlich nicht zweimal sagen, obwohl ich mir die Sache einfacher vorgestellt hatte, als sie es tatsächlich war. Wohl hatte ich in unsern zahlreichen gemeinsam bestandenen Abenteuern Beck als einen Detektiv, wie er im Buch steht, kennen gelernt, leider aber bot seine Persönlichkeit so gar nichts, was die Neugier der Leser zu reizen vermochte. Er konnte nicht Geige spielen und Shag rauchen wie Sherlock Holmes, hatte weder scharfe Züge noch stechende Augen und war keine Spur morphiumsüchtig. Auch spielte er nicht Kricket gleich Raffles, machte keine Gedichte wie Kapitän Kettle — kurz, ich vermochte ihm nicht das kleinste Reklameplakat anzuhängen. Er war nichts weiter als ein hübscher Junge, der noch dazu ein ganzes Teil jünger aussah, als er in Wirklichkeit war. So kam ich eine Zeitlang mit meinen Zeitungsartikeln gar nicht recht von der Stelle.
Den Anfang finden, das war die grösste Schwierigkeit. Oft, wenn ich nach einer anstrengenden Jagd- oder Golfpartie mit Beck noch eine Weile nach dem Essen bei einer guten Zigarre zusammensitze, scheinen — obwohl wir uns gegenseitig ausgiebig anschweigen — unsre Gedanken miteinander über das gemeinsam Erlebte Zwiesprache zu halten. In wunderbarer Klarheit stehen dann Personen und Örtlichkeiten vor meinem inneren Auge; am deutlichsten aber war es an jenem Septembermorgen in Cambridge das Bild meines jungen Freundes selbst, das sich mit der Schärfe einer starkbelichteten Momentaufnahme meinem Gedächtnis eingeprägt hat.
Ich war ungefähr drei Wochen dort, als einer meiner Lehrer, der alte Doktor Day, mir eines Morgens beim Frühstück einen jungen Neuankömmling vorstellte, den ich ein wenig herumführen sollte. Im Sprechzimmer befanden sich bei meinem Eintritt vier Personen, Doktor Day selbst, um dessen hochaufgeschossene, schmächtige Gestalt die abgetragene Amtstracht schlotterte, und dessen mächtige Glatze nur noch hinten im Nacken ein spärliches Haarkränzlein aufwies, ferner ein schmächtiges Bürschlein, das mit seinen Eltern am Fenster stand.
„Kirwood,“ sagte der Doktor zu mir und deutete mit einer vorstellenden Handbewegung auf den untersetzt gebauten, freundlichen Herrn, der mit dem Rücken gegen das Fenster lehnte, „Sie haben doch wohl schon von Mr. Beck gehört?“
Ob ich schon von Paul Beck gehört hatte! Sherlock Holmes und Paul Beck waren seit langer Zeit meine ganz besonderen Lieblinge. Sherlock war natürlich spannender, doch hatten Becks Abenteuer den unleugbaren Vorzug, buchstäblich wahr zu sein. Ein wonniges Gruseln durchrieselte mich bei der Vorstellung all der aufregenden Erlebnisse, die der Mann dort vor mir schon durchgemacht hatte. Er sah übrigens genau so aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte — kraftvoll und von überlegener Ruhe, mit einem Zug gewinnender Liebenswürdigkeit um Mund und Augen. Die hübsche Dame neben ihm war vermutlich seine Frau, Dora Myrl, die mir für den alten Paul immer viel zu schade vorgekommen war, und der dicht neben ihr stehende Sprössling musste wohl ihr Sohn sein, den ich jetzt ins Schlepptau nehmen sollte. Ich erinnere mich noch heute, wie verächtlich ich damals die Nase darüber rümpfte, dass sich dieses verzärtelte Schosskindchen von seiner Mutter ins College begleiten liess. So war der erste Eindruck, den der junge Beck auf mich machte, kein allzu vorteilhafter; mein neuer Kamerad, mit dem ich später so manches seltsame Abenteuer bestehen sollte, war eben ein Muttersöhnchen, und Muttersöhnchen erfreuen sich niemals sonderlicher Beliebtheit.
Mit seinem Lockenkopf und seinen blauen Augen glich er mehr einem Mädchen als einem rechtschaffenen Jungen, und merkwürdig mädchenhaft mutete mich auch das Grübchen in seiner linken Wange an, das sich aber — wie ich später beobachtete — nur dann zeigte, wenn er, wie eben jetzt, in grosser Erregung die Lippen fest zusammenpresste. Neben dem hochgewachsenen Doktor sah er viel kleiner aus, als er in Wirklichkeit war, und ich konnte später gar nicht begreifen, wie dieser schmächtige Knabenkörper so viel Muskelkraft zu entwickeln vermochte; an jenem ersten Tage schien es mir ein leichtes, mit dem vermeintlichen Schwächling fertig zu werden. Mein Gesicht musste wohl ein ziemlich deutlicher Spiegel meiner Empfindungen gewesen sein, denn die kleine Frau schien mir mit ihren hellen Augen meine geheimsten Gedanken von der Stirn abzulesen.
„Er ist durchaus nicht so schwächlich, wie er aussieht,“ sagte sie; „das können Sie mir, seiner Mutter, schon glauben.“
Offenbar machte ich jetzt ein sehr dummes Gesicht.
„Das habe ich ja gar nicht so gemeint,“ stammelte ich, wobei ich ganz vergass, dass ich doch gar nichts gesagt hatte. „Ich hoffe, wir werden gute Freunde werden.“
„Davon bin ich überzeugt,“ erwiderte Mrs. Beck.
Und sie war eine gute Prophetin, denn schon nach acht Tagen waren wir tatsächlich die dicksten Freunde, und nie hat unsere Freundschaft seitdem einen Riss bekommen.
Schon vor unsrer Ankunft in Cambridge hatten es die Zwillinge Bertram, obwohl sie uns nur um ein Semester voraus waren, zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Selbst für Zwillinge war ihre Ähnlichkeit verblüffend; nicht einmal ihre vertrautesten Freunde konnten die beiden auseinander halten, daher gingen diese bei all ihren Streichen gewöhnlich straflos aus. Schwänzte einer von ihnen die Vorlesung, so konnte der Professor nicht feststellen, welcher es gewesen war; wurden sie bei irgendeinem Schabernack ertappt, so vermochte der Proktor den Schuldigen nicht anzugeben; stets wurde der Unrichtige beschuldigt — wenigstens seiner eigenen Beteuerung nach.
Sie waren hübsche schwarzhaarige und schwarzäugige Burschen, zwar etwas klein, aber breitschultrig und von wahrhaft affenähnlicher Gewandtheit. Ihnen beim Hockey- oder Lawn-Tennis-Spiel zuzuschauen, wie sie hin und her liefen und sprangen, war ebenso genussreich, wie es schwierig war, sie zu unterscheiden, denn keiner von ihnen hatte irgend ein persönliches Merkmal. Welches Eddie und welches Freddie Bertram war, wussten nur sie allein, und beide hüteten sich wohl, es zu verraten.
Ihr Tun und Lassen hielt das ganze College in Atem, und dennoch waren sie, man wusste nicht recht warum, trotz ihrer ungezwungenen Umgangsformen und ihres lebhaften, übermütigen Naturells durchaus nicht allgemein beliebt.
Die Bertrams waren Zöglinge des St. John’s College, während Beck und ich dem Cam’s College angehörten; daher kam es, dass wir schon vierzehn Tage in Cambridge weilten, ohne mit ihnen in nähere Berührung gekommen zu sein. Erst als einer der Zwillinge Eddie oder Freddie — genau weiss ich’s nicht mehr — meinen Freund und mich beim Tennisspiel unsern Part mit Glanz gewinnen sah, setzten sie fünf Pfund gegen uns. Wir nahmen an und wurden trotz scharfer Gegenwehr in fünf Spielen dreimal geschlagen. Ich glaube, jeder einzelne von uns wäre mit jedem einzelnen von ihnen wohl fertig geworden, vereint aber waren sie unwiderstehlich.
Unser Zusammenspiel verursachte grosses Aufsehen, und wir kamen überein, in vierzehn Tagen um den doppelten Einsatz zu spielen. Beck jedoch, der anfangs Feuer und Flamme dafür war, verlor bald die Lust daran. Schon nach acht Tagen mochte er nicht mehr mit mir üben, und nach Ablauf der zweiten Woche zog er seine Zusage zurück. Natürlich waren die Zwillinge darüber verstimmt und lehnten meinen Vorschlag, mit mir gemeinsam Beck umzustimmen, kurzerhand ab.
In den folgenden Wochen bekam ich sie fast gar nicht zu Gesicht, bis mich ein ziemlich aufregendes Ereignis wieder mit ihnen zusammenführte.
Ich pflegte vor dem Frühstück ein Stündchen auf dem Cam zu rudern, und zwar in einem Rob-Roy-Kanu, das ich einem gewöhnlichen Ruderboot vorziehe, weil man darin die Strecke, die man vor sich hat, übersehen kann. Ich gehöre zwar nicht zu den Leuten, die beim Anblick einer schönen Gegend in Begeisterung geraten, doch ist eine liebliche Flusslandschaft mit dem bewegten Spiel von Licht und Schatten und den klaren Spiegelbildern der Ufer für mich das Schönste auf Gottes Erdboden.
Als ich eines Morgens ungefähr zwei Meilen weit gerudert war und gerade um einen Ufervorsprung bog, bemerkte ich vor mir ein leichtes Zweierboot und erkannte bei schärferem Hinsehen die Zwillinge an den Rudern.
So meisterhafte Tennisspieler sie auch waren — vom Rudersport hatten sie augenscheinlich keine Ahnung, denn jeder ruderte auf eigene Faust drauflos, ohne sich dem andern anzupassen, und das kleine Fahrzeug taumelte in sprunghaften Stössen stromaufwärts wie eine aufgescheuchte Forelle.
Ich war ein wenig überrascht, sie so ungeübt im Doppelrudern zu sehen, doch liessen sie mir nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Denn ehe ich mich dessen versah, machte der am Schlagriemen sitzende Zwilling einen zu tiefen Ruderschlag und fiel hintenüber, während der andere in demselben Augenblick durch einen zu kurzen Schlag das schwankende kleine Fahrzeug vollends zum Kentern brachte.
Mit einem Male versanken die beiden weissgekleideten Gestalten in dem hoch aufspritzenden Wasser und boten in der Plötzlichkeit ihres Verschwindens einen so überwältigend komischen Anblick, dass ich in lautes Lachen ausbrach. Natürlich zweifelte ich keinen Augenblick daran, dass die Verunglückten schwimmen konnten. Im nächsten Moment tauchte der eine prustend und keuchend wieder auf und klammerte sich krampfhaft an das gekenterte Boot, während der andre mit der Strömung kämpfte, die ihn rasch flussabwärts trug. Auf halbem Wege zwischen dem Boot und meinem Kanu hoben Arm und Kopf sich sekundenlang aus den Fluten, und ein verzweifelter Hilfeschrei gellte über das Wasser.
Jetzt verging mir freilich das Lachen, denn ich sah, dass hier ein Ertrinkender mit dem Tode kämpfte. Rasch fuhr ich mit dem Arm bis zur Schulter ins Wasser und packte den eben bei mir vorüberwirbelnden Körper glücklich an dem weissen Flanellhemd. Allerdings kenterte bei der heftigen Bewegung auch mein kleines Fahrzeug, doch daraus machte ich mir nicht viel, da ich wie ein Otter schwimme und nichts als das Nasswerden zu fürchten hatte.
„Nur ruhig! Keine Gefahr!“ keuchte ich, während ich seinen Kopf über Wasser hielt und den Mann auf meinen Rücken beförderte.
„Jawoll,“ erwiderte er und blieb dann auch so regungslos und handlich liegen wie ein Stück Holz. Rasch schaffte ich ihn ein Ende weiter stromabwärts, den beiden Booten gegenüber ans Land und eilte dann sofort seinem Bruder zu Hilfe.
„Laufen Sie sich warm,“ rief ich dem Geretteten zu, während ich das Ruderboot mit dem andern sich noch immer krampfhaft daran festhaltenden Zwilling dem Ufer zuschob. Als ich das Boot wieder aufgerichtet und auch das Kanu eingefangen hatte, fand ich die Zwillinge so munter wie die Fische im Wasser, und sie erklärten sich sofort bereit, selbst zurückzurudern, wovon ich aber nichts wissen wollte, da es mich nicht nach einer zweiten Auflage dieses Scherzes gelüstete.
„Wenn Ihnen nicht zu kalt ist und Sie mir versprechen, ganz still zu sitzen, will ich Sie zurückrudern,“ sagte ich. „Das Kanu können wir ins Schlepptau nehmen. Und ehe Sie sich wieder in solch einem leichten Boot aufs Wasser wagen, sollten Sie wenigstens eine schwache Ahnung vom Rudern und Schwimmen haben.“
„Dann los! Ich bin so warm wie ’ne frischgebackene Semmel!“ riefen beide gleichzeitig und dabei in so übereinstimmendem Tonfall aus, dass es mich förmlich verblüffte.
Unterwegs überboten sie sich geradezu in allerhand Spässen und machten sich über ihr unfreiwilliges Bad weidlich lustig.
„Nichtsdestoweniger werden wir es Ihnen nie vergessen, Kamerad,“ sagte der eine von ihnen beim Aussteigen. „Ohne Ihr Dazwischentreten hätte der Fluss heute morgen wahrscheinlich zwei Leichen angeschwemmt.“
„Deren Identifizierung dem Leichenbeschauer ohne Zweifel viel Kopfzerbrechen verursacht hätte,“ meinte der andere lachend.
So leicht sie die Sache mir gegenüber auch nahmen, so viel Aufhebens machten sie davon vor den anderen. Das ganze College erfuhr brühwarm die Geschichte meiner „unerschrockenen Tat“, und es war mir schliesslich beinahe lästig, mich von den Kameraden für nichts und wieder nichts beglückwünschen und wie ein Götzenbild anstaunen zu lassen. Indessen konnte ich den Zwillingen nicht recht böse sein, denn sie meinten es sicherlich gut und benahmen sich auch sehr taktvoll, als ich sie deswegen zur Rede stellte.
Je öfter ich sie sah, desto besser gefielen sie mir. Ich kann wohl ohne Überhebung sagen, dass ich im College einen sehr netten Umgangskreis gefunden hatte, und alle meine Kameraden mochten die Zwillinge gut leiden mit einziger Ausnahme meines besten Freundes Beck.
Eines Morgens beim Frühstück — das heisst ich frühstückte allein, Beck war schon seit ein paar Stunden damit fertig — machte ich ihm deswegen Vorhaltungen. Ich war an jenem Morgen nicht gerade in rosiger Laune, da ich am Abend vorher beim Bridge siebenundfünfzig Pfund verloren hatte.
„Hast du etwas gegen die Bertrams, Beck?“ fragte ich daher in ziemlich kurzem Tone; „ich glaube, ich habe ein Recht, danach zu fragen.“
„Gewiss,“ bestätigte er ruhig; „ja, ich habe etwas gegen sie.“
„Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt?“
„Warum hast du mich nicht schon früher danach gefragt? Ich will es dir keineswegs verhehlen. Einer von den beiden ist nämlich ein ganz gemeiner Schuft.“
„Welcher?“ fragte ich gedankenlos.
Beck brach in herzliches Lachen aus, in das ich sofort einstimmen musste, denn etwas so unwiderstehlich Fortreissendes wie das Lachen meines Freundes gibt es so leicht nicht wieder.
„Ja, da fragst du mich zu viel,“ rief er aus; „das möchte ich selbst für mein Leben gern wissen, damit ich ihm das Genick brechen könnte.“
„Wie, so schlimm ist die Sache?“
„Ja, ich könnte zu keinem andern darüber sprechen als zu dir. Kennst du die kleine Miss Bloom?“
„Ach, die Kleine aus dem Zigarrenladen? Nur ganz flüchtig. Niedlicher kleiner Käfer!“
„Miss Bloom ist eine Dame,“ bemerkte Beck ziemlich steif; „das scheinst du nicht zu wissen. Ihr Vater war ein sehr beliebter Geistlicher mit gutem Einkommen, starb aber ganz plötzlich und liess seine Witwe und seine einzige Tochter in recht bedrängter Lage zurück. Lucy, ich meine Miss Bloom, war damals eine der begabtesten Studentinnen des Girton-College a), gab aber nach des Vaters Tode sofort ihr Studium auf und übernahm mit Hilfe einiger Freunde den Tabakladen an der Ecke, um sich und ihrer Mutter ein neues Heim zu schaffen.“
„Du weisst ja über Miss Blooms persönliche Verhältnisse geradezu glänzend Bescheid, alter Junge,“ neckte ich, worauf Beck errötete — tatsächlich errötete — Beck!
„Das weiss hier jeder ausser dir, du Dickkopf,“ antwortete er in scharfem Ton. „Alle Kommilitonen kaufen dort ihren Tabak und ihre Zigarren und könnten wahrhaftig keine bessere Bezugsquelle finden — doch davon ist hier nicht die Rede; jeder einzelne von ihnen sieht in Miss Bloom die Dame, die sie tatsächlich ist, nur deine famosen Bertrams nicht.“
„Das heisst — einer von ihnen,“ verbesserte ich.
„Ganz recht, das meinte ich.“
„Nun, und was hat er ihr denn getan?“
„Er hat sich ihr gegenüber als der brutale, ungehobelte Bursche benommen, der er im Grunde genommen ist.“
„Welcher?“
„Mach keine Witze, Kirwood, mir ist nicht nach Scherzen zumute. Noch heute kocht mir das Blut, wenn ich daran denke. Als das arme Mädchen nach einem anstrengenden Tage einen Spaziergang am Flussufer machte, erdreistete sich der Lümmel, ihr nachzuschleichen und ihr mit Gewalt einen Kuss zu rauben.“
Ich muss gestehen, dass die Geschichte keinen sonderlichen Eindruck auf mich machte und ich Becks Entrüstung keineswegs teilte.
„Na, was ist denn schliesslich so Verdammenswürdiges dabei, wenn ein junger Mann einem hübschen Mädel einen Kuss raubt?“ meinte ich leichtsinnig.
Das war zu viel für Beck. Ich glaube, nie ist unsre Freundschaft so nahe daran gewesen, in die Brüche zu gehen, wie in jenem Augenblick. Ohne ein Wort der Erwiderung kehrte er mir den Rücken und ging nach der Tür.
„Verzeih mir, Beck!“ rief ich ihm nach. „Ich wollte dich nicht verletzen.“
Langsam liess er die Hand vom Türdrücker sinken und kam wieder zurück.
„Wie würde es dir gefallen, wenn dieser Bengel versuchen wollte, deine Schwester gegen ihren Willen zu küssen?“ fragte er unvermittelt. „Und ich kann dir nur sagen, Kirwood, dass Lucy Bloom deiner Schwester nicht um Haaresbreite nachsteht.“
„Aber — —,“ begann ich von neuem, denn das Hereinziehen meiner Schwester in diese Angelegenheit berührte mich unangenehm.
„O ich weiss, was du sagen willst,“ fiel mir Beck ins Wort. „Wir haben alle schon mal ein Mädel geküsst. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn das Mädchen nichts dagegen hat. Aber einer Dame einen Kuss zu rauben, dazu gehört denn doch schon ein guter Teil Unverfrorenheit — und eine geradezu bodenlose Frechheit, wenn diese Dame Lucy Bloom ist.“
Ich fühlte mich zwar noch immer nicht überzeugt, vielleicht weil ich Miss Bloom damals noch nicht kannte, allein Beck hatte sich so in Eifer geredet, dass ich es für geratener hielt, ihm nicht mehr zu widersprechen.
„Wie bist du denn dahintergekommen?“ fragte ich ablenkend.
„Sie hat es mir selbst erzählt. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen, sie macht sich im übrigen keinen Deut aus mir, und auch ich bin nicht die Spur in sie verliebt; ich verehre und bewundere sie nur ausserordentlich — das ist alles. Vor ungefähr acht Tagen traf ich sie eines Abends mit ganz verweinten Augen allein im Laden an, und dabei kam die ganze Geschichte heraus. Um ihre Mutter zu schonen, hatte sie ihr nichts davon erzählt, besonders da die alte Dame beständig in sie dringt, das Geschäft doch aufzugeben. Nachdem sie von jenem Bengel in so unverschämter Weise beleidigt worden war, hatte sie ihm verboten, seinen Fuss jemals wieder über ihre Schwelle zu setzen. Doch beide besuchten den Laden nach wie vor, besonders wenn Miss Bloom allein war, lehnten sich über den Ladentisch, gafften sie an und raspelten Süssholz, ob es ihr angenehm war oder nicht. Das fatalste dabei aber war, dass sie gar nicht wusste, welchen von den beiden sie eigentlich los sein wollte. ‚Beruhigen Sie sich, Miss Bloom,‘ tröstete ich sie; ‚das werde ich bald herausfinden.‘ Ich habe aber bis jetzt noch keine Ahnung, wer der Schuldige ist. Als ich mit dem einen sprach, stellte der es in Abrede, und als ich den andern ins Gebet nahm ...“
„Den andern? Kannst du sie denn unterscheiden?“
„So ziemlich, allein das half mir nichts. Jeder schob die Schuld lachend auf seinen Bruder, und so konnte ich mit dem besten Willen nicht dahinter kommen. Auch Miss Bloom vermochte mir nicht die geringsten Anhaltspunkte zu geben, und aus Furcht, den Falschen zu erwischen, muss ich dem Schurken die wohlverdiente Züchtigung schenken.“
„Liegt dir denn so viel an seiner Bestrafung?“
„Man sieht, dass du Miss Bloom nicht kennst, Kirwood, sonst würdest du nicht so fragen. Sie ist das lieblichste, sanfteste Wesen unter Gottes Sonne, und es zuckt mir förmlich in den Fingern, den Schuft zu ohrfeigen, der sich an solch einem wehrlosen Geschöpf vergreifen kann. Einen Erfolg hat es übrigens doch gehabt, dass ich mir die beiden Burschen vornahm, sie haben seitdem den Bloomschen Laden nicht mehr betreten.“
„Also vergib und vergiss und komm heute abend zu einer kleinen Bowle auf meine Bude.“
„Wenn es dir einerlei ist, alter Junge, möchte ich lieber wegbleiben.“
Es war mir zwar nicht einerlei, ich verlor aber darüber weiter kein Wort. Mir schien es reichlich übergeschnappt, dass Beck mit einem Kameraden keine Gemeinschaft haben wollte, bloss weil dieser ein hübsches Mädel geküsst oder zu küssen versucht hatte. Wenn ich Miss Bloom nicht kannte, so kannte er eben die Zwillinge nicht; ich aber kannte sie und gewann sie von Tag zu Tag lieber.
Ich fürchte, in mir steckt eine verkappte Spielratte, was bei den Kirwoods wohl im Blute liegen muss. Zwar hat mein Vater niemals in seinem Leben auf ein Rennpferd gewettet oder eine Karte angerührt, mein Grossvater aber hat sein ganzes Barvermögen, den dritten Teil unseres Gesamtvermögens, nach und nach verspielt. Ich glaube, die Spielleidenschaft, die mir im Hirn spukt, ist sein Erbteil und hat nur eine Generation übersprungen, um sich in mir aufs neue zu verkörpern.
Die Zwillinge nun verstanden und beherrschten jedes Spiel, von „Kopf oder Wappen“ bis zum „Hasard und Kümmelblättchen“ und zeigten sich im Gewinn wie im Verlust gleich angenehm. Obgleich sie kleine Einsätze bevorzugten, drückten sie sich vor grossen keineswegs und waren zu einem „Doppelt oder quitt“, gleichviel in welcher Höhe, ebenfalls stets bereit.
Ihr Mut lohnte sich übrigens reichlich. Wir spielten gewöhnlich Bridge, und in der Regel waren die beiden Bertrams Partner, wobei das Glück sie in einer Weise begünstigte, die selbst bei guten Karten und vollendetem Spiel verblüffend wirkte. Ohne Zweifel waren sie brillante, wenn auch etwas waghalsige Spieler, doch brauchte ich in dieser Hinsicht den Vergleich mit ihnen durchaus nicht zu scheuen, und Tom Staunton, meistens mein Partner, war unter uns weitaus der beste Spieler. Allein trotzdem gewannen die Zwillinge immer und immer wieder den Robber, selbst wenn Staunton und ich die denkbar besten Karten hatten. Ihre Karten schienen sich immer ganz wunderbar zu ergänzen und beim Ausspielen verfehlten ihre Feinheiten fast niemals die Wirkung.
Dabei war ihr Spiel durchaus nobel, ja sorglos, und sie gewannen öfter, wenn ihre Gegner als wenn sie selbst die Karten gaben. Ihre Entschlossenheit war beispiellos; nicht einen Augenblick zögerten sie beim Trumpfmachen oder Erklären. Stets hiess es sofort: „Ich gehe mit“ oder: „Ich überlasse es dir, Partner.“ Und prompt wie ein Echo erfolgte die Antwort, wenn sich einer von ihnen mit der Frage: „Soll ich?“ oder: „Partner, soll ich ausspielen?“ oder dergleichen an den andern wandte.
Täglich hoffte ich, dass sich das Blatt einmal wenden würde, aber das Glück kehrte mir hartnäckig den Rücken, und ich war schliesslich bei den Bertrams so tief in Schulden geraten, dass mir ganz schwül wurde, wenn ich nur daran dachte. Allerdings benahmen sie sich äusserst taktvoll, begnügten sich stets mit Schuldscheinen und drängten nie mit der Bezahlung.
In diese Zeit fiel ein Ereignis, das meine Geldsorgen für eine Weile ganz in den Hintergrund drängte. Eines schönen Tages teilte mir Beck nämlich mit, dass seine Eltern auf acht Tage nach Cambridge kämen. Das war mir eine willkommene Gelegenheit, auch meinen alten Herrn und Gerty zu einer derartigen Spritztour zu veranlassen.
Irre ich nicht, so habe ich Gertrud bisher noch nicht erwähnt, man verliert bei einer so langen Geschichte leicht die Übersicht. Indessen hat diese Unterlassungssünde nichts zu bedeuten, da Gerty ja erst jetzt auf dem Schauplatz meiner Erzählung auftaucht. Sie ist meine einzige Schwester, und obwohl sie drei Jahre weniger zählt als ich, tyrannisiert sie mich nicht schlecht, würde aber niemals dulden, dass ein andrer es täte.
Ich hatte ihr schon des öfteren von meinem Freunde Beck geschrieben, auch zu Hause viel von ihm erzählt, doch war es mir nicht gelungen, sie auch nur im geringsten für ihn zu erwärmen. Augenscheinlich verletzte es ihre schwesterliche Eitelkeit, dass ich neben irgend jemand nur die zweite Geige spielen sollte, und je mehr ich ihn rühmte, desto weniger mochte sie ihn leiden.
„Dein geliebter Beck scheint nach allem, was du sagst, ja ein schlaues Huhn zu sein,“ meinte sie; „mein Geschmack aber ist er jedenfalls nicht. Ich liebe starke, grosse, brünette Männer, nicht solche hübsche, rosige Bürschchen.“
„Warte doch nur erst ab, bis du ihn persönlich kennen lernst,“ erwiderte ich.
„Darauf will ich gern bis zum Jüngsten Tage warten,“ rief sie lachend.
Natürlich kannte Gertrud alle Detektivgeschichten vom alten Beck und Dora Myrl, aber sie hatte für den Vater ebensowenig übrig wie für den Sohn.
„Diese erkünstelte Bescheidenheit, die zwar immer nur von Glückszufällen spricht, sich dabei aber innerlich um so mehr im Bewusstsein der eigenen Findigkeit bläht und spreizt, ist mir in den Tod zuwider,“ pflegte sie zu sagen.
Dora Myrl schätzte sie jedoch sehr hoch und freute sich darauf, mit ihr bekannt zu werden. Daher hielt es auch nicht schwer, Gertrud zu einem Besuch in Cambridge zu veranlassen, solange Becks Angehörige dort weilten, und da um diese Zeit das Parlament gerade Pfingstferien hatte, so war auch unser alter Herr abkömmlich, der Gerty stets begleitete, wohin sie wollte.
Waren das famose Tage damals — wenigstens für mich. Der alte Beck erschien mit seiner Gattin zuerst auf der Bildfläche, und es war ein Vergnügen zu sehen, wie umschwärmt die Mutter meines Freundes sofort war. Die Würdenträger der Universität sahen in ihr die ehemalige hochbegabte Studentin, die einige von ihnen sogar noch unterrichtet hatten, und auf die jüngere Generation übten ihre Detektivtriumphe eine geradezu prickelnde Wirkung aus.
Was mich anbetrifft, so vermochte ich es kaum zu glauben, dass diese abgeklärte, von mütterlicher Würde umflossene Frau die Heldin so vieler aufregender Abenteuer gewesen sein sollte. Nur ein gelegentliches Aufblitzen ihrer Augen verriet noch die frühere Dora Myrl, den weiblichen Detektiv.
Am nächsten Morgen kamen meine Angehörigen an. Beck und ich losten, wer das Frühstück geben sollte, und er gewann. Noch nie habe ich einen Menschen in solcher Aufregung über Weine, Delikatessen und Tafelschmuck gesehen, wie ihn an jenem Vormittag. Vermutlich verursachte ihm die Schilderung, die ich von meiner Schwester entworfen hatte, starke Beklemmungen. Nichts konnte ihm der Diener recht machen, fortwährend schob und rückte Beck alles durcheinander und fuhr sich dann wieder verzweifelt durch die Haare, bis glücklicherweise eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit seine Mutter auftauchte und die Sache selber in die Hand nahm.
Mein Vater und Gerty verspäteten sich um etwa fünf Minuten, und schon erging sich Beck in den schwärzesten Befürchtungen, dass sie überhaupt nicht kämen, als die Erwarteten endlich eintraten.
Gertrud ist eine hochgewachsene Erscheinung und tut sich nicht wenig darauf zugute, so dass ich immer angenommen hatte, sie müsse grösser sein als mein Freund. Als die beiden jedoch nebeneinander standen, zeigte sich gerade das Gegenteil, Beck überragte meine Schwester noch um volle zwei Zoll.
Bei der gegenseitigen Vorstellung verneigte sich Gerty sehr förmlich und sagte zu meinem Freunde in kühlem Tone: „Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Mr. Beck; durch meinen Bruder habe ich schon viel von Ihnen gehört.“
Man kennt ja diese entsetzliche Sorte von Gemeinplätzen, die lebendige Menschen in Automaten verwandeln. Im Gebrauch solcher nichtssagender Redensarten ist Gertrud geradezu Meisterin, obwohl sie, wenn es ihr passt, äusserst lebhaft und angeregt zu plaudern versteht. Ich beschloss, ihr darüber noch an demselben Abend ernstliche Vorhaltungen zu machen.
Auch mein alter Herr war anfangs reichlich steif und zugeknöpft. Das ist so seine Art; er meint, das unserm Namen und unsrer gesellschaftlichen Stellung schuldig zu sein.
„Mein lieber Junge,“ sagte er an jenem Morgen zu mir; „es kostet mich wirklich einige Überwindung, deine Schwester mit dieser Sorte von Leuten in Berührung zu bringen. Was dich selbst anbetrifft, so habe ich gegen diesen Verkehr nicht das geringste einzuwenden, denn für einen jungen Mann ist es immerhin ganz gut, mit möglichst verschiedenen Gesellschaftsschichten in Berührung zu kommen, und ich möchte um alles in der Welt keinen Snob aus dir machen, zumal dein junger Freund sich ja entschieden sehen lassen darf. Im übrigen ist es aber gerade in unserm demokratischen Zeitalter dringend erforderlich, irgendwo eine deutliche Grenze zu ziehen.“
Nichtsdestoweniger taute mein alter Herr sofort auf, als sich die kleine blankäugige Mrs. Beck ihm widmete. Sie war eine kluge, geistreiche Frau und verstand in seltenem Masse die schwere Kunst, eine hübsche Geschichte in wenige schlagende Sätze zusammenzufassen. Allein nicht durch Reden, sondern durch Zuhören gewann sie sich das Herz meines Vaters, dem es ausserordentlich schmeichelte, dass solch eine hübsche, kluge Frau seinen Worten mit so hingebender Aufmerksamkeit lauschte.
Unterdessen machte der alte Beck, der neben Gertrud an der andern Seite seines Sohnes sass, an dieser eine Eroberung. Er hatte eine geradezu bezaubernde Art, sich zu unterhalten, und ich beobachtete mit Vergnügen, wie liebenswürdig er sich von meiner Schwester ausfragen liess und wie Gertys Erregung und Entzücken mit jedem neuen Abenteuer wuchsen.
Als ziemlich unbeteiligter Zuschauer hatte ich zum Beobachten die beste Musse und bemitleidete von ganzem Herzen meinen armen Freund, der sich auf den ersten Blick rettungslos in meine Schwester verliebt hatte. Ich weiss nicht, woran das liegt — aber es geht den meisten Männern so, die mit Gerty in Berührung kommen. Wie mir bisweilen erzählt wurde, behext sie jeden mit ihren schönen Augen, und aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ein Lächeln von ihr imstande ist, allen Trübsinn und alle schlechte Laune im Handumdrehen zu verscheuchen.
Sie war nicht geradezu abweisend gegen meinen Freund, obgleich sie auch das sehr wohl versteht, wenn es ihr passt. Von Zeit zu Zeit unterhielt sie sich sehr höflich mit ihm — zu höflich sogar; seinem Vater gegenüber aber gab sie sich mit ungeschminkter Herzlichkeit und belegte ihn ganz und gar mit Beschlag.
„In den alten Paul bin ich ganz verliebt,“ gestand sie mir des Abends, als ich in ihrem Hotelzimmer noch ein wenig mit ihr plauderte. „Seine Frau soll zusehen, wo sie bleibt. Ich nehme alles zurück, was ich früher über ihn gesagt habe. Es ist kaum zu glauben, dass dieser sechzigjährige alte Herr all jene Abenteuer wirklich erlebt haben soll. Und wie reizend er sie schildert! Weder eitle Ruhmredigkeit noch das Gegenteil davon spricht aus seinen Worten.“
„Also auch keine ‚erkünstelte Bescheidenheit‘?“
„Nicht die Spur. Ich sagte dir ja schon, dass ich alles reumütig zurücknehme. Ein richtiger Herzenbrecher ist er, und es wundert mich gar nicht, dass all die jungen Mädchen, mit denen er zu tun hatte, mehr oder weniger in ihn verliebt waren.“
„Was wird seine Frau dazu sagen?“
„Nichts. Dazu ist sie viel zu klug und verständig und passt daher ganz vorzüglich für den alten Paul. Unserm Papa hat sie’s auch angetan.“
„Und wie gefällt dir der junge Beck?“
Gertrud schnitt ein Gesicht.
„Er ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte — eine hübsche, wohlerzogene Null. Ich weiss wahrhaftig nicht, Charlie, was du eigentlich an ihm findest. Ja, wenn er ein Mädchen wäre, wozu er mit seinem rosigen Gesicht und seinem gesitteten Benehmen auch entschieden besser passen würde — dann könnte ich deine Neigung für ihn begreifen.“
„Er ist der beste Mensch unter der Sonne.“
„Das bestreite ich nicht. Er mag ja seelengut sein, aber ich liebe nur solche Männer, in denen ein Stückchen Teufel steckt, wie in seinem alten Papa.“
„Oh, auch der junge Beck hat den Teufel im Leibe, wenn er gereizt wird.“