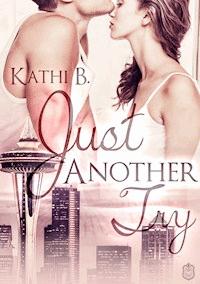
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eisermann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amanda ist vom Leben mehr als enttäuscht, das sie von einem Tief ins nächste schickt. Ihr Freund entpuppt sich als Arsch, sie muss erkennen, dass sie schon vor Jahren einen folgenschweren Fehler begangen hat und wird auch noch wegen seiner extremen Eifersucht in eine Messerstecherei verwickelt. Sie trifft daraufhin eine Entscheidung, die ihr Leben von Grund auf verändert und sie in die Arme eines Mannes treibt, der ihr völlig unerwartet den Halt gibt, den sie braucht, um ihre geschundene Seele wieder zusammen zu flicken. Marc bringt Licht in ihr Leben und zeigt ihr eine bis dato völlig unbekannte neue Seite an ihr, doch auch er bringt eine Vergangenheit mit sich, die ihre Liebe überschattet…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 901
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Just Another Try
eBook Ausgabe 10/2016
Copyright ©2016 by Eisermann Verlag, Bremen
Umschlaggestaltung: Sabrina Dahlenburg
Satz: André Ferreira
Lektorat: Myriam Blümel
http://www.Eisermann-Verlag.de
ISBN: 978-3-946342-06-9
Kathi B.
Just Another Try
Prolog
Ich hasse Notaufnahmen.
Das war so ziemlich der einzige Gedanke, der mir seit dem Augenblick dieser verdammten Attacke immer und immer wieder durch den Kopf kreiste.
Der Krankenwagen hatte mich begleitet von ohrenbetäubendem Sirenengejaule und sagenhaften Lenkmanövern auf direktem Wege dorthin gebracht.
Dass ich nicht hatte kotzen müssen, war echt noch das Beste an dieser Fahrt gewesen.
Als ich auf der Liege in die Räumlichkeiten geschoben wurde, überkam mich sofort das kribbelige Gefühl, in einem großen überlasteten Bienenstock gelandet zu sein. Hektik, Stress und Zeitmangel verursachten eine unangenehme Atmosphäre und mir ging es direkt noch schlechter. Auch die verfrühte Sommerdekoration am Empfang machte es nicht besser und die Lichter der Deckenbeleuchtung blendeten mich tierisch.
Hier wollte ich nicht sein.
Von der Liege aus, dessen Kopfteil höhergestellt worden war, sah ich gestresst oder besorgt wirkende Krankenschwestern mit Klemmbrettern oder Bergen von in Plastik verpacktem Verbandsmaterial in den Armen umherschwirren, während das am Empfang angrenzende Wartezimmer vollgestopft war mit kränklich blassen und verletzten Menschen, die genervt umherblickten oder ihrer von der Warterei herrührenden wachsenden Ungeduld Luft machten, indem sie mit den Füßen wippten. Direkt neben mir saß ein älterer Herr mit dunklen Augenringen an die Wand gelehnt auf einem Stuhl, der darauf wartete, dass sein Tropf durchlief, während er mir einen flüchtigen gleichgültig wirkenden Blick zuwarf. An der Empfangstheke versuchte ein Pfleger die völlig aufgelösten Angehörigen eines schwer verletzten Unfallopfers zu beschwichtigen; ab und an sah ich Männer und Frauen in weißen Arzt- oder blauen OP-Kitteln von einem ins nächste Behandlungszimmer huschen und ich beobachtete einige Momente eine Schwester, die das ständig klingelnde Telefon mit einer bemerkenswerten Geduld bediente und so aussah, als hätte sie eigentlich dringend noch ein paar andere Dinge zu erledigen.
Das Bimmeln des Apparates verschlimmerte meine hämmernden Kopfschmerzen und war nahezu ohrenbetäubend. Das war gar nichts im Vergleich zu dem lauten Stimmengewirr und der scheinbar stetig ansteigenden Geräuschkulisse.
Oh nein, hier wollte ich wirklich nicht sein. Und erst recht nicht bleiben.
Plötzlich bekam meine Liege einen Ruck von hinten und ich wurde weitergeschoben. Ich nahm jetzt alles verschwommen wahr, doch an meiner rechten Seite tauchte ein Arzt auf, den ich klar und deutlich erkennen konnte und der den Sanitäter und mich mit schnellen Schritten in irgendein kleines Behandlungszimmer eskortierte. “Schwester in Schockraum Eins, bitte“, rief er über die Schulter, ehe er von dem Sanitäter das bereits ausgefüllte Unfallformular entgegennahm und fragte: „Was haben wir?“ Ich mochte den Ton seiner Stimme nicht. Er klang, als wäre ich kurz vorm Sterben und so schlimm hatte ich es nun auch wieder nicht abbekommen. Hoffte ich zumindest.
„Amanda Black, fünfundzwanzig. Hat auf offener Straße versucht, eine Messerstecherei zu verhindern, wobei ihr ein Messer in den Bauchraum gestoßen wurde.“
Der Arzt hob ungläubig eine Augenbraue. Eigentlich konnte ich es ihm nicht verübeln. Für ihn musste das klingen, als seien Massen von Menschen tollwütig mit Klappmessern aufeinander losgegangen.
„Darüber hinaus konnten wir Druckempfindlichkeit im Brustkorb feststellen, es scheinen ein, zwei Rippen zumindest angebrochen zu sein. Des Weiteren hat sie eine Platzwunde an der linken Schläfe…“
Bla, bla, bla. Der Sanitäter leierte irgendwelche Zahlen meiner Vitalwerte herunter, von denen ich nichts verstand, mit denen der Arzt aber ganz offensichtlich etwas anfangen konnte. Sie sprachen über mich, als wäre ich nicht bei Bewusstsein oder gar nicht erst anwesend. Das nervte mich extrem.
Der Arzt nickte einfach nur, bedankte sich schließlich kurz und nachdem ich umgebettet worden war und der Sanitäter den Raum mit der Liege verließ, kam auch die Schwester. Sie sah gereizt aus. Ich war es auch.
„Besorgen Sie schon mal einen Termin beim Röntgen“, sagte der Arzt zu ihr, ehe er sich endlich mal mir zu wandte und direkt mit mir sprach. „Ich bin Dr. Smith“, sagte er, „wissen Sie, wer Sie sind und wo Sie sich befinden?“
Ich kam mir vor, als würde er mich für geistig behindert halten. Außerdem hatte ich Schwierigkeiten, ihm in die Augen zu schauen, weil die Lampe ziemlich hell brannte und er sah aus, als hätte er einen überdimensionalen Heiligenschein über dem Kopf.
„Ich bin Amanda Black, bin vierundzwanzig und bin im Krankenhaus“, leierte ich herunter. „Mir geht´s gar nicht so schlecht. Ist alles In Ordnung. Geben Sie mir einfach ein paar Tabletten und es geht schon wieder.“ Ich machte Anstalten, mich aufzusetzen, doch ich wurde wieder zurückgedrückt.
„Sie sollten liegen bleiben“, gab mein Gegenüber schlicht zurück. „Können Sie sich erinnern, wie Sie sich ihre Wunden zugezogen haben?“ Ich mochte es nicht, dass er mir nicht in die Augen sah, während er sprach, sondern meinen Bauch untersuchte.
Ich verdrehte die Augen. „Ja, ich weiß noch alles ziemlich genau“, gab ich äußerst unkooperativ zurück. „Ich…“ Ich keuchte kurz.
„Haben Sie Schmerzen?“
Was war das denn für eine Frage? Er würde doch auch nicht vor Freude im Dreieck springen, wenn ihm jemand ein Messer in den Bauch gerammt hätte?
„Ja!“, gab ich statt meines eigentlichen gehässigen Gedankenganges zurück. Ich hielt immer wieder lautstark den Atem an, weil das Stillhalten der Bauchdecke den brennenden Schmerz wenigstens für einen Moment linderte.
Dr. Smith wandte sich der Schwester zu und forderte sie auf, mir ein Schmerzmittel zu geben. Zumindest hoffte ich, dass es eins war, weil ich den Namen des Medikaments noch nie zuvor gehört hatte.
Es kam mir vor, als würde ich dort bereits seit Stunden liegen, bis die Schwester endlich den Tropf an dem bereits vom Sanitäter gelegten Zugang anschloss.
Ich hätte schreien können, als Dr. Smith den provisorischen Verband von meinem Bauch löste, obwohl er sich sicherlich die größte Mühe gab, vorsichtig zu sein. Ich biss mir auf die Lippe, um keinen Mucks von mir zu geben, bis ich Blut schmeckte.
„Amber“, sagte er nach kurzer Begutachtung zu der Schwester, „bereiten Sie einen OP vor.“
Unter anderen Umständen hätte ich bestimmt protestiert und mich gegen jedes weitere Wort gewehrt, doch ich fühlte mich plötzlich benebelt und wurde schläfrig. Mir fiel es schwer, die Augen offenzuhalten. Ich wurde von Dr. Smith mit einem kritischen Blick gemustert. „Beeilen Sie sich“, fügte er an die Schwester namens Amber gewandt hinzu, ehe er sich wieder mir zuwandte.
„Amanda, wir müssen Sie operieren. Der Schnitt ist tief und ich… Hören Sie mich? Amanda, können Sie mich hören?“
Ich hörte ihn, um ganz genau zu sein, kaum noch. Seine Worte waren zwar irgendwie verständlich und doch war mein Gehirn unfähig, die Bedeutung gänzlich zu verstehen, geschweige denn eine Antwort an meinen Mund zu schicken, die irgendeinen Sinn ergeben hätte.
Ich sah sein Gesicht und seine Lippen bewegten sich, als würde er mit mir reden. Seine grünen Augen fixierten meine und ich wusste, dass er versuchte, mich bei Bewusstsein zu halten, obwohl ich seine Worte nicht verstehen konnte. Ich gab mir auch große Mühe, bei ihm zu bleiben und seinen Blick festzuhalten, doch irgendwie hatte ich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle und meine Augenlider verweigerten mir nach einiger Zeit des Kämpfens den Dienst. Sie klappten einfach zu und mein inneres Ich sank in das tiefe Schwarz der schmerzfreien Bewusstlosigkeit.
Kapitel 1
Natürlich gibt es eine Geschichte, wie ich in der Notaufnahme gelandet bin… Ich beginne mal von vorn.
Der frische Duft von Frühling hing schwer und betörend in der Luft. Die Sonne lachte von einem strahlend blauen Himmel auf die überfüllte Stadt herab und wurde von keinem auch noch so kleinen Wölkchen daran gehindert, die bunten Frühlingsblumen aus dem noch vom Winter kalten Boden in die Wärme des Tages hervorzulocken, die sie mit ihren wunderbaren Strahlen verströmte.
Ich liebte diese Jahreszeit mit all ihren verschiedenen Facetten. Die Nächte sind manchmal so eisig kalt, dass es statt Regen Schnee gibt und man am nächsten Morgen auf eine weiße Landschaft blickt, wenn man die Vorhänge aufzieht, um den Tag hereinzulassen. Die Bäume sehen aus, als wären sie durch den Frost mit einer leichten Schicht Zuckerguss überzogen worden, doch wenn die Sonne dann hervorkommt, bringt sie nicht nur alles zum Glitzern, sondern auch das Eis zum Schmelzen und vertreibt damit das harte und unbarmherzige Gesicht des Winters. Ein weiterer wunderbarer Moment, den man wirklich nur im Frühling erlebt, ist die Wiederkehr der Wildgänse. Es gibt beinahe nichts Schöneres, als ihr aufgeregtes Schnattern zu hören und ihnen dabei zuzusehen, wie sie in ihren v-förmigen Formationen über das Firmament gleiten. Schwerelos. Völlig frei und ungebunden, lediglich getrieben durch ihren natürlichen Instinkt, in wärmere Gefilde zu ziehen.
Außerdem ist es mir jedes Jahr auf Neue eine große Freude, die Natur dabei zu beobachten, wie sie langsam und allmählich aus ihrer monatelangen Winterstarre erwacht; wie die Knospen der Bäume, Büsche, Sträucher und Blüten wachsen und irgendwann aufbrechen, um die Welt in ein buntes Farbenmeer aus den verschiedensten Nuancen zu tauchen.
Nicht zu vergessen sind die einmaligen Sonnenuntergänge des Frühlings. Es ist immer wieder ein unbeschreiblicher Moment, wenn die Sonne den Horizont küsst und der Mond seinen sanften blassen Schein über das Nachtleben legt…
Okay, genug von den kitschigen Beschreibungen meiner Vorlieben.
Was ich eigentlich sagen wollte: Genau so ein wunderbarer Tag, den der beste Künstler schöner nicht hätte malen können, war es gewesen, der natürlich kein gutes Ende hatte nehmen dürfen. Zumindest läuft es in meinem Leben immer wieder genau auf die gleiche Weise. Geht’s mir gut und ist etwas Schönes passiert, kommt gleich der nächste Fausthieb. Karma und so.
Ich hätte wissen müssen, dass dieser Tag kein gutes Ende nehmen würde. Mein Freund John war einfach zu gut drauf und viel zu übermütig gewesen… Eine schlechte Kombination, wie ich später feststellen durfte. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass seine Launen auch mal schnell ins Negative umschlagen können; manchmal ging es sogar so schnell, dass jegliche Intervention nahezu unmöglich war. Ich hätte es wissen sollen. Immerhin kennen wir uns seit über zehn Jahren. Ich hätte die Vorzeichen erkennen müssen.
Nun lag ich also da auf dem gepflasterten Platz; blutend und schwer atmend, während irgendein Sanitäter an mir herumfummelte. Über seinem Kopf blinkten die Lichterketten des Frühlingsfestes in den Wipfeln der Bäume einer der zahlreichen Stadtparks von Seattle. Sie sahen aus wie bunte Glühwürmchen, die mich fürchterlich blendeten.
Ich spürte den kalten feuchten Boden unter und die Blicke der gaffenden Menge auf mir. Das Blut, das meinen Körper aus diversen Verletzungsherden verließ, fühlte sich so brodelnd heiß an, während eine Gänsehaut meinen gesamten Körper überzog, die seltsamerweise genauso schlimm war wie der stechende Schmerz in der Gegend meines Magens.
Ich hörte die entsetzten Worte der schaulustigen Leute um mich herum wie durch ein Megaphon. Alles war so grell und laut und jeder Ton schien mit jeder weiteren Schmerzenswelle noch verdoppelt zu werden. Ich hatte dröhnende Kopfschmerzen, auf Grund derer es mir fürchterlich schwerfiel, dem Sanitäter zuzuhören, der direkt zu mir sprach.
„Können Sie mir Ihren Namen sagen?“
„Sie heißt Amy!“, schrie John von links herüber. Amy war nur mein Spitzname. Eine Verniedlichung vom Namen Amanda, der voll ausgesprochen wesentlich erwachsener und reifer klang als ‚Amy‘.
Ich drehte den Kopf zur Seite. Ich sah meinen Freund John, von dem ich nicht sicher war, ob ich weiterhin wollte, dass er mein fester Freund war, der sich mit Leibeskräften gegen die Griffe zweier Polizeibeamter wehrte. Da hatten sie wahrlich den Richtigen erwischt, denn John hatte die Auseinandersetzung mit den drei Betrunkenen auch angefangen, die dann in diese verflixte Messerstecherei ausgeartet war, von der ich mir zu dem Zeitpunkt sehnlichst wünschte, dass ich sie nicht zu schlichten versucht hätte.
Kapitel 2
„Miss! Miss!“ Da war wieder die Stimme des Sanitäters, der zu mir geeilt war, nachdem der Krankenwagen endlich eingetroffen war. Er holte mich aus meinen Gedanken zurück. Ich spürte, dass er mit seinen Händen festen Druck auf meinen Bauch ausübte. Oh Gott… der Schmerz war übermächtig und mich überkam das heftige Bedürfnis, mich zusammen zu krümmen.
„Können Sie mir Ihren Namen sagen?“, wiederholte er seine eingangs gestellte Frage nochmal.
„Ich sagte doch bereits, sie heißt Amy, du bepisster Scheißkerl!“, brüllte John. Ich musste gar nicht mehr hinsehen, um zu wissen, dass er sich immer noch mit Leibeskräften gegen die Griffe der Polizisten wehrte. Im Stillen hoffte ich inständig, dass er endlich die Klappe halten würde, zur Not konnten die Beamten sie ihm meinetwegen auch stopfen. Das sollte mir ebenfalls recht sein.
Der Sanitäter verhielt sich jedoch professionell und ignorierte meinen Freund, von dem ich mit einem Mal nicht mehr wusste, warum ich überhaupt noch mit ihm zusammen war… und warum ich es mit ihm so lange ausgehalten hatte. Seine Eskapaden hatten schließlich nicht erst seit gestern zugenommen. Heute hatte er mein Kontingent an Geduld und Nachsichtigkeit jedoch maßlos ausgereizt.
„Amanda“, flüsterte ich schließlich. „Ich heiße Amanda.“
„Okay, Amanda“, sagte der Sanitäter mit einem aufmunternden Lächeln, „wir werden das hier wieder hinbekommen, aber Sie müssen mir dabei helfen, indem sie bei mir bleiben, okay?“
Ich nickte schwach und der Sanitäter wandte sich wieder seiner Arbeit zu, indem er haufenweise Verbandsmaterial aus seiner Verbandstasche herausholte, während eine weitere Sanitäterin neben mir kniete und eine passende Vene für einen Flüssigkeitszugang suchte. Ich spürte den Einstich der Nadel kaum, als sie schließlich zustach und nahm auch ihre Worte kaum wahr, die sie mit ihrem Kollegen wechselte. Die Werte meines EKGs oder was auch immer interessierten mich in diesem Moment auch herzlich wenig.
Vielmehr hatte ich eine Passantin im Blick, die mit einem Polizisten sprach und ihm offensichtlich ihre Beobachtungen mitteilte, die er eifrig auf einem kleinen Block mitschrieb. Sie hatte braune Chucks an, an dessen Seiten ein flauschiges Fell herausragte und das flauschig und ziemlich warm aussah. Ich wünschte mir, dass ich auch solche Schuhe angehabt hätte, weil meine Füße so unglaublich kalt waren und sich wie Eisklumpen anfühlten. Lediglich in meinem Bauch war eine Hitze, die ich kaum aushalten konnte. Ich spürte mein Herz flattern, das verzweifelt versuchte, das Blut in alle wichtigen Regionen zu pumpen.
Mein Blick glitt nochmal zu John herüber. Die Polizisten hatten ihn mittlerweile gebändigt, indem sie ihm die Hände auf den Rücken gedreht und Handschellen verpasst hatten. Er fluchte immer noch und beschimpfte die Officer aufs Übelste. Unwillkürlich hoffte ich, dass sie ihn kräftig in die Mangel nehmen würden. Einen ordentlichen Schlag in die Fresse hätte er allemal verdient, denn nur wegen seinem prolligen Gehabe lag ich dort auf diesem verflucht kalten Boden. Natürlich machten sich direkt mein schlechtes Gewissen und mein Ego bemerkbar. Ersteres meldete an, dass es gemein war, jemand anderem etwas Schlechtes zu wünschen. Bla, bla. Als ob mein Kopf das nicht von selbst wüsste. Letzteres hingegen gab zu bedenken, dass John diese Prügelei für mich angezettelt hatte. Nur wegen mir ganz allein, denn ich war sein Baby.
Gott, was klingt dieser Spitzname idiotisch. Woher hatte John das eigentlich? Vielleicht aus Dirty Dancing? Jedenfalls hatte ‚Baby‘ nichts Romantisches an sich. Da rollen sich einem ja die Fußnägel hoch. Beschämend, dass ich auf diese Bezeichnung mal stolz gewesen bin!
Im selben Moment meldete sich auch mein Verstand zu Wort, der anmerkte, dass John es nur aus Eifersucht getan hatte. Gleichzeitig bemängelte er zudem den heftigen Schmerz, der in steten Wellen durch meinen Körper floss und das Blut aus mir hinaustrieb.
Ich keuchte.
„Halten Sie durch, Amanda“, sprach diesmal die Sanitäterin beruhigend auf mich ein. „Wir sind gleich soweit. Es dauert nicht mehr lang.“
Ich war zu müde, um zu antworten. Stattdessen glitt mein Blick nochmal zu John herüber, der mittlerweile auf der Rückbank eines Streifenwagens platziert worden war. Seltsamerweise berührte mich dieses Bild nicht besonders. Ich begann sogar, mir zu wünschen, dass mir ein Wiedersehen mit ihm erspart blieb. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Vielleicht hätte ich eine ordentliche Ausbildung gemacht. Wäre zum College gegangen. Hätte einen guten Abschluss bekommen. Nichts dergleichen hatte ich getan, obwohl das früher einmal meine Wünsche gewesen waren. Für was genau hatte ich sie nochmal aufgegeben…? Die plötzliche Erkenntnis, dass eine Entscheidung, die ich in meiner Jugend getroffen hatte, mich bis heute begleitete und mir nahezu jegliche Zukunftschancen verbaute, traf mich hart und unerwartet. Beinahe schmerzhaft.
Mittlerweile war das Gebiet recht weiträumig abgesperrt. Ich sah ständig Beine durch mein Blickfeld huschen und mir ging durch den schmerzenden Kopf, dass es eine ziemlich seltsame Perspektive ist, wenn man auf dem Boden liegt. Mir fielen zum Beispiel die außerordentlich blank geputzten Schuhe eines Polizeibeamten auf, der sich mit einem der freiwilligen Helfer unterhielt. Einer jungen Frau ragten die bunten Stricksocken aus den Stiefeletten und ich stellte mir vor, wie muckelig warm ihre Füße wohl sein mochten. Unwillkürlich schweiften meine Gedanken zu meinem warmen Bett, meiner warmen Wohnung und meinem Lieblingsbuch. Eine heiße Tasse Kakao in der einen Hand und eine Wärmflasche auf dem Bauch. Ich stellte mir vor, wie sich die wohlige Wärme bis in jede einzelne Faser meines Körpers ausbreitete, so wie ein heller Sonnenstrahl am Morgen, der sich Stück für Stück seinen Weg durch die dichten Nebelschwaden bis auf den Boden bahnt…
„Amanda!“
Ich öffnete die Augen. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie zugefallen waren, aber jetzt lag ich im Krankenwagen und das grelle elektrische Licht blendete mich so sehr, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Mein Kopf schmerzte davon noch mehr.
„Sie wollten doch bei mir bleiben, schon vergessen?“
Der Sanitäter sah wirklich sehr sympathisch aus. Er hatte mit seinen blonden Haaren, den blauen Augen und der hellen sommersprossigen Haut eindeutig etwas Europäisches an sich. Vielleicht kam er ja aus Skandinavien?
„Sie werden es schon schaffen“, sprach er mir gut zu. Um seine klaren Augen legten sich die kleinen Fältchen eines aufrichtigen Lächelns. Ich nickte einfach nur.
„Erzählen Sie mir etwas Amanda. Egal was“, forderte er mich auf.
Ein Beutel mit einer durchsichtigen Flüssigkeit baumelte immer wieder in mein Blickfeld. Wenn der Krankenwagen weiter in diesem Tempo durch die Kurven der Stadt raste, würde ich kotzen müssen, so viel stand fest.
Mir war klar, dass er mir diese Aufforderung nur deshalb stellte, um mich davon abzuhalten, wieder das Bewusstsein zu verlieren, doch ich tat ihm den Gefallen und sagte das erste, was mir in den Sinn kam. „Ich mag keine Bananen.“
Der Sanitäter lachte. „Was? Sie mögen keine Bananen? Die mag doch jedes Kind!“
Ich lächelte schwach. Das Atmen fiel mir schwer, weil der Schnitt bis tief in meinen Bauchraum schmerzte. Ich war so müde und wusste ganz genau, dass meine Augen immer und immer wieder zufielen, obwohl ich krampfhaft versuchte, sie offen zu halten.
Ich weiß nicht, wie lange die holprige Fahrt dauerte. Irgendwann jedoch fand ich mich in diesem völlig überlasteten Bienenstock wieder und mein nächster Gedanke war: Ich hasse Notaufnahmen.
Kapitel 3
Ich hatte einen ziemlich verrückten Traum in seltsamen Blautönen, der wie ein Film auf der Kinoleinwand vor meinem inneren Auge ablief. Er zeigte mein Leben und den Ort, an dem ich aufgewachsen war. Ich sah mein Zimmer, dessen Wände in meiner Jugend mit Postern von Britney Spears und den Backstreet Boys zugepflastert gewesen waren. Überall hatten Sachen herumgelegen, weil ich nie der ordentlichste Mensch war (heute übrigens auch noch nicht). Nicht selten lagen Zeitschriften von den letzten drei Monaten unter meinem Bett, schauten frisch gebügelte Ärmel von Pullovern zwischen den Türen meines Schranks hervor, lagen Essensreste von gestern oder Schulunterlagen herum. Meine beachtliche Büchersammlung war mit einer dicken Staubschicht überzogen und das kleine Röhrenfernsehn mit der Antenne fungierte als Dreckwäschetonne, weil ich nicht gern fernsah. Dafür dass mein Zimmer das reinste Chaos war, war mein Verstand umso aufgeräumter. Ich war recht schlau, worauf meine Eltern, die beide einfache Angestellte im sozialen Bereich und daher nie reich gewesen waren, ziemlich stolz waren. Lernen fiel mir nicht schwer und ich verbrachte gerne Zeit mit der Analyse von Gedichten, Kunstgeschichte, chemischen Versuchen und manchmal sogar mit Mathe. Hausaufgaben waren kein ein Problem für mich gewesen. Niemals. Mir hatte es auch nichts ausgemacht, dass ich keine Freunde hatte, denn die meisten meiner Klasse fanden mich seltsam. Im Nachhinein kann ich das sogar verstehen, denn welcher Teenie hatte schon so seltsame Interessen wie ich? Popgroups und Naturwissenschaft oder Literatur passten nicht zusammen und interessierten in dieser Kombination nur wenige. Eigentlich sogar nur mich.
Zumindest war mir meine soziale Abgeschiedenheit so lange egal, bis ich John kennenlernte. Ich war vierzehn gewesen zu diesem Zeitpunkt. Er war mir in einem Nachhilfeprogramm meiner staatlichen Schule, an dem ich jedes Jahr teilnahm, zugeteilt worden. Die Nachhilfe bei mir war seine letzte Chance gewesen, bevor er von der Schule geworfen worden wäre und so waren zwei Welten in einem schulisch erzwungenen Kontext aufeinandergeprallt.
Ihm ging mächtig gegen den Strich, dass ich, zwei Jahre jünger als er, mehr draufhatte und ihm sowohl in Mathe, Chemie und Physik als auch in Englisch auf die Sprünge helfen musste. Mich hingegen nervte seine Art, mich mit meiner Unerfahrenheit in puncto Jungs aufzuziehen, die er mir offensichtlich an der Nasenspitze hatte ablesen können. Durch meine Unsicherheit merkte man mir natürlich mehr als deutlich an, dass ich bisher kaum Kontakt zum anderen Geschlecht gehabt hatte und seine blöden Kommentare machten es nicht besser.
Irgendwie rauften wir uns jedoch mehr und mehr zusammen und hatten sogar Spaß miteinander. Mich faszinierte seine offene zwanglose, wiederwillige Art, alles mit der leichten Schulter zunehmen. Er war der coole Typ mit Lederjacke, stark, reif, männlich. Ich hingegen war die kleine verkannte Prinzessin, die bisher isoliert in ihrem Turm versauert war und die nur darauf wartete, von dem Rebellen entführt zu werden.
Durch John wurde ich lockerer. Traf neue Leute. Gehörte einer Gruppe an und lernte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl kennen, in ein soziales Gefüge hinein zu gehören – zumindest so lange, wie ich mich ihm anpasste.
Natürlich verliebte ich mich mit der Zeit Hals über Kopf in ihn und er sich irgendwie auch in mich.
Von da an waren Hausaufgaben und all meine Ziele passé. Es gab für mich nur noch John und seine coole Welt voller Sorglosigkeit, Alkohol und manchmal sogar Drogen. Vorbei war die Zeit, in der ich Britney Spears hörte und darauf hoffte, einmal genau so berühmt zu werden wie sie (nicht mit Musik, aber durch meinen Grips). Ich wollte weder aufs College noch eine Ausbildung machen. Ich wollte nur bei John sein, darüber lachen, wie er Mist baute, wollte seine Küsse auf meiner Haut spüren und den Wind in meinen Haaren, wenn wir im Park saßen und dicke Kinder beleidigten.
John war das genaue Gegenteil von mir und ich genoss seine Rebellion gegen alles, die mich dazu brachte, mich ebenfalls gegen so ziemlich alles aufzulehnen, was mir nicht in den Kram passte.
Das Schulsystem zum Beispiel. Schule? Pfft, wer brauchte die schon!
Das Gesetz Alkohol nicht vor dem 21. Lebensjahr trinken zu dürfen. Nichts schmeckte besser, als ein Verbot zu brechen.
Meine Eltern. Sie waren heillos überfordert mit ihrer nunmehr siebzehnjährigen Amanda, die bis vor knapp vier Jahren nie Probleme gemacht hatte. Dementsprechend hatten sie keine Ahnung, wie sie mit mir und meiner abwehrenden Art umgehen sollten.
Es war mir egal und ich zog, nachdem ich die Schule mit einem mehr schlecht als rechten Zeugnis zu Ende gebracht und einen Job in einem schäbigen Diner angenommen hatte, gegen ihren Willen in ein ranziges Ein-Zimmer-Appartement im dreckigsten Viertel der Stadt. Auch das war mir egal gewesen. Ich hatte John, der mich regelmäßig besuchte und bei oder wahlweise auch mit mir schlief. Irgendwie war ich auf eine seltsame Art und Weise zufrieden und glücklich gewesen.
Doch John veränderte sich irgendwann. Drehte krumme Dinger, trank mehr Alkohol als sonst, wurde aggressiver, traf sich übermäßig oft mit seinen Kumpels zum Saufen und äußerte explizit, dass er mich nicht dabeihaben wolle. Nachts, wenn er betrunken heimkam, war ich gerade einmal gut genug gewesen, um die Beine für ihn breitzumachen. Es war widerlich, wie sein alkoholisierte Atem mein Gesicht strich, wenn seine feuchten Lippen auf meine trafen oder wenn er meinen Namen keuchte… „Amanda… Amanda…“
Moment, er hatte mich nie Amanda, sondern Amy genannt.
„Amanda!“
Ich schlug die Augen auf und blinzelte ein paar Mal gegen das statische Licht der Deckenlampe. Ich vernahm das grelle regelmäßige Piepen von Maschinen, die meine Herzaktivität überprüften, deren Geräusche in meinen Ohren klingelten.
In meinem Blickfeld erschien das Gesicht eines jungen Mannes, den ich als Dr. Smith erkannte.
„Geht’s noch lauter?“, fuhr ich ihn müde an. Ich hatte immer noch dröhnende Kopfschmerzen. Auch in meinem Bauch pochte es unaufhörlich.
„Sie haben Glück, ich wollte gerade zu meiner Backpfeifenmethode greifen“, gab der Arzt gereizt zurück.
„Oh ja, anschreien ist da wahrlich die bessere Alternative“, giftete ich, obwohl mir bewusst war, dass er sich wahrscheinlich nur deshalb mir gegenüber so verhielt, weil ich auch nicht sonderlich freundlich zu ihm war. Zudem hatte er wahrscheinlich eine lange Nacht gehabt, denn durch die geöffneten Lamellen des Rollos in meinem Zimmer konnte ich die rötliche Morgendämmerung erahnen.
„Sie ist ganz offensichtlich bei klarem Verstand“, sagte er mit sarkastischem Unterton an die Schwester gewandt, die auf der anderen Seite meines Bettes stand und unsicher lächelte.
„Ja bin ich!“ Ich mochte es nicht, wenn man über mich aber nicht mit mir redete.
Dr. Smith atmete tief durch. „Gut Amanda“, sagte er betont ruhig, „dann können Sie mir ja auch sicherlich sagen, ob Sie Schmerzen haben.“
„Ja“, erwiderte ich brummig.
„Wo?“
„Ich habe Kopfschmerzen.“
Er murmelte etwas, das sich anhörte wie „Die habe ich auch“ und forderte die Schwester auf, die Dosis an Schmerzmitteln zu erhöhen. Ganz schön unprofessionell.
„Können Sie mir nicht noch mehr geben?“, fragte ich direkt.
„Nein.“
Gott, war der unfreundlich! „Warum nicht?“
„Weil es Richtlinien für die Verabreichung von Schmerzmitteln gibt.“
„Sie scheinen ziemlich spießig zu sein.“
„Sie dafür wohl umso weniger“, antwortete er mit einem sarkastischem Lächeln auf den Lippen, während mich das kindische Bedürfnis überfiel, ihm die Zunge rauszustrecken.
Er vermerkte eine letzte Notiz auf dem Klemmbrett, ehe er es wieder an das Fußende meines Bettes hing. „Ich mache für heute Feierabend“, hörte ich ihn noch sagen, bevor er mit wehendem Kittel das Zimmer verließ.
Was für eine nette Begegnung. Ha ha.
Kapitel 4
Knapp zwei Wochen hatte ich im Krankenhaus bleiben müssen.
Ein Polizist war zwei Tage nach meiner Operation bei mir vorbeigekommen, der mich zu dem Ablauf des Abends, an dem ich den Messerstich abbekommen hatte, befragte. Sobald ich nicht alles bis ins kleinste Detail beschrieben hatte, bohrte er so lange nach, bis er wirklich jede noch so kleine Winzigkeit auf seinem Block niedergeschrieben hatte. Einer der Täter hatte fliehen können, was mir scheinbar entgangen war, weshalb ich eine möglichst genaue Beschreibung hatte abgegeben müssen. Als ich nach John fragte und erläutert hatte, dass ich seine Freundin war, zeigte sich der Officer sehr offen und erklärte mir, dass sie John nach vierundzwanzig Stunden Befragung hatten gehen lassen, da es offensichtlich und durch mehrere Zeugen bestätigt worden sei, dass er lediglich in Notwehr gehandelt habe. Mir fiel die Kinnlade runter und der freundliche Herr fragte auch, ob es mir gut gehe, doch ich war zu geschockt, um auch nur einen Ton hervorzubringen. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Situation so verzerrt von Außenstehenden dargestellt werden würde, doch offensichtlich hatte es so gewirkt, dass John mich lediglich verteidigt hatte. Dass er nicht ein einziges Mal hergekommen war, um mich zu besuchen und sich nach meinem Befinden zu erkundigen, schockierte mich noch mehr als alles andere. Interessierte es ihn etwa nicht, wie es mir ging? Es war immerhin seine Schuld gewesen, dass ich so viel Zeit im Krankenhaus hatte verschwenden müssen. Ich finde, dass es seine verdammte Pflicht gewesen wäre, mir wenigstens einen Anstandsbesuch mit einem ordentlichen Blumenstrauß und einem fetten Entschuldigungslächeln auf den Lippen abzustatten. Oder wenigstens eine SMS. Eine E-Mail. Ein Anruf. Von mir aus auch eine Brieftaube. Aber da war nichts gekommen. Rein gar nichts.
Wenigstens meine Freundin Jenny hatte mich besucht, um mir ein paar Sachen zu bringen.
Ich war sprachlos und überlegte, ob ich nicht einfach die Wahrheit sagen sollte, doch entschied mich dann dazu, den Mund zu halten. Ich hatte einen Entschluss gefasst, den ich schon vor gefühlt zwanzig Jahren hätte fassen sollen und ich wollte, dass John die Möglichkeit erhielt, auch nochmal von vorn beginnen zu können, wenn ich mich von ihm trennte. Es wurde einfach Zeit, einen Schritt in eine andere – hoffentlich bessere – Richtung zu machen. Mir war es wichtig, dass ihm die Option – ohne Vorstrafen – ebenfalls offenstand. Irgendwie war er mir auch noch wichtig, denn immerhin hatten wir elf Jahre lang eine Beziehung geführt.
Dementsprechend schwer war mein Herz, als ich in meinem Patientenzimmer stand und mein Schränkchen leerräumte. Ich hatte nicht viele Sachen, die ich verstauen musste und so war meine Tasche auch relativ leicht, als ich den Reißverschluss zuzog und mich von der netten Schwester Laura verabschiedete, die immer sehr freundlich zu mir gewesen war. Dr. Smith hatte mich vor einer guten Stunde nochmal untersucht und sich dann dazu entschlossen, mich zu entlassen. Ich war froh darum, denn ich spürte, dass er mich nicht mochte, weshalb ich ihn noch weniger leiden konnte. Manchmal gab es ja einfach so Menschen im Leben, denen man ohne wirklichen Grund am liebsten nie wieder begegnen mochte und er gehörte definitiv dazu.
Nun trat ich also durch die breiten Flügeltüren, die sich automatisch öffneten, in den strahlenden Sonnenschein und atmete die frische Frühlingsluft tief ein. Ich hörte durch den regen Verkehr der Straße das fröhliche Zwitschern der Vögel und als ich auf dem Vorplatz des Krankenhauses an einem kleinen kreisrunden Blumenbeet vorbeiging, das man in der Mitte angelegt hatte, konnte ich ihren süßen Duft riechen. Die Sonne kitzelte auf meiner blassen Haut und ich streckte ihr mein Gesicht entgegen, um ihre Wärme tief in mir aufzunehmen. Die angenehme Strahlung durchfloss mich wie ein kleiner Bach, der in meinem Kopf begann und sich von dort aus bis in jede noch so kleine Pore meines Körpers ausbreitete. Sogar meine beträchtliche Bauchwunde fiepte nur noch ein klein wenig unter dem großen weißen Pflaster. Ich versuchte mental Kraft zu sammeln für das Bevorstehende. John würde wahrscheinlich erstmal ordentlich ausflippen, wenn ich ihn aus der kleinen Wohnung werfen würde, die ich ganz allein durch mein Kellnergehalt finanzierte, weil er seins regelmäßig versoff oder bei irgendwelchen illegalen Pokerspielen verzockte.
„Amanda!“
Ich drehte mich zur Seite in die Richtung, aus der der Ruf ertönt war. Ich sah einen jungen Mann mit hellblonden Haaren auf mich zueilen, den ich kurze Zeit später als den Sanitäter von vor knapp zwei Wochen wiedererkannte.
„Amanda war doch richtig oder?“, fragte er leicht außer Atem, als er kurz vor mir zum Stehen kam.
Ich lächelte. „Ja.“
„Ihnen geht’s wieder gut?“ Er kniff eines seiner hellblauen Augen zusammen und blinzelte gegen die Sonne. Es sah wirklich niedlich aus, wie er seine sommersprossige Nase krauszog.
„Wahrscheinlich nicht zuletzt dank ihnen“, erwiderte ich und schob mir eine meiner rotbraunen Locken hinter das Ohr, die mir um die Schultern fielen. „Ich glaube, an dieser Stelle ist ein dicker Dank angesagt“, fügte ich noch hinzu.
„Das ist gern geschehen. Ich muss jetzt leider auch weiter, die Schicht fängt an… Leben retten und so.“ Er grinste und ich tat es ihm gleich.
„Dann hoffe ich, dass ihr Superheldenkostüm aus der Reinigung gekommen ist und frisch gebügelt in ihrem Schrank hängt“, scherzte ich und er lachte. Irgendwie durchströmte mich ein gutes Gefühl, als ich seine weißen Zähne sah und sein tiefes Glucksen erklang. Ich hatte schon lange niemanden mehr zum Lachen gebracht. „Gut, dann wünsche ich jedenfalls viel Erfolg und… einen schönen Tag noch.“ Er verabschiedete sich ebenfalls und ich drehte mich um, um weiter zu gehen. Ich schüttelte den Kopf darüber, dass mich ein so positives Gefühl durchströmte, nur weil er über einen dummen Scherz von mir gelacht hatte.
Wir waren bereits einige Meter voneinander entfernt, als er nochmal meinen Namen rief. Ich wandte mich abermals um und er kam wieder auf mich zugelaufen. „Hier, für den Fall, dass Sie mal Lust auf einen Kaffee haben.“ Lächelnd drückte er mir ein Kaugummipapier in die Hand, auf das er seine Handynummer gekritzelt hatte, ehe er sich wieder auf den Weg ins Krankenhaus machte. Ich sah ihm noch ein paar Augenblicke grinsend nach, bevor ich das Papier in die Tasche meiner Jeansjacke verschwinden ließ und weiter ing. Immerhin hatte ich noch eine Aufgabe zu bewältigen, bevor ich mich Hals über Kopf in ein neues Abenteuer stürzen konnte. Erst viel zu spät fiel mir ein, dass ich vielleicht mal hätte nach seinem Namen fragen sollen.
Der Bus hielt etwa sechshundert Meter von meiner Haustür entfernt. Wie man sich bestimmt denken kann, lag sie nicht in der allerbesten Wohngegend, die eigentlich nur aus unzähligen Betonklötzen mit zahllosen Stockwerken oder schäbigen Einfamilienhäusern bestand – das Rainier Valley von Seattle. Das schönste daran war wohl die Parkanlage, die für zu viele Leute auf zu engem Wohnraum einfach zu klein war. Auf dieser Grünfläche, die etwa so groß wie ein Basketballfeld war, standen sage und schreibe sieben Bäume und vier Bänke, von denen eine kaputt und eine so sehr mit Kaugummi beklebt war, dass man sich nicht mehr darauf niederlassen konnte. Die Bäume waren zwar von einem grünen Schimmer umgeben, der wohl von zahllosen Knospen herrührte, dennoch erschienen sie kahl und recht trostlos. Zumindest vorerst. Außerdem gab es einen Sandkasten in der Größe eines Planschbeckens für Kleinkinder, in dem nicht nur die heimischen Katzen, sondern auch betrunkene Idioten regelmäßig ihre Exkremente verbuddelten. Ergo würde ich mein Kind nur dann in diesem Sandkasten spielen lassen, wenn ich darauf aus wäre, es mit möglichst vielen Krankheitserregern zu infizieren, um es elendig verrecken zu lassen. Es gab auch eine Schaukel, nur leider war diese – welch Überraschung – seit ungefähr einem halben Jahr kaputt, weshalb der Sitz lediglich von einer Kette gehalten wurde und seither einsam quietschend im mal mehr oder weniger kräftigen Wind vor sich hin baumelte.
Klingt einladend, nicht…?
Ich seufzte. Nichts war besser geworden in den zwei Wochen, die ich nicht hier gewesen war. Im Gegenteil. Ich entdeckte ein neues Graffiti an einer Hauswand, auf meinem Weg zu dem Betonklotz, in dem ich heimisch war. Manche Graffitis sind wahrlich respektverdienende Kunstwerke: aufwändig, farbenfroh und gesellschaftskritisch. Dieses aber war nichts von alledem. „Blody Bitch“ stand an der blassgelben Hauswand, deren Farbe die Gegend wohl ein bisschen aufhellen sollte. Ich ging davon aus, dass es „Bloody“ heißen sollte. Dass der Autor dieses Kunstwerkes im negativen Sinne selbst in ein solch einfaches Wort noch einen Fehler einbaute, spiegelte das Bildungsniveau und die sozialen Missstände wohl in etwa wider, sodass ich denke, dass ich dazu nicht mehr viel erzählen muss. Ich wusste von noch einem Graffiti zwei Betonklötze weiter, auf dem in auffällig roten Lettern „arse-end oft the world“ – am Arsch der Welt – geschrieben stand. Wie recht die Person damit doch hatte.
Ich betrat das Gebäude und lief die Treppen in den sechsten Stock zu Fuß hinauf, weil der Aufzug – wie so oft – kaputt war. Vor ein paar Monaten hatten drei Jugendliche sich einen Spaß daraus gemacht, in den Fahrstuhlschacht zu pinkeln. Das hatte nicht nur die Elektrik kurzgeschlossen, sodass das gesamte Haus für über zwei Stunden keinen Strom gehabt hatte, sondern auch noch über Wochen hinweg fürchterlich gestunken.
Als ich oben angekommen war, musste ich verschnaufen und mir den Bauch halten, weil der Schnitt immer noch schmerzte und ich erinnerte mich an die Worte von Dr. Smith, der mir zur Ruhe geraten und mir sogar einen Krankenschein für die kommende Woche mitgegeben hatte. Leider war ich mir nicht so sicher, ob ich meinen Job behalten konnte, wenn ich eine weitere Woche krankmachen würde.
Als ich schließlich durch den langen Flur gelaufen und an meiner Wohnungstür angelangt war, atmete ich ein paar Mal tief durch. Es konnte gut sein, dass John da war. Es war Freitag, sein Lieblingstag zum Blaumachen. Ich war mir nicht sicher, ob ich stark genug für eine solche Diskussion mit ihm war, doch ich wollte es endlich hinter mich bringen. Jetzt oder nie.
Ich schob den Schlüssel in das Schloss und drehte ihn herum. Die Tür sprang auf und ich trat ein. „John?“ rief ich über den kleinen Flur, in dem überall – dem Geruch zufolge – seine Dreckwäsche verteilt lag. Es blieb still, auch nachdem ich erneut nach ihm rief. Ich warf meinen Schlüssel in die Schale neben der Tür, die auf einer kleinen Kommode stand, bevor ich im Schlafzimmer, in der Küche und in dem Mini-Wohnzimmer nachsah. Nichts. Er war nicht da.
Seufzend ging ich in die Küche zurück, wo ich mir ein wenig Kranwasser in ein Glas goss, das ich wütend hinunterkippte. War John wohl arbeiten? Ich überlegte, ob ich ihn nun nach knapp zwei Wochen doch mal anrufen sollte, doch im gleichen Moment fiel mir ein Zettel ins Auge, der mittels Magnet (übrigens in Form eines Bierkrugs) an den Kühlschrank gepinnt worden war.
Hey Baby, ich brauche mal eine Auszeit von dem ganzen Stress mit der Polizei und so. Bin erstmal unterwegs. Liebe dich.
Überrascht ließ ich mich auf einem der zwei Küchenstühle nieder und starrte die Notiz an, die notdürftig auf einem alten Kassenbon hinterlegt worden war. Meine Güte, der Kerl hatte Nerven! Wer von uns beiden hatte denn wohl eher eine Auszeit verdient?! Und wohin war er überhaupt gefahren…?
Weil ich mich augenblicklich fragte, mit welchem Geld er sich seinen Abstecher finanzieren wollte, hechtete ich ins Bad, um die Tamponschachtel zu überprüfen, in der ich mein Trinkgeld sparte. Ich atmete erleichtert auf und dankte Gott im Stillen für Johns Einfältigkeit. Nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, dass sich Geld in so einer Schachtel befinden würde. Als unsere Beziehung noch bessere Zeiten durchlebt hatte, war er manchmal sogar einkaufen gegangen, wobei er sich jedoch jedes verdammte Mal wie ein kleines Kind angestellt hatte, wenn ich ihn darum gebeten hatte, mir Tampons mitzubringen. Als wäre dies das Hexenwerk schlechthin und als wäre ich die einzige Frau auf der weiten Welt, die die Dinger benutzte. Hätte er jedoch gewusst, dass ich dort eine kleine Geldsumme hortete, hätte er sicherlich keine Hemmungen gehabt, zuzugreifen.
Ich stellte die Schachtel zurück ins Regal und sah mich um. Es sah aus wie im Schweinestall und war auch mindestens genauso dreckig. Vorsichtig hob ich mit einem Finger den Toilettendeckel an. Urghs. John hatte im Stehen gepinkelt… und scheinbar auch seit zwei Wochen keine Toilettenbürste mehr benutzt. Ich war zwar ein unordentlicher Mensch, dem ein wenig Chaos nichts ausmachte, doch im Dreck leben mochte selbst ich nicht.
Leider blieb mir nun nichts weiter übrig, als aufzuräumen, seine Hinterlassenschaften wegzuputzen, die von ihm geplünderten Vorräte wieder aufzufüllen und abzuwarten.
Kapitel 5
Ich wartete. Fast eine ganze Woche sogar.
Ein paar Mal hatte ich daran gedacht, den freundlichen und sympathischen Sanitäter anzurufen, doch ich wollte zuerst mit John abschließen. Ich wollte mich nicht mit jemand anderem treffen, wenn ich wusste, dass es ihn noch in meinem Leben gab. Natürlich war ich nicht gleich auf eine Beziehung aus, doch John hatte vor mittlerweile fast drei Wochen nochmal nachdrücklich bewiesen, dass seine rasende Eifersucht keine Grenzen kannte und ich wollte den freundlichen jungen Mann nicht gleich den ganzen Ärger auf den Hals hetzen, der ihm zweifelsohne bevorstehen würde, wenn ich John noch im Nacken gehabt hätte.
Ich war gerade dabei, die Wäsche auf unserem Balkon aufzuhängen, der in etwa die Größe eines Pappkartons hatte. Die Sonne schien warm von einem strahlend blauen Himmel und es war so angenehm, dass ich Lust auf Sommer bekam. Der leichte Wind, der mir eine Gänsehaut bescherte, ließ meinen schwarzen Rock um meine Knie flattern, den ich noch trug, weil ich eben erst von der Arbeit aus dem Diner gekommen war. Eigentlich war ich ja krankgeschrieben, doch die Bescheinigung hatte ich aus Angst um meinen Job nicht eingereicht, obwohl ich sie dringend nötig gehabt hätte, weil ich seit drei Tagen einen Magenvirus mit mir rumschleppte. Das ging mir kräftig gegen den Strich, weil ich erst vor einiger Zeit einen solchen Infekt gehabt hatte. Ständig war mir schlecht und ich hatte kaum Appetit. Meine Abneigung gegen Essensgerüche kam erschwerend hinzu, vor allem dann, wenn man die Tatsache berücksichtigte, dass ich in einem Diner arbeitete, in welchem ich natürlich nahezu jede Minute dampfende Burger mit Pommes oder Bratkartoffeln mit Speck servieren musste. In den letzten drei Tagen hatte ich mich gefühlt eintausend Mal übergeben müssen. Aber die frische und dennoch wärmende Luft hier draußen tat mir gut und es ging mir ein wenig besser als heute Morgen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























