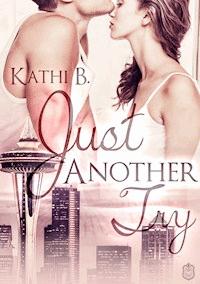Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eisermann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luise hasst vieles: Weihnachten, Pärchen, ihren Job und am meisten sich selbst. Mit der Konfektionsgröße 46 scheint sie in keine der gängigen Normen zu passen, die die Gesellschaft vorgestrickt hat. Dass sie in dem Modeunternehmen King‘s Fashion arbeitet, das Klamotten für die Schlanken und Schönen dieser Welt produziert, macht die Sache wahrlich nicht besser – erst recht nicht, als sie den reichlich attraktiven Vorgesetzten Matheo König vor die Nase gesetzt bekommt, der prompt ihren alten Schulschwarm Lars Behrens als Personalchef einstellt. Luises bis dato sorgsam vergrabene Vergangenheit bahnt sich durch Lars immer häufiger einen Weg ans Licht und bringt sie gehörig ins Straucheln ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Epilog
Stopp, geh noch nicht!
King’s Love E-Book-Ausgabe 03/2019 Copyright ©2019 by Eisermann Verlag, Bremen Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns Satz: André Piotrowski Lektorat: Sabrina Schumacher Korrektur: Alexandra Schwind http://www.Eisermann-Verlag.de ISBN: 978-3-96173-182-4
Kapitel 1
Ich hasste Weihnachten.
Wer auch immer veranlasst hatte, die Geburt eines Babys zu feiern, das vor über zweitausend Jahren geboren worden war, sollte meiner Meinung nach dafür gesteinigt werden.
Warum sollte ich mir die Mühe machen, meine Wohnung entsprechend der Jahreszeit zu dekorieren? Warum sollte ich haufenweise Plätzchen backen, bloß um in Stimmung zu kommen und mich auf die angebliche Besinnlichkeit zu freuen? Warum sollte ich so tun, als hätte ich gute Laune, obwohl ich die gar nicht hatte? Warum sollte ich mein sauer verdientes Geld für nutzlose Geschenke verschleudern? Für Menschen, die ich ohnehin nicht mochte? Und warum in drei Gottes Namen sollte ich dieses verliebte Pärchen mir gegenüber nicht mit meinen Pommes bewerfen?
Ach ja, weil sie erstens zu teuer waren, um sie für nervtötende Hormonschleudern zu verschwenden, sie zweitens zu lecker schmeckten und ich drittens einen ziemlich großen Frusthunger verspürte. Schon seit Tagen beschäftigten mich die eben aufgezählten Fragen. Vor allem deshalb, weil meine Lieblingsbratwurstbude von den kleinen Holzhüttchen des alljährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes umzingelt war wie von fünfzig Katzen, die sich auf ein und dieselbe Maus stürzen wollten.
Mit finsterem Blick betrachtete ich die Masse an Menschen, die sich freiwillig in das Weihnachtsgetümmel stürzte, um die Zeit in der Dämmerung zwischen Lichterketten, Bratapfelgeruch und Gewusel zu genießen. Dabei fielen mir gefühlt tausend Pärchen auf, immer zwei Menschen, egal ob Mann mit Mann, Frau mit Frau oder die Heterovariante. Sie hielten Händchen, warfen sich verliebte Blicke zu, schenkten sich »Forever in Love«-Lebkuchenherzen oder knutschten herum. Und nervten. Vor allem mich.
Ein Exemplar eines solchen Paares stand in meiner unmittelbaren Nähe und versperrte mir die Sicht auf die Zuckerwattebude, an der ein ziemlich frecher Jugendlicher über den Preis seines pinken Zuckerberges diskutierte.
Eine Currywurstschale stand zwischen dem Pärchen auf dem Stehtisch, die sie sich genüsslich kauend teilten. Er hielt den Holzpiekser in der Hand und fütterte seine Angebetete mit einem dümmlich wirkenden Grinsen. Noch nicht mal Pommes waren dabei.
Zwischendurch küssten sie sich, obwohl sie noch gar nicht geschluckt hatten. Ich konnte mir nicht verkneifen, angewidert die Brauen zusammenzuziehen. Jetzt mal ernsthaft, was stimmte denn nicht mit denen? Eine Currywurstschale für zwei Personen? Dafür war die Portion doch viel zu klein. Aber so dünn, wie beide waren, lebten die ohnehin nur von Luft und Liebe – und diese kleine Currywurst war bloß ein Abstecher ins Schlaraffenland aller Frustesser.
Genervt wandte ich den Blick ab. Menschen mit rosaroter Brille auf der Nase waren mir suspekt und gerade an Weihnachten, dem wohl wichtigsten Fest für alle wahren Romantiker, wurde mir immer wieder gewahr, wie sehr ich dieses Brimborium hasste. Ich war zwar katholisch erzogen worden, und doch war mir der Sinn dieses Festes seit eh und je verborgen geblieben. Der wahre Grund war wohl irgendwo zwischen Vermarktungsindustrie und den Coca-Cola-Weihnachtstrucks verloren gegangen, immerhin trugen die großen Konzerne den meisten Gewinn nach Hause in die gut beheizten, mit Geschenken vollgestopften Wohnzimmer. Es sollte doch eigentlich um Beisammensein, Besinnlichkeit und Familie gehen. Das Einzige, das ich Jahr für Jahr von Weihnachten mitbekam, war jedoch die Tatsache, dass jeder einen riesengroßen Aufriss veranstaltete, Festessen plante und haufenweise Geschenke aus Einkaufshäusern trug. Zusätzlich stellten irgendwelche Idioten auch noch Holzhütten in die Innenstadt, an denen zu neunzig Prozent Fressalien verkauft wurden, die mich zum Essen verführten, verdammte Scheiße!
Ich schob mir die letzten Pommes in den Mund und seufzte noch immer kauend, ehe ich die leere Schale über den Stehtisch schob und sie in einen Abfallkorb fallen ließ.
Missmutig beobachtete ich die anderen Menschen, die sich zwischen den Holzbuden hindurchquetschten, während ich meinen Schal fester zog und die Handschuhe überstreifte. Da gerade Zeit für den Feierabend war, waren mindestens siebzig Prozent auf der Suche nach einer Fressbude oder einem Glühweinstand, um sich zu betrinken. Hm, trinken, das hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch gern getan, aber das konnte ich heute wirklich nicht bringen.
Ich stöhnte innerlich beim Gedanken an jene Weihnachtsfeier, die mir an diesem Abend bevorstand. Alle Angestellten dicht eingepfercht im Foyer der Firma, es gab Wein, Sekt und Prosecco in Dosen, Fingerfood vom Caterer um die Ecke und eine Karaokeshow. Bei meinem Glück würde mir bei den schiefen Tönen nicht nur das Trommelfell platzen, sondern ich würde sicherlich irgendeinen meiner Kollegen dabei überraschen, wie er in eine meiner Büronachbarinnen ejakulierte. Eklig, absolut widerlich.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Weihnachtsfeiern hasse?
Kapitel 2
Das Hauptgebäude von King’s Fashion – dem Konzern schlechthin, wenn es um die Mode von morgen ging – war mitten in der Stadt in einem teilweise modernisierten Altbau eingerichtet worden. Das Gebäude war im frühen neunzehnten Jahrhundert eine Stadtvilla gewesen und hatte Karl Friederich König und seiner Familie damals als Winterresidenz gedient. Selbiger war Besitzer eines großen Kaufhauses gewesen, das zu dieser Zeit die Innovation der neuen und modernen Gesellschaft dargestellt hatte. Karl Friederich König hatte eine Schneidereiabteilung für Männer eingerichtet, in welcher maßgeschneiderte Anzüge gefertigt worden waren. Die Königsanzüge, wie man sie noch immer scherzhaft nannte, glänzten mit hoher Qualität der besten Stoffe, die es zu erwerben gab, und waren schon bald nicht mehr der kleine Geheimtipp des Einzelnen gewesen, sondern die gefragteste Marke der ganzen Stadt. Im Laufe der Zeit florierte das Geschäft und nach und nach hatte sich das Sortiment des Kaufhauses ausgeweitet, zusätzliche Filialen waren auch in anderen Städten eröffnet worden und letztendlich hatte sich die Kette, als Karl Friederich König starb, zum marktführenden Imperium entwickelt.
So viel zur Historie des Unternehmens. Warum ausgerechnet ich, Luise Schmal, in der Modebranche gelandet war, konnte ich im Grunde nur mit geistiger Umnachtung beschreiben, die aus Geldnot heraus entstanden war.
Meine Kindheit hatte ich in einer typisch deutschen Massenwohnsiedlung zugebracht, bei der man an jeder Tür hätte klopfen können, um das gleiche Elend zu finden, das Hartz IV und unzureichende Bildung hieß. Der Kartoffelsalat mit der Bockwurst zu Weihnachten und Silvester war der Gipfel der Kultiviertheit, Hochzeiten wurden zwischen gespannten Wäscheleinen auf Bierbänken auf dem Rasenstreifen alias Gemeinschaftsgarten hinterm Haus gefeiert und Drogen konnte man im Hinterzimmer des Kiosks zwei Straßen weiter oder bei den richtig coolen Gettokids kaufen, die immer auf dem morschen Klettergerüst im Park herumlungerten. Letztere hatte ich wie die Pest gemieden, um Beschimpfungen möglichst aus dem Weg zu gehen, denn Angriffsfläche hatte ich mit meinem Übergewicht genug geboten. Warum Gott mich bei meiner Leibesfülle auch noch mit dem Nachnamen Schmal gesegnet hatte, konnte nur als hundsgemeiner Scherz durchgehen.
Vielleicht waren mein familiärer Hintergrund und das Aufwachsen inmitten eines sozialen Brennpunktes genau das, was ich gebraucht hatte, um mich aus diesem Sumpf herauszukämpfen. Nach dem Abitur und meiner Ausbildung zur Bürokauffrau war die Zusage von King’s Fashion mein Sprungbrett zur finanziellen Unabhängigkeit gewesen und im letzten Jahr war ich zur Sekretärin des Chefs aufgestiegen. Allerdings klang das besser, als es in Wirklichkeit war. Die Beförderung war mir nicht etwa zuteilgeworden, weil man mich gerne in dieser Position sah. Vielmehr war dem Personal nicht entgangen, dass Gottfried König, der Urenkel von Karl Friederich, immer vergesslicher und schusseliger wurde und von Monat zu Monat, der ins Land zog, mehr Unterstützung bei der Koordinierung wichtiger Angelegenheiten brauchte. Dummerweise schien die Intelligenz der diversen Bürokauffrauen, die bei King’s Fashion angestellt waren, proportional zur Körbchengröße zu sinken. Plump gesagt: Je dicker die Dinger, die sie vor sich hertrugen, desto dümmer waren ihre Besitzerinnen.
Da nichts von Königs Schusseligkeit nach außen dringen sollte, war klar gewesen, dass man jemanden brauchte, der zu mehr in der Lage war, als Modezeitschriften im Empfangsbereich zu sortieren und gut auszusehen. Jemanden, der im Hintergrund Termine koordinierte, Akten auf dem neusten Stand hielt, einen Überblick über das Unternehmen hatte und vor allem nichts vergaß und bums … diese Wahl war auf mich gefallen.
Anfänglich war die Freude groß gewesen. Zumindest so lange, bis ich kapiert hatte, dass es mich offiziell gar nicht gab. Also, auf dem Papier gab es meine Stelle natürlich, aber nach außen hin wusste niemand, dass ich existierte. Offenbar war man der Auffassung, dass mein Äußeres nicht akzeptabel genug war, um King’s Fashion an der Seite von Gottfried König zu repräsentieren – dabei empfand ich mich selbst gar nicht als hässlich. Aber mit Kleidergröße sechsundvierzig entsprach ich nicht dem Schönheitsideal, das King’s Fashion vermarktete. Darum stellte man kurzerhand eine blonde, vollbusige Tussi mit Zahnpastalächeln ein, die wie eine Plastik-Katie-Price aussah und zu Presseterminen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen mitgeschickt wurde. Meine Aufgabe bestand darin, sie so zu vorzubereiten, dass sie in der Lage war, unseren Chef adäquat zu unterstützen. Doch ihr IQ war so unterirdisch, dass ich mich ernsthaft fragte, wie diese Frau es geschafft hatte, überhaupt irgendeinen Abschluss zu bekommen. Wahrscheinlich hatte sie mit allen Lehrern geschlafen, anders konnte ich es mir nicht erklären.
Na gut, vielleicht besaß sie andere Fähigkeiten. Meine schlechte Meinung über sie basierte jedoch auf ihren fiesen Kommentaren mir gegenüber, und während sich diese Frau im Licht meiner Arbeit präsentierte und sich in meinen Lorbeeren wälzen durfte, wurde mir immer wieder aufs Neue bewusst: Ich war einfach nur der Arsch vom Dienst.
Hätte ich den Absprung geschafft und die angebotene Stelle nicht angenommen, hätte ich mich an diesem zwanzigsten Dezember jedenfalls nicht missgelaunt zur Weihnachtsfeier schleppen müssen.
Einmal im Jahr wurde für alle Kollegen eine kleine Festivität ausgerichtet, die eigentlich so gut wie immer in ein Massenbesäufnis ausartete, bei welchem ich bereits das eine oder andere Mal höchstpersönlich den Krankenwagen gerufen hatte. Ich ging nur deshalb hin, weil ich es musste, denn es herrschte Anwesenheitspflicht bei der Ansprache unseres Chefs. Diesem war es anscheinend derart wichtig, dass wirklich jeder seiner Angestellten das alljährlich wiederkehrende Gesäusel und den Jahresrückblick mitbekam, dass man sich dafür sogar einstempeln musste. Die einzigen Entschuldigungen, die galten, waren ein gelber Schein vom Arzt oder der eigene Tod. Der Depp, der das kontrollieren musste, tat mir richtig leid.
Einige Herzschläge lang blieb ich vor der beachtlichen Villa stehen, die in der einsetzenden Dämmerung des Abends in weihnachtlichem Glanz erstrahlte. Ich hatte die Hausmeister angewiesen, Lichterketten an den Regenrinnen rund um das Dach zu befestigen. Der Gärtner hatte den in Form geschnittenen Buchsbäumen ebenfalls ein Lichterkleid verpasst und aus einem Fester hing ein überdimensional großer Weihnachtsmann an einer Strickleiter, als wollte er gerade in das Haus einsteigen. Gepaart mit den weißen, verschnörkelten Giebeln, den hohen Fenstern und dem aufwendigen viktorianischen Baustil des Hauses war es ein hübscher und geschmackvoller Anblick. Dass sich hinter der weiß gestrichenen Flügeltür die Verwaltung eines Modeimperiums verbarg, war für Außenstehende und Touristen nicht gleich einsehbar. Lediglich ein bronzefarbenes Schild mit der Aufschrift »King’s Fashion – Hauptsitz« verriet, was sich hinter den Wänden der mehrstöckigen Villa abspielte.
Seufzend schob ich das schmiedeeiserne Tor auf, ehe ich den kleinen Vorgarten durchquerte und die schwere Holztür aufzog. In Anbetracht der Tatsache, dass King’s Fashion Mode vertrieb, die sich zu jeder Jahreszeit dem Wandel der neusten Trends anpasste, empfand ich klobige Holztüren, die sich nicht von selber öffneten, als ziemlich altbacken und hinterwäldlerisch. Gottfried König jedoch schwor auf Tradition und war sehr stolz auf die Geschichte des Unternehmens, weshalb er ein beträchtliches Vermögen in das Gebäude fließen ließ, um alles entsprechend in Schuss zu halten. Außerdem lag Shabby Chic momentan derart im Trend, dass man im letzten Jahr sogar mehrere Modenschauen und Fotoshootings im Ballsaal veranstaltet hatte, in welchen ich dieses Jahr das Karaokeequipment verbannt und das Buffet hatte aufbauen lassen.
Nachdem ich mich brav eingestempelt hatte, betrat ich das Foyer, das mit einem prachtvollen Marmorboden und einer breiten geschwungenen Treppe bestach, die sich nach oben hin nach rechts und links aufteilte. Ich hatte Stehtische mit goldenen Tischhussen aufstellen lassen, die in der Mitte von blutroten Schleifen zusammengebunden waren und wie das Kleid einer Prinzessin in hübschen Falten die Füße umspannten. Von der Decke hingen goldene Laternen mit roten Kerzen im Inneren und derjenige, der sich auskannte, würde auch die Mistelzweige erkennen, die ich in einer meiner zahlreichen Nachtschichten zur Organisation dieser Feier an einigen Türrahmen aufgehängt hatte. Um das Geländer der Treppe rankten sich Lichterketten und samtrote Bordüren, die einen Fremden sicherlich in Staunen versetzt hätten. Immerhin sah es geschmackvoll, chic und pompös gleichermaßen aus und ich fand, dass ich bei der Auswahl der diesjährigen Weihnachtsdekoration wirklich eine ansprechende Wahl getroffen hatte – immerhin passte das kräftige Rot nicht nur zum Anlass dieser Feierlichkeit, sondern ebenso zur diesjährigen Winterkollektion. Doch da ich bereits beim Eintreten ins Foyer in Beschlag genommen wurde, blieb mir keine Zeit, mich in dem Gefühl von Stolz zu sonnen.
»Er hat etwas vor, irgendetwas stimmt da nicht. Ganz und gar nicht!«
Vincent Brems packte mich bei den Schultern und schob mich in eine Ecke links neben der Eingangstür, sodass wir gemeinsam hinter einer überdimensional großen Topfpflanze verschwanden, die ich mit Christbaumkugeln dekoriert hatte. Es waren schon einige Mitarbeiter da und scheinbar war das, was Vincent mir zu sagen hatte, nicht für jeden bestimmt.
»Was?«, fragte ich, während ich mich umständlich aus meinem Wintermantel schälte und ihn an der nahegelegenen Garderobe aufhängte.
»Oh, Schätzchen! Du hast ja immer noch die gleichen Klamotten von eben an!« Vincents blaue Augen huschten über mein Outfit, das aus einer schwarzen Jeans und einem weinroten Rollkragenpullover bestand. Schlicht und elegant, wie ich fand. Nebenbei bemerkt, war es auch das einzige einigermaßen brauchbare Outfit gewesen, das mein Schrank heute Morgen zu bieten gehabt hatte, weil mir dank eines von Gottfried Königs eingeschobenen Kollektionsmeetings keine Zeit mehr zum Waschen geblieben war.
»Wie sollte ich denn in der letzten halben Stunde nach Hause gefahren sein und mich umgezogen haben? Ich wohne auf der anderen Seite der Stadt, schon vergessen?«
»Aaach, Süße, ich würde dir jetzt so gerne ein hübsches champagnerfarbenes Kleid verpassen, so mit Tüll und Rüschenborde, aber …«
Ich konnte mir ein Augenverdrehen nicht verkneifen. Vincent war neben Betti aus der Rechnungsabteilung einer meiner wenigen Freunde in diesem Laden, doch obwohl er hier Designer war, hatte er bisher noch keine Mode für Übergewichtige entworfen – weil es nicht erwünscht war.
»Ja, ja, ich weiß, ich bin zu fett.« Ich wickelte meinen groblöchrigen Strickschal ab und stopfte ihn missmutig dreinschauend in den Ärmel meines Mantels.
Vincent warf mir einen messerscharfen Blick über den Rand seiner weißen Hornbrille mit goldglänzenden Glitzerelementen hinweg zu. »Das hast du jetzt gesagt, Püppi.«
»Also, was ist los, Vincent?«, lenkte ich vom Thema ab, anstatt weiter darauf einzugehen.
»Ich bin noch nicht sicher, was da im Busch ist, aber es ist schon seltsam, dass Königs Junior wieder aufgetaucht ist, oder?«
Ich bekam große Augen. »Echt jetzt? Ich dachte, der sei auf ewig im Exil?«
Matheo König war Gottfrieds Sohn und ein Sprössling mit … sagen wir mal, besonders intensiven Bedürfnissen. Außer gut auszusehen und alles anzuspringen, was nicht bei drei auf den Bäumen war, konnte er meines Wissens nach nicht viel. Fast alle Weiber aus der Hauptverwaltung unter dreißig hatten schon mal auf seinem Schoß gesessen und das, obwohl sein Ruf als Casanova kein Geheimnis war. Er war die männliche Hure des Hauses, immer auf der Suche nach einem neuen Bett-, Schreibtisch- oder Klokabinenabenteuer.
Als er vorletztes Jahr dabei erwischt worden war, wie er eine der auszubildenden Näherinnen während der Weihnachtsfeier auf dem Schreibtisch seines Vaters vernascht hatte und davon dummerweise ein Foto im Internet gelandet war –, das sich auf Facebook und Instagram ungefähr so rasend schnell wie Ebola in einem Entwicklungsland verbreitete –, war er von Papi höchstpersönlich ins Ausland verbannt worden. Wohin er geschickt worden war, wusste keiner so genau, und Herr König hatte in meiner Anwesenheit nie ein Wort darüber fallen lassen, doch hinter vorgehaltener Hand hatten alle gemunkelt, dass er sich einer Therapie bei einem namenhaften Psychodoc wegen seiner Sexsucht hatte unterziehen müssen.
»Ja, ernsthaft, er ist eben vorgefahren. In einer ziemlich dicken Karre, versteht sich ja von selbst«, erwiderte Vincent mit sarkastischem Unterton in der Stimme.
»Meine Güte, ich bin mal gespannt, ob er geheilt ist oder immer noch über alles drüber rutscht, das zwei Beine und Möpse hat und einigermaßen gut aussieht.«
»Dann lass dich von ihm mal nicht bezirzen, Süße.«
Vincents schiefes Grinsen wirkte sympathisch und war ansteckend. »Nicht von dem«, gab ich rasch in der Hoffnung zurück, er möge das Thema Männer nicht vertiefen.
Ich mochte Vincent und in gewisser Weise war er in den sechs Jahren, in denen ich nun hier angestellt war, zu meinem besten Freund geworden. Doch selbst ihm hatte ich nicht anvertrauen können, dass ich gar nicht wusste, was Liebe war, weil ich sie nie kennengelernt hatte. In meiner Jugend hatte ich zu Hause gesessen, Bücher gelesen und mich in ferne Welten davongeträumt, anstatt vor die Tür zu gehen und zu lernen, wie man selbstbewusst auf Männerfang ging. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, mein Gewicht und damit gleichsam mich selbst zu verstecken, dass ich die erste große Jugendliebe verpasst hatte. Zumindest war mir nie ein Junge begegnet, der mich wirklich gerngehabt hatte.
Der Einzige, für den ich während meiner Schulzeit geschwärmt hatte, hatte mich nach Strich und Faden verarscht. Lars Behrens, der coolste Typ der ganzen Schule, wie ich damals fand, lud mich an einem Donnerstagmittag nach dem Deutschunterricht ganz unverhofft zu einem Date ein. Ich war blind vor Verknalltheit und konnte gar nicht glauben, dass ihm meine stille Bewunderung für ihn aufgefallen war. Ausgerechnet ich! Luise Schmal fiel sonst nie irgendjemanden auf, zumindest nicht im positiven Sinne. Wenn es darum ging, jemanden mit Schimpfwörtern zu bombardieren, hätte ich sogar Harry Potters Tarnumhang tragen können und man hätte mich trotzdem gefunden und als Opfer auserkoren.
Lars und ich gingen Eis essen. Er erzählte mir von sich und ich ihm von mir. Ich weiß noch, wie schön ich seine Lippen fand und dass mir die Art gefiel, wie er sie bewegte, wenn er mit mir sprach. Sie verbargen schöne weiße Zähne, die von einer Zahnspange gerichtet worden waren, die er erst vor drei Monaten losgeworden war. Ich konnte mich auch noch daran erinnern, dass ich in diesen zwei Stunden alles viel intensiver wahrnahm. Die Blätter der Bäume waren ein bisschen grüner, die Sonne wärmte ein bisschen mehr und das Eis schmeckte ein bisschen besser als sonst. Es gab nur ihn und mich und er war witzig, so witzig. Ich mochte seinen Humor und die Art, wie er sich über Herrn Petersmeyer, unseren Chemielehrer, lustig machte. Lars konnte ihn gut nachäffen und brachte mich so oft zum Lachen, dass mein Bauch schmerzte.
Es war einer der schönsten Nachmittage meines gesamten Lebens. Kein Plattenbau, kein betrunkener Stiefvater, keine weinende Mutter. Niemand, der mich anschrie. Niemand, der mit der Hand nach mir ausholte, wenn ich irgendeinen nichtigen Fehler begangen hatte. Es gab nur Lars, mich und die unbändige Freude darüber, dass er mich zu mögen schien. Mich. Luise Schmal, die Außenseiterin, die für nichts außer die Opferrolle zu gebrauchen war.
Als wir durch die Stadt nach Hause gingen, durchquerten wir den Skatepark an der Herrmannstraße. Er nahm mich irgendwann bei der Hand und zog mich zu sich heran. Das dunkle Grau seiner Augen war wunderschön und sein Blick derart intensiv, dass ich dachte, es sei endlich dieser eine besondere Moment gekommen, den alle Mädels aus den Teeniefilmen erleben, die ich zuhauf im TV gesehen hatte. Der Moment, in dem sie von einem kleinen Mädchen zur jungen Frau wurden und die Raupe sich zum Schmetterling entwickelte. Ich hatte so lange darauf gewartet und mir diesen Augenblick so oft in meiner Fantasie ausgemalt – und doch übertraf das Gefühl, das ich verspürte, als ich so nah bei Lars stand, all meine Vorstellungskraft um das Tausendfache.
Kurz bevor sich unsere Lippen berührten, stieß er mich jedoch völlig unerwartet von sich. Er begann zu lachen, auf eine ganz seltsam bizarre Art und Weise und plötzlich tauchten Lars’ unzählige Freunde aus allen Ecken auf, als hätten sie sich auf diesen Platz gebeamt. Ganz langsam kamen sie auf mich zu, umzingelten mich und schlossen mich in einem Kreis aus Feindseligkeit ein. Sie lachten ebenfalls, zeigten auf mich, ließen ihre abschätzigen Blicke über meinen Körper wandern. Jeder einzelne fühlte sich an wie ein kraftvoller Peitschenhieb. Ihr Lachen war verzerrt, raue und höhnische Töne, die mich derart trafen, dass es mir buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzog. Ich war wie versteinert, konnte mich nicht bewegen und war unfähig zu begreifen, dass Lars diesen Nachmittag nur inszeniert hatte, um mich bloßzustellen.
Sie bewarfen mich mit faulen Eiern. Ich werde niemals vergessen, dass die Aufschläge der Eier auf meinem schutzlosen Körper nicht mal ansatzweise so schmerzhaft waren wie das Gefühl, das mein Innerstes zerriss. Als sie irgendwann von mir abließen, weil ihre Pappkartons leer waren, und sich von mir entfernten, brauchte ich ewig, bis ich mich aufraffen und nach Hause gehen konnte. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Scham, Trauer, Wut und Selbsthass empfunden wie in diesen Momenten, die sich wie unzählige Stunden anfühlten.
Wie Lars mich einen ganzen Nachmittag hatte hinters Licht führen und dann bei meiner sozialen Hinrichtung hatte zusehen können, verstehe ich bis heute nicht. Aber die Worte »Nie im Leben könnte ich mit so einer hässlichen, fetten Sau was anfangen« brannten sich kilometertief in mein Gedächtnis ein. »Deine Beine sind so fett, wenn du sie breitmachst, kann man deine Fotze immer noch nicht sehen.« Das hatte er gesagt. Und ich hatte noch heute seine Stimme und das höhnische Gelächter seiner Kumpane im Ohr.
Diese Geschichte konnte ich niemandem anvertrauen. Nicht einmal dem urguten Vincent, der mich sicherlich in den Arm genommen und getröstet hätte. Wenn er die Geschichte kennen würde, wäre es ein Leichtes für ihn, zu verstehen, warum ich mit meinen fünfundzwanzig Jahren noch ungeküsst war. Warum ich nie die Hand eines Mannes gehalten hatte. Warum ich noch Jungfrau war. Warum ich die Liebe so sehr verabscheute, dass ich sie nicht einmal den verliebten Pärchen auf dem Weihnachtsmarkt gönnte.
Doch ich konnte nicht darüber sprechen. Zu groß wäre der Gesichtsverlust gewesen, zu groß die Scham wegen des Vergangenen. Ich wollte ihm diese Schwäche nicht zeigen. Durfte es nicht. Denn wenn ich die Erinnerungen an jenen Juninachmittag zurückholen würde, der mein Leben so nachhaltig beeinflusst hatte, wäre ich zusammengebrochen.
»Luise, Schätzchen? Jemand zu Hause?«
Vincents Stimme holte mich aus meinen Gedanken. »Ja?«
»Hast du Tränen in den Augen?« Vincents Blick wanderte forschend über mein Gesicht, sodass mir Schamesröte die Wangen emporschlich. Ich neigte schnell den Kopf zur Seite und blinzelte die Tränchen weg, die sich dummerweise ausgerechnet an diesem scheiß Abend hatten durchringen können. Immer, wenn ich es am nötigsten hatte, ließ mein Körper mich im Stich. Das war ein ungeschriebenes Gesetz und wurde durch die blöde Weihnachtszeit noch verschlimmert. Mochte wohl daran liegen, dass ich niemanden hatte, mit dem ich den Heiligen Abend verbringen konnte und ich deshalb ein wenig gefühlsduselig war.
»Weinst du etwa, weil der König-Sohn wieder da ist?«
Absolut falsche Interpretation. »Nein! Ich heule, weil es in dieser modrigen Bude so staubig ist!« Ich sah wieder zu Vincent hinüber, dessen Blick mit skeptischem Ausdruck auf mir lag.
»Ich wäre auch lieber in neuen Büroräumen«, gab er nach einer kurzen Pause zurück. »Dieses altbackene Ambiente verstaubt meine ganze Kreativität, auch wenn Rouven sagt, dass es ihn in alte Zeiten zurückversetzt, in denen Mode noch von wahren Könnern gemacht wurde und nicht nur aus Löchern bestand.«
Grinsend schielte ich auf Vincents Jeans, die mit ihrem used look und den ganzen Rissen nicht nur hochmodern, sondern für diese Jahreszeit auch unpassend war. Immerhin sollte Kleidung vorrangig vor Wind und Wetter schützen.
»Ach, du weißt doch, wie Rouven ist. Er ist selber ein Urgestein und da kann man es doch verstehen, wenn er auf dieses Haus steht«, erwiderte ich froh darüber, dass sich das Gesprächsthema in angenehmeren Gefilden bewegte. Rouven Hilberstedt war der Designer bei King’s Fashion und war eine Ikone auf seinem Gebiet. Alle Entwürfe von Vincent oder den anderen Designern gingen über seinen Tisch und mussten seiner beinharten Kritik standhalten, bevor auch nur eine Socke in Produktion gehen durfte.
»Apropos, da ist Lucy und ich glaube, sie sucht dich«, fügte ich hinzu und zeigte in Richtung Treppe, auf der die Praktikantin der Designerabteilung stand und ihren Blick durch die Menge gleiten ließ.
»Oh, heiliger Bimbam, es ist ja schon nach fünf! Um halb sechs sollen die Models fertig sein! Rouven wird mir den Kopf abreißen!« Vincent schloss mich in eine flüchtige Umarmung, ehe er sich durch das langsam voller werdende Foyer drängte.
Kopfschüttelnd sah ich ihm nach und beobachtete meine Kollegen, von denen sich die meisten einen Prosecco oder einen Orangensaft am Empfang abholten und sich dann in kleinen Grüppchen an den Stehtischen zusammenfanden, um vor der Weihnachtsansprache des Chefs noch ein wenig zu plaudern und die Geselligkeit zu genießen. Ich überlegte, ob ich mich zu irgendjemandem dazustellen sollte oder nicht, beschloss dann aber, dass ich mich in meiner Ecke hinter der Topfpflanze ganz wohlfühlte. Auf diese Weise konnte ich wenigstens niemandem auffallen.
Kapitel 3
»Luise, Luise, Luise! Endlich, da bist du ja!«
Ich zuckte heftig zusammen. Ich war derart tief in die Beobachtung einer meiner Kolleginnen vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen hatte, dass jemand nach mir suchte. Die Faszination darüber, wie Sarah Müller – eine neue Angestellte aus dem Catering – Kai Schlüter aus dem Controlling in großer Runde unter dem Tisch in den Schritt fasste und sich nebenbei feuchtfröhlich mit dem neben ihr Stehenden unterhielt, katapultierte mich ins Jenseits meiner Vorstellungskraft. Wie konnte man denn bitte so heiß darauf sein, einen Kerl in der Öffentlichkeit zu begrapschen und dann auch noch denken, niemand würde es mitbekommen? War das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Dem verkniffenen Gesicht von Kai konnte ich jedenfalls weder wahre Beglückung noch Verunsicherung entnehmen – vielleicht versuchte er, so normal wie möglich zu schauen. Daher konnte ich schlecht einschätzen, wie er dazu stand, dass sein Gemächt in der Öffentlichkeit von einer Kollegin gestreichelt wurde. Warum konnte man damit nicht warten, bis man im Schlafzimmer verschwunden war – von mir aus auch in irgendeinem Büro? Das war nicht nur unfassbar, sondern auch widerwärtig!
»Luise, hallo, wen starrst du denn da so an? Einen süßen Typen?«
Nur mühselig konnte ich meinen Blick von Kai und Sarah abwenden und mich auf die Person vor mir konzentrieren. Erst zu diesem Zeitpunkt registrierte mein Hirn, dass ich mir ein besseres Versteck hätte suchen müssen.
»Oh, hey.« Vor mir baute sich Vanessa Rosenberg auf, meine herzallerliebste Lieblingskollegin, von der ich eben schon mal kurz berichtet hatte. Die Vorzeigetussi für Pressetermine, die dumm wie Bohnenstroh war und ein Talent dafür hatte, umwerfend auszusehen und Männer mit einem Wimpernaufschlag aus der Bahn zu werfen. Vincent und ich betitelten sie einfach immer nur als PKP – eine Abkürzung für Plastik-Katie-Price.
»Ich habe ewig nach dir gesucht!«
Ihre Stimme quietschte in meinen Ohren wie die Gummiente, die zu Hause auf meinem Badewannenrand stand, und ich musste mir große Mühe geben, die Augen nicht zusammenzukneifen oder mir die Ohren zuzuhalten.
»Warum versteckst du dich hinter dieser Palme? Magst du nicht gern zeigen, dass du dich nicht umgezogen hast für die Weihnachtsfeier?«
Nur um das richtig zu stellen: Es war keine Palme, sondern ein großer Ficus, ein verdammter Ficus. Außerdem war es mir scheißegal, was meine Kollegen davon hielten, dass ich mich nicht extra aufgebrezelt und keinen goldenen Lidschatten aufgetragen oder mir wilde, verführerische Locken wie Julia Roberts in Pretty Woman gedreht hatte.
»Ich verstecke mich nicht«, erwiderte ich so ruhig wie möglich. »Was kann ich für dich tun?«
PKP hakte meinen Arm bei sich unter, als wären wir die besten Freundinnen, und führte mich durch das Foyer auf die linke Seite zu unserem Büro. Wir teilten uns das Vorzimmer von Herrn Königs Schaffensbereich. Es war ein großzügig geschnittener Raum mit hohen, stuckverzierten Decken, die in einem pastellgelb mit weiß-grünen Pflanzenornamenten tapeziert und mit knarzendem Parkett ausgelegt war. Hätten die Aktenschränke und die mit technischem Equipment gesäumten Schreibtische dort nicht gestanden, hätte man meinen können, der Raum wäre seit dem neunzehnten Jahrhundert nicht mehr verändert worden und jeden Moment würde ein Mädchen mit hübschem Rüschenkleid und geflochtenen Zöpfen durch die Tür kommen, um ihren Vater zu bitten, die Liebe ihres Lebens heiraten zu dürfen. Sorry, ich hatte zu viele historische Kitschromane gelesen.
Durch die beiden bodenlangen Sprossenfenster jedenfalls konnte ich trotz samtblauer Dämmerung erkennen, dass es angefangen hatte, zu schneien.
Schnee kurz vor Weihnachten. Igitt, wie kitschig. Wollte mich heute denn sogar der Wettergott im Stich lassen?
PKP dirigierte mich zu ihrem Schreibtisch.
»Ich finde die Datei mit der Rede von Herr König nicht … Kannst du sie raussuchen?«
Die Rede, die ich vorletzte Nacht quasi selbst verfasst hatte? Die Rede, die vom Chef nur abgenickt und dann zur Seite gelegt worden war, als hätte sie mich nicht fünf Stunden Schlaf gekostet? Die Rede, in der ich gefühlt über mich selbst und meine Kompetenzen hinausgewachsen war? Immerhin war ich hier bloß eine von vielen Bürokauffrauen, die ein derart mickriges Gehalt verdiente, dass es gerade mal so für eine Einzimmerbude in Berlin-Neukölln reichte, direkt neben so einem neofaschistischen Arsch, der sich immer mit dem Syrer aus dem vierten Stock anlegte. Ich war keine verdammte Journalistin, der das Schreiben in die Wiege gelegt worden war, und doch hatte ich es nach stundenlangem Kopfzerbrechen hinbekommen, eine tolle Ansprache zu verfassen. Und dann wurde sie bloß mit einem Nicken entgegengenommen, als hätte ich ihm einen Kaffee gereicht.
»Und die PowerPoint-Präsentation mit den Bildern der Modenschauen ist auch weg!«
Redete PKP etwa von der PowerPoint-Präsentation, die jede Praktikantin aus der zehnten Klasse im Orientierungspraktikum besser hinbekommen hätte als sie selbst und doch von mir angefertigt worden war?
Ich presste die Lippen aufeinander und hoffte, dass ich nach außen hin die Ruhe in Person war. »Klar, ich schaue mal nach«, sagte ich mit der sanftesten Stimme, die ich zu bieten hatte.
»Super, danke, du bist ein Schatz. Ich gehe derweil dem jungen König ein wenig zur Hand.«
Hä? Wobei denn? Beim Penishalten oder was?
Mit zusammengezogenen Brauen sah ich PKP nach, wie sie ihren herzförmigen Prachthintern in Position brachte und mit durchgedrücktem Rücken ohne anzuklopfen in das Zimmer des Chefs stolzierte, wobei sie den Eindruck machte, als hätte sie einen Stock im Arsch.
Ich vernahm das Gemurmel eines Gesprächs zwischen drei Personen, von der die eine Stimme König senior und die andere natürlich unverkennbar zu Vanessa gehörte. Die dritte war mir weniger vertraut, aber nicht unbekannt. Außerdem hatte PKP ja bereits erwähnt, dass sie dem König-Sohn zur Hand gehen wollte …
Augenrollend und wie ein Dampfkessel kochend vor Wut suchte ich nach der Rede, die tatsächlich nicht zu finden war. Was hatte diese dumme Gans denn nur damit gemacht? Ich hatte ihr die Datei doch geschickt und sie hätte sie bloß ausdrucken müssen … Aber sie hatte meine E-Mail in Outlook gelöscht. Warum das denn? Selbst die gelöschten Elemente des Mailordners hatte sie gelöscht. Ernsthaft? Wenn Gottfried König gleich keine vorgefertigte Rede mit zur Ansprache würde nehmen können, würde er nicht nur seinen Jahresabschluss versauen, sondern mich zusätzlich achtkantig vor die Tür setzen.
Fieberhaft suchte ich nach der Datei, die sich nur noch auf diesem PC befinden konnte, weil meiner heute Vormittag abgestürzt war und seither nicht mehr hochfuhr. Leider hatte der Haustechniker bisher noch keine Zeit gehabt, um sich darum zu kümmern, weil er mit dem Aufbau des blöden Karaokekrams beschäftigt gewesen war. So eine verdammte Scheiße!
Während die Existenzangst die Dämme meiner Schweißporen öffnete, hörte ich PKP im Nebenzimmer quietschend lachen. Es klang, als wäre jemand auf das Gummispielzeug eines Hundes getreten.
Ich klickte mich durch sämtliche Dateiordner, die sie auf ihrem PC hatte, und als selbst die Suchfunktion nichts fand, packte mich eine derart verzweifelte Wut, dass ich am liebsten aus vollem Halse geschrien hätte. Die Weihnachtsmusik, die alle Anwesenden schon mal in Stimmung versetzen sollte, tat ihr Übriges, denn ich hasste diese alljährlich wiederkehrenden Songs so sehr, dass ich einem Tränenausbruch epischen Ausmaßes nahe war. Ich hörte das Stimmengemurmel aus dem Chefzimmer allzu deutlich und war so sauer, dass ich am liebsten das Telefon genommen und es gegen die geschlossene Tür gepfeffert hätte, weil ich hier allein saß und mich abmühte, während PKP mit dem König-Sohn und wahrscheinlich auch dem senior flirtete. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sie ihren Entenhintern auf dem Massivholzschreibtisch drapiert hatte, ihre gertenschlanken Beine übereinanderschlug und ihren Paillettenrock ein Stück nach oben schob, um die Blicke der anwesenden Männer auf sich zu ziehen. Sie wusste natürlich, dass die Nuttenmasche funktionieren würde, weil Gottfried König kein Kind von Traurigkeit war, nur dass er damit noch nicht in der Presse gelandet war. So viele Termine, wie der alte geile Bock mit Weibern hatte, war es kein Wunder, dass sein Sohn ähnliche Tendenzen zeigte. Ich fragte mich ernsthaft, was PKP sich davon erhoffte, wenn sie sich an beide ranmachte, womöglich auch noch gleichzeitig. Vielleicht erwartete sie für ihre Sexdienste eine Festanstellung mit mehr Gehalt oder so was. Denn mit ehrlicher Arbeit kam man hier wahrlich nicht weit, dachte ich frustriert, als ich die blöde Rede und die PowerPoint-Präsentation im Papierkorb des Computers fand, den PKP Gott sei Dank nicht auch noch gelöscht hatte. Mir war sehr klar, dass sie damit versucht hatte, mir eins auszuwischen. Dumm an der Sache für sie war nur, dass ihre Friseuse ihr mit der Auffrischung des platinblonden Haarschopfes auch noch den allerletzten Rest Verstand aus dem Hirn gefärbt hatte.
Ich führte die Maus zum Druckersymbol der Worddatei und klickte so fest darauf, als würde ich eine Nadel in eine Voodoopuppe rammen. Diese dumme Gans!
»Ja, Herr König«, flüsterte ich in spitzem Ton, als ich zum Drucker ging und auf das Papier wartete. »Das mache ich, Herr König. In meiner Jugend habe ich gelernt, wie man Lollis riiichtig geil lutscht, Herr König. Ich kann mich verbiegen wie eine Brezel, Herr König.«
»Bitte was?«
Ich zuckte heftig zusammen und verfiel in eine Schockstarre, in der ich für einige Momente verharrte. Offenbar hatte die Wut achtzig Prozent meiner Sinne außer Kraft gesetzt, sodass ich nicht bemerkt hatte, dass jemand aus dem Büro des Seniors gekommen war. Nachdem der Drucker das letzte Blatt ausgespuckt hatte und es ruhig wurde im Büro, überfiel mich eine Gänsehaut. Die Stille bei einer Totenwache wäre die Party des Jahrhunderts gegen dieses frostige Schweigen gewesen.
So langsam wie die Ballerina einer Spieluhr drehte ich mich um. Unmittelbar vor mir stand Matheo König.
Kapitel 4
Hätte ich gewusst, wie attraktiv Matheo König war, hätte ich mir die Augen zugehalten, denn das, was ich wahrnahm, schlug ein wie eine Bombe und brachte mich völlig durcheinander. Ich hatte ihn zwar durchaus in Erinnerung, doch die Zeit hatte ihn … verändert. Er war erwachsener geworden. Seine blonden Engelslocken waren nicht mehr zu lang, sondern in einem modernen Haarschnitt zurechtgestutzt worden. Gleichzeitig erschien mir der penible Seitenscheitel beinahe ein wenig altbacken, doch der sündhaft teure Hilfiger-Anzug in dem sanften Marineblau machte diesen Eindruck wieder wett. Um seinen kräftig-markanten Kiefer malte sich ein dunkler Dreitagebart, der mich an einen neumodernen Hipster erinnerte, die man zurzeit überall auf den Plakaten großer Kleidungsketten sah, die Mode für junge Erwachsene produzierte. Das blütenweiße Hemd, das unter seinem Jackett hervorlugte, spannte sich auf eine attraktive Art und Weise um seine Brust, die mir noch nie zuvor bei einem Mann aufgefallen war. Das Schlimmste und gleichzeitig Beste an ihm waren jedoch seine Augen. Sie waren kristallblau wie ein Bergsee in den Alpen, derart kräftig und farbintensiv, dass man die eigenen Augen ein wenig zusammenkneifen musste, um nicht zu sehr geblendet zu werden. Sein Blick war stechend und mich beschlich neben einer Gänsehaut das Gefühl, dass er sich wie ein Korkenzieher direkt in meinen Kopf bohrte.
Nicht wissend, was ich antworten sollte, stand ich vor ihm wie der dümmste Mensch der Welt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mit Sprechen am Zug war, hatte ich ohnehin schon wieder vergessen, was er überhaupt gesagt hatte, weshalb ich ihn anstarrte, als wäre ich auf Diät und er ein BigMac von McDonald’s. Ich spürte, wie mein Körper einfror und mich bewegungsunfähig machte, während unglaublich viele Empfindungen auf mich einprasselten, die ich nicht deuten konnte. Mein Herz stolperte mehrfach, meine Hände schwitzten und ohne in den Spiegel zu schauen, wusste ich, dass ich in den letzten Momenten rot angelaufen war wie die Tomatensauce einer Miracoli-Packung. Insgesamt war ich nicht nur völlig überrumpelt von dieser Hormonflut, sondern fühlte mich, als hätte mich eine Herde paarungsbereiter Zuchtbullen überrannt.
Was sollte ich nur tun? Einen Krankenwagen rufen? Vielleicht hatte mich in eben jenem Augenblick ein tödliches Virus angefallen. Hilfe!
»Hallo? Jemand zu Hause bei Ihnen?« Matheo schnipste ungeduldig mit Daumen und Zeigefinger vor meiner Nase herum.
»Äh … ja. Wa-warum?«, stotterte ich. Meine Stimme brach beim letzten Wort. Das Kratzen in meinem Hals deutete wohl auf eine Mandelentzündung hin und die Schweißausbrüche kamen vom Fieber, das ich bestimmt hatte. Ja, so musste es sein.
»Weil Sie mich anschauen, als wären Sie sechs Jahre alt und hätten entdeckt, dass es den Nikolaus gar nicht gibt.«
»Doch, den gibt es«, protestierte ich, woraufhin er überrascht seine blonden Augenbrauen in die Höhe zog.
»Also, es gab ihn zumindest«, erläuterte ich weiter und äußerst wenig geistreich.
»Ich bin nicht so bibelsicher, ist mir dementsprechend egal. Und wenn Sie an den Osterhasen glauben, soll mir das auch recht sein. Wo ist die Rede?«
»Welche Rede?«
Mein Gegenüber verdrehte die Augen. Sein Blick konnte nichts anderes als Ungeduld bedeuten. »Wenn Sie aufhören würden, an Brezeln zu denken, während Sie arbeiten, hätten Sie vielleicht auch ein Auge für das Wesentliche«, fauchte er mich an.
»Ach so, die Rede! Ja, hier habe ich sie!« Oh Gott, ich klang ja wie ein unterwürfiges, kleines Mädchen! Dennoch wirbelte ich eilends zum Drucker und reichte ihm die Zettel. Matheo riss sie mir aus der Hand, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte ohne ein weiteres Wort in das Büro seines Vaters zurück. Die Tür flog mit einem lauten Knall ist Schloss, was mich zum Zusammenzucken brachte.
Ich blies die Luft durch meine geblähten Wangen und ließ mich auf den Bürostuhl fallen.
Was war das denn bitte gewesen? Er hätte ja wenigstens mal Danke sagen können, dachte ich, während ich die geschlossene Tür hypnotisierte, durch die Matheo eben verschwunden war. Und dann auch noch zu meinen, ich hätte den Blick für das Wesentliche verloren! Hatte der ’ne Macke? Jetzt mal ernsthaft: Wer hatte diesen ganzen Scheiß denn bitte organisiert? Die Einladungen fertig gemacht? Die blöde Rede geschrieben und noch dazu die PowerPoint-Präsentation angefertigt? Wer hatte den Caterer beauftragt und das Karaokeequipment bestellt? Das hatte alles ich gemacht. Ich ganz allein, während PKP sich die Nägel lackiert oder mit irgendwelchen Kollegen vergnügt hatte. Ich war Bürokauffrau und keine Eventmanagerin, verdammt noch mal!
Mein seltsames Gefühl von eben verzog sich so schnell wieder, wie es gekommen war, und schlug in einen Schwall geballte Wut um. Dieses Arschloch! Und warum wollte PKP mir eins reinwürgen, indem sie diese vermaledeite Rede und noch dazu die Fotopräsentation löschte? Am liebsten wäre ich in das Büro reinmarschiert und hätte ihr das Ungetüm von einem Drucker an den Kopf gedonnert. Wenn man schon fürs Gutaussehen bezahlt wurde, dann konnte man doch wenigstens denjenigen seinen Job machen lassen, der ihre Stelle erst ermöglichte. Denn wenn es mich nicht gäbe, wäre sie schon so manches Mal auf die Schnauze und wahrscheinlich sogar aus dem Unternehmen geflogen. Blöde, undankbare, vollbusige und verlogene Kuh!
Wütend hämmerte ich auf der Maus herum und zog die Präsentation auf einen Stick, mit dem ich schließlich ins Foyer zurückkehrte. Mittlerweile dürften die meisten Mitarbeiter der Verwaltung angekommen sein, schätzte ich, da sich um jeden Stehtisch quasselnde Grüppchen gebildet hatten, die die ausgelegten Spekulatius mampften und Sekt oder Orangensaft tranken. Ich ging zur Treppe, wo ein Laptop mit Beamer aufgebaut war, der die Bilder der letzten Kollektionen aus diesem Jahr an eine Wand werfen sollte. Während ich alles für den passenden Start vorbereitete, fragte ich mich, warum ich mich damit überhaupt beschäftigte. PKP hätte das genauso gut machen können. Aber nein, stattdessen saß die dumme Nuss beim Chef auf dem Schreibtisch und produzierte mehr Schleim als die Rotznase eines fünfjährigen Kindes mit Erkältung.
Gerade, als ich fertig war, sah ich, wie Gottfried König dicht gefolgt von seinem Sohn und PKP das Foyer betrat. Ich konnte mit Worten kaum beschreiben, wie ich diese Frau verabscheute. Sie dackelte Matheo wie ein braver, kleiner Hund hinterher und wenn mich nicht alles täuschte, würde jeden Moment ihre Zunge aus ihrem geschminkten Mund fallen und sie würde zu sabbern beginnen.
Ich trat zur Seite, als Gottfried König sich mir näherte. Sein Blick glitt gewinnend lächelnd durch die Menge, und wenn ich ihm keinen Platz gemacht hätte, wäre er bestimmt durch mich hindurch gelaufen wie durch ein Gespenst – denn genauso fühlte ich mich in dem Augenblick, als er mir nicht mal einen kleinen Moment seiner Aufmerksamkeit schenkte. Kein Zeichen oder anerkennendes Lächeln, mit dem er mir versicherte, dass ihm aufgefallen war, was ich in den letzten Wochen und sogar Jahren für die Firma auf die Beine gestellt hatte.
Ich wusste nicht so recht, ob ich wütend oder traurig sein sollte. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem, als ich passend zu seiner Rede die Präsentation zum Laufen brachte und ein Model an die freie Wand rechts neben der Treppe projiziert wurde, das in einem reinweißen Kostüm mit extravagantem Pelzbesatz und modernen Winterstiefeln vor einem karamellbraunen Hintergrund posierte.
»Meine lieben Kolleginnen und Kollegen«, begann Gottfried König schließlich zu sprechen, nachdem er sich auf der sechsten Treppenstufe positioniert hatte und gewinnend in die Menge schaute, »es ist kaum zu glauben, dass ein ganzes Jahr schon wieder fast vorüber ist. Mir kommt es so vor …«
Bla. Bla. Bla. Ich schaltete ab, immerhin hatte ich die Rede geschrieben, die er gerade vortrug und als sein Eigenwerk verkaufte. Ich machte ein paar Schritte in Richtung Wand und zog mich aus der Menge zurück, in der ich mich ohnehin nicht wohlfühlte. Herr König senior hingegen stand selbstsicher auf dem unteren Treppenabschnitt und trug die Worte, für die ich fast eine ganze Nacht geopfert hatte, mit einer Leichtigkeit vor, als hätte er sie vor wenigen Minuten selbst zu Papier gebracht. Man sah ihm an, dass er überhaupt kein Problem damit hatte, öffentlich vor vielen Menschen zu reden, und hätte ich nicht gewusst, dass er mittlerweile ein Mann mit gewisser Altersvergesslichkeit war, wäre mir nicht aufgefallen, dass die Worte nicht von ihm kamen. An seinem Aussehen war nicht zu erkennen, dass Herr König ein Senior weit über sechzig war. Seine Schläfen waren angegraut, ja, aber sein Haar war dennoch weißblond, seine blauen Augen glasklar und seine Statur schlank. Nur ein kleiner Bauchansatz verriet, dass er etwaigen Süßspeisen nicht ganz abgeneigt war.
Seine Routine während des Sprechens brachte eine Leichtigkeit mit sich, die neben der Wut, die ich gerade empfand, schon so etwas wie Bewunderung mit sich brachte. Immerhin schaffte er es, kleine Witzchen in seine Worte einzuflechten, die mir nicht eingefallen waren und die ich ihm dementsprechend nicht aufgeschrieben hatte. Nicht, dass ich zugehört hätte, was er da faselte, doch ich nahm natürlich die Lacher wahr, die aus der Belegschaft kamen.
Ja, ja, Gottfried König war durchaus geschätzt unter den Kollegen.
Ich glaubte, dass ich die Einzige war, die das anders empfand als alle anderen und ich fragte mich, warum ich mich ständig herabgesetzt, stehengelassen und wenig wertgeschätzt fühlte. Manchmal glaubte ich, dass dieses Gefühl mit meiner Vergangenheit zusammenhing, in der ich so oft niedergemacht worden war, dass die Finger von zwanzig Personen nicht ausgereicht hätten, um die Erlebnisse daran abzuzählen.
Ich war niemand, der für seine Taten in den Himmel gelobt werden wollte, ganz gewiss nicht. Alles, was ich wollte, war ein bisschen Anerkennung für mein Mitwirken, die mir, wie ich fand, durchaus zustand. Ich tat so viel für Gottfried König und sein blödes Modeunternehmen und das Einzige, das er machte, war …
»Und ganz herzlich möchten wir uns heute natürlich bei unserer allseits wertgeschätzten Kollegin Vanessa Rosenberg bedanken, die viele Dinge koordiniert hat, um diesen Abend möglich zu machen.«
… PKP für die Organisation der Weihnachtsfeier zu danken?!
Applaus aus der Menge.
Wäre das ein Film gewesen, wäre die Kamera dramatisch durch den Raum geschwenkt, um bei mir stehen zu bleiben und mein geschocktes Gesicht in den Fokus zu nehmen. Ganz nah hätte man herangezoomt, damit man sehen konnte, wie sich Tränen der Wut in meinen Augen sammelten und mir die Kinnlade herunterfiel. Meinen eigenen Gesichtsausdruck stellte ich mir in etwa so vor, als hätte ich gerade erfahren, dass meine Mutter die Königin von England höchstpersönlich und ich die rechtmäßige Thronerbin der Windsor-Dynastie war.
Und jetzt mal ernsthaft … Hatte Gottfried König ’nen Lattenschuss? War seine lapidare Vergesslichkeit in Idiotismus umgeschlagen? Es konnte doch nicht gänzlich spurlos an ihm vorübergegangen sein, dass ich Überstunden ohne Ende gemacht hatte, um diese blöde Festivität auf die Beine zu stellen? Oder doch?
Am liebsten hätte ich dem Kerl die Zettel der Rede in den Hals gestopft, Mund und Nase zugehalten und ihn qualvoll daran ersticken lassen. Ich wollte diese Schmalzlocken nicht mehr sehen, die er an seinen Sohn weitergegeben hatte, der direkt neben dem Treppengeländer stand und wie ein braves Jüngelchen zu seinem Vater empor lächelte. Direkt daneben hatte sich PKP platziert, deren breites Grinsen mich derart auf die Palme brachte, dass ich ein wütendes Schnauben nicht unterdrücken konnte.
Dumm war nur, dass Herr König eine Redepause eingelegt hatte und es nach dem Applaus recht still geworden war, sodass mein seltsames Geräusch die kollektive Aufmerksamkeit auf sich zog.
Plötzlich stand ich im Mittelpunkt aller, die sich in meiner Nähe befanden, und ich ärgerte mich tierisch, dass ich meine Gefühle nicht hatte im Zaum halten können. Statt stillschweigend vor mich hinzukochen, stand ich im Foyer von King’s Fashion und grölte wie ein verreckendes Pferd nach einem 100-Kilometer-Sprint. Zumindest musste es für die anderen so geklungen haben, denn eine Schneiderin aus dem Atelier bot mir an, ein Glas Wasser zu holen, das ich mit hochrotem Kopf dankend ablehnte, während ich gleichermaßen stur wie beschämt darauf wartete, dass sich alle wieder umdrehen und Gottfried König seine blöde Rede einfach fortsetzen möge.
Dieser Moment dauerte sicher nur wenige Sekunden, fühlte sich jedoch wie ganze Stunden an, aber dann faselte mein Chef weiter, als wäre nichts gewesen.
Puuuh. Glück gehabt.
Ich fokussierte meine Aufmerksamkeit auf meine liebe Bürokollegin Vanessa, deren breites Grinsen quasi vom einen zum anderen Ohr reichte und schon beinahe beängstigend wirkte mit ihren gebleichten, ultrageraden Zähnen. Wie sehr ich diese dumme Kuh hasste. Das Schlimmste an der ganzen Situation war noch nicht mal die Missachtung meines Vorgesetzten mir gegenüber, vielmehr war es PKP, der es überhaupt nichts ausmachte, sich in dem Rampenlicht anderer zu suhlen wie ein Ferkel, das noch vor seinen Geschwistern die beste Schlammpfütze für sich ergattern konnte.
Ich entschuldige mich für die derbe Ausdrucksweise, aber am liebsten hätte ich ihr meine halb verdauten Weihnachtsmarktpommes in die Fresse gekotzt.
Gerade achtete jedoch niemand auf sie und ihre grinsende Fratze, weil alle an den Lippen von Herrn König hingen, die schließlich tatsächlich Worte formten, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen.
»Da ich Sie nicht allzu sehr mit meinem Geplänkel langweilen möchte, komme ich nun auch allmählich zum Ende. Jedoch gibt es im kommenden Jahr noch zwei personelle Veränderungen, die ich gerne bekannt geben möchte. Wie viele von Ihnen bereits bemerkt haben dürften, ist mein Sohn Matheo von seinen Auslandsstudien zurückgekommen.«
Ja klar, Auslandsstudien, von wegen, dachte ich.
»Matheo wird von mir eingearbeitet und im Sommer der Nachfolger meiner Position, auch wenn ich nicht gerne zugebe, dass ich das Rentenalter nun so langsam erreicht habe … Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam meinen Sohn. Ich hoffe, dass Sie alle so freundlich und loyal zu ihm stehen werden wie zu mir.«
Matheo erklomm leichtfüßig die Stufen der Treppe, bis er direkt neben seinem Vater stand, der ihm lächelnd auf den Rücken klopfte.
Mein Herz stolperte, als ich ihn dort stehen sah, mit seinem anerkennenden Lächeln, das er in die klatschende Menge warf.
»Ich danke Ihnen«, sagte er mit freundlichem Gesichtsausdruck. »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen von Ihnen und kann es kaum erwarten, mich in alle Prozesse einzudenken. Ich wünsche Ihnen nach dem Ende dieser entsetzlich langen Rede meines Vaters« – liebevolles Knuffen gegen Matheos Arm seitens der angesprochenen Person, kurze Lacher aus dem Publikum – »eine schöne Weihnachtsfeier und werde gleich eine Menge Spaß dabei haben, die ersten Bekanntschaften zu knüpfen.«
Zwinkerte er PKP zu? Augenrollend verschränkte ich die Arme vor der Brust.
»Ja, ja, ich komm jetzt gleich zum Schluss«, schaltete sich Gottfried König wieder ein. »Eines möchte ich jedoch noch erwähnen und dann dürfen Sie sich über unser festliches Essen im Ballsaal hermachen. Da unser Personalchef im November in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, freue ich mich nun, Ihnen die Person vorstellen zu dürfen, die die offene Stelle besetzen wird. Begrüßen Sie bitte ebenso eifrig wie meinen Sohn den neuen Personalchef von King’s Fashion …«
Im Nachhinein glaubte ich fest daran, dass er diese dämliche Kunstpause nur für mich einlegte, als er nach einem langen Atemzug den Namen »Lars Behrens!« von der Treppe rief.
Kapitel 5
Die Welt blieb stehen, da war ich mir ganz sicher. Für einen Moment bewegte sich nichts mehr, kein Vorhang flatterte, kein Kleidungsstück raschelte, kein Glas klirrte. Nur Lars Behrens hatte die Fähigkeit, Raum und Zeit zu überwinden und die Stufen zu seinem Vorgesetzten zu erklimmen. Zuerst sah ich nur seine Rückenansicht: ein dunkelblaues Sakko, das im Schein des elektrischen Lichts beinahe schwarz wirkte. Es war ein wenig tailliert, wodurch seine breiten Schultern betont wurden. Obwohl ich ihn nur von hinten sah, wusste ich intuitiv, dass er seinen jugendlichen Charme und das gute Aussehen nicht verloren hatte. Warum ich mir dessen so sicher war, konnte ich nicht erklären, doch ich hatte Angst vor der Welle der Erinnerungen, die sich gerade am Rand meiner Seele wie ein gewaltiger Tsunami auftürmte.
Als er Herrn König erreicht hatte, drehte er sich um. Beinahe wie in Zeitlupe bekam ich Stück für Stück mehr von Lars zu sehen und musste feststellen, dass er sich tatsächlich kaum verändert hatte. Seine Haare wellten sich noch immer in diesem samtenen Kastanienbraun um seinen Kopf. Vor etlichen Jahren hätte ich meinen rechten Fuß geopfert, bloß, um ein einziges Mal meine Finger in den Strähnen zu versenken und sie auf meiner Haut zu spüren. Die Konturen seines Gesichtes waren nicht mehr so jugendlich, sondern hatten die kantigen Züge eines erwachsenen Mannes angenommen, und sein Kinn sowie die Wangen wurden von einem kräftigen Bartschatten umrahmt. Sein großgewachsener Körper steckte in einem perfekt zu ihm passenden blauen Anzug, wobei das weiße Hemd aussah, als sei es professionell in der Reinigung gebügelt worden, so glatt war es. Auf seinen Lippen breitete sich ein offenes, sympathisches Lächeln aus. Niemand hätte vermutet, dass sich dahinter jemand verbarg, der seine Klassenkameradin einst gequält und ihre verletzliche Seele noch kaputter gemacht hatte, als es ihrem Zuhause bereits gelungen war. Wie auch? Er sah aus wie ein Engel. Brav, gut, unschuldig.
Die Zeitlupe war vorüber, als Gottfried König erneut das Wort ergriff. Diesmal war es, als hätte jemand die Vorspultaste des Videorekorders gedrückt. Der Rest der Ansprache mitsamt der Begrüßungsfloskel des neuen Teammitgliedes gingen in einem kraftvollen Quietschen unter und alle Bewegungen flogen in doppelter Geschwindigkeit an mir vorüber. Sektgläser wurden hinuntergestürzt, der Begrüßungsapplaus dauerte nur wenige Atemzüge und die Models, die ich extra für eine interne Präsentation der besten Kleidungsmodelle des Jahres gebucht hatte, rannten die Treppe des Foyers wie bei einem Marathon erst hinunter und dann wieder hinauf.
Lars Behrens hatte sich derweil zu Gottfried und Matheo König gesellt, die von PKP, Rouven Hilberstedt, Vincent und ein paar anderen Kollegen flankiert wurden. Lars warf den Models bewundernde Blicke zu, lachte und schien Rouven Komplimente zum Einfallsreichtum der Kollektion zu machen. Er lebte im Hier und Jetzt und amüsierte sich voller Leichtigkeit mit Personen, die er erst an diesem Abend kennengelernt hatte, während ich mich in meine Vergangenheit zurückversetzt fühlte, in die ich mit einem harten Faustschlag katapultiert worden war. Ich stand plötzlich nicht mehr im Foyer der Hauptverwaltung von King’s Fashion, sondern auf dem Pausenhof meiner alten Schule am Rande von Berlin Kreuzberg. Überall gab es kleine Grüppchen, die die Köpfe zusammensteckten, Tratsch austauschten, sich über Lehrer und den Stundenplan beschwerten oder Pläne für den freien Nachmittag schmiedeten. Nur ich stand am Rande des Geschehens mit meinem Butterbrot, das ich mit den Händen zu verdecken versuchte, damit niemand die großen Löcher bemerkte, die daher rührten, dass ich den Schimmel herausgeschnitten hatte.
Ich hatte nie irgendwelche Freunde gehabt. Wenn ich gewusst hätte, was ich falsch machte, dann hätte ich es sofort geändert. Doch ich hatte nicht gelernt, auf Leute zuzugehen und mich zu öffnen, weil mein Stiefvater mir eingebläut hatte, dass ich keinesfalls nach außen tragen durfte, was sich bei uns zu Hause abspielte. Von klein auf war es so abgelaufen. Ich hielt mich fern, baute keine Beziehungen auf und vertraute niemandem. Stattdessen stand ich abseits des Schulhofes, fernab von der Mensa, damit mir die Essensgerüche nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen konnten. Ich tauschte mich mit niemandem über irgendetwas aus und hoffte die gesamte Pause hindurch, dass die Zeit schnell vergehen mochte und ich mich wieder auf meinen Platz im Klassenraum setzen durfte. Wenn der Unterricht lief, wurde ich in der Regel in Ruhe gelassen und es wurden mir keine hässlichen Kommentare an den Kopf geworfen, die sich so tief und unwiderruflich in meine Seele schnitten wie eine Kerbe, die in einen Echtholztisch geritzt worden war.
An diesem Abend fühlte ich mich an genau solch eine Pause erinnert. Überall Grüppchen, Menschen, die sich gut verstanden, unterhielten und lachten, während ich in einer Ecke des Raumes wartete und die Situation betrachtete.
Ich war eine Beobachterin des Geschehens, aber wurde nie Teil dessen. Oft starrte ich die Schüler um mich herum an, zweifelsohne immer in der Hoffnung, sie würden mich nicht bemerken, denn sonst war eine Mobbingattacke vorprogrammiert. Ich war fasziniert davon, wie leicht es ihnen zu fallen schien, mit ihren Mitmenschen Kontakt aufzubauen, Witze zu reißen und sich fallen zu lassen. Das musste ein sehr angenehmes und befreiendes Gefühl sein. Ich konnte mich noch gut an Lars erinnern, der seine Pause fast immer in der Nähe der Raucherecke verbracht hatte. Seine Freunde und er hatten sich dort eine Bank gesichert, die sie mit frechen überheblichen Sprüchen vor Fünftklässlern verteidigten. Lars war immer derjenige gewesen, der seinen Arm um die Schultern eines Mädchens aus der Parallelklasse gelegt und sie mit doofen Sprüchen zum Kichern gebracht hatte. Es war kein normales Lachen, sondern stets dieses kokette Quietschen, das mir damals sehr albern vorgekommen war. Heute wusste ich, dass es die ersten Flirtversuche der beiden gewesen waren. Sie hatten es aneinander geübt und konnten nun im Erwachsenenalter auf eigenen Beinen stehen, was das anbetraf. Ich hingegen hatte so was nie erlebt und lief schon rot wie ein Schneewittchenapfel an, wenn nur das Wort Penis irgendwo fiel.
»Hey, Luise!«
Ich schüttelte den Kopf, um diese seltsamen Gedanken zu vertreiben, und richtete meine Aufmerksamkeit auf die Person, die ihre Hand auf meinen Oberarm gelegt hatte. Es war Betti aus der Rechnungsabteilung, die Zahlenfee aller Zahlenfeen.
»Ich dachte schon, du drückst dich vor der Feier«, sagte sie lachend. »Ich habe dich eben schon gesucht, aber da warst du unauffindbar.«
»Echt? Ich stand die ganze Zeit hier«, erwiderte ich mit einem halbherzigen Lächeln.
»Ist alles gut bei dir? Du siehst so blass aus. Oder hast du dich gut abgepudert, damit der Chef dich eher gehen lässt?«
Ich schüttelte den Kopf. Schminke war nicht so mein Ding. »Du weißt doch, wie das läuft … Ich dürfte die Weihnachtsfeier erst dann eher verlassen, wenn man mich mit den Füßen voran auf einer Trage hier raus wuchten müsste, weil mein Herz den Geist aufgegeben hat.«
Betti lachte. »Da hast du wohl recht. Aber ohne dich würde der Laden zusammenbrechen. Also hast du dir ein paar Drinks auf die Kosten des Hauses mehr als redlich verdient. Und deshalb werden wir die Rechnung des Chefs jetzt mal ordentlich in die Höhe treiben.«
»Aber wenn ich den Überblick verliere, wird irgendwas schiefgehen, denn auf PKP kann ich mich nicht verlassen«, gab ich zu bedenken.
Betti hakte sich bei mir unter und zog mich in Richtung Treppe, wohin sich auch die Menge bewegte, denn das Buffet und die Bar waren im Ballsaal aufgebaut worden. Die Modenschau war vorüber, sodass damit der letzte offizielle Programmpunkt abgehakt war und nun der ausgelassene Teil der Festivität beginnen konnte.
»Jetzt komm schon, lass dich mal gehen. Selbst du hast eine Pause nötig«, meinte Betti bestimmend.
Mehr oder minder widerwillig ließ ich mich von ihr mitziehen. Sie hatte ja recht. Wenigstens eine kleine Auszeit hatte sogar ich verdient. Oder … Nein. Besonders ich hatte das verdient. Immerhin war es meinem organisatorischen Talent zu verdanken, dass sich hier alle den Wanzt vollschlagen und genügend Alkohol trinken konnten. Das hatte ich alles ganz allein auf die Beine gestellt.
Der Ballsaal der Villa war für kleinere Events jeglicher Art der perfekte Ort. Es war ein großzügig geschnittener Raum, der sich fast über die gesamte Grundfläche des Gebäudes erstreckte und somit allen Angestellten genügend Platz zum Sitzen, Stehen oder Tanzen bot. Sogar die Raucher kamen auf ihre Kosten, da nach hinten raus ein rechteckiger Balkon über den Stadtgarten ragte und deshalb niemand extra nach unten vor die Tür gehen musste. Ich hatte es den Lungenquälern so bequem gemacht, wie es im Winter nur möglich war. Ich hatte Decken auslegen und zwei Heizpilze aufstellen lassen, sodass niemand frieren musste.
Die Fenster ragten hier nicht bis ganz auf den Boden, beeindruckten dennoch durch ihre überdimensionale Größe und waren von samtroten Vorhängen umrahmt, die von goldenen Kordeln mit ausladenden Quasten zusammengehalten wurden. Der Boden glänzte noch immer im originalgetreuen Fischgrätenparkett, auf das Gottfried König sehr stolz war und deshalb großen Wert auf die angemessene Pflege zum Erhalt legte. Die Wände waren in einem sanften Eierschalenweiß gestrichen und wirkten im Vergleich zum Rest des Raumes recht schlicht. Der pompöse Kronleuchter, der von der Decke hing, machte das jedoch wieder wett und zog so gut wie jedes Mal die Blicke aller Besucher auf sich, die den Ballsaal zum ersten Mal betraten. Der Name der Familie König passte nicht nur gut zur Glamourösität des Raumes, sondern unterstrich diese Eigenschaft sogar. In diesem Saal hätten echte Könige gekrönt werden und Prinzessinnen ihre Hochzeitsfeiern ausrichten können.
»Zwei Martini, bitte«, orderte Betti, nachdem wir uns auf den Barhockern niedergelassen hatten, die allesamt noch frei waren, weil die meisten sich entweder aufs Buffet stürzten oder den Balkon aufsuchten, um eine Zigarette zu rauchen.
»Also, Herzchen, jetzt erzähl Mama doch mal, wo die Sorgenfalte auf deiner Stirn herkommt. Wenn du mich weiterhin so anschaust, muss ich befürchten, dass dein hübsches Gesicht so stehen bleibt.«