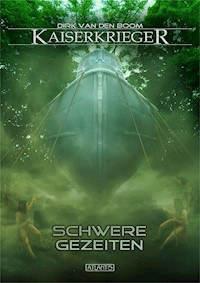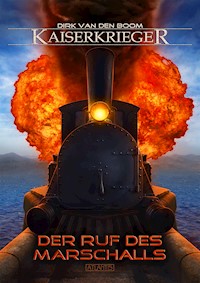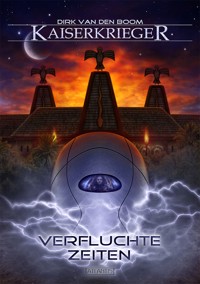
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Angriff Baekyes auf die Verbündeten Roms erreicht eine neue Phase und das Schicksal der Welt steht nun auf dem Spiel. Der Konflikt tobt nicht nur an den verschiedenen Fronten, auch im Land des Diktators selbst spitzt sich die Situation zu, als ein heftiger Kampf um die Nachfolge des Geliebten Marschalls entbrennt. Und als die Zeitreisenden versuchen, den Urheber für das entsetzliche Chaos ausfindig zu machen, stellen sie fest, dass sie sich auf niemanden verlassen können - nicht einmal auf ihre eigenen Nachfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
1
Sie erfuhren von der schrecklich schönen Nachricht, als sie das Dorf bereits verlassen hatten. Der Geliebte Nachfolger, mit gefasstem Gesicht, dem man die Gefühle nicht entnehmen konnte, ließ die Kolonne anhalten, kletterte selbst aus seinem Fahrzeug, die Gattin an seiner Seite. Es war plötzlich gekommen, ohne Ankündigung, wie es oft bei diesen Ereignissen ist, doch es war ein dermaßen großes Unglück, dass es sie alle wie ein Schock traf. Die Bediensteten und Soldaten stellten sich am Straßenrand auf, sahen sich ratlos an, verschämt fast, nervös aber ganz sicher, soweit dies durch die wundersame Selbstbeherrschung erkennbar wurde, derer sich alle stets befleißigten. Latinus sah, dass große Besorgnis und Unsicherheit jeden erfasst hatten, mehr als nur eine Irritation oder ein Fragen. Das Unglück lag in der Luft.
Dabei gab es dafür doch erst einmal gar keinen Anlass, denn die letzten Tage waren für jeden treuen Anhänger des Regimes ganz ordentlich gewesen. Sogar mehr als das. Ein Triumph eigener Art, eine Abfolge erfolgreicher Taten, Ergebnis guter Vorbereitung und größter Einsatzbereitschaft.
Der Besuch im Dorf war perfekt abgelaufen. Die Bewohner hatten dem Nachfolger zugejubelt, er hatte eine Rede gehalten, nicht so lang, wie wohl alle befürchtet hatten, dann Geschenke verteilt, sehr großzügig dazu, ebenfalls mehr als erwartet, schließlich verdiente Bürger mit Orden geehrt. Seine Frau war vorgestellt worden und war von den Menschen mit Freude akzeptiert worden, was gewiss vor allem an ihrem respektvollen Auftreten sowie den unbestreitbaren körperlichen Reizen lag. Gesagt hatte sie nichts, durfte nicht, stand im Schatten ihres Gatten, wo sie nach der Meinung der Mehrheit wohl auch hingehörte. Dann, nach einem Tag des Aufenthalts, war die Kolonne wieder aufgebrochen, hatte sich unter dem Jubel der Dorfbevölkerung auf die nächste Etappe gemacht. Da man die Ressourcen des Dorfes für den Besuch bis an die Grenzen belastet hatte, waren viele gewiss insgeheim froh, dass der Nachfolger nicht länger blieb, und ihm dankbar, dass er ihre Gastfreundschaft nicht noch mehr strapazierte. Es wurde sehr viel und sehr inbrünstig gewunken, als sich die Kolonne wieder in Bewegung setzte, und zwar so lange, bis das Dorf wirklich für jeden aus dem Blickfeld verschwunden war. Bereits jetzt empfand Latinus die Reise als mühsam und seine Dienste waren bislang vom Nachfolger auch nicht in Anspruch genommen worden. Er ließ es sich natürlich nicht anmerken.
Dann dieser ungeplante Halt, mitten im Nirgendwo. Es gab die Straße, links und rechts Reisfelder, ein paar Bäume, einen Entwässerungsgraben. Kaum jemand weit und breit zu sehen, von den Teilnehmern des Konvois einmal abgesehen, die jetzt alle so dastanden. Einige, unruhige Gesellen, scharrten mit den Schuhen über die Backsteine der Straße, alle bemüht, sich auf das Unerwartete vorzubereiten, ein wie immer unmögliches Unterfangen.
Der Nachfolger hatte neben seinem Fahrzeug gewartet, bis alle versammelt waren und ihn erwartungsvoll ansahen. Dann erklomm er die schmale Metallleiter, die es ihm ermöglichte, auf das Dach des Wagens zu klettern, von wo aus er von allen gesehen und vor allem gehört wurde. Latinus kam nicht umhin, die gleiche gespannte Erwartungshaltung zu empfinden, die jetzt alle ergriffen hatte. Niemand glaubte an eine spontane Propagandarede. Es war tatsächlich etwas passiert und der Römer ahnte bereits, was das sein konnte.
Er wusste mehr als die anderen. Und die Zeit war wohl gekommen.
Der Nachfolger sprach, laut und klar. Er hatte genug Übung für diesen Moment, dennoch klang seine Stimme belegt, fast mit der Andeutung eines Zitterns. Ob gespielt oder nicht, es war ungewöhnlich.
»Ich habe soeben über den Kurzwellensender im Funkwagen einige Nachrichten erhalten, die ich niemandem vorenthalten werde, vor allem deswegen nicht, weil es unsere Reise beeinflusst. Diese Nachrichten verkünde ich euch mit schwerem Herzen, wohl wissend, dass die Konsequenzen uns alle betreffen werden. Dies ist ein schrecklicher Tag, dies ist ein schrecklicher Moment. Wir werden ihn nie vergessen und er wird auf immer auf uns lasten. Hört denn alle gut zu. Zwei Dinge wurden heute bekannt, die ich hiermit, meiner Pflicht entsprechend, bekannt gebe.«
Er machte eine Kunstpause. Latinus hörte sehr aufmerksam zu, obgleich er sich von Antonov alles leise flüsternd übersetzen lassen musste. Der Nachfolger sprach flüssig, ohne Aussetzer, ohne Versprecher. Der Diplomat konnte sich irren, aber bei ihm wurde dadurch der Eindruck erweckt, dass der Mann diese Rede vorbereitet hatte, geprobt und ausformuliert, und die nunmehr eingetretenen Ereignisse ihn keinesfalls überraschten, er zumindest auf die Eventualität vorbereitet war, auf seine Weise. Bei einer gewissen möglichen Neuigkeit, deren Inhalt der Römer erahnte, konnte Latinus das gut nachvollziehen. Aber dass es gleich zwei seien, erschütterte seine Voraussage ein wenig. Was war denn noch?
Der Nachfolger holte tief Luft. Es schien, als würde er für einen Moment schwanken, aber das war gewiss nur Einbildung. Als er aber sprach, hatte sich seine Stimme doch erkennbar verändert, klang erstickt, hatte ein sanftes Vibrieren, eine Unsicherheit im Ton, als kämpfe der Mann mit seinen Gefühlen. Latinus verschloss sein Gesicht. Er hatte recht. Er wusste, was jetzt kam. Und er ging bei allem Verständnis davon aus, dass der Großteil der Trauer, die gerade ausgedrückt wurde, nur gespielt war.
»Mein Vater. Euer Vater. Der Vater der Nation, der Geliebte Marschall, die Sonne Baekyes, ist nicht mehr. Er ist tot. Die Ahnen haben ihn zu sich genommen, in allen Zeiten.«
Der Nachfolger schluchzte. Er trug dick auf. Latinus erwartete ein peinlich berührtes Schweigen, eine betretene, in sich gekehrte Stille, alle achtsam darauf bedacht, nicht die falschen Gefühle zu zeigen. Letzteres war gewiss nicht falsch, aber es war dennoch anders, als der Römer erwartet hatte. Es war eher so, als hätten diese Worte die Fluttore eines Damms geöffnet und es gäbe kein Halten mehr.
Keine Stille. Das Gegenteil.
Sie alle weinten. Und eigentlich war das eine Verniedlichung, denn der Ausdruck des Schmerzes, der nun öffentlich wurde, ging über sanfte Tränen der Trauer weit hinaus.
Latinus starrte sie an, die gut ausgebildeten Soldaten, die Hofschranzen und Diener, denen perfekte Selbstbeherrschung zur zweiten Natur geworden war, deren Selbstdisziplin ohne Fehl und Tadel sein musste, wollten sie zur Entourage des Nachfolgers gehören.
Er sah sie weinen. Es war keine dezent weggedrückte Träne, kein sanftes Schluchzen, diskret, aufgewühlt zwar, aber würdevoll.
Es war die völlige Auflösung. Es war hysterisch.
Tränen, ja, aber auch: in sich zusammensinkende Körper, erzitternd vor Leid und Qual. Erstickte Laute des Leids, entrungen aus in Verzweiflung geöffnetem Mund. Die Augen weit aufgerissen, die Hände in erschütterndem Leid in die Luft gestreckt. Lang gezogene Schreie, tief aus der Brust, als ob sich dort, ausgelöst durch die Nachricht des Sohnes, ein lange angestauter Strom der Sorge Bahn gesucht hatte. Latinus sah Männer in Uniform, 30 Jahre und älter, unter der Last dieser plötzlichen Überwältigung zusammenbrechen. Nicht ihre geliebte Frau, kein eigenes Kind war gegangen, kein hochverehrter Vater oder die fürsorgliche Mutter, es war ein Staatsführer, ein ferner, durch Propaganda bis zur völligen Unkenntlichkeit in eine lebende Statue verwandelter Mann, der halb ein Gott, halb eine durch endlose Schichten an Legenden entrückte Person gewesen sein musste.
Vielleicht doch ein Vater. Vielleicht ein echter Gott, nur ein sterblicher, der sie nun verlassen hatte. Der Verlust war ein realer, doch wie real waren die hier in völliger Entfesselung ausgedrückten Gefühle? Latinus wusste, was religiöse Hysterie war, er war ihr in seinem Leben schon mehrmals begegnet, von stiller, glasiger Entrückung bis hin zu ekstatischer Hingabe, alles, worin sich ein wahrer Gläubiger, angetrieben durch heilige Worte oder den eisernen Wunsch nach Erlösung, hineinsteigern konnte. Das hier war nicht anders, es war sogar extremer, denn es war Projektion eines Schmerzes, der größer, überwältigender zu sein schien als jede spirituelle Verzückung.
War es echt?
Das war die Frage und Latinus konnte sie nicht eindeutig beantworten. Er sah, wie die Leidenden sich heulend auf dem Boden wälzten, das Gesicht in den Dreck drückten, sich mit Fäusten auf den eigenen Schädel hieben. Selbstverletzungen wurden als adäquates Mittel der Verzweiflung angesehen. Nägel fuhren durch die Haut, schürften sie ab, bis Blut austrat. Die Schläge, die sich manche versetzten, waren nicht nur Schauspielerei, wie die blauen Flecke und die aufgesprungene Haut bewiesen. Hier wurde Schmerz durch Schmerz potenziert, wie eine Art von Läuterung – oder eine Strafe dafür, dass sie alle das Unmögliche nicht hatten verhindern können, als ob sie allesamt verantwortlich für den Tod des Marschalls wären. Latinus sah, wie sie den Nachfolger laut beschwörend baten, das Unglaubliche, das Unfassbare ungeschehen zu machen, als sei er ein Hohepriester, der die Macht habe, die Toten wieder ins Leben zu erwecken. Doch der Nachfolger stand da, still, reglos wie eine der Statuen, die zu seinen Ehren überall im Lande errichtet wurden, die Augen umwölkt von der eigenen Trauer.
Alles nur Schauspiel?
Latinus schaute hin, selbst konzentriert auf die sparsamsten Bewegungen seines Körpers, wollte weder respektlos sein noch anderweitig auffallen. Er war sich nicht sicher. Dies konnte nicht nur einstudiert, eingeübt und konditioniert sein. Da war ein genuines Leid in diesen Menschen, die so nahe am Machtapparat Baekyes gelebt hatten, näher am Machtzentrum als die allermeisten Untertanen des Marschalls. Sie mussten gleichzeitig größere Einblicke in die Wahrheit gehabt haben wie auch in besonderer, disziplinierter Weise eingebunden sein in das System aus Strafe und Belohnung, das Heilsversprechen des Marschalls und die aus seiner Hand ausgeteilte Verdammnis.
Das war nicht nur ein »als ob«. Da war etwas, was weggebrochen war, eine Stütze, die viele dieser Menschen ihr ganzes Leben begleitet hatte. Eine magische Person, aus der Zeit auf sie hinabgekommen, Katalysator für revolutionäre Veränderungen, mehr als ein Sterblicher. Jemand, der doch eigentlich nicht einfach starb, einfach so, ohne Ankündigung. Vielleicht hatten sie den Marschall nicht so geliebt, wie es Vorschrift gewesen war, manche Begeisterung nur geheuchelt. Aber sie alle mussten spüren, dass eine neue Epoche angebrochen war, eine echte Zeitenwende, denn der Gründer ihres Staates, aus dem Nichts in ihr Leben getreten, der ihnen allen neue Größe und einen Sinn gegeben hatte – gegeben, aufgedrückt, eingebrannt, es war wohl egal –, der war nun tot. Was würde werden? Wohin würde die Reise gehen?
Was war vom Nachfolger zu erwarten?
Den gleichen Gedanken musste der neue Marschall hegen, als er mit bedrückter Miene auf seine leidenden Untertanen blickte. Was erwartete man von ihm? Wie weit war er frei in seinen Entscheidungen oder schon so sehr Teil des Systems, in das er hineingeboren war, dass sein Vater, obzwar verstorben, mit kalter Hand aus dem Jenseits weiterhin seine Schritte lenken würde? Gedanken, die auch Latinus umtrieben, denn sie würden sehr unmittelbare Auswirkungen auf die Allianz haben, auf Rom und seine Verbündeten.
Latinus würde nicht den Fehler machen, Mitleid mit ihm zu empfinden. Seine Worte waren sorgfältig einstudiert gewesen, seine Haltung Teil einer Trauerchoreografie. Der Zustand seines Vaters war dem Sohn natürlich absolut bekannt gewesen. Er hatte Zeit und Gelegenheit gehabt, sich vorzubereiten, und dieser Prozess, der nun begann, war ein Theaterstück, zu dessen letztem Akt er den Thron des Vaters besteigen würde und aus dem Nachfolger tatsächlich in Vollendung der neue Marschall wurde.
Der Sohn hob erneut beide Hände. Lautstärke und Intensität der Trauer wurden dadurch etwas geringer, völlige Stille aber kehrte nicht ein. Genug saßen immer noch mit nassem Gesicht auf dem Boden, einige starrten vor sich hin, als hätte ein tiefer Schock sie vollständig gelähmt.
»Und jetzt vernehmt dies: Noch müssen wir diese Nachricht für uns behalten! Üble Kräfte lauern in den Schatten, Untreue und Verrat haben den Marschall stets umgeben! Ehe wir nicht in die Hauptstadt zurückgekehrt sind und die Dinge vor Ort in die Bahnen lenken können, die mein Vater uns in die Herzen gelegt hat, wollen wir daher Stillschweigen bewahren. Gebt ihr mir dieses Versprechen?«
Ein vielstimmiger Ruf der Zustimmung erklang. Soldaten salutierten. Alle wirkten sehr entschlossen. Der Nachfolger aber war noch nicht fertig.
»Unser geliebter Anführer ist von uns gegangen. Ich teile euren Schmerz. Aber er hat uns noch ein Geschenk mit auf den Weg gegeben, eine letzte aus seiner Güte und Einsicht geronnene Weisung, ein Akt seiner Menschenfreundlichkeit, seiner Weitsicht, seiner Klugheit und seines Genies. Noch auf dem Sterbebett galt seine ganze Aufmerksamkeit, sein Streben und Denken alleine dem Wohle Baekyes, wie es von Anbeginn seiner Herrschaft gewesen ist. Das soll uns ein Trost sein, so schal er angesichts der Tiefe unserer Trauer auch heute zu sein scheint. Diese letzte Weisung, die uns der Marschall mit auf den Weg gab, ist mir, ist euch Aufruf und Treueschwur zugleich, und wir wollen unser Leben hinlegen, um seine letzten Worte durch unsere Taten mit einem heiligen Feuer der Entschlossenheit zu erfüllen! Ich erhielt diese Nachricht des Aufbruchs, der Hoffnung und der Zuversicht zur gleichen Zeit wie die über sein Ende.«
Die Sprache des Nachfolgers hatte etwas Beschwörendes angenommen und das verfehlte seinen Eindruck keinesfalls. Er hatte die Aufmerksamkeit aller und Latinus gehörte natürlich dazu. Einige wischten sich bereits die Tränen aus den Augen, im Blick neue Hoffnung und Entschlossenheit. In dieser Kolonne dienten nur die ganz Fanatischen oder die ganz Zynischen, ein Dazwischen dürfte es bei dem hier versammelten Personal nicht geben.
»Und so hört die unsterbliche Weisung unseres Geliebten Marschalls, von ihm gegeben mit seinem letzten Atemzug, bis zu seinem Tod bereit, das Wohl aller im Blick zu haben: Voranschreiten sollen wir auf dem Weg der Nation! Mit aller Kraft und im Bewusstsein unserer zivilisatorischen Mission erklärt Baekye heute und mit aller Entschiedenheit dem Persischen Reich, dem Reiche von Aksum, dem Land Teotihuacán und dem Imperium der Römer den totalen Krieg!«
Und dann gab es Jubel. Wieder Tränen, diesmal der Freude. Latinus aber starrte auf den Nachfolger. Ja, er hatte es kommen sehen. Rom wusste, dass der Zeitpunkt eines Tages da sein würde, aber ihn zu erleben, quasi aus erster Hand, das war … etwas anderes.
Der Rubikon war überschritten. Hier waren mehr als ein paar Würfel gefallen, hier waren Wagenladungen auf den Boden geprasselt. Formal bestand dieser Kriegszustand natürlich bereits, ergab sich aus dem Bündnis mit dem schon länger angegriffenen China, aber jetzt hatte Baekye endgültig alle Zügel losgelassen, alle Vorsicht beiseitegeschoben, jetzt war das ausgebrochen, was der Römer nur als Weltenbrand, als Weltkrieg bezeichnen konnte. Dem Römer schwindelte vor der Tragweite dieser Erkenntnis und vor den Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden. Dies konnte nur bedeuten, rein praktisch, dass die Armeen Baekyes jetzt in Persien einmarschieren würden – und die andere Front in Mittelamerika wäre gewiss die nächste, auch wenn die dort versammelten Streitkräfte weitaus kleiner waren als alles, was sich nun in Asien in Bewegung setzen würde.
So vermischten sich bei den Zuhörern Freud und Leid. Auch der Nachfolger hatte jetzt eine andere, wohlstudierte Maske aufgesetzt. Wo sein Antlitz soeben noch von Gram umwölkt gewesen war, wirkte er nun entschlossen, vorwärtsgewandt, den Blick zum Horizont erhoben, in dem er wohl den endgültigen Sieg in dieser globalen Auseinandersetzung erwartete.
Das bedeutete nur eines. Er wollte in der Tat den Weg seines Vaters weitergehen. Wer auch immer, Latinus inklusive, die sanfte Hoffnung in seinem Herzen getragen hatte, dass sich die Dinge unter dem Sohn ändern würden, war nun eines Besseren belehrt. Ja, auch er hatte offenbar diese irrationale Vorstellung tief in sich genährt, anders war das plötzliche Gefühl der Enttäuschung, das ihn nun befiel, kaum zu erklären.
Latinus drückte sich an einen der Wagen. Er wollte nicht gesehen werden. Er wollte im Grunde auch nichts mehr sehen oder hören. Es war alles ganz bedrückend und schrecklich, und wo die Worte des Nachfolgers, der kein Nachfolger mehr war, Begeisterung auslöste, rührten sie bei ihm einen Cocktail aus Angst und Verzweiflung an. Ein Weltkrieg. Das schien nun unausweichlich. Welch ein schreckliches Schicksal für alle, egal wer am Ende obsiegen würde. Er sah hoch zu dem jungen Mann, der sich nun frenetisch mit Beifall belohnen ließ, und dachte an das, was ihm angeboten, ja aufgetragen worden war.
Ihn zu töten. Es war nicht gesagt, dass es danach besser werden würde. Schlechter aber offenbar auch nicht mehr. Vielleicht war dies als Auslöser nun genug, genug, die Entscheidung reifen zu lassen. Er musste auf den richtigen Zeitpunkt warten. Er würde dabei sterben, diese Gewissheit drängte sich ihm mit großer Wucht auf. Die Konsequenzen waren ungewiss. Aber wenn er nur etwas Sand ins Getriebe werfen konnte, war vielleicht schon viel erreicht. Latinus wappnete sich. Er war Soldat. Das war der Feind.
Jetzt brauchte es nur noch die richtige Zeit und den richtigen Ort.
Latinus hielt inne. Ihm kam ein Gedanke, entsprungen aus Angst und einer natürlichen Bequemlichkeit. Warum sollte er der Täter sein? Der Marschall war tot. Gewiss ging in der Hauptstadt jetzt so einiges vor sich.
Es konnte gut sein, dass ihm jemand die Last dieser Tat abnahm …
2
Die Sonne ging unter über Rom. Adrianus, Kaiser des Imperiums, hatte die letzten Minuten damit verbracht, auf das Bild zu starren, dass die kaiserlichen Porträtmaler von seinem Großvater erschaffen hatten. Ein gutes Porträt. Die Malerei hatte nach der Ankunft der Zeitenwanderer einen beispiellosen Aufschwung genommen. Bei den Bildhauern hatten die Deutschen nichts zu melden gehabt, da war die römische Meisterkunst unübertroffen. Aber dreidimensional wirkende, lebensechte Porträts, da hatten einige nur durchschnittlich begabte Zeichner der Saarbrücken erstaunlich viel Wissen vermittelt, das anschließend von deutlich begabteren Römern übernommen und verfeinert worden war. Eigentlich war das etwas, was einem zukünftigen Zeitalter namens Renaissance vorbehalten gewesen war, aber die diversen Zeitreisen hatten den vorherbestimmten Gang der Dinge furchtbar durcheinandergebracht, sonst wäre Adrianus nicht hier. Möglicherweise würde es niemals eine Renaissance geben – oder es würde eine geben, aber dabei mit völlig anderen Themen und Entwicklungen. Der Imperator war der Auffassung, dass sich die menschliche Geschichte am Ende immer selbst heilte und das ereignen ließ, was sich auch ereignen muss. Eine naive Vorstellung, ja, und keine, die auf rationalen Argumenten beruhte, gleichzeitig aber eine beruhigende.
Adrianus schaute auf das Gemälde. Thomasius – oder eigentlich Thomas Volkert – war zu früh verstorben, wie viele bis heute dachten, unter anderem auch sein Sohn, der Vater von Adrianus, der den Purpur zwar nicht unvorbereitet, dennoch mit dem Widerwillen eines Mannes empfangen hatte, der sich sein Leben etwas anders vorgestellt hatte. Adrianus’ Widerwille war nicht ganz so groß gewesen, aber in einer Zeit der Krise dieses Amt anzutreten, machte keine Freude, würde weiterhin keine Freude machen und das schlug sich auch auf sein Gemüt nieder. Sein Großvater schaute ihn weder anklagend noch auffordernd an, sein Blick war auf allen Gemälden in die Ferne gerichtet, als erwarte er dort eine Offenbarung oder Erlösung. Nicht einmal im spirituellen Sinn. Wie sein Sohn und sein Enkel war Thomasius ein Mann gewesen, der der Religion Respekt, aber keine richtige Verehrung entgegengebracht hatte.
Adrianus seufzte. Er klagte nicht, jedenfalls nicht allzu laut. Die Umstände waren, wie sie waren, und er hatte immerhin sein Pflichtbewusstsein vom Vater geerbt, wenngleich sonst möglicherweise nicht ausreichend seiner positiven Eigenschaften und Charaktermerkmale. Adrianus fühlte sich, als wäre sein Leben ein ständiger Marsch bergauf. Nicht wie beim guten Sisyphos verbunden mit der Erkenntnis, dass jeder Fortschritt unausweichlich in einem Scheitern enden musste, aber der Gipfel erschien stets unerreichbar. Es waren nicht nur Felsbrocken nach oben zu rollen, es wurden auch Steine in den Weg gelegt. Ein Problem war gelöst, zwei neue erschienen, zwei Schritte ging es nach vorne, einen wieder zurück. Es war diese Ruhelosigkeit, die einen den ganzen Tag erfüllte, die ihn so mitnahm. Ständig auf der Hut. Was für eine Katastrophe kam als Nächstes … oder mit welcher Nichtigkeit wurde er jetzt behelligt? Musste ein Imperator wirklich so viel selbst entscheiden? Thomasius hatte etwas getan, das er »delegieren« genannt hatte. Das funktionierte aber nur, wenn das System mitspielte. Das System war faul. Es lud gerne Verantwortung nach oben hin ab. Und wer stand da, ganz oben, der alles nur noch auf Gott abladen konnte, der sich bedauerlicherweise nicht so richtig kümmerte?
Da stand der Imperator, nahe am Gipfel. Nie ganz erreichbar. Adrianus war sich nicht einmal sicher, ob er ihn jemals erreichen wollte. Was würde das für ein Gefühl sein, alle Ziele zu verwirklichen? Es war zu befürchten, dass er dann Ausschau hielt nach weiteren Gipfeln, noch höheren, die zu erklimmen sich lohnen würde. Das hörte sich genauso anstrengend an wie seine aktuelle Wanderung. Außerdem war so eine Denkweise für einen Imperator eine gefährliche Sache, da er Macht hatte und nicht alle sein Interesse für neue Höhen zu teilen bereit waren. Es war gut, dass er manchmal keine Lust mehr aufs Bergsteigen hatte. Und je älter er wurde, desto länger wurden diese Phasen der Lustlosigkeit.
Das Porträt stellte trotz aller Kunstfertigkeit seinen Großvater nur akkurat dar, wenn man sehr viel guten Willen oder viel Fantasie aufbrachte – oder über ein verdammt schlechtes Erinnerungsvermögen verfügte. Es war diese Mischung aus idealisierter Darstellung, der Fluch eines jeden Hochwohlgeborenen, wenn es darum ging, aus dem eigenen Antlitz Propaganda zu machen, und der relativ wenig weit fortgeschrittenen Fähigkeit der Maler, dem politischen Willen und damit dem Auftraggeber zu widersprechen. Skulpturen waren kein Problem, niemand erwartete bei ihnen Schmerbäuche und krumme Beine, das gehörte sich einfach nicht. Es gab auch davon mehr als genug, genauso idealisiert, aber ohne dass sie beim Betrachten das Gefühl auslösten, dass irgendwas nicht stimmen konnte, irgendeine Linie, ein Winkel, eine Perspektive falsch war, auch ohne dass man sogleich den Finger auf den Makel zu legen imstande war. Bilder hatten eigentlich einen anderen Anspruch, fand Adrianus. Aber er machte sich nichts vor. Die Porträts seiner selbst waren auch nicht akkurat.
Das Bild jedenfalls zeigte nicht seinen Großvater, sondern ein Symbol. Der Imperator als Symbol. Der Mensch, der hinter das Amt zurücktrat, oder vielmehr das fleischgewordene Amt. Das Bild war Teil der ewigen politischen Erzählung von Staatsführern, ihrem Ruhm, ihrer Weisheit, mithin der Unfehlbarkeit, die alle annahmen, die jedoch niemand jemals erreichen konnte. Diese Erzählung war unausweichlich, sie war untrennbarer Teil des Systems, wie Dampf, der durch die zahlreichen Zuleitungen einer Dampfmaschine zischte und ohne dessen Allmacht und Allgegenwart sich kein Kolben jemals rühren würde. Sein Vater hatte sich auch auf diese Erzählung eingelassen, weil sie Teil seiner Aufgabe war, etwas, das von ihm erwartet wurde. Adrianus erinnerte sich daran, dass er seinem Vater manchmal dabei zugesehen hatte, wie er geduldig den Bildhauern und Malern Modell stand, unbeweglich, in festliche Gewänder gehüllt, während im Hintergrund Offizielle ihm Depeschen aus allen Provinzen des Imperiums vorgelesen hatten, damit seine kostbare Zeit auf keinen Fall verschwendet erschien. Der Sohn hatte sich schnell gelangweilt und die Freiheit gehabt, sich zu verabschieden. Diesen Luxus gönnte sich Adrianus nicht. In der Geschichte Roms hatte es bisher exakt einen Kaiser gegeben, der in den Ruhestand gegangen war: Diokletian. Es hatte nicht gut funktioniert, alles in allem.
Damals, als kleiner Junge, hatte Adrianus den langen Vorträgen aus den Depeschen und Meldungen gar nicht bewusst zugehört. Erst später, als er selbst mit den Inhalten administrativer Pflichten betraut worden war, hatten sich Erinnerungsfetzen in sein Gehirn geschlichen. Das war mitunter sehr hilfreich gewesen, konnte er doch dann informierter erscheinen, als er tatsächlich war – und damit die eigene Erzählung von Kaiser Adrianus, dem Herrscher mit dem fantastischen Gedächtnis, beginnen. Nun war er genauso unausweichlich gefangen wie sein Vater und er fühlte sich wahrscheinlich genauso unwohl dabei wie er. Es gab allerdings kein Entkommen. Er war das Amt, das Amt war er. Er konnte den Zwängen genauso wenig entfliehen wie der Verantwortung und das, was seine Eltern ihm vermittelt hatten, war ein moralisches Korsett, dem er sich niemals würde entledigen können. Und angesichts der Umstände schien es, als würde ihm das Schlimmste noch bevorstehen.
Adrianus drehte sich um. Unweit von hier war die Terrasse, angelegt von seinem Großvater, einer seiner liebsten Orte. Langsam schritt der Enkel den Gang entlang, öffnete die gläserne, mit einem Gitter durchzogene Tür nach draußen. Es war angenehm kühl und die Gerüche der Metropole, nicht immer die angenehmsten, zogen nach oben.
Er schaute über Rom, über das sich die Abendsonne senkte. Auf einem kleinen Tisch stand seine abendliche Karaffe mit Wein, daneben ein Glas. Er goss sich ein, eine fast schon rituelle Handlung, hob das Glas nach oben, schaute hindurch. Die Terrasse des Palastes war noch gut ausgeleuchtet und der rote Wein im Kristallglas schimmerte verheißungsvoll. Adrianus’ Arbeitstag war noch nicht am Ende und er würde nicht mehr trinken als dieses eine Glas. Jeden Moment konnte sein Gast gemeldet werden und es stand zu befürchten, dass diese Begegnung bis in die frühen Morgenstunden dauern würde. Keine fröhliche Feier, keine gesellige Nacht, sondern eine der Sorgen, der Planungen, der Vorbereitungen und der Ungewissheiten mächtiger Herrscher, deren scheinbare Autorität nur zur Konsequenz hatte, dass ihre Unfähigkeit, in die Zukunft zu sehen, sich besonders fatal auswirken konnte.
Er nahm einen Schluck. Ein erlesener Tropfen. Eine der Vorzüge seines Amtes: der beste Wein in Rom und darüber hinaus. Er gönnte sich ja sonst nichts. Ein zweiter Schluck und …
»Der König ist eingetroffen, Herr!«
Adrianus hatte gar nicht bemerkt, dass sein Leibdiener eingetroffen war. Der Mann schlich wie eine Katze und es war gut, dass er ihm vertrauen konnte. Flavius hätte sonst schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, seinen geistig abwesenden Imperator umzubringen. Der ältere Mann war dazu absolut in der Lage: Er hatte seine Stellung nach 18 Jahren Dienstzeit in den Legionen erhalten. Nach einer schweren Beinverletzung, die ihn humpeln ließ, war er durch Familienverbindungen in den Dienst des Palastes getreten und hatte sich durch stille Kompetenz und Zuverlässigkeit hochgearbeitet. Dass er immer noch den Dolch und das Schwert führen konnte, davon ging der Imperator fest aus, denn aus irgendeinem Grund hatte der Diener nicht ein Gramm Fett am Leib und seine Bewegungen waren trotz des Humpelns – vielleicht auch gerade deswegen – kraftvoll und sicher. Für Adrianus war er ein zusätzlicher Leibwächter, er vertraute dem Mann blind. Und er vergaß nie einen Termin. Das wiederum war sehr schade.
Adrianus schaute bedauernd auf sein Glas. Es sollte wohl nicht sein.
»Danke, Flavius. Wir sollten …«
»Ich habe Wein und eine Kleinigkeit im Arbeitszimmer serviert. Wenn größerer Hunger besteht, ist die Nachtschicht in der Küche bereit, wenn die Müdigkeit siegt, sind die Unterkünfte bereitet. Das Feuer im Kamin brennt auch. Wenn Ihr etwas benötigt …«
Er benötigte so vieles, dachte Adrianus, als er lächelnd den Kopf schüttelte. Leider war Flavius in keiner Position, ihm seine tatsächlichen Wünsche zu erfüllen.
»Nein, wir haben dann alles. Es wird länger dauern. Eine Kanne Kaffee wäre gut, am besten auf dem kleinen Fliesenofen.«
»Steht schon bereit, Herr.«
Selbstverständlich. Er hätte einfach den Mund halten und Flavius seine Arbeit machen lassen sollen. Aber auch ein Kaiser musste sich hin und wieder durch angemessene Anordnungen in Erinnerung bringen. Auch er dachte an Dinge. Auch er war vorbereitet. Autorität musste in Worte gekleidet werden, in großen wie in kleinen Dingen.
Adrianus nickte und folgte seinem Leibdiener in das kleinere, aber sehr behaglich eingerichtete Arbeitszimmer, das noch von seinem Vater als solches designiert und in moderner Form dekoriert worden war. Auch hier zeigte ein Fenster in Richtung Stadt und bot einen schönen Ausblick, aber dominiert wurde der Raum durch einen Schreibtisch, eine Wand voller Bücher, eine zweite Wand mit einer ständig aktuell gehaltenen Karte des Imperiums und seiner Nachbarn und einer Sitzecke mit einer breiten Couch und zwei Sesseln, in denen auch seine Vorgänger manches vertrauliche Gespräch geführt hatten.
Adrianus war als Kind immer sehr gerne in diesem Zimmer gewesen. Oft hatte er hier spielen dürfen, während sein Vater am Schreibtisch saß und endlose Berge von Dokumenten durchging. Seine Erinnerungen waren durchweg positiv und so hatte er nach Amtsantritt nur wenig verändert. In keinem anderen Raum des Palastes wurde ihm eindringlicher bewusst, auf wessen Schultern er hier stand.
Alles war vorbereitet, wie Flavius es versprochen hatte. Es war angenehm warm, aber nicht stickig. Die Sessel sahen zu einladend aus. Kaffee. Da stand die Kanne.
»Herr!«
Sein Gast kam an. Adrianus verscheuchte die Erinnerungen.
Ouzebas II., König von Aksum, wurde in den Raum geleitet. Der Mann war in den letzten Jahren sichtlich gealtert, er gehörte zu einer Generation, die es in vielen Gegenden der Welt gar nicht mehr unter den Lebenden gab. Sein Vater hatte noch Thomasius gekannt, den ersten Imperator aus der Gruppe der Zeitenwanderer. Wie alt musste er sein? Adrianus wagte es nicht, ihn zu fragen, er würde wahrscheinlich auch nur eine kryptische Antwort erhalten. Der Aksumite hielt sich kerzengerade, aber in seinem vormals makellos schwarzen Haar hatte sich sehr viel Weiß gemischt, ebenso wie in den perfekt gepflegten Backenbart. Die lange Reise aus seiner Heimat musste ebenfalls Spuren hinterlassen haben, wenngleich sie nicht mehr ganz so viel Zeit beanspruchte wie früher: Zwei Luftschiffe der Imperialen Luftflotte verbanden die beiden Hauptstädte in regelmäßigem Linienverkehr. Wenn eines in Aksum startete, flog das andere in Rom los und so war ein steter Austausch an Personal für Botschaften, die militärische Kooperation und die wichtigen Handelsbeziehungen möglich. Ouzebas war natürlich mit einem Sonderflug gekommen. Die Luftflotte Aksums befand sich erst im Aufbau, sodass hier erneut eine freundliche Geste Roms für rasche Beförderung gesorgt hatte. Leider war der Herr von Aksum, dessen unbestreitbare Qualitäten allen bewusst waren, kein Freund der Luftfahrt, vor allem sein Magen nicht. Er fügte sich in das Unvermeidliche, von der gleichen Disziplin erfüllt wie Adrianus, aber Freude empfand er dabei gewiss nicht. Wie oft würde der alte Mann noch auf eine solche Reise aufbrechen? Adrianus erinnerte sich an die traurige Pflicht, genauere Erkundigungen über die zahlreichen Prinzen Aksums einzuholen, um eine Idee dafür zu bekommen, wer künftig regieren würde. Der Tod des persischen Königs hatte ihn schmerzlich daran erinnert, wie schnell es zu einem solchen Wechsel kommen konnte, aus mehr oder auch weniger natürlichen Ursachen.
Der König Aksums war erst vor rund zwei Stunden gelandet und hatte wenig Zeit gehabt, sich auszuruhen. Dass Flavius nur einen kleinen Imbiss angerichtet hatte, war der Erkenntnis geschuldet, dass Ouzebas derzeit noch nicht in der Lage war, größere Festessen zu sich zu nehmen. Adrianus war das nur recht. Er aß ohnehin zu viel, vor allem wenn er unter Druck stand – also fast immer.
Und das Falsche.
Es war ein Kreuz.
»Wie war die Reise?« Adrianus musste fragen. Es war mehr als reine Höflichkeit. Sein Gast war alt. Er machte sich ernsthaft Sorgen um ihn. Unter anderen Umständen hätte er nicht akzeptiert, dass der alte Mann diese Strapaze auf sich nahm. Aber die Umstände waren … drängend.
»Oh, erstaunlich gut«, kam die etwas unerwartete Antwort. Der Aksumite setzte sich in einen Sessel und warf den aufgebauten Köstlichkeiten einen abwägenden, aber keinesfalls feindseligen Blick zu. Sein Blick blieb länger als einen Moment auf den kandierten Früchten hängen. Die besondere Leidenschaft seines Gastes für diese Süßigkeit war Flavius selbstverständlich bekannt gewesen. »Ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen und bin todmüde in meine Kabine gewankt. Augen zu und durch. Ich habe vom ganzen Flug nichts mitbekommen, obgleich es zwischendurch etwas windig gewesen sein soll. Das hat sehr geholfen. Deswegen bin ich jetzt auch sehr frisch.« Er sah Adrianus prüfend an, lächelte schwach. »Ihr auch, geehrter Imperator?«
»Der geehrte Imperator hat eine Kanne aksumitischen Goldes bestellt«, erwiderte dieser und wies auf den silbern schimmernden Behälter auf dem Kachelofen. »Sollte ich erschlaffen, wird mir diese Segnung Gottes über mein körperliches Tief hinweghelfen.«
Sein Gast lächelte nun breiter. Aksum war nicht zuletzt durch den Export der Kaffeebohne zu einem sehr wohlhabenden Land geworden. Eine gute Kaffeebohne, von Meisterhand geröstet, war zwar nicht ganz mit Gold aufzuwiegen, aber es fehlte nicht viel.
»Zu viel davon ist auch nicht gut«, sagte der alte Mann warnend.
»Das sagt mein Leibarzt auch immer. Doch was hilft es?«
Ouzebas nahm von den kandierten Früchten. Sein Widerstand hatte wirklich nicht lange vorgehalten. Die Zuckerschale zerbarst unter seinen Zähnen, als er eine in den Mund schob und für einen Moment hörte man nichts als knirschende Geräusche. Adrianus erinnerte sich an den Wein, den er immer noch halb ausgetrunken in der Hand hielt, und nahm einen Schluck. Er hatte in seinem Gast keinen Gegner, aber auch der König Aksums war bei aller Freundschaft durchaus auf seinen Vorteil bedacht. Es war nie eine gute Idee, in einer solchen Situation dem Alkohol zu sehr zuzusprechen. Kaffee war in dieser Situation die weniger verhängnisvolle Droge der Wahl. Er stellte das Glas ab. Genug davon.
»Ich habe trotz aller Erschöpfung noch die aktuellen Berichte gelesen, um mich auf unser Zusammentreffen vorzubereiten«, sagte der Imperator schließlich und damit begann der ernste Teil ihrer Diskussion. »Ich möchte nicht lange herumreden, auch angesichts der fortgeschrittenen Stunde. Wir sind beide zu alt für durchwachte Nächte.«
Der König nickte bestätigend.
»Wann rechnen wir mit dem Beginn der Invasion?«, fragte Ouzebas. »Meine Generale haben dazu eine klare Meinung, bedauerlicherweise jeder seine eigene.«
Die beiden Männer erlaubten sich ein leises Lachen.
»Für unsere persischen Freunde hat sie mit dem Angriff auf Persepolis bereits begonnen, auch wenn die Grenzen ansonsten stabil zu sein scheinen«, meinte Adrianus dann, der mit diesen Worten sehr schnell wieder ernst wurde. »Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Luftangriff war ein Test, eine Erkundung mit großer Macht. Das führt man nicht durch, wenn es nicht Teil eines größeren strategischen Plans ist. Meine Generale sind sich genauso uneins, aber keiner rechnet damit, dass es länger als drei Monate dauern wird, bis es richtig losgeht. Der neue persische König übrigens auch nicht. Einer mit Verstand und Entschlusskraft, wie ich ergänzen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Agenten Baekyes sich mit dem Attentat auf den alten Yazdegerd einen Gefallen getan haben. Unser gemeinsamer Freund war schon sehr müde geworden. Ich hätte ihm noch viele Jahre gewünscht, aber jetzt … jetzt könnte sich sein Tod sogar noch, auf zynische Weise, als Glücksfall erweisen.«
Er hob die Hände in einer Geste der Entschuldigung, doch der Aksumite winkte ab.
»Ihr habt in der Tat den Zyniker in Euch entdeckt, edler Imperator. Das Leben macht einen dazu, nicht wahr? Er ist mein steter Begleiter seit vielen Jahren. Keine Entschuldigung notwendig.«
»Nur unter Freunden. Man sollte damit nicht an die Öffentlichkeit treten. Es wird leicht als Defätismus missverstanden und nichts wäre weiter entfernt von der Wahrheit als das.«
Ouzebas nickte. »Drei Monate also. Nun, wir in Aksum sind so bereit, wie wir bereit sein können. Die Streitkräfte sind mit modernen römischen Waffen ausgerüstet. Wir haben die gemeinsame Militärdoktrin gelernt und geübt. Ich kann nicht behaupten, dass wir begierig sind auf diesen Krieg. Es gibt an meinem Hof jene, die sagen, dass wir uns heraushalten sollen, da Baekye uns bestimmt nicht angreifen werde. Das sind natürlich Narren. Leider ist es wie mit dem Zynismus: Ich darf es ihnen nicht offen und geradeheraus sagen, was sie für Idioten sind.«
Adrianus verkniff sich eine Antwort. Es gab einige Individuen in seinem Umfeld, die ebenfalls eine Strategie vorzogen, die daraus bestand, den Kopf in der Erde zu begraben und ansonsten zu beten, dass alles nur ein böser Traum sei. Er hatte durchaus Verständnis für dieses Wunschdenken und in seinen dunklen Stunden überkam ihn der Drang, es genauso zu handhaben. Glücklicherweise wachte er aus diesen Stunden schnell wieder auf und sah die Dinge, wie sie waren – und dass die sich weder auflösten noch anderweitig zu verschwinden gedachten. Es waren schwierige Zeiten. Viele Nachrichten prasselten auf einen hinab. Überall sich anbahnende Katastrophen. Man konnte sich das irgendwann nicht mehr anhören und auf alles gleichermaßen besorgt und aktiv reagieren. Es wurde zu viel, das Gehirn schloss dann zu und warf den Schlüssel weg. Adrianus hatte das bei sich beobachtet und mit großer Sorge verfolgt. Er musste auf sich und jene im Praetorium, seinem militärischen Lagezentrum, gut aufpassen, denn wenn der Schlüssel einmal weg war, fand man ihn möglicherweise nicht so schnell wieder. Und so ein Schloss mit Gewalt aufzubrechen, das war eine große Verschwendung von Kraft, die sie anderweitig benötigten.
»Wir haben zwei zusätzliche Legionen nach Persien in Marsch gesetzt«, sagte er dann in sachlichem Tonfall. »Das war eine einfache Entscheidung, da wir sie ohnehin an Bereitstellungsräumen nahe der Grenze zu Rom stationiert hatten. Ansonsten stärken wir noch einmal unsere Grenzanlagen, aber das ist mehr ein symbolischer Akt. Seit es Luftschiffe gibt und seit Baekye bewiesen hat, was es damit anfangen kann, benötigen wir eine andere Art der Verteidigung. Wir haben verschiedene Szenarien im Blick, aber auch hier kann ich nur bestätigen, dass die Generale sich uneins sind.« Er seufzte, vielleicht ein wenig zu theatralisch. »Am Ende hängt es natürlich bei uns.«
Ouzebas beugte sich nach vorne. Diese Aussicht schien ihn nicht weiter zu bekümmern. »Wir werden diesen Krieg möglicherweise nur dadurch gewinnen, dass wir alle zusammenstehen und hart kämpfen. Das wird aber Hunderttausende, vielleicht mehr als eine Million Tote zur Konsequenz haben, von den langfristigen Folgen ganz zu schweigen. Ein über Jahre währendes Ringen, wie es unsere Freunde in China kennen und erleiden. Wir dürfen uns nicht alleine auf diesen Weg versteifen. Es muss noch andere Möglichkeiten geben.«
»Ich höre.«
»Ich habe die römische Geschichte studiert – und unsere eigene. Es gab in beiden Fällen immer wieder Möglichkeiten, gegnerische Truppen mit anderen Mitteln als nur der Macht der Waffen dazu zu bewegen, ihre Loyalitäten infrage zu stellen. Bestechung hilft manchmal zum Beispiel sehr, das Versprechen auf eine andere, eine bessere Zukunft. Etwas, mit dem man Leute dort berührt, wo sie empfindlich sind – oder empfänglich. Das muss kein Gold sein, obwohl Gold bestimmt hilfreich ist.«
Ouzebas lächelte, als er das spontane Kopfnicken seines Gesprächspartners sah. Der Imperator hatte dagegen in der Tat wenig einzuwenden – vom Prinzip her. Rom hatte schon immer sein ungesundes Maß an Korruption gekannt, sowohl im Umgang mit Feinden als auch mit Freunden. Leider gab es auch Offizielle, die sich dieses Mittels bedienten. Früher war die Ernennung zum Provinzgouverneur ein Freifahrtschein gewesen, um sich durch allerlei Mittel während der Amtszeit die Taschen zu füllen. Thomasius hatte damit Schluss gemacht und nicht nur Freunde dadurch gewonnen.
»Den Feind bestechen?«, echote Adrianus. »Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert.«
Ouzebas zeigte zur Kaffeekanne. Der Imperator erhob sich ohne Scheu. Den alten Freund zu bedienen, gereichte ihm zur Ehre. Der Aksumite sprach derweil weiter, wohl wissend, dass Adrianus immer noch gut zuhörte.
»Jeder hat etwas, wonach er sich sehnt – und nicht bei allen ist es die Todessehnsucht. Wir haben die Dinge, die uns wichtig sind oder die uns fehlen. Ich gebe zu, nicht alles kann man kaufen und je nach Persönlichkeit sind wir manchmal besser und manchmal schlechter gegen Versuchungen gewappnet. Gold ist ja nur ein Beispiel. Das funktioniert nicht bei jedem. Aber unsere Feinde sind viele. Es sind bei aller scheinbaren Gleichförmigkeit doch Individuen. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, was der Marschall, was die offizielle Politik Baekyes möchte. Wir haben uns bisher nur am Rande mit der Frage befasst, was die Leute eigentlich wollen, die für ihn ins Feuer gehen.«
»Die Tatsache, dass sie für ihn ins Feuer gehen, weist darauf hin, dass er ganz gut im Bereich Motivation tätig ist. Er hat sich entweder die gleiche Frage gestellt wie wir hier oder er hat den einfachen Weg gewählt.«
Adrianus ahnte, worauf sein Amtskollege hinauswollte, und er räumte ein, dass diese Idee wert war, weiterverfolgt zu werden. Er hatte aber gewisse Zweifel, dass ihnen das jetzt und hier von Nutzen war, zumindest als unmittelbare Reaktion auf die Zuspitzung der militärischen Krise.
Ouzebas runzelte die Stirn. Er nahm den Kaffee entgegen, trank langsam und vorsichtig, obgleich das Getränk nicht mehr zu heiß war. Er sog den Duft mit einem lauten Schnaufen ein. Selbst wenn man nicht so müde war, schärfte das Getränk die Sinne. Oder es verschaffte zumindest für einige Minuten die Illusion.
»Der einfache Weg?«, fragte er dann nach, da Adrianus geduldig auf ihn gewartet hatte.
»Er hat ein Bedürfnis erschaffen, selbst festgelegt, und dieses dann erfüllt. Das ist fast schon die perfekte Vorgehensweise, da er damit alles im Griff hält, einen geschlossenen politischen Kreislauf erschafft. Es hat seine Gefahren, aber durch die Zeit gereist zu sein und eine kleine Armee mit sich zu führen, hilft natürlich sehr dabei, sich Gehör zu verschaffen. Die Frage ist nun: Wenn man so etwas selbst erzeugt und erdacht hat, womit kann man diesen Riegel um die Köpfe der Menschen durchbrechen? Mit Gold? Vielleicht bei einigen. Mit der Verlockung auf Frieden? Nach allem, was wir wissen, lockt der Marschall exakt damit – aber mit einem Frieden, dessen Bedingungen er vorher definiert hat, sodass jede andere Lösung wie eine Niederlage oder Schmach schmecken muss. Ein Frieden, der in seinen Versprechungen zu einem Paradies führen wird, in dem die Bürger Baekyes die Welt beherrschen und sie von allen bedient und respektiert werden. Nicht irgendein Frieden also, sondern ein perfekter Frieden. Mehr als die Abwesenheit von Krieg. Der Himmel auf Erden sozusagen.«
»Eine schöne Vision, aber auch gefährlich, wenn ihre Verwirklichung länger dauert als erwartet. Ermattung kann dazu führen, dass Leute umdenken. Wie lange führt Baekye jetzt schon diesen Krieg? Da müssen doch die Leute irgendwann genug haben.«
Adrianus wog seinen Kopf von rechts nach links.
»Geduld ist nicht ewig strapazierbar, das ist wahr. Es gibt Grenzen, da sind wir uns doch einig.«
»Gewiss, aber hat man je genug vom Siegen?«, fragte der Aksumite zurück. »Hatte Rom jemals die Einsicht, dass es mal damit genug sein musste? Hier noch eine Provinz. Da noch eine Provinz. Etwas präventive Verteidigung. Eine kleine Begradigung der Grenzen.« Adrianus lachte, sagte aber nichts. »Der Erfolg spricht für sich. Siege haben ihre eigene Sogwirkung auf den Geist der Menschen. Sie sind wie eine Droge, die man zu sich nimmt, ein Kraut, das immer wieder einen Rausch auslöst.«
Der Römer nickte versonnen, schickte seine Gedanken in die Vergangenheit, deren Details seine Lehrer ihm mit großer Beharrlichkeit und Sorgfalt zu vermitteln trachteten.
»Wir sind zur Vernunft gekommen, wenn die Umstände uns gezwungen haben – als sich das Schicksal bereits gegen uns drehte, damals, als mit Marcus Aurelius’ Sohn der Niedergang eingeläutet wurde. Da haben es einige verstanden, aber immer noch nur sehr wenige. Ich glaube, bis zur Ankunft der Zeitenwanderer haben es die meisten noch nicht richtig begriffen. Valens gewiss nicht. Gratianus vielleicht irgendwann, wenn er länger gelebt hätte. Theodosius auch nicht, obgleich er späterhin einsichtig wurde und manches überdachte. Nein, wir verstehen historische Prozesse meist erst, wenn sie im Grunde schon abgelaufen sind, nicht, wenn wir mitten in ihnen leben.«
»Und wir bewerten die Gegenwart meist auf der Basis unserer persönlichen Einschätzung der Vergangenheit, nicht auf einer Betrachtung nur der aktuellen Situation«, fügte Ouzebas hinzu und bewies, dass er sich über diese Dinge viele Gedanken gemacht hatte. Der römische Imperator fand, dass sein aksumitischer Gegenpart in alledem recht hatte und er von ihm lernte. Aber er wusste immer noch nicht, worauf das hinauslaufen würde.
»Was tun wir also?«, fragte der Römer. »Diese Gedanken sind sehr interessant und wir sind beide kluge Männer voller Bildung und fähig zum Nachdenken über uns selbst. Wunderbar. Aber das bringt uns den wichtigen Entscheidungen auch nicht näher.«
Der Aksumite lächelte. »Sind wir so wunderbar?«
»Sonst wären wir keine Herren über unsere Länder. Wir müssen wunderbar sein, und wenn nicht, sollten wir uns verdammt noch mal sehr anstrengen, es zu werden!«
Beide Männer lachten leise bei diesen Worten, tranken nun Kaffee, weil es spät wurde und so schwere Gedanken müde machten.
»Wir müssen aktiv werden und nicht nur reagieren«, sagte der Aksumite schließlich. »Wir müssen die Psyche des Gegners erschüttern, um ein Umdenken zu ermöglichen. Wir brauchen etwas in der Hand, eine Botschaft, die die dicke Wand aus Lügen, Propaganda und goldenen Visionen zerbricht oder zumindest eine tiefe Kerbe in sie schlägt.« Ouzebas beugte sich nach vorne, als wolle er, dass die weiteren Worte auf jeden Fall bei Adrianus Gehör fanden. »Wir müssen das tun, wovor wir bisher allesamt zurückgeschreckt haben, wohl in der Annahme, so würden wir das Unausweichliche aufhalten. Ein Irrtum. Und daher ist für mich klar: Wir dürfen uns nicht länger nur verteidigen – wir müssen angreifen.«
Ob es die Haltung seiner Vorgänger in diesem Amt war oder die wachsende Ungeduld über seine eigene relative Untätigkeit und Passivität, in diesem Moment war Adrianus der Ansicht, dass hier sehr wichtige und richtige Worte gesagt worden waren. Ein Gefühl, als würde ein Knoten platzen und sich eine Beklemmung von seiner Brust lösen. Er lächelte.
»Dafür sind die Offiziere in meinem Praetorium noch nicht bereit. Ich kann so etwas nicht einfach so befehlen, wenn alle dem Befehl nur halbherzig folgen und dann einknicken, wenn etwas nicht gleich so klappt, wie es geplant wurde.«
»Nun, sind wir nicht ganz wunderbar? Wir müssen die Generale überzeugen, nicht nur überreden – vor allem nicht überrumpeln. Es ist eine Frage des richtigen Wortes zur richtigen Zeit, edler Imperator.«
»Das ist wohl richtig. Wir sollten uns genau überlegen, was der richtige Ansatz ist.« Adrianus schaute auf die Süßigkeiten. Zucker und Koffein, das war die Mischung, die sie beide jetzt durch die Nacht bringen würde. »Und möglicherweise finde ich jemanden, der mir dabei hilft.«