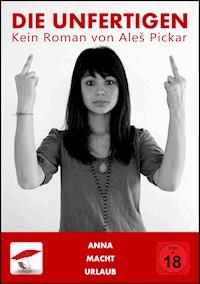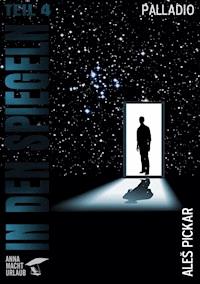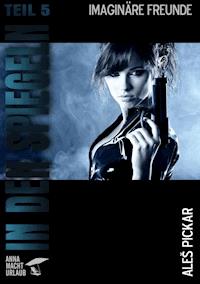4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Neun Götter haben Kalion längst verlassen – nur der Stille Mahner am Firmament zeugt noch davon, dass die Welt einmal eine glücklichere war, bevor der Hochmut der Menschen sie zerstörte. Seit Generationen sind die Völker des rauen Kontinents Neroê zerstritten. Im Norden wütet eine rätselhafte Krankheit. Die verwöhnte Prinzessin Linederion aus dem Ostreich soll an einen fremden Hof verheiratet werden, der gefallene Feldherr Gellen ist auf der Flucht, weil er sein Geheimnis nicht preisgeben kann, die ehemalige Sklavin Nelei will Rache nehmen und die Schwägerin des Königs von Kendaré spinnt Intrigen, um ihren unbeliebten Sohn auf den Thron zu setzen. Doch sie alle ahnen nichts von der dunklen Gefahr, die sich im Westen zusammenbraut … Aleš Pickar erschafft mit KALION ein facettenreiches, geheimnisvolles und vor allem düsteres Epos. Die lautlose Woge ist der Beginn einer Reise in eine rätselhafte und raue Welt und ein spannender Roman, der mit den Normen des High-Fantasy-Genres bricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
periplaneta
ALEš PICKAR: „KALION – 1 Die lautlose Woge“ 1. Auflage, Januar 2017, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege
© 2017 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Ereignissen wären rein zufällig.
Projektleitung, Schlusslektorat: Marion Alexa Müller Coverkonzept, Kartografie, Sprache: Aleš Pickar
Grafik, Satz, Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-95996-032-8 epub ISBN: 978-3-95996-033-5
Aleš Pickar
KALION
DIE LAUTLOSE WOGE
Taranga nesuara
periplaneta
Die Entstehung der Welt
Wir sind die Erben unserer Ahnen. Vieles bleibt uns verborgen, weniges hat die Zeit überdauert. Die einzige Überlieferung, die aus der schemenhaften Dunkelheit unserer Mythen bis in die Gegenwart greift, ist die Geschichte der drei Urgötter. Sie hatten das vorangegangene Zeitalter beherrscht. Ihre Namen – Kerestes, Alamud und Hewed – sind uns erhalten geblieben; über jene Menschen, die sie angebetet haben, wissen wir hingegen nichts. Doch alte Schriften sprechen von einem himmlischen Krieg. Sie berichten, wie alle drei Weltenlenker um die Vorherrschaft kämpften, denn jeder von ihnen war davon überzeugt, dass es für die anderen zwei keinen Platz am Himmelszelt gab.
Am Ende prallten sie in einer entscheidenden Schlacht aufeinander und das nächtliche Sternenzelt erstrahlte heller als der sonnigste Tag. Die drei Urgötter verschwanden, zerschmettert von ihrer eigenen, gebündelten Kraft.
Das Vierte Zeitalter, das eingeweihte Priester auch die Ära des Bleis nennen, ging damit zu Ende. Eine neue Ewigkeit begann, doch nennt man diese Epoche nicht „das fünfte Zeitalter“, denn bei der Zählung der göttlichen Zeit folgt auf die Vier stets die Eins. Dies ist unsere Ära – das Erste Zeitalter, an dessen Ende wir uns befinden und das nun schon viel länger währt, als es unsere Zeitrechnung zu erfassen vermag.
Aus der alles vernichtenden Urgewalt der drei alten Götter, die den Himmel in Feuer tauchte, wurden neue Gottheiten geboren. Wir alle kennen und heiligen ihre Namen: die männlichen – Tianol, Drughal, Saitan, Gatmon; die weiblichen – Täe, Niobe, Klea, Ekaté. In ihrer Mitte die oberste Gottheit in Tiergestalt – unser aller Gebieter Arkron. Und die Neun stiegen herab, um unter den Menschen zu weilen. Kein Gott sollte mehr Menschen wie Spielsteine über ein Brett schieben, ohne Anteil zu nehmen an ihren Nöten und Sehnsüchten.
Das Reich Schankaré wurde von ihnen erschaffen, ein Land von märchenhafter Schönheit, von dem heute niemand mehr weiß, wo es sich befand. Es war ein magisches Reich, in dessen Hauptstadt Bhen Tai – die Nordstadt – der Palast der Tausend Winde von den Neun erbaut wurde. In diesem Tempel standen neun Throne, von denen aus die Götter die Welt regierten. Hier wurde den Göttern geopfert – in ihrer Anwesenheit.
Eine Blütezeit brach an und währte. Doch die Bewohner von Schankaré waren vergiftet vom Wetteifer der alten Götter und schrieben allzu gerne ihre Erfolge sich selbst zu. Sie fragten die Neun immer seltener um Rat, denn die Antworten entsprachen oft nicht dem, was sie hören wollten. Die Menschen flüsterten heimlich, dass ihre Götter überflüssig seien, da einzig der Mensch über die Welt herrschen sollte.
Im Geheimen schmiedeten sie einen Plan zum Sturz der Neun. Sie wollten die Göttlichen auf die Probe stellen. Also schossen sie einen Pfeil auf den Mond, versehen mit einem langen Seil. Die Frevler wollten den Mond einfangen und langsam auf die Erde holen. Sie planten, ihn in nach Bhen Tai zu tragen, in den göttlichen Thronsaal zu legen und zu sagen: „Seht, was wir geleistet haben. Wenn Ihr mächtiger seid als wir, nehmt den Mond und setzt ihn zurück an seine alte Stelle am Himmel.“ Denn niemand hatte jemals die Götter bei der Ausübung eines solchen Wunders erlebt.
Während der Mond immer näher kam, erwies er sich größer als angenommen. Tausende zogen an dem Seil, doch der Mond widerstand und zerrte zurück.
Als schließlich das Seil riss, stürzten die Menschen und die Erde bebte. Bis dahin ungesehene Stürme brachen los und Wellenwogen, so riesenhaft wie Berge, überfluteten nahezu das gesamte Land.
Da traten die neun Götter vor die Tore ihres Palastes und der allmächtige Arkron sprach: „Von diesem Tag an sollt ihr nicht mehr die Segnungen unserer Macht genießen, sondern euch in einem fortwährenden Kampf mit der Natur befinden. Ohne unsere schützende Hand werden eure Frauen in Schmerzen gebären und eure Alten auf allen vieren kriechen. Eure Ernten werden misslingen und erbarmungslose Ungeheuer eure Kinder rauben und schänden. Erst wenn auch der Letzte die Eitelkeit und die Gier in seinem Herzen erkennt und bereut, werden wir zurückkehren. Bis dahin wird euer Leid andauern.“
So sprach Arkron – der affenköpfige Tiergott mit den drei Hörnern und der Oberste aller Götter – und die Neun verließen die Welt. Von da an bewohnten sie das für uns unerreichbare Ipokûn, griffen in des Menschen Schicksal nur noch aus der Ferne ein und wurden uns zu Kals – Geistern.
Noch lange tobten Stürme und Erdbeben. Ebenen erhoben sich und Ebenen versanken. Vier lange Jahre regnete es unaufhörlich und Vulkane spien glühende Asche und alles verschlingende Lava. Über sechzig Jahre sah niemand tagblauen Himmel oder nächtliche Sterne.
Als sich die grauen Wolken zum ersten Mal wieder lichteten, erblickten die Menschen, was sie angerichtet hatten. Verwundet hing nun der Mond am Firmament, näher und gewaltiger denn je zuvor. Geübte Augen sehen immer noch Trümmer um das Gestirn kreisen. So wissen wir den Mond bis heute und deshalb nennen wir ihn den Stillen Mahner.
Schließlich verstummten die Gewalten der Natur und die Überlebenden, die Zuflucht auf den Gipfeln der Gebirge gefunden hatten, kehrten in die Täler zurück.
Seitdem opfern die Bewohner von Neroê zu den neun Geistergöttern in Erwartung der Parata – ihrer Rückkehr. Die Reuigen in Kendaré, Gorkonai, Demené und Tamaré beten täglich zu ihnen. Sie wünschen, dass die Geister zurückkommen, um unter den Menschen zu wandeln und sie mit Rat zu stützen.
Doch die Neun sind ohne Eile und des Menschen Lebensspanne ist nur ein einzelner Schlag ihrer Augenlider.
Das bezeugt jene Zeit, als die Götter noch unter uns weilten. Priester, Edle und Gelehrte streiten nun, ob es von Menschenhand geschaffen wurde, oder unter direkter Einwirkung der Götter. Wie sonst ließe sich die überragende Qualität und der rätselhafte Zweck der Gegenstände erklären?
Im Kalidôr sehen wir die glanzvolle Vergangenheit, nun da wir im Angesicht von Leid und Gefahr leben und rastlos in den Ruinen der alten Welt streifen. Tief in der Erde graben wir nach unserem Glück, doch es sind nur Brotkrumen einst großer Bankette, die wir in den finsteren Minen finden.
Und nicht selten wecken sie nur die alte Gier nach mehr.
Es heißt, dass die Tiefen der Erde noch weitere Geheimnisse bergen. Unten in den Erdspalten, abseits der Fundstellen, soll das DunkleKalidôr liegen. Eine Macht von dämonischem Ausmaß, der kein Magier oder König gewachsen ist. Es ist der todbringende Atem der drei Urgötter. Manche sagen, es sei eine mächtige Waffe, die da tief unter den Bergen ruht, und wer ihrer habhaft wird, könne die gesamte Welt beherrschen. Sie nennen es Argûl katros, die dunkle Wunde.
Doch das ist nur eine Mär, erfunden von den Kalineros, die zu viele Tage ihres Lebens in den düsteren Minen verbracht haben, dazu verurteilt, langsam ihren Verstand zu verlieren.“
„Kalion in Sagen und Legenden“
Gesammelt und kommentiert von Valdan (Original aufbewahrt in der Königlichen Bibliothek von Denroen Tai)
Die Hinrichtung
Gorkonai
Der Wald schweigt nie. Auch in dieser späten Stunde flüsterten und hauchten die Baumkronen und das finstere Dickicht ihre unverständlichen Botschaften.
Gellen stand an der schmalen Fensterscharte in der Wand und lauschte den Stimmen der Tiere und des Windes. Der Waldrand war nicht weit und die Geräusche der Natur drangen bis in seine karge Zelle.
Der einstige Feldherr der gorkonischen Armee war Anfang vierzig und hatte die Zeit im Kerker achtsam gezählt. Heute war der sechshundertvierundzwanzigste Tag. Beinahe zwei Jahre.
Viele der Gefangenen blickten Gellen mit Verachtung an, als wäre er für ihre Haft verantwortlich. Dabei hatten sie selbst einmal Sklaven besessen und der Armee zugejubelt, die den Aufstand der Demenäer niederzuschlagen versuchte. Auch gab es genug Neider, die sich nie damit abfinden konnten, dass Dhedron, die Sonne der Gorkonen, damals einem jungen Mann so viel seiner Gunst gezeigt und ihn in solcher Geschwindigkeit durch die Ränge hatte aufsteigen lassen.
Für die meisten war Gellen der „gefallene Feldherr“, die letzte noch lebende Verkörperung ihrer Niederlage. Er stand für das Versagen des einst so mächtigen Volkes. Für all diese gebrochenen Männer bestand dieses Versagen jedoch nicht darin, dass sie Abscheuliches getan und Menschen wie Tiere behandelt und damit den Aufstand heraufbeschworen hatten. Das Versagen bestand für sie in dem Scheitern, die demenäischen Sklaven nicht besiegt und hartherzig bestrafen zu haben. Und Gellen gaben sie daran die Schuld.
Er blieb somit lieber für sich und hielt sich die meiste Zeit hinter den Gitterstäben seiner Zelle auf. Er hätte zwar nur durch seine Gittertür treten müssen, um in den Innenhof zu gelangen, doch diesen betrat er nur selten. Dies verstärkte nur die ablehnende Haltung der anderen Gefangenen, die hierin Gellens Hochnäsigkeit zu erkennen glaubten. Doch Gellen sah seine Bestimmung nicht darin, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Er wusste, dass früher oder später Fojt, der Gefängniswärter, in seine Zelle kommen würde. Der Tag der Hinrichtung mochte monatelang immer wieder aufgeschoben worden sein, doch zu viele der „neuen Herren“ da draußen sehnten seinen Tod herbei. Er, der letzte große Würdenträger, sollte unter unermesslichen Bauchkrämpfen sterben, während tausende Augenpaare an seinem Gesichtsausdruck hingen. Gellen, der im Verlauf seiner zweijährigen Haftzeit genügend Hinrichtungen erlebt hatte, wusste genau, was ihn erwartete.
Die Demenäer glaubten, eine Seele könne nur durch das Schwert überleben. Sie nannten es Geng Darag, den stählernen Weg. So war es Brauch, verstorbene Angehörige symbolisch mit einem Dolch zu schneiden, zumeist am Handrücken oder an der Wange. Nur so war gesichert, dass die Seele vom Körper schied. Dass sie sich auf dem Weg ins Ipokûn befand. Demenäische Krieger ehrten damit die Feinde auf dem Schlachtfeld. Den gorkonischen Verbrechern widmeten sie keine solche Würde. Ihre Seelen sollten sterben und für immer aus dem Diesseits und Jenseits verschwinden. So bedienten sich die neuen Machthaber einer Hinrichtungsmethode, die von ihren einstigen Peinigern eingesetzt wurde.
Hierbei wurde der Verurteilte mit gestreckten Armen auf eine Holzplatte oder ein Kreuz gefesselt. Ein Henker setzte ihm einen hohlen, kugelförmigen Knebel ein, der auf einem kurzen Stab befestigt war. Die Vorrichtung, die die Gorkonen Kareta genannt hatten, spreizte den Mund weit zu einer lachhaften Grimasse auf. Durch eine Öffnung flößte der Vollstrecker das Gift ein. Anschließend drehte er die hinter den Vorderzähnen klemmende Kugel um ihre Achse, bis die Öffnung nach unten zeigte, direkt in den Rachen des Todgeweihten. Infolge der Gesetze der Natur floss das Mittel aus dem Behälter nicht ab. Erst wenn der Henker auf der Gegenseite einen Verschluss öffnete, ergoss sich das Gift in die Kehle.
Diese Vorgehensweise hatte sich in den „alten Tagen“ großer Beliebtheit erfreut. Sie war wirkungsvoll und sauber. Den Schöpfer der Kareta hatte man für seinen Einfallsreichtum gepriesen.
Für die wütenden Demenäer war eine derart würdelose Hinrichtung der Gorkonen eine mit Ironie und Hohn getränkte Rache, bei der die ehemaligen Sklaventreiber ihre eigene Behandlung zu spüren bekamen. Sie beschimpften sie und sahen belustigt zu, während die Gorkonen langsam unter qualvollen Schmerzen verendeten, und bespuckten anschließend ihre noch zuckenden Körper.
Doch auch Wut verklingt zu müdem Hauch. Trauer schleift sich ab. Und Hass erlahmt unter den Anforderungen des Alltags. Wie die Glut eines Kamins mögen sie noch eine ganze Weile störrisch glimmen. Wenn niemand sie mit neuen Scheiten nährt, erlischt sie. Andere Dinge werden wichtig.
Die Demenäer waren der Hinrichtungen müde. Sie waren es überdrüssig, Menschen bei ihren tödlichen Bauchkrämpfen zuzusehen. So hatten sich in den vergangenen Monaten die meisten Vollstreckungen nur noch im Hof des Gefängnisses ereignet. Vor den zornigen, tränenerfüllten Augen der Häftlinge zwar, doch fern des aufgebrachten Pöbels. Der Kerker lag am südwestlichen Rand von Kanvä und man machte sich nicht mehr die Mühe, jeden Verurteilten in die Stadtmitte zu karren, um dort auf einem der Marktplätze öffentlich sein Leben zu beenden.
Gellen war jedoch sicher, dass sie in seinem Fall eine Ausnahme machen würden. Welcher der demenäischen Räte auch immer den Befehl zu seiner Hinrichtung gab, er würde es nicht versäumen, den großen Feldherren auf eine öffentliche Bühne in Kanvä zu zerren und dem Volk jene Befriedigung zu geben, die ihnen der einstige Herrscher der Gorkonai durch feigen Selbstmord versagt hatte.
Im Kerker hatte Gellen nur einen Verbündeten. Sie nannten ihn Orim Satar – den alten Mann. Seinen richtigen Namen kannte niemand. Im Gefängnis war er der älteste Häftling und genoss allerlei Sonderrechte. So besaß er außerhalb des Zellenblocks ein kleines Laboratorium, in dem er für die Demenäer allerlei Tränke braute, allen voran jenes Gift, das sie verwendeten, um Rache an ihren ehemaligen Herren zu nehmen.
Die Wächter hielten Orim Satar für gänzlich tatterig. Es gab niemanden, der sich an eine Zeit ohne ihn erinnern konnte. Es war, als ob er noch vor dem Gefängnis da gewesen wäre und erst dann die Mauern und Zellen um ihn herum gebaut worden waren.
In letzter Zeit fiel der Greis zunehmend seinen Gebrechen anheim und so kam er immer seltener zu Gellens Gefängniszelle. Für den ehemaligen Feldherrn waren es beschämende, quälende Augenblicke, dem alten Mann zuzusehen, wie er sich über den Hof schleppte – mit beiden Händen den Gehstock umklammernd – und ächzend einen Fuß hinter dem anderen her zog. Hätte man eine Schildkröte neben den alten Mann gestellt, wäre diese durchaus schneller gewesen.
Gellen stand noch immer an der schmalen Fensterscharte und lauschte dem Wald, als der Greis ihn in dieser Nacht aufsuchte. Orim Satar blieb vor seiner Zelle stehen. Er rutschte mühevoll entlang seines aufgestellten Wanderstabs zu Boden und vollendete diese Handlung mit einem tiefen Ächzen. Müde lehnte er sich an den grobgemauerten Türstock. Gellen freute sich über seinen Besuch. Doch beide Männer neigten nicht dazu, diese Freude offen zu zeigen. Hier, an diesem zermürbenden Ort, galt Überschwang als eine Lücke in der Panzerung. Frohsinn behielt man für sich.
Wortlos gesellte sich Gellen dazu. Er setzte sich auf seiner Seite des Gitters so, dass er nur teilweise vom flackernden Licht des großen Turmfeuers beschienen wurde.
„Deine Zeit ist gekommen, Herim“, sagte nach einer Weile der alte Mann mit dünner, brüchiger Stimme.
„Ich wünschte, sie hätten mir ein Lamm und einen Krug Wein gegeben, für jedes einzelne Mal, wenn sie mich für todgeweiht erklärt haben“, wandte Gellen ein. „Wir würden hier jede Woche ein Fest feiern.“
„Fojt hat heute den Todestrank bestellt“, fuhr Orim Satar fort. „Doch wer ist noch da, um den Becher des Todes zu trinken? Außer dir sitzen nur noch Kaufleute und Soldaten hier.“
Der Greis steckte den zitternden Arm durch das Gitter und reichte ihm etwas. Gellen runzelte die Stirn, beugte sich vor und blickte zuerst vorsichtig in den Hof. Doch niemand beachtete sie. So hielt er seine Hand unter die geschlossene Faust von Orim Satar und nahm deren Inhalt entgegen.
„Und wo bleibt das große Tribunal, das sie mir einst versprochen haben?“, fragte Gellen. Er betrachtete das Geschenk in dem unruhigen Licht des Turmfeuers.
„Sie vergiften nicht mehr so viele wie vor einem Jahr“, meinte der Greis. „Sie haben alle großen Namen längst ausgelöscht. Bis auf dich. Doch sie wollen nicht mehr, dass man sich an uns erinnert. Und deine Hinrichtung wird viele Erinnerungen wecken.“
Gellen versuchte, den Gesichtsausdruck des Alten zu erkennen. Im flackernden Schein der Feuer sah dessen Profil wie ein Felsvorsprung aus.
Er öffnete seine Hand und sah erneut die klebrigen Kügelchen an. „Ich soll mir vorher das Leben nehmen, um dem zu entkommen?“
„Was dem einen Gift ist, kann dem anderen Heilmittel sein“, erwiderte der alte Mann. „Die ganze Welt besteht nur aus Stoffen und Flüssigkeiten. Ob sie heilsam oder giftig sind, entscheidet die Menge.“
„Ich erkenne die Beeren. Sie können unmöglich einen milderen Tod bescheren als dein Gifttrank.“
Der Greis lachte leise und klang dabei wie ein alter Karren. „Jeder hier träumt von einem milden Tod“, erklärte er. „Doch du bist Gellen.“ Er neigte sich zu den Gitterstäben und sagte leise mit seiner schnarrenden Stimme: „Nimm die Beeren nicht später ein als eine Stunde, bevor sie dir die Kareta einsetzen. Das eine Gift wird das andere Gift im Zaum halten. Vielleicht lieben dich die Götter und du kannst deinen Tod vortäuschen und später in der Nacht aus einer Leichengrube herausklettern.“
„Weshalb hilfst du mir?“
„Sie haben eine tote Frau gebraucht, um dich anzuklagen. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, warum solltest du es tun?“ Die Worte bereiteten ihm offensichtlich Mühe. Aufs Neue ächzend, stemmte er sich gegen den Stock und kämpfte sich auf die Beine. Dann schlurfte er mit seinem unverkennbaren, schleppenden Schritt davon.
Gellen blickte erneut in die Handfläche. Mondrugan nannte man die Sträucher, auf denen diese Beeren wuchsen, die man Träume des Todes nannte. Sie mussten früh im Herbst gepflückt werden, noch bevor sie reif wurden. In geringer Menge konnten sie Kopfschmerzen vertreiben, in ausreichender Menge waren sie gallig genug, um einen Ochsen umzubringen. Sie lösten Wahn und merkwürdige Sicht aus. Die Einteilung war somit ein Problem.
Am nächsten Tag erfuhr Gellen, dass der alte Mann in seiner Zelle verstorben war. Man hatte ihn in ein Tuch gewickelt und herausgetragen. Die dünne Leiche lag im Hof, direkt an der Außenmauer. Aus dieser Entfernung sah der längliche Stoffballen unnatürlich klein aus, als wäre ein Kind darin eingewickelt.
Fojt kam persönlich in den Hof, um Gellen zu sprechen. Er brachte zwei bewaffnete Wächter mit und behielt dennoch einen sicheren Abstand zu Gellens Gitter.
„Nun gibt es hier niemanden mehr, der dich leiden kann“, spottete der Gefängnisaufseher. Sein hagerer Brustkorb wippte dabei unkontrolliert auf und ab. Er erinnerte Gellen an eine Handpuppe in einem Kindertheater auf dem Jahrmarkt.
Gellen kannte diesen rückgratlosen Speichellecker seit seiner Jugend. Damals hatte Fojt auf dem Hof von Gellens Vaters Mist geschaufelt und in der Scheune die Ziegen belästigt. Nach dem Sklavenaufstand wurde Fojt ein Büttel der Demenäer. Doch das überraschte Gellen nicht. Verrat an den eigenen Landsleuten war in diesen Tagen nicht selten. Fojt aber schien er besonders leicht zu fallen. Vermutlich hasste er sein eigenes Volk, da es ihm niemals die Anerkennung gezollt hatte, die er sich in heimlichen Fantasien ausmalte. Nun befahl er über diese kleine Festung und drangsalierte dort seine Landsleute.
Gellen setzte sich stumm in die Ecke. Er blickte gedankenversunken vor sich hin.
In der Nacht erwachte Gellen durch den Klang von Schritten im Gefängnishof. Er öffnete die Augen und lauschte auf die herannahenden Geräusche. Er nahm den unruhigen Schritt des Gefängnisaufsehers wahr.
Hastig stürzte Gellen in die Ecke der Zelle und entfernte einen losen Stein aus der Wand. Er griff in die dunkle Öffnung und zog einen schmutzigen Tuchfetzen heraus, in dem sich die Mondrugan-Beeren befanden. Gellen steckte sie in den Mund und kaute eilig. Sie besaßen einen reizlosen, leicht bitteren Geschmack.
Doch Fojt ging nicht allein über den leeren Hof. Ohne hinzusehen unterschied Gellen noch einen anderen Schritt, weich und kaum hörbar. Nicht nur erfahren in der Jagd und im Anschleichen, sondern leichtfüßig in seiner eigensten Natur: den Gang einer Frau.
Er richtete seinen Oberkörper auf und blickte sich um. Er konnte ihren Umriss im Schein des Turmfeuers erkennen. Nelei.
Dass sie hier erschien, war nicht gut. Der Gorkone hatte mit einer dem Anlass entsprechenden Hinrichtungstruppe gerechnet. Nicht mit der Frau, die ihn über alles hasste. Fojt hatte oft gewitzelt, das Gefängnis beschütze in erster Linie Gellen. Es beschütze ihn vor Nelei. Doch nun war sie hier.
Gellen wusste nicht, wie lange es dauern würde, bis er eine Wirkung der Beeren spürte. Noch weniger war ihm klar, wie sich diese Wirkung bemerkbar machen würde. Er überlegte, sich schnell die Finger in den Hals zu stecken und die Träume des Todes wieder herauszuwürgen. Doch dafür war keine Zeit mehr. Er konnte nur warten. Träge lehnte sich Gellen gegen die Wand und betrachtete die Demenäerin.
Nelei trug geschmeidige Stiefel und Hosen aus braunem Wildleder. Ihr schwarzer Lederbrustpanzer hatte nicht nur viele Winter erlebt, sondern auch einen Aufstand siegreich überstanden. Die Kratzer und Kerben bezeugten es. Nie trug sie andere Kleidung, nur so kannten alle Nelei Deirea.
Nach der Befreiung verfielen demenäische Frauen geschwind der gorkonischen Mode. Was zuvor als Merkmal der Unterdrücker empfunden wurde, galt nur einen Sommer später als kleidsam. Doch Nelei lebte abseits des alltäglichen Klatsches und des städtischen Zeitgeschmacks. Sie schien keine Freunde zu haben und niemand wusste mit Gewissheit, was sie den gesamten Tag tat.
Nelei blieb kurz vor seiner Zelle stehen. Fojt machte noch ein paar hastige Schritte in übertrieben geduckter Haltung und entfernte die Sperren von dem Gitter.
„Wir machen einen kleinen Ausflug“, verkündete er mit einem schwachsinnigen Grinsen. Nelei schwieg. Wie eine Statue stand sie hinter ihm, beide Hände ruhend auf den Schäften ihrer Schwerter, und wartete, bis Fojt Gellens Handgelenke gefesselt hatte. Der Gefängnisaufseher zog die Kapuze seines langen Mantels über den Kopf und sein Gesicht verschwand beinahe vollständig im Dunkel.
‚Es geht zu Ende‘, dachte Gellen.
Einst hatten gorkonische Gelehrte große Zeitalter und bedeutsame Führer vorhergesagt. Die Gorkonen waren gebildet und für eine Weile machte sie dieser Umstand zu dem überlegenen Volk von Neroê. ‚Wir waren arrogant.‘
Der Kerker hatte ihm zur Einsicht verholfen. Hinzu kam, dass ihn die Strategie der Demenäer beeindruckte. Unerkannt hatten die Sklaven geduldig den passenden Augenblick abgewartet. In demütiger Pose die Jahre, Monate und Tage gezählt. Sich heimliche, verschwörerische Blicke zugeworfen. Bis sie an jenem einen Tag ihre Halsbänder und Ketten abwarfen, während die Armeen der Gorkonai im benachbarten Kendaré in einen hoffnungslosen Krieg verwickelt waren.
Gellens Truppen waren hastig von der Front zurückmarschiert. Sie hatten einige Bergstraßen im Süden des Landes sichern und vor den Toren von Sarangar die Aufständischen sogar zurückschlagen können. Doch vor der Hauptstadt Kanvä hatte sich ihr Schicksal entschieden. Die meisten von ihnen waren an diesem Tag gefallen. Der ruhmreiche Feldherr Gellen war verletzt gefangengenommen worden. Nelei war in jenen Tagen dabei gewesen. Sie war es, die die Hauptstadt eingenommen und dann vor ihm verteidigt hatte.
‚Die Schlacht vor Kanvä war eine Eselei‘, dachte Gellen, während ihn Fojt unsanft auf den Hof stieß und ihn wortlos anwies, Nelei zum großen Tor folgen. ‚Ich habe Männer in den Tod geschickt, die jetzt noch am Leben wären. Wir hätten uns einfach ergeben sollen.‘
In den hundert Jahren ihrer Herrschaft hatten die Gorkonen unzählige Leibeigene ins Land gebracht, als Huren und Leihmütter, Bauarbeiter und Bauern – und die Kenseti-Kämpfer, deren blutige Auftritte sich in Kanvä und Dakara einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuten. Für die Gorkonen waren sie nur Schaukämpfer und raubeinige Athleten. Niemand hätte sich vorstellen können, dass sie unter geeigneter Führung imstande wären, das gesamte Land ins Chaos zu stürzen.
Die Gorkonen hatten die Zeichen der Zeit verkannt. Sie hatten geglaubt, dass nach all den Jahrzehnten in der Sklaverei der Unterworfene jeglichen Gedanken ans Auflehnen vergessen würde. Man hatte angenommen, dass man ihm sogar ein Schwert hätte reichen können und ihm sagen: „Empöre dich!“, selbst dann hätte der Sklave nicht gewusst, was zu tun gewesen wäre. Irrtümer der Vermessenen!
Lange hatte Gellen auf seine Hinrichtung gewartet. Frei von Hoffnung hatte er sich schließlich seinem Schicksal ergeben und war bereit gewesen, das Gift anzunehmen. Doch dann war der alte Giftmischer gekommen und hatte ihm die Träume des Todes gegeben, als griffe eine göttliche Hand in sein Geschick ein. Neue Hoffnung hatte seine mühevoll gepflegte Todesbereitschaft hinweggefegt. Nun schmeckte er den bitteren Nachgeschmack der Mondrugan-Beeren und spürte die Unruhe der Ungewissheit, während er Nelei über den in Flackerlicht getauchten Innenhof folgte. Gellen kannte Nelei Deirea seit ihrer Kindheit. Sie war eine der beiden Töchter von Harada Dei, dem großen Lehrmeister des Kenseti-Kampfsports. Mit großen braunen Mandelaugen hatte sie den Athleten beim Training zugesehen, hinter der Absperrung ihre Bewegungen nachgemacht. Ihr Vater war so berühmt, dass sogar die Gorkonen ihn verehrten, obwohl er „nur“ ein Demenäer war. Der beliebte Kenseti-Lehrer war der Stolz von Kanvä, dessen Bürger ihm für all die Siege, die er der Stadt gebracht hatte, unentwegt Geschenke sandten. Der ruhmreiche Harada Dei mochte zwar ein hochangesehener Schaukämpfer sein, das Brandzeichen auf der Schulter trug er jedoch wie die anderen demenäischen Sklaven.
‚Wären wir wirklich so klug, hätten wir erkannt, dass stolze Kämpfer wie Harada Dei ihre Sklaverei niemals vergessen würden‘, dachte Gellen. Doch obwohl der Blick von den hohen Türmen der Forschung und Philosophie in die Ferne trägt, in das Herz eines Sklaven reicht er nicht.
Vor dem Gefängnistor bestieg Nelei Keiro, ihren schwarzen Hengst, und wartete, bis Fojt ein Seil um Gellens Hals band. Mit einer demütigen Geste reichte der Gefängnisaufseher Nelei das Ende des Strickes, ließ sich eine Fackel bringen und bedeutete den Wächtern, zurück in die Festung zu gehen. Es begann zu regnen und Wassertropfen verzischten in der Flamme.
Nelei stieß sanft die Fersen in die Flanken ihres Pferdes und ritt langsam voran in Richtung des Waldes. Fojt zückte den Dolch und drückte seine Spitze unfreundlich zwischen Gellens Rippen. Gellen lief los und bemühte sich, mit dem Hengst Schritt zu halten.
An ihrem Sattel war eine geladene Armbrust befestigt und für einen Augenblick dachte Gellen daran, nach ihr zu greifen. Seine Hände waren vor seinem Körper gebunden, doch er mochte Glück haben und wenigstens Fojt einen Bolzen durch die Brust schießen. Der Gefängnisaufseher schien diesen Gedanken zu ahnen, denn er drängte sich zwischen ihn und Neleis Pferd und wies Gellen mit der Fackel den Weg. Während der Feldherr dem Pferd hinterher stolperte, betrachtete er Nelei von unten. Sie wirkte abwesend und gedankenverloren. Ob sie es genoss, ihn so an einer Hundeleine in den Wald zu führen? Gellen hatte oft diesen reizvollen Körper bewundert, das spitze Kinn und die geschwungenen Augenbrauen. Ihr Haar trug sie straff zusammengebunden, als würde die Gunst der Männer sie nicht mehr interessieren. Doch gerade das ließ sie noch stolzer und begehrenswerter erscheinen.
Gellen hatte nie viel Freude an höfischen Sitten und gesellschaftlichen Anlässen gehabt. Es lag zum Teil daran, dass ihn die Sprösslinge von alteingesessenen Adelsfamilien für einen Emporkömmling hielten. Doch zum überwiegenden Teil hatte es damit zu tun, dass dies nicht Gellens Wesen war. Er sehnte sich nicht nach Liebeleien mit Adelstöchtern und das Gekicher verzogener Backfische verunsicherte ihn.
‚Nelei wäre die Art von Frau, mit der ich mir ein Leben hätte vorstellen können‘, dachte er.
Es war ein törichter Gedanke, sie in diesem Augenblick zu begehren. Die Beeren verwirrten seine Sinne. Nelei hasste ihn und ihre vor Zorn brennenden Eingeweide sollten erst dann Kühle erfahren, wenn der Gorkone tot war. Er, der ihr das genommen hatte, was ihr am meisten bedeutete.
‚Ich muss es ihr sagen‘, überlegte Gellen. ‚Ich muss ihr klarmachen, dass ich es nicht gewesen bin.‘
Sie kamen auf der vom Regen aufgeweichten, unbefestigten Straße nur langsam voran. Eine merkwürdige Gruppe am Ende der Nacht. Eine Frau zu Pferd und zwei Männer zu Fuß. Einer erbärmlich in Lumpen gekleidet, der andere mit einer knisternden Fackel in der Hand und einer zerfransten kleinen Peitsche am Gürtel.
Auf einmal zog Nelei an den Zügeln und der Hengst blieb stehen. Gellen atmete die feuchte Luft tief ein, bis sie in den Lungen schmerzte. Es war lange her, seit er zuletzt auf dieser Straße gestanden hatte, die Kanvä mit Sarangar verband. Unweit von hier hatte er seinen Vater zum letzten Mal lebend gesehen, als dieser vor den erzürnten Sklaven in das Grenzgebiet geflohen war. Er hatte seinen Sohn angefleht, mit ihm zu kommen.
Nur seines Vaters Kopf war zurückgekehrt und hatte eine Weile auf einem Spieß im Großen Garten von Kanvä gesteckt. Die Demenäer hatten kein Mitleid mit einem reichgewordenen Sklavenhändler. Sie hatten damals Gellen aus dem Kerker gezerrt und ihn einen Tag lang auf den Schädel blicken lassen.
Fojt griff nach dem Zaum des Pferds und hielt es ruhig, während Nelei abstieg. Ihr kürzeres Schwert hing an der Seite. Das längere steckte hinter dem Sattelgeschirr. Nelei zog es langsam heraus und befestigte es an ihrem Gürtel. Dann griff sie nach der Armbrust.
Fojts Blick blieb auf Gellen geheftet, der kurz die Augen schloss und das Flüstern des Waldes in sich aufnahm. Oben in den raschelnden Kronen wandte sich leichter Wind. In der Ferne fauchte eine Wildkatze. Der Himmel war noch immer wolkenverhangen. Der Regen, der die Blätter der Bäume rauschen ließ, hatte aufgehört.
Nelei deutete stumm auf den dunklen, im Fackelschein sichtbaren Pfad, der an dieser Stelle von der Straße tiefer in den Wald führte. Fojt ging mit dem Feuer voran, hinter ihm Gellen und zuletzt die Demenäerin mit der Armbrust in den Händen.
Gellen kannte Neleis Gewandtheit. Der Gedanke, dass er es hier und jetzt beenden könnte, indem er sie zwang, ihn mit der Armbrust zu töten, stieg in ihm auf.
‚Es wäre das Beste‘, dachte Gellen. ‚Hätte mich der alte Mann nicht aufgesucht, wüsste ich genau, was zu tun ist. Wie verwirrend ist doch die Hoffnung, wenn sie in den Verzweifelten entflammt wird.‘
Zu diesem Zeitpunkt fühlte er bereits einen seltsamen Schüttelfrost. Die Dunkelheit des raschelnden Waldes erschien ihm wie der lange Mantel eines Wesens, das ihm etwas mitteilen wollte. Er erkannte, dass die Beeren zu ihm sprachen.
An einem mit Efeu und Moos bewachsenen Fels blieb die Dreiergruppe stehen. Die Bäume wuchsen hier spärlicher und gaben den Blick frei auf eine kleine Lichtung. Die Morgenröte war noch nicht bis zu ihnen vorgedrungen. Der Ort erschien bedrohlich und unübersichtlich.
Fojt zog ein dunkles Fläschchen aus dem Beutel und reichte es Gellen. „Trink das!“, sprach er mit zischender Stimme.
Nelei streckte dem Gorkonen wortlos den in der Armbrust aufgespannten Bolzen entgegen, als erwartete sie Widerstand. Im Augenblick des Todes gleicht jeder Mensch einem in die Ecke gedrängten Biest, das nur einen Instinkt kennt.
‚Ein schäbiger Augenblick am Ende meines Lebens‘, dachte Gellen. Er blickte auf die Fesseln an seinen Gelenken und das kleine Gefäß, das er zwischen den Handflächen hielt. Fojt griff in einen kleinen Beutel, der an seinem Gürtel hing, und zog einen Knäuel aus Lederriemen heraus.
„Ich brauche keine Kareta“, röchelte Gellen. Er kniff die Augen zusammen. Ob sie merkten, dass hinter seinem versteinerten Gesicht seltsame Stürme tobten? Ob sie merkten, dass sein Magen sich bereits verkrampfte, noch bevor er ihr Gift trank?
In Gellens Kopf wüteten Geister und Gespenster. Er erinnerte sich an den alten Mann. Daran, wie dieser ihm am Tag zuvor riet, im richtigen Augenblick den Tod vorzutäuschen. Doch dies waren keine gelangweilten Aufseher, die sich kaum bemühten, den Tod des Hingerichteten festzustellen und lediglich warteten, bis das Zucken erstarb, um dann den leblosen Körper auf einen Karren zu werfen. Und welch seltsames Spiel des Schicksals, dass der alte Mann nur eine Nacht zuvor verstorben war. Zu viele Geheimnisse, zu viele Fragen umkreisten diesen Augenblick.
Der Gorkone wandte sich an Nelei. „Ich weiß, was dich in schlaflosen Nächten umtreibt“, sagte er. „Doch ich habe es nicht getan.“
Eigensinnig riss er den mit Stroh umwickelten kleinen Korken aus dem Gefäß heraus und schüttete sich die Flüssigkeit in den Mund. Es war nur wenig mehr als ein Schluck. Fojt starrte mit gerunzelter Stirn auf Gellens Kehlkopf, bis er sicher war, dass der Gefangene das Gift heruntergeschluckt hatte.
An einem anderen Tag, in einer anderen Ausgangslage, hätte sich Gellen mit leeren Händen auf sie gestürzt und den Bolzen oder gar den tödlichen Streich des kalten Stahls erzwungen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Nelei für ihn nur noch eine flackernde Gestalt, die wild vor seinem Auge tanzte. Würde sie denn glauben, dass ein Herim einfach das Gift nimmt? Dass er sich wie ein wehrloser Stadtbürger hinrichten ließe? Schwerfällig machte Gellen einige Schritte rückwärts und lehnte sich erschöpft gegen den Fels. „Warum hier?“, fragte er langsam und hörte die eigene Stimme in einem seltsamen Echo verhallen.
„Niemand hat dir erlaubt, dich auszuruhen!“, bellte Fojt, doch Nelei bedeutete ihm wortlos, zu schweigen.
„Der große Gellen. Ich erinnere mich, wie sie dich als Held durch die Straßen getragen haben.“
Auch Gellen erinnerte sich. In seinen Haaren hatten sich blassrosa Blütenblätter verfangen und begeisterte Soldaten hatten ihm mit erhobenen Fäusten salutiert. Damals hatten sie ihn noch gefeiert, während ihre Sklaven heimlich einen Plan ausbrüteten.
„Doch hier, an dieser Stelle, warst du etwas ganz anderes“, fuhr sie fort. Er neigte den Kopf in den Nacken und blickte zu den Baumkronen auf. Der feuchte Fels kühlte seinen Hinterkopf. Die Sterne erschienen in Wolkenlücken. Sie verblassten rasch und gaben dem grauen, rötlichen Morgendunst nach. Die Vögel hatten begonnen, sich mit ihren rastlosen Stimmen zu verständigen und nahmen der Finsternis ihr hohles Grauen.
Es waren seltsame zwei Tage gewesen. Zuerst der alte Mann, dann Nelei und nun der kühle Wald um ihn. Gellen hatte nahezu zwei Jahre mit Nichtstun verbracht, verrottend in einem verdreckten Loch, und jetzt ereignete sich so viel in wenigen Stunden. „Dein Hass, Nelei … So groß, dass du deine eigenen Ratsherren hintergehst …“
„Ich habe keine Herren“, zischte Nelei und hielt die Armbrust hoch. Die Bolzenspitze drückte sich gegen seinen Hals.
„Du kannst nicht einfach Gorkonen im Wald hinrichten, Nelei“, fügte er mit rauer Stimme hinzu. „Was werden die Ältesten dazu sagen?“
Nelei ging darauf nicht ein. „Geschah es hier? Hast du es hier getan?“, erwiderte sie stattdessen. „Wir haben sie dort gefunden.“
„Ich bin niemals zuvor hier gewesen“, flüsterte Gellen und drückte sich fester gegen das Gestein. Die Lichtung hob und senkte sich wie ein Schiffsdeck in einem Sturm. Seine Eingeweide brannten. Er sah, wie sich das Seil tief in seine Handgelenke schnitt, doch er spürte es nicht. Sein Herz begann zu rasen. Er fühlte Zweige und Efeu im Rücken. Wie Schlangen wanden sie sich und umwickelten seinen Brustkorb und seine Oberarme.
Nelei blickte schweigend zurück auf den dunklen Pfad, über den sie gekommen waren. Sie wollte den langsam sterbenden Gellen nicht unentwegt anstarren. Die Zeit schien gefroren.
Fojt warf den rauchenden Stummel der Fackel fort und trat misstrauisch an Gellen heran. „Es müsste längst vorüber sein“, murmelte er ungeduldig und sah zu Nelei. Ihr Gesicht verriet keine Gefühlsregung.
Gellen öffnete die Augen. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Doch es war bereits hell. Er war in sich zusammengesunken, lehnte aber noch immer gegen den mit Moos bewachsenen Felsen. Er sah Ameisen, die ihm über die Oberschenkel liefen. Sein Herzschlag hatte sich beruhigt und nur sein Magen war zerrüttet von Krämpfen. Nelei stand noch immer auf derselben Stelle, reglos wie eine Steinsäule eines Parks in Hoé. Fojt ging nervös auf und ab und suchte übertrieben nach Worten. Gellen neigte den Kopf zur Seite und übergab sich.
Nelei blickte Gellen mit zusammengekniffenen Lippen an. Mit einer schnellen, tausendfach geübten Bewegung riss sie ihr Schwert aus der Scheide.
„Ja, töte ihn!“, knirschte Fojts unangenehme Stimme.
Sie streckte ihren Arm aus und verlängerte ihn mit dem kalten Stahl ihrer Waffe. Die Spitze des Schwerts berührte die Unterseite von Gellens bärtigem Kinn und drückte seinen gesenkten Kopf hoch. „Es ist nicht unsere Art“, entgegnete sie leise. „Ich werde meine Klingen nicht mit ihm besudeln.“
Fojt wusste, dass es verboten war, dem Gorkonen einen Ehrentod zu geben. Nicht einmal heimlich im Wald. „Ich werde ihn vergraben oder verbrennen. An seiner Asche wird es niemand sehen“, krächzte er und zog seinen Dolch. „Und ich bin kein Demenäer.“ Er fuchtelte damit vor Gellens Nase.
„Ich müsste dann auch dich töten“, erwiderte Nelei. „Oder denkst du, ich würde mich auf deine Verschwiegenheit verlassen?“
Das schien Fojt auf andere Gedanken zu bringen. Er steckte den Dolch wieder ein und verschränkte trotzig die Arme über der Brust. „So nimm den Bolzen“, maulte er unzufrieden. „Richte ihn mit einem Pfeil hin, so wie die Ximanti es tun!“
Gellen protestierte mit einem trockenen Röcheln. Sein Hals war rau und die Zunge fühlte sich wie die Sohle einer Sandale an. „Ihr kennt das Recht“, er hustete kurz, unsicher darüber, ob sein Magen nicht noch mehr des spärlichen Inhalts ausstoßen würde. „Es ist euer Gesetz. Wer die Hinrichtung überlebt, darf kein zweites Mal für eine Tat sterben.“
„Sprich nicht von unserem Recht, während Kotze an deinen Lippen klebt“, bellte Nelei. „Du bist nicht hier, weil meine Leute dich angeklagt haben. Du bist hier, weil du meine Schwester getötet hast. Das ist etwas zwischen dir und mir. Kein Tribunal wird mir mehr vorschreiben, was ich mit dir zu tun oder zu lassen habe.“
„Warum tötest du mich dann nicht?“ Gellen senkte seine Augen und nickte leicht. Er wollte ihr erzählen, was ihm auf dem Herzen lag. Doch er hatte einen Schwur abgelegt, der ihn zum Schweigen verpflichtete. Und dann war da noch Fojt. Insbesondere er sollte nichts erfahren.
Langsam richtete sich Gellen auf, neigte sich nach vorne und blickte Nelei eindringlich an. „Während meine Leiche in diesem Wald verrottet und Wölfe an meinem Fleisch zerren, läuft der Mörder von Helei frei herum. Wäre sie meine Schwester gewesen, ich könnte damit kaum leben.“
Nelei starrte ihn stumm an. Ihre Lippen bebten. Sie zeigte auf eine Stelle unweit des Felsens. „Dort lag ihr Körper“, flüsterte sie leise, in ihrer Brust loderte der alte Zorn wieder auf. „Mit deinem Schwert in ihrer Seite.“ Ihr wurde plötzlich bewusst, wie dürftig dieser Beweis war.
„Mein Schwert …“, murmelte Gellen. Ein bitteres Lächeln überflog sein Gesicht und er schüttelte den Kopf. Neleis Blick durchbohrte ihn. Gellen sah die Spannung in ihren Kiefermuskeln.
Sie hatte sich so oft gewünscht, ihn tot zu sehen. Doch nun, in diesem Augenblick, hatte sie Zweifel. „Ich würde mit dir kämpfen“, sagte sie schließlich. „Doch du bist zu schwach dafür.“
Gellen wollte ihr helfen, das Richtige zu tun – im eigenen Interesse. Doch er durfte sein Geheimnis nicht verraten. „Nelei“, sagte er leise. „Ma-ki schan mejen ti-ya.“
Sie starrte ihn reglos an. Die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Fojt runzelte die Stirn und beobachtete diesen seltsamen Augenblick der Stille mit Misstrauen.
Mit brüchiger, leiser Stimme ergriff Nelei schließlich das Wort. „Erkläre dich.“
Gellen schwieg. In seinen Augen glänzte das Zwielicht des Morgengrauens.
Ohne Hast trat sie näher an ihn heran und drückte langsam den kalten Stahl ihrer Waffe gegen seinen Hals. Ihre Lippen bebten. „Erkläre dich“, flüsterte sie. Es klang beinahe wie ein Schluchzen.
Gellens Mund blieb regungslos, doch seine Augen deuteten unmerklich auf Fojt.
Sie roch Gellens Schweiß und spürte seinen Atem. Sie senkte ihr Schwert und trat zwei Schritte von ihm zurück. „Was wünschst du zu tun?“, hauchte sie aus.
Hinter ihr kam Fojt näher. Seine Kinnlade sank merklich und sein Blick wanderte verwirrt zwischen Nelei und Gellen.
„Lass mich gehen und ich werde in der Verbannung mein Leben fristen“, antwortete Gellen.
„Es ist dem Kerker und der Richtstätte vorzuziehen“, stimmte ihm Nelei zu. Sie wirkte abwesend. Sie wandte sich plötzlich ab. Gellen atmete erleichtert aus. Nelei nahm wortlos den Waldpfad zurück zur Straße, während der Gefängnisaufseher ungläubig auf ihren Rücken starrte.
„Du lässt ihn hier?“, kreischte er und griff nach Gellens Arm. „Bring ihn wenigstens zurück in seine Zelle.“
Gellen wehrte sich gegen Fojts Griff. Für einen Augenblick sahen die beiden Gorkonen wie zwei alte Freunde in einer Umarmung aus. Dann stieß Gellen den Gefängnisaufseher kräftig von sich, Fojt strauchelte und stürzte im nahegelegenen Gestrüpp zu Boden. Doch sofort war der hagere Mann wieder auf den Beinen. Hasserfüllt starrte er Gellen an und schien zu überlegen, was jetzt zu tun sei.
„Was ist gerade passiert?!“, rief Fojt auf und rannte Nelei nach. „Das kannst du nicht machen, Herrin!“
Gellen blieb dort, wo er war. Die Kühle des Waldes umschmeichelte ihn und beruhigte seinen geschundenen Körper. Aus seinem angerissenen Ärmel rutschte Fojts Dolch. Es war ihm leichtgefallen, das Messer in der Rangelei unentdeckt an sich zu nehmen. Er hielt die billige Waffe mit beiden Händen fest und warf sie kurz in die Luft, so dass sie herumwirbelte und mit der Klinge zum Körper wieder in seinen Händen landete. Er rieb die nicht besonders scharfe Schneide gegen das Seil, bis es schließlich nachgab.
Gellen verstaute das Messer hinter dem alten, brüchigen Gürtel, der seine zerschlissene Hose hielt, und rieb sich die Handgelenke. Dann stützte er die Hände auf seine Knie und sammelte Kräfte.
Etwas später richtete er sich mühsam auf und taumelte mit schweren Schritten ebenfalls zur Straße zurück. Als er sie erreichte, sah er in der Ferne Nelei Richtung Kanvä reiten. Fojt trippelte neben ihrem Pferd und redete hektisch auf sie ein.
Gellen blickte in die entgegengesetzte Richtung. Die Straße führte nach Sarangar, die große Hafenmetropole im Süden der Gorkonai. Die nun von den Demenäern verwaltete Stadt wäre kein gutes Versteck für einen hochrangigen gorkonischen Flüchtling. Doch sie war ein Knotenpunkt der bekannten Welt und lag nahe der Grenze zum Südosten. Das Niemandsland begann dort. Ein Landstreifen, in dem kein König und kein Truchsess regierten und wo die Männer der Berge lebten. Ein Ort, den demenäische Krieger mieden, war ein Ort, nach dem er sich sehnte. Noch einmal blickte er kurz Nelei nach. „Ma-ki schan mejen ti-ya“, flüsterte er. „Ob ich es dir eines Tages erklären kann?“
Lakriels Spiegel
Gorkonai
Mit Geschepper warf Nelei ihre Waffen auf die Truhe. Die Armbrust blieb dort liegen, doch die Schwerter klirrten auf den Holzboden. Nelei beachtete es nicht. Sie trat zu der großen Schüssel und schüttete sich mit beiden Händen Wasser ins Gesicht.
Es war ein später Sommertag, mehr schon Herbst, noch immer mild und angenehm. Breite Sonnenstrahlen fielen durch das opake Dachfenster in ihr Zimmer und fröhliche Stimmen von Kindern drangen hinein. Die Morgenluft roch nach dem nächtlichen Regen frisch und schmeckte nach Laub.
Die misslungene Hinrichtung Gellens hinterließ eine wütende Spur der Zerstörung in Neleis Gefühlswelt. Vielleicht hatte Fojt recht und sie hätten ihn, allen Regeln und Gesetzen zum Trotz, dort im Morgengrauen erstechen sollen. Eine passende Erklärung dafür zu finden, wäre leicht gewesen. Doch sie verstand, dass dies Gedanken waren, die Fojt entsprachen. Hätte sie ihnen nachgegeben, wäre ihre Wut möglicherweise noch größer. Verdammter Gellen …
Nelei stützte sich gegen die Kommode und betrachtete sich im Spiegel. Dieses Kalidôr gehörte Lakriel und es gab Menschen, die vorbeikamen, nur um hineinzublicken. Die gorkonischen Spiegel galten als die besten auf Neroê und doch waren sie nur aus poliertem Metall und gaben ein verschwommenes Bild wieder. Aber diese runde Scheibe spiegelte das menschliche Gesicht mit einer solchen Schärfe, dass beinahe jeder in der Stadt von Lakriels Spiegel gehört hatte. Er bestand aus zahlreichen Mosaiksteinchen, getrennt durch Fugen, die so winzig waren, dass man die Oberfläche ganz nahe vor das Auge halten musste, um sie zu erkennen. Das leicht rötliche Bild erinnerte an den Wasserspiegel einer ruhigen See kurz nach dem Sonnenuntergang. Wenn man im richtigen Winkel Sonnenlicht einfallen ließ, färbte er sich in den Farben des Regenbogens. Viele sprachen von einem Zauberspiegel und verbreiteten sonderbare Geschichten darüber, wie Lakriel in seinen Besitz gekommen war. Nelei fand, dass es etwas voreilig war, um von Zauber zu sprechen, zumal der Spiegel weder Wünsche erfüllte, noch die Zukunft zeigte.
Am erstaunlichsten war das seltsame Material, aus dem dieses Kalidôr bestand. Denn der Spiegel war nicht dicker als eine Scheibe Papier und wog kaum mehr als ein Lufthauch. Es war möglich, ihn wie eine Schriftrolle zusammenzurollen, und ließ man los, rollte er sich von selbst wieder auf. Wie allweise waren die Götter einst, dass sie die Menschen solche wundersamen Dinge herzustellen lehrten? Wäre Diebstahl unter den Demenäern nicht so verpönt gewesen, Lakriel hätte zwei Wachen neben dem Kalidôr abstellen müssen.
„Nelei?“, erklang seine Stimme. Sie zuckte kurz zusammen. „Ich habe Lärm gehört.“
„Es war nichts“, rief sie über die Schulter. Sie hob die vom Gürtel umwickelten Schwerter vom Boden auf, hielt sie schuldbewusst an ihre Lippen und griff nach der Armbrust mit den Bolzen. Dann trug sie alles in ihre Waffenkammer.
Lakriel mochte den Spiegel haben und manch eine Frau wäre bereit gewesen, sein Bett zu teilen, nur um sich darin sehen zu dürfen. Doch der Ruhm des runden Spiegels war nicht zu vergleichen mit der Berühmtheit von Neleis Schwertern. Es gab Menschen, die jenseits von Demené oder der Gorkonai lebten und die dennoch Neleis Schwerter erkennen und benennen konnten. Die lange Waffe trug den Namen Kangbe. In Neleis Muttersprache, dem Tukwantar, bedeutete dies so viel wie Terror oder Schrecken. Das Kurzschwert hatte sie Daischaa genannt – das Gemetzel.
Die beiden Klingen waren das größte Geschenk, das Harada Dei seiner Tochter gemacht hatte. Sie waren auch das Einzige, was ihr von ihrem Vater, der sich bis an sein Lebensende weigerte, Besitztümer anzuhäufen, geblieben war.
Auf Neroê gab es Stich- und Hiebwaffen von unterschiedlicher Qualität. Manche waren aus Bronze und manche aus Eisen. Die teuren waren aus kendarischem Stahl. Doch die besten von ihnen wurden aus Kalidôr geschliffen. Ein Kalidôr war selten, doch überall in Kendaré, Tavanna und der Gorkonai wurde danach fieberhaft gesucht. Denn viele der Fundstücke konnten für die Herstellung guter Werkzeuge und neuer Waffen dienen. Handelte es sich um ein Metall, so wurde es geschmolzen, geschliffen oder gebogen und als Schmuck, Schwert oder Axt verwendet.
Doch nur Nelei besaß zwei vollständige Schwerter der Ahnen. Zwei unveränderte Kalidôr-Waffen, geschmiedet von den Vorfahren, vielleicht sogar von den Göttern selbst.
Die Priester glaubten, das Kalidôr sei kein Erbe der Ahnen, sondern eine göttliche Gabe. Wie sonst konnte es sein, dass das, was alt war, bessere Eigenschaften besaß, als das, was danach erschaffen wurde? Das machte Kangbe und Daischaa zu einem Geschenk der Allmächtigen.
Vor Wasser und Luft sicher verpackt, hatten die Schwerter unfassbare Zeitspannen überdauert. Dass Sibres Sibressin, ein wohlhabender gorkonischer Kalidôr-Baron, sie seinem demenäischen Sklaven vermacht hatte, belegte die eigentümliche Rolle ihres Vaters in der gorkonischen Gesellschaft.
Harada Dei hatte aus Kirschholz neue Griffe und Scheiden angefertigt und diese mit festem Leder überzogen. Dann hatte er beide Schwerter wochenlang geschärft und poliert, bevor er sie seiner Tochter schenkte. Mit dem Gebot, ihnen Namen zu geben und sich niemals von ihnen zu trennen.
Kangbe, das Langschwert, war kaum länger als ein ausgestreckter Männerarm und damit deutlich kürzer als vergleichbare Waffen dieser Zeit. Daischaa, das Kurzschwert, mutete den Beobachter eher wie ein zu lang geratener Dolch an. Beide Waffen besaßen weder den üblichen zweischneidigen Schliff noch eine typische Parierstange, wie sie bei den Kendari und Gorkonen gebräuchlich war. Stattdessen befand sich hinter der Fehlschärfe lediglich ein schlichter ovaler Ring. Leichtigkeit und Gleichgewicht waren neben unvergleichlicher Festigkeit und Schärfe die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Gefährten.
Die Erzählungen an fernen Lagerfeuern überhöhten ihre Schwerter. So machten die Krieger, denen Nelei begegnete, häufig den Fehler, von dem Aussehen der Waffen enttäuscht zu sein. Doch wer es jemals gewagt hatte, Säbel oder Schwert mit diesen Kalidôr zu kreuzen, lebte nicht lange genug, um diesen Irrtum zu bereuen.
Die Erinnerung an ihren Vater machte Nelei traurig. Die Demenäer gingen davon aus, dass er von der Seuche dahingerafft worden war, auch wenn ihn niemand hatte sterben sehen. Bei den ersten Anzeichen soll er ein kleines Schiff genommen haben und war zurück auf die Demené-Insel gefahren, um noch ein letztes Mal sein Geburtsdorf nördlich von Megar zu besuchen. Von dort sei er in See gestochen, mit dem tiefhängenden Stern der Demenäer vor dem Bug.
Nelei hatte ihr gesamtes Leben in der Gorkonai verbracht. Im Land der Herren und Sklavenhalter. Doch wie bei allen Demenäern war ihre Identität untrennbar mit dem „Ewigen Licht“ verbunden. Sie hatte es erst nach dem Aufstand, als bereits erwachsene Frau, zum ersten Mal gesehen. Sotor eien – das Ewige Licht – war ein Symbol ihrer Heimat, der Demené-Insel. Ein Bild, das mindestens einmal am Tag in ihren Gedanken und nicht selten in ihren Träumen erschien.
Dieser seltsamste aller Sterne leuchtete unweit des nördlichen Horizonts und war deshalb nur von der Nordküste der Insel sichtbar. Befand man sich weiter südlich, verschwand das Gestirn bereits hinter dem Horizont des Erathiar-Meers.
Jedes Kind auf Neroê wusste, dass die Sterne sich nachts in Bewegung befanden und um eine im Norden gelegene Mitte kreisten. So mochten sie zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen hinter den Bergen verschwinden, stets war darauf Verlass, dass sie am nächsten Tag wieder erschienen.
Doch Sotor Eien, der Stern der Demenäer, widersetzte sich diesen Gesetzen und schwebte seit Menschengedenken an derselben Stelle. Ein Segen durch den obersten Gott Arkron, den Herren über den Himmel und all seine Körper.
Aus der Verehrung des ruhenden Gestirns war ein Ritus entstanden, den man Lanka Sotorang nannte: den Weg des Lichts. Wer Schmach oder Unehre vermeiden wollte, der stach ins Meer und fuhr gen Norden, mit dem Kurs auf das Sotor Eien. Wer diese Reise antrat, galt als gereinigt und erhaben über Gebrechen. Nelei hatte niemals davon gehört, dass jemand von der Lichtreise zurückgekehrt sei.
Ihr Vater hatte keinen Abschied von ihr genommen. Sie war damals in Kanvä, er in Dakara. Von seinem Aufbruch erfuhr sie durch einen Boten. Sie vertraute der Nachricht, denn der Bote kannte die richtige Losung: Ma-ki schan mejen ti-ya.
Es war ein schlichter Satz in ihrer Muttersprache Tukwantar: Du bist der Sperling auf dem Tor.
Als kleines Mädchen hatte sie den Kenseti-Kämpfern beim Training zugesehen. Es war ein heißer Sommertag gewesen und der Staub des Übungsplatzes brannte an ihren nackten Füßen. Ein kleiner Vogel hatte sich auf den breiten Torflügel am Eingang gesetzt.