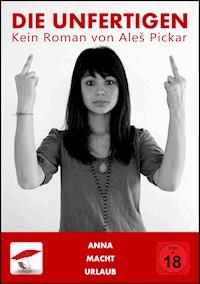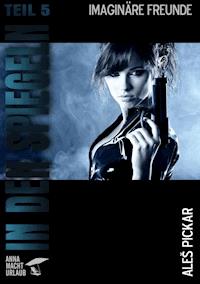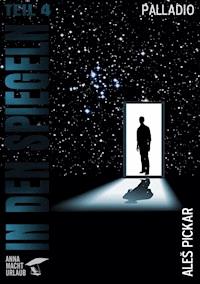
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Anna macht Urlaub
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kann Jan-Marek der Gastfreundschaft der Lux Aeterna vertrauen? Sind die Mitglieder der Gruppe lediglich Untote, jederzeit bereit über ihn herzufallen? Jan-Marek ist nun ein Gast der Lux Aeterna. Doch zunehmend begreift er, dass seine Anwesenheit die Züge einer Gefangenschaft trägt. Brookfield, die Privatarmee des Oktagons unternimmt den Versuch, ihn zu fassen. Wie stets in Jan-Mareks Leben sind die Folgen katastrophal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aleš Pickar
In den Spiegeln
Teil 4
Palladio
Aleš Pickar
In den Spiegeln
Teil 4
Palladio
© Ales Pickar 2011
Lektorat: Andrea Huber
Titelillustration:"Man´s Fear"von mtkang@ fotolia
Layout + Umschlaggestaltung: Anna macht Urlaub (www.annamachturlaub.de)
http://angelodaemonia.net
ISBN: 978-3-9815154-6-6
Fragment
Wenn du in den Spiegel blickst, weißt du wirklich, was du siehst? Kannst du es wirklich erfassen? Es wirklich begreifen? Hast du dich an diesen Anblick jemals gewöhnt? Ihn vollständig verstanden?
Aber die Blitze zerrissen mit wilden und roten
Augen die Nacht, die Öde der Säle zu hellen,
Und in den Spiegeln standen mit Köpfen, den grellen,
Drohend herauf mit schwarzen Händen die Toten.
Georg Heym
Wahrlich, keiner ist weise,
der nicht das Dunkel kennt.
Hermann Hesse
München, 28. November 1999
Aktenzeichen 254/D/17
Von: Lateinlehrer
An: Hotelier
Übermittlung CLMB
Betr.: Sicherstellung von pers. Aufzeichnungen / Jan-Marek Kámen / Hamburg, Schutzwohnung der Lux Aeterna / Polizeieinsatz
4.1 Der Spiegel
Urwald.
Nacht.
Um mich herum zirpen nächtliche Insekten und die Luft ist vollgesogen mit Wasser und Zellulose und Leben. Der Meister mit den schläfrigen Augen rollt einen für seine kleinen Finger viel zu wuchtigen Joint und bewegt nonchalant die spitzen Ohren. Er zündet den Dübel an, macht einen tiefen Zug und pustet mit abwesendem Blick den Rauch aus.
Wir sollten an einem nächtlichen Lagerfeuer sitzen, doch es ist kein Feuer da. Nur ein seltsames, kugelförmiges Objekt, das vor uns schwebt, nicht höher als einen halben Meter über dem Boden. Das fahle, grünblaue Licht der Kugel reflektiert sich in unseren Gesichtern.
»Macht, die du hast, du nicht verstehst. Die Zeichen zu sehen, nicht bereit du bist.«
»Was mache ich denn falsch?«, frage ich, während ich den glimmenden Joint aus seinen lemurenartigen Fingern nehme.
»Es gibt kein ›falsch‹ um dich«, erwidert er leise.
Ich nicke nachdenklich und reiche ihm den Stick zurück. Wir rauchen. Wir schweigen. Der Meister blinzelt verschlafen mit den Augen und um uns herum summt und brummt der Amazonas. In der Ferne erklingt brüchig ein sanfter kristalliner Ton, wie die hohe Taste eines Synthesizers. Als würde Feuchtigkeit in Obertönen schwingen.
Neben uns raschelt plötzlich das Gestrüpp. Doch es ist nicht der Panther Baghira, der uns einen Besuch abstattet, sondern ein dürrer Mann mit großen Augen und einem Vollbart. Er trägt ein T-Shirt, auf dem die Worte »STONED APE« geschrieben stehen.
»Hallo«, sagt er mit einem schelmischen Grinsen und zieht das Grußwort melodiös in die Länge. »Lange nicht gesehen.«
»Lange Zeit du fort gewesen«, erwidert der Meister geheimnisvoll.
»Ja«, antwortet der Neuankömmling und setzt sich zu uns. »Ich komme zurück vom Ende der Zeit.«
»Vom Ende der Zeit?«, wiederhole ich verwundert. »Wie sieht das Ende der Zeit aus?«
»Ich habe aztekische Paläste gesehen und Königreiche im Hyperraum. Und eine Zeit, die sichtbar war und sich wie eine Schlange immer schneller wand.«
»Die Schlange der Zeit du gesehen hast«, stimmt ihm der Meister zu. »Sie besänftigen wir müssen.«
»Die Wurzeln unserer Geschichte liegen in der Zukunft«, sagt der Besucher, während er die leuchtende Kugel betrachtet. »Das Mysterium liegt im Körper.« Er blickt wieder mich an. Seine dunklen Augen sind voller Sterne. »Ein Herz, zwei Welten. Ein wunderbarer Schamane, wenn du nur verstündest.« Er putzt konzentriert seine Brille und sieht mich dabei mit väterlich hochgezogenen Augenbrauen an. Dann setzt er die Gläser wieder auf und blickt zwischen dem Meister und mir mit einem schelmischen Lächeln hin und her. »Kinder, lasst mich auch mal ziehen ... Weiß jemand, ob es heute einen Rave gibt?«
Irgendwo in der dunklen Ferne heult ein Raubtier auf.
Ich öffnete die Augen und starrte die Zimmerdecke an. Sie war durchzogen von kleinen Rissen und Sprüngen im Putz.
Surreale, infantile Träume waren nun an die Stelle meiner Hyper-Albträume getreten. Prophetische Träume, ganz poppig. Es lag an den Drogen, die man mir in einem Plastikbecher dreimal am Tag feierlich überreichte. Bye-bye, Blutbäder und massakrierte Frauen. Ich bin jetzt ein Mystiker. Badda-Bing, Badda-Bang. Abrakadabra.
Wenn man nur genug Türen zwischen sich und den dumpfen Schlägen schließt, verhallt das grässliche Echo letztendlich.
Die Horrormaschine war zum Stillstand gekommen.
Also wo waren wir hier eigentlich? Und warum waren so viele Drogen in meinem System?
Das Krankenzimmer war erdrückend weiß und erinnerte an die Hohlkehle eines Modefotografen. Es besaß keine Fenster, was stets ein schlechtes Zeichen ist.
Mein Arzt hieß Dr. Romell. Er verbrachte vermutlich sein ganzes Leben in Labors und auf Wohltätigkeitsbanketten, ohne jemals einen einzigen echten Patienten betreut zu haben, weshalb seine Umgangsformen zu wünschen übrig ließen. Er besaß die hässliche Freundlichkeit eines Nazi-Arztes und ich nahm an, dass seine Wahrheitsliebe einem ähnlichen Vergleich standhielt.
Ich hatte einige Nächte ans Bett gefesselt verbracht und bekam Injektionen aller Art. Das Ganze war ein endloser Trip, der nur in den Morgenstunden ein wenig abebbte und mir einen etwas klareren Kopf erlaubte. Nicht wirklich klar, doch im Vergleich zu den Höllenritten am Abend war es nur ein dünner Morgennebel, den ich manchmal als Kind im Schrebergarten meiner Großeltern gesehen hatte, nur Minuten, bevor sich die ersten Strahlen der Sonne über den Feldern und Auen brachen. Ich konnte nie sagen, wohin der Nebel verschwand; plötzlich sah man sich um und er war weg, aufgelöst durch die Sonne.
Hier an diesem Ort, in einer Klapsmühle, in der ich gegen meinen Willen festgehalten wurde, begann meine Transformation. Meine Metamorphose in etwas Größeres. Die topografische Landschaft meines Schicksals war bereits aufgedeckt und alles, was ich nun tun musste, war, die Augen zu öffnen und sie anzusehen. Ich musste bereit sein, in die Wunde hineinzustarren. Das letzte Puzzlestück in die Mitte des Gebildes zu legen.
Aamon war mein einziger Begleiter in diesen dunklen Stunden. Denn ich hatte eines Abends, bevor man mir die Fesseln für den Schlaf anlegte, dreimal die Worte »Non serviam« ausgesprochen und dreimal in die Hände geklatscht. Die Pfleger (die mehr wie Schläger aussahen) schüttelten nur den Kopf. Für sie war ich bloß ein gewöhnlicher Spinner.
Als ich morgens aufwachte, war ich nicht mehr allein. Er war in mir. Er war eins mit mir. Der Dämon hatte mich betreten. Ich war der Grund, weshalb die Kirche Exorzisten unterhielt.
Ich wurde bikameral.
Ich weiß, dass das alles sehr verwirrend klingt. Und die meiste Zeit war ich auch verwirrt. Aber mit etwas Geduld … nun, es ist erklärbar, das will ich damit sagen. Man muss sich nur lange genug in diesem Morast des Irrsinns aufhalten und die Dinge beginnen langsam Sinn zu machen.
Obwohl meine Gedanken unkonzentriert waren und irgendwann nur noch einem Mischmasch aus Vorstellungen und Einbildungen glichen, verlor Aamon nie die Geduld, mit sanfter Stimme zu mir zu sprechen. Vor hundert Jahren hätte er mit einem Engel um mich gerungen, doch heute focht er seinen Kampf mit den Medikamenten in meinem Gehirn.
Zu später Stunde am Tag konnte ich längst nicht mehr unterscheiden, ob ich ihm in Gedanken antwortete oder laut. Hier spielte es auch keine Rolle.
Nach einigen Tagen ließ man schließlich von der allabendlichen Fünf-Punkt-Fixierung (die natürlich nur zu meinem eigenen Schutz angewendet wurde) ab und so konnte ich nachts bei meinen obligatorischen Kotzorgien wenigstens den Kopf in die Kloschüssel stecken, anstatt wie an den Tagen zuvor mein unwürdig anmutendes Nachthemd vollzureihern.
Am amüsantesten waren die länglichen roten, recht aggressiv aussehenden Pillen. Nahm man sie, wurde man innerhalb weniger Minuten durstig und der Mund fühlte sich wie trockenes Schuhleder an. Dazu gab es die runden Blauen, die meinen Blutdruck jedes Mal in die Höhe jagten, aber zum Glück mit nur einer geringen Wirkungsverspätung von einigen Minuten von den Weißen begleitet wurden, die mich wiederum schläfrig machten und meinen Blutdruck beruhigten. Dann gab es da noch die wirklich seltsamen grünen Trips, die ich nur alle paar Tage bekam. Sie lösten Spasmen aus und bescherten mir unglaubliche Erektionen und leider manchmal auch einen recht peinlichen Speichelfluss aus meinem Mundwinkel.
Eines Tages spielte mir Dr. Romell eine selbst gebrannte DVD vor, auf der man mich durch eine der Überwachungskameras bei einem typischen nächtlichen Lallen sehen und hören konnte. Es war wohl ein Zwiegespräch mit Aamon, aber auf einem Fernsehmonitor im Krankenzimmer einer Psychiatrie sah es natürlich etwas verfänglich aus.
»Wenn Sie mich nicht mit Drogen vollknallen würden, müsste ich vielleicht nicht in der Nacht mit mir selbst reden«, erwiderte ich und konnte kaum die Augen offen halten.
Dr. Romell nickte mitfühlend.
»Es sind keine Drogen. Es sind Medikamente. Die Behandlung Ihrer Krankheit ist alles andere als einfach. Dabei ist vieles noch in einem experimentellen Stadium. Doch die gute Neuigkeit ist, dass wir in der Tat nun einen großen Teil der Präparate absetzen können.«
»Halleluja«, sprach der Teufel in mir.
Dr. Romell öffnete seinen Aktenkoffer. Er nahm einen Stapel weißes Papier heraus und ließ mit einem lauten Klappern eine Handvoll Stifte auf die Tischplatte fallen.
»Ich möchte, dass Sie Ihre Geschichte aufschreiben. Ich werde sie dann lesen und mit Ihnen darüber sprechen. Ich will, dass Sie fühlen, wie Ihre Berichte auf Sie selbst wirken. Sie werden sehen, es wird eine gute Erfahrung. Für uns beide.«
Ich war noch zu benommen, um ihm zu widersprechen. Um ihm irgendeine bissige Unverschämtheit an den Kopf zu werfen.
In der Tür blieb er noch einmal kurz stehen.
»Ach ja, und die Stifte sind abgezählt«, erklärte er mit einem freundlichen Lächeln und verschwand.
Ich hatte keine Ahnung, wie viele Tage ich bereits hier war. Es kam mir wie einige Wochen vor. Doch es gab kein Fenster, das mir den Wechsel zwischen Tag und Nacht hätte zeigen können, und so lag es an diesen verdächtigen Halbgöttern in Weiß, meinen Tagesrhythmus zu bestimmen.
Mein Körper fühlte sich entsprechend schwach. Mein Geist steckte hinter einem Dunstschleier. Ich begann in meiner Zelle auf und ab zu gehen, um Bewegung zu haben und meine Gedanken besser ordnen zu können. Dr. Romell hätte sich gegen den Ausdruck »Zelle« sicherlich gewehrt - es war doch schließlich ein Krankenzimmer. Es waren auch keine Drogen, mit denen sie mich vollpumpten, sondern Medikamente.
Meine Zelle war karg, weiß und leer, und sie konnte von innen nicht geöffnet werden. Das Scheißhaus war im selben Raum, was in meinen benebelten Augen jeglichen Anspruch auf den Titel »Krankenzimmer« zunichtemachte. Die Tür hatte offensichtlich auf keiner Seite einen Griff, sondern wurde elektrisch zur Seite gefahren.
Ich war ein Gefangener der Oktagon-Stiftung. Die Oktagon-Leute hatten es schon lange auf mich abgesehen. Sie hatten mich bereits in Hamburg erledigen wollen, als sie meine Freundin Evelyn benutzten, um sich Zutritt zu meiner Wohnung zu verschaffen. Nun, eigentlich zu der Wohnung von Lux Aeterna. Diese kam mir damals auch zu Hilfe. Und dann wollte mir das Oktagon im Krankenhaus an den Kragen. Paul Lichtmann persönlich stand mir dort bei. Man könnte meinen, ich hätte der Lux Aeterna viel zu verdanken. Doch dazu später. Für den Augenblick reicht es, zu wissen, dass der Aufenthalt bei den Gefolgsleuten Luzifers diesem Kurort eindeutig vorzuziehen war.
Auch wenn Dr. Romell es als neurologische und psychiatrische Obhut bezeichnete, ich war ein Gefangener. Doch statt mich zu foltern oder den Aufenthaltsort von Paul Lichtmann aus mir herausprügeln zu wollen, plapperten die Ärzte ständig etwas von Therapie, mentaler Labilität und Holophrenie.
Diese wenig bekannte Krankheit, so der Experte Dr. Romell, sei der Schizophrenie nicht unähnlich, beinhalte jedoch noch extremere Wahnvorstellungen. Meine Erlebnisse in der Vergangenheit sollten also bloße Phantasien sein. Und ähnlich wie bei der Schizophrenie wäre ich eben in einem typischen Alter, in dem die Symptome zum ersten Mal verstärkt diagnostiziert werden könnten.
Ich kannte diese Slogans schon lange. Unklar blieb nur, ob die Wissenschaftler der Oktagon-Stiftung selbst daran glaubten oder dies lediglich als ein neues mediales Instrument verwenden wollten, um die Lux Aeterna in der Öffentlichkeit als einen Haufen schwer psychotischer, gefährlicher Spinner darzustellen.
Diese Frage beschäftigte mich nun jedes Mal, wenn sich Dr. Romell oder seine Assistenten mit einer Injektionsspritze über mein Bett beugten. War Romell selbst davon überzeugt, dass ich krank war, oder folgte er nur einer Strategie, deren Bestandteil die Vorspiegelung einer ominösen seelischen Zivilisationskrankheit war?
Dr. Romell hatte natürlich einen Trumpf im Ärmel - den Spiegel - und er wurde es nicht leid, ihn bei gegebenen Anlässen auszuspielen.
Sie zeigten mir den Spiegel, als ich den Doktor das erste Mal mit der Tatsache konfrontierte, dass die Oktagon-Stiftung mich töten wollte. Ich erinnere mich, wie ich mit dem Zeigefinger vor seinem Gesicht fuchtelte wie in einem James-Cagney-Film.
»Es sind Ihre Leute!«, schrie ich. »Ihr wollt mich aus dem Weg räumen.«
»Aber Jan-Marek«, erwiderte Romell gelassen, »wenn das wahr wäre, weshalb würden wir zusammen so viele Sitzungen absolvieren?«
Das war ein interessantes Argument. Ein Punkt für ihn. Ich hielt kurz inne und sammelte meine verstreuten Gedanken.
Doch ich griff den Faden schnell wieder auf und neigte mich mit einem mafiotischen Blick langsam über die kalte Tischplatte.
»Weil Sie nicht daran glauben, dass ich krank bin. Hier geht es in Wirklichkeit um Informationen. Sie wollen wissen, was ich weiß.«
Dr. Romell schwieg bei dieser Antwort und blickte schließlich langsam über seine Schulter, wo zwei seiner Assistenten standen.
»Bringt den Spiegel.«
Sein Kollege klopfte gegen die Tür, die sogleich von außen geöffnet wurde.
Unser Streitgespräch war zum Erliegen gekommen. Dr. Romell schaltete das Aufnahmegerät aus und begann seine Unterlagen zu sortieren. Schließlich betraten zwei muskulöse Pfleger, Schläger oder vielmehr Gefängnisaufseher den Raum. Sie waren in weiße Hosen und weiße T-Shirts gekleidet, die sich an ihrem Oberkörper wie eine Bemalung abzeichneten.
Sie trugen einen großen Spiegel.
Man konnte noch nicht sehen, dass es ein Spiegel war, denn er war mit einem ebenso weißen Tuch verdeckt.
Ich dachte daran, dass ich Klaus Grünwalds bulligen Leib nicht wirklich lieben gelernt hatte, und dass es wohl irgendein irrsinniger Therapieschritt war, »ja« und »ich« und »ja, ich liebe mich« zu meinem eigenen, desolaten Anblick zu sagen.
Die beiden Bulldoggen postierten sich direkt vor mir, sodass ich meine gesamte Gestalt betrachten konnte.
Nun war da nur noch das Tuch.
Dr. Romell, der oberste Dompteur in diesem Zirkus, konnte es sich natürlich nicht nehmen lassen: Er trat zwischen den Spiegel und mich und riss es mit einer dramatischen Geste herunter.
Ich habe keine Erinnerung daran, dass ich geschrien hätte. Es war mehr ein Aushauchen, wie ein letzter Atemstoß. Dann starrte ich stumm auf mein Spiegelbild.
Da war ich, in einem Aluminiumstuhl sitzend, trotz des unwürdigen, hinten verschließbaren Patientenkittels lässig mit übereinandergeschlagenen Beinen, als wollte ich Romell demonstrieren, dass er meinen Geist und damit meine Freiheit niemals haben konnte.
Doch es war nicht Klaus Grünwald, der mir da entgegenstarrte. Es war kein Mittfünfziger mit angeschwollenem Bierbauch und Haarausfall, mit kurzen Beinen und einem unrasierten Doppelkinn. Ich sah mich. So wie ich war. So wie alles begann. Hier war der Jan-Marek Kámen, der in der Theresa-Berkley-Straße in München gelebt, abends mit Manzio Joints gebaut und über Verschwörungstheorien gesprochen hatte.
»Das ist unmöglich ...«, sagte ich leise. »Es kann nicht sein.«
»Weshalb, Jan-Marek?« fragte mich Dr. Romell.
»Diesen Körper gibt es nicht mehr. Er starb auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Hamburg. Ich bin zwischenzeitlich reinkarniert.«
Dr. Romell nickte verständnisvoll.
»Und dennoch ist er wieder hier, in diesem Spiegel. Sie verstehen doch, was sonst noch anders ist mit Ihnen ...«
Ich sah ihn lange schweigend an und siebte schließlich durch meine Zähne: »Die Medikamente.«
»Die Medikamente«, stimmte mir Dr. Romell zu.
»Sie haben also Medikamente erfunden, die mich meinen alten Körper halluzinieren lassen«, sagte ich und nickte unmerklich mit zusammengepressten Lippen.
»Nein, Jan-Marek«, erwiderte der Arzt und lächelte leicht schnaubend. »Sie halluzinieren ohne jegliche Hilfe. Doch wenn wir Ihnen die richtigen Präparate verabreichen, beginnen Sie wieder zu sehen, was da ist.«
Seit dieser ersten Demonstration war viel Zeit vergangen und ich bekam zur Erinnerung noch einige Male das kalte Glas des großen Spiegels gezeigt. Sie trugen es wie eine Monstranz in meine Zelle hinein, als erwarteten sie, dass ich es küsste. Seltsamerweise schienen sie keine Angst zu haben, dass ich aufspringen und mich gegen den Spiegel werfen würde, wie es sich für einen richtigen Irren gehörte. Dass ich mir eine große Scherbe greifen und mit ihr herumfuchteln würde. Dass ich versuchen würde, mir die Halsschlagader damit aufzuschneiden.
Und sie hatten recht. Ich wurde ruhiger. So wie ein Trinker nach einem Wutanfall in sich versinkt und den Rest des Abends seinen Kopf in den Händen hält. Es gab keine Möglichkeit, hier mithilfe von Tobsuchtsanfällen herauszukommen. Sogar ich hatte das begriffen.
Dr. Romell versprach, die Medikamente zu reduzieren. Das bedeutete natürlich nicht, dass er mich clean haben wollte. Er entfernte nur einige Bausteine aus seinem Zaubercocktail, damit ich etwas motivierter war, überhaupt aus dem Bett zu steigen und mich mit dem Stapel Papier an den Tisch zu setzen.
Was hatten die nur alle mit dem Schreiben? Als mich Lichtmann alias Adam Kadmon ins Jenseits mitnahm - manche würden wohl eher den Ausdruck »verschleppen« gebrauchen - war es Michael, der mürrische Erzengel, der mir auftrug, über diese Ereignisse zu berichten. Eine Aufgabe, der ich nicht nachgekommen war, da sich seit meiner Rückkehr alles ein wenig hektisch gestaltet hatte. Und nun wollte Romell, dass ich schrieb. Vielleicht konnte ich hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es fiel mir zwar nicht schwer, mein Geplapper zu Papier zu bringen, doch mein grundsätzliches Problem mit jeglicher Form von Autorität steigerte nur die Wut, die ich beim Schreiben empfand.
Außerdem musste ich an Etienne Fremont denken. Es ist leicht, an die eigene Realität zu glauben und die anderen als Lügner zu bezeichnen. Doch Zufälle sind stets ein Problem. Man kann sich nur eine gewisse Zeit lang einreden, dass diese Zufälle nicht am Podest der vermuteten Realität kratzen und nagen. Es ist etwas in uns, das mit Unwahrscheinlichkeiten nicht gut klarkommt.
Jemand kann Ihnen erzählen, er habe ein Zugunglück überlebt oder fortgeschrittenen Krebs besiegt. Er kann Ihnen damit ein »aha« oder ein »wow« abringen, doch wenn Sie fünfundzwanzigmal mit fünfundzwanzig gänzlich unterschiedlichen Würfeln dieselbe Zahl würfen, wird die Überraschung viel größer sein. Ihre Welt wird ins Wanken geraten. Sie beginnen entweder an eine riesige Konspiration zu glauben, die jeden Würfel im Umkreis von Kilometern extra Ihretwegen manipuliert, oder daran, dass Sie Teil eines Wunders sind, das Sie noch nicht durchschaut haben.
Das ist natürlich schade und traurig, denn ein Zugunglück zu überleben oder eine schwere Krankheit zu besiegen, ist viel wichtiger und relevanter als irgendwelche Holzwürfel. Doch so sind wir Menschen. Gefangen in einer ewigen Drehtür zwischen Form und Substanz.
Ich will also nicht bestreiten, dass die Zweifel an mir nagten. Ob diese Zweifel durch die Medikamente oder durch meine Innenschau begünstigt wurden, kann ich rückwirkend kaum sagen. Doch eins stand fest: Dr. Romell mochte ein ätzendes Arschloch sein, aber das allein war kein Beweis dafür, dass die Ereignisse der letzten Monate real waren.