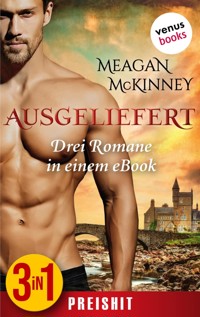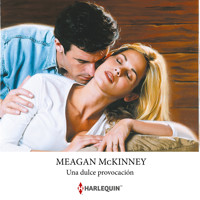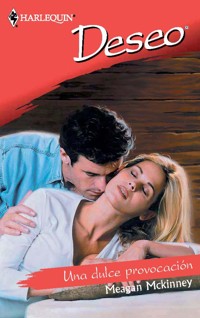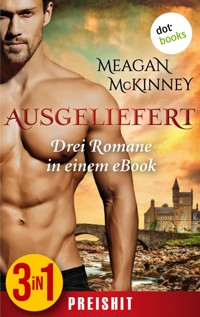4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur in ihren Träumen ist sie immer noch Kayleigh - sie und ihre Zwillingsschwester Morna leben darin noch immer in der heilen Welt der Vergangenheit, einer Welt, in der ihre größte Sorge war, welches Kleid sie wohl anziehen sollten.
Aber die Vergangenheit ist längst vorbei, aus Kayleigh ist Kestrel geworden, die sich ihren Lebensunterhalten als Taschendiebin in New Orleans verdient. Kestrel hat jenen anderen Teil ihres Lebens verdrängt - vor allem jenen schrecklichen Tag, an dem Morna ermordet wurde und sie selbst gerade noch mit dem Leben davonkam. Als sie jedoch dem geheimnisvollen St. Bride Ferringer begegnet, verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart miteinander. Ist dieser Mann ihre Rettung - oder hat sie sich durch ihre Liebe zu ihm erneut in Lebensgefahr gebracht?
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Anmerkung des Autors
Teil I: La Nouvelle-Orleans, Mai 1746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Teil II: Wolf Island, Georgia
20
21
22
23
24
25
26
Teil III: Belle Chasse
27
28
29
30
31
32
Epilog
Über dieses Buch
Nur in ihren Träumen ist sie immer noch Kayleigh – sie und ihre Zwillingsschwester Morna leben darin noch immer in der heilen Welt der Vergangenheit, einer Welt, in der ihre größte Sorge war, welches Kleid sie wohl anziehen sollten.
Aber die Vergangenheit ist längst vorbei, aus Kayleigh ist Kestrel geworden, die sich ihren Lebensunterhalten als Taschendiebin in New Orleans verdient. Kestrel hat jenen anderen Teil ihres Lebens verdrängt – vor allem jenen schrecklichen Tag, an dem Morna ermordet wurde und sie selbst gerade noch mit dem Leben davonkam. Als sie jedoch dem geheimnisvollen St. Bride Ferringer begegnet, verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart miteinander. Ist dieser Mann ihre Rettung – oder hat sie sich durch ihre Liebe zu ihm erneut in Lebensgefahr gebracht?
Über die Autorin
Meagan McKinney hat ihre Karriere als Biologin aufgegeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie lebt mit ihrer Familie in New Orleans und schreibt nicht nur historische Liebesromane, sondern auch packende Thriller.
MEAGAN McKINNEY
Kampf der Liebe
Ins Deutsche übertragen von Dorothee von der Weppen
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
© Copyright 1988 by Ruth GoodmannOriginaltitel: My Wicked EnchantressPublished by arrangement with Dell Publishing,a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Digiselector | sivilla | Scott A. BurnseBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3889-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für die, die sie gewesen sein könnte
Für Jo
Meiner Agentin, Pamela Gray Ahearn,und meiner Schriftstellerkollegin, Rexanne C. Becnel,möchte ich für ihren festen Glaubenan dieses Buch danken und ihnen meineWertschätzung aussprechen.
Anmerkung des Autors:
Obwohl Belle Chasse Plantation tatsächlich einst existierte, handelt es sich in meinem Roman um ein vollkommen frei erfundenes Belle Chasse ...
Sie war wieder Kayleigh.
In ihrem Traum befand sie sich in Mhor Castle. Es war vor genau einem Jahr, 1745. Culloden war noch nicht zum Schlachtfeld geworden, und der Wind, der über das Hochland und über ihr geliebtes Zuhause wehte, erzählte von idyllischer Ruhe und Frieden.
Sie lachte.
Die Räume, die sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester bewohnte, befanden sich im Ostflügel des Schlosses, und sie war gerade in ihrem Ankleidezimmer und sah Morna zu, wie sie ein Kleid nach dem anderen anprobierte.
»Nein, nein, Morna!«, kicherte sie. »Dieses grüne Brokatkleid ist zu gewagt! Was soll denn Mrs MacKinnon denken? Sie wird uns so nie gehen lassen!« Sie lachte wieder und strich sich eine Locke ihres glänzenden schwarzen Haares aus dem Gesicht.
»Kayleigh, ich habe es satt, bevormundet zu werden, und es ist mir vollkommen egal, wie Mrs MacKinnon darüber denkt!« Morna blickte ihre Schwester im Spiegel an, und ein boshaftes kleines Lächeln lag auf den süßen Lippen. Kayleigh beobachtete, wie Morna schamlos das sowieso schon viel zu tiefe Dekolleté ihres grünen Kleides noch weiter herunterzog.
»Also, das wird Duncan ganz bestimmt beeindrucken«, bemerkte Kayleigh trocken. »Aber was wird er von einer jungen Miss denken, die im Ballkleid zu einem Picknick erscheint? Morna, er wird dich ganz sicher für verrückt halten!«
»O nein, das wird er nicht. Es wird ihm sehr gut gefallen!«
»Dann werden sie denken, dass ich verrückt bin!« Kayleigh schüttelte den Kopf und trat neben ihre Zwillingsschwester. »Zieh das blaue Seidenkleid an, Morna. Es passt viel besser zu einem Picknick. Außerdem hat Mrs MacKinnon endlich einmal zugestimmt, dass nur ich dich begleite, und wenn sie herausfindet, dass du dieses Kleid angezogen hast, wird sie dich nie mehr ohne eine ganze Armee von Anstandsdamen fortgehen lassen.«
»Bist du sicher, dass du meine Schwester bist, Kayleigh, und nicht meine Mutter?« Morna warf ihr einen missbilligenden Blick zu, aber ihre Augen blitzten vor Übermut.
»Manchmal nicht. Manchmal bin ich mir überhaupt nicht sicher!« Kayleigh zwickte sie leicht in die Wange und half ihr dann, die Bänder zu lösen. Bald hing das smaragdgrüne Kleid wieder im Schrank.
Das glockenblumenblaue Seidenkleid passte viel besser. Morna sah aus wie ein Engel – etwas, was Kayleigh nie vergönnt war. Obwohl Morna dieselben indigoblauen Augen hatte und dieselbe hohe Stirn, dieselbe Stupsnase und dieselben üppigen Lippen, war Morna von Geburt an von einem Heiligenschein silberblonder Locken umgeben. Im Gegensatz dazu war ihr eigenes Haar rabenschwarz, und von Kindesbeinen an war es im Zweifel immer Morna, die wie ein kleiner unschuldiger Engel aussehen konnte und von Strafen verschont wurde, wenn eine von beiden etwas ausgefressen hatte.
»Hilfst du mir, mein Haar hochzustecken, Schwesterchen?« Morna saß vor ihrem Frisiertisch und blickte in den alten Spiegel. Hinter ihr nahm Kayleigh die Silberbürste und fuhr damit durch das lange silberblonde Haar.
»Kayleigh«, sagte Morna nach einer Weile, »warum hast du dir nicht etwas Hübscheres angezogen? Ich fürchte, dass du in diesem alten grauen Wollkleid kaum einen Verehrer finden wirst.«
»Ich möchte heute Nachmittag zeichnen. Was sollte ich sonst anziehen? Mein bestes Seidenkleid?«
»Nein, aber etwas ansehnlicher könntest du dich schon zurechtmachen. Duncan bringt vielleicht einen seiner Brüder mit, und dann blamierst du uns!«
»Sehe ich wirklich so schlimm aus?«
»Nein, nein! Du bist die wunderbarste Schwester, die ich habe!« Morna kicherte und nahm Kayleigh die Bürste aus der Hand. »Aber lass mich wenigstens dein Haar frisieren. Ich werde es auch hochstecken. Dann wirkst du viel modischer.«
»Wenn es dir Freude macht. Aber sei nicht entsetzt, wenn ich vom Zeichnen zurückkomme und Duncan sagt, dass ich wie eine Vogelscheuche aussehe, weil alle Nadeln herausgefallen sind!« Kayleigh nahm vor dem Frisiertisch Platz, und Morna stellte sich hinter sie und begann, das schwarze lange Haar zu bürsten.
»Hast du noch mehr Nadeln?« Morna schüttelte eine kleine, mit Edelsteinen besetzte Dose, die auf dem Frisiertisch gelegen hatte. Zwei Nadeln fielen heraus.
»Nein. Binde sie einfach wieder mit dem Band zusammen, Morna.«
»Gib mir deine Dose, Kayleigh. Du musst noch Nadeln haben.«
»Nein, Morna. Ich habe wirklich keine –« Kayleigh sprach nicht weiter. Sie sah, wie Morna bereits auf ihren Frisiertisch zusteuerte und ihre mit den gleichen Edelsteinen besetzte Dose öffnete.
»Also, das ist ja – Kayleigh! Die ist ja voller Kohlestifte!«
»Ja. Ich zeichne mit Kohle.« Kayleigh stand auf und fasste schnell ihr Haar mit einem blauen Seidenband zusammen.
»Du bist hoffnungslos, weißt du. Mutter hat uns diese Dosen geschenkt, damit sie uns Glück bringen. Und du hebst deine Kohlestifte darin auf.«
»Aber ich hüte sie wie meinen Augapfel und habe sie immer bei mir.«
»Ich glaube, Mutter dachte, dass wir sie für etwas weniger Gewöhnliches benutzen.« Morna stellte beide Dosen nebeneinander auf ihren Frisiertisch. Sie starrte Kayleigh an, die Hände in die Hüften gestemmt. »Sieh mal, da ist ein riesiger Kohlefleck auf deinem Porträt.« Morna nahm ein Tuch von ihrem Tisch und wischte den Deckel ab.
Die kobaltblauen Emailledosen mit den winzigen Saphir- und Diamantsplittern an dem filigranen Rand waren identisch, bis auf die Porträts auf den Innenseiten der beiden Deckel. Unter den Porträts befanden sich ihre Namen, und darunter waren Worte geschrieben, die die Wahrsagerin, von der ihre abergläubische Mutter die Dosen gekauft hatte, den beiden Mädchen zugedacht hatte.
Auf Mornas Dose stand »Die Geliebte«. Auf Kayleighs Dose jedoch stand »Die Verzaubernde«. Und zum Entsetzen ihres Vaters kündigten viele Bedienstete vom Hochland und verließen Mhor Castle, sobald sie die Inschrift auf Kayleighs kleiner Dose entdeckt hatten.
»Komm schon, Morna. Du musst meinen Frevel entschuldigen – wenigstens heute.« Kayleigh steckte die mit Kohlestiften gefüllte Dose in eine Tasche, die unter den weiten Röcken verborgen war. »Wir sind schon spät dran. Duncan hat wahrscheinlich Nairn bereits verlassen und ist ohne uns zum Picknick gefahren, so unpünktlich, wie wir sind!«
»Du hast recht, aber trotzdem – du bist unmöglich, Kayleigh.« Morna setzte sich wieder und überprüfte noch einmal ihre Frisur. »Ich fürchte, aus dir wird noch eine alte Jungfer, oder schlimmer, es bleibt dir nichts anderes übrig, als unseren Vetter Straught zu heiraten.«
»Mach dir darüber keine Sorgen. Ich wollte es dir beim Frühstück schon sagen. Vetter Straught macht mir nicht mehr den Hof.« Kayleigh steckte eine Haarnadel in den blonden Knoten, zu dem Mornas Haar aufgesteckt war.
»Wie kommt das denn? Ich war überzeugt, dass er niemals aufgeben wird. Er schien mir immer so ... wild entschlossen.«
Morna erschauderte bei dem Gedanken und reichte ihrer Schwester die letzte Nadel. »Wie ich wünschte, Vater hätte ihm nicht Mhors Jagdhaus hinterlassen! Seit Mutter und Vater tot sind, scheint es, dass Vetter Straught ständig herumschleicht und dir wie ein Schatten folgt. Ich schätze, er wäre gar kein so schlechter Verehrer, denn er sieht wirklich gut aus, das muss man ihm lassen. Aber diese unnatürlichen Augen! Und dann ist er so schrecklich alt! Du liebe Güte, er muss mindestens schon fünfunddreißig sein!«
»Ach, und so ein riesiger Unterschied zu Duncans jungen achtundzwanzig!«, hänselte Kayleigh.
Morna stützte ihren Kopf auf die Hände und starrte verträumt in den Spiegel. »Ja, aber Duncan ist so ... er ist einfach so ...«
»Verärgert.«
»Was?«
»Ich schätze, er ist verärgert.« Kayleigh beugte sich zu ihrer Schwester hinunter. »Hast du vergessen, wie spät wir bereits dran sind?«
»Natürlich!« Morna sprang auf und stopfte alle möglichen Kleinigkeiten, die eine Lady so braucht, in ihre Dose: eine kleine Schere, Faden, ihre letzte Haarnadel; dann war sie fertig zum Gehen.
»Dein Saum!«, rief sie plötzlich entsetzt aus.
»Mein Saum? Ist er ausgerissen?« Kayleigh blickte an ihrem Rock herunter. Tatsächlich, eine Seite schleifte über den steinernen Fußboden.
»Ich werde mich, so schnell ich kann, umziehen! Das verspreche ich! Ich brauche nicht lange.«
»Nein, Kayleigh, ich fahre schon mal. Ich hole Duncan ab, und wir treffen dich dann in Forsyth Knoll. Dann machen wir unser Picknick eben dort.«
»Du willst allein fahren? Was soll Mrs MacKinnon dazu sagen? Sie wird uns für so etwas Unschickliches eine ordentliche Strafpredigt halten.«
»Mrs MacKinnon wird es nicht erfahren. Sie besucht ihre Schwester, und wenn du es ihr nicht erzählst ...«
Morna funkelte sie drohend an.
»Ich erzähle ihr nichts, aber –«
»Wir treffen uns also in Forsyth Knoll, Kayleigh.« Morna rauschte aus dem Zimmer.
Kayleigh lief ihr nach. »Aber Morna, vielleicht solltest du lieber warten!« Doch ihre Worte fielen auf taube Ohren. Morna war schon um die Ecke.
Kayleigh brauchte nicht lange, um sich umzuziehen. Und bald schon war sie auf der Spitze von Forsyth Knoll und sah Mornas Kutsche nach, die unter ihr in Richtung Moray Firth Road fuhr. Sie überlegte kurz, ob sie den Berg hinunterlaufen und versuchen sollte, ihre Schwester einzuholen und doch noch zu begleiten, aber der Tag war zu warm, und sie war zu träge, deshalb blieb sie, wo sie war, und genoss die Aussicht.
Überall um sie her blühten Glockenblumen. Zarter Ginster bedeckte den Hügel. Es duftete nach Wacholder, nach Schafwolle und nach dem Meer. Das Leben war einfach zu schön!
Ihre Röcke blähten sich in der Brise auf. Kayleigh setzte sich und beschloss, Mornas Kutsche zu zeichnen, wie sie langsam auf dem Weg dahinzog. Aber bevor sie noch die Kohlestifte aus ihrer Dose hervorgeholt hatte, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte.
Voller Entsetzen und in Panik erstarrte Kayleigh, als sie sah, wie Mornas Kutsche in die Schlucht nahe am See stürzte. Nicht eine Minute war vergangen, als auch schon fast ein Dutzend Reiter auf der Straße auftauchten. Kayleigh konnte sich nicht erklären, woher die Männer plötzlich kamen. Sie verstand auch nicht, warum sie die Schreie ihrer Schwester unbeachtet verhallen ließen und seelenruhig von ihren Pferden stiegen und das abgestürzte Gefährt betrachteten.
Kayleigh war entsetzt bei dem Gedanken, dass ihre Schwester schwer verletzt sein könnte und ihr niemand zu Hilfe kam. Sie rannte den Abhang hinunter. Sie musste Morna helfen! Auf halbem Wege sah sie, dass einer der Männer – sie konnte ihn aus der Entfernung nicht erkennen – die Kutschentür öffnete. Gott sei Dank, endlich kümmerte sich jemand um ihre Schwester. Aber bevor sie noch einen Schritt tun konnte, hörte sie den grauenhaften Schrei.
Kayleigh blieb wie angewurzelt stehen – ungläubig und wie betäubt vor Schreck. Gleich darauf kam der Kopf des Mannes wieder zum Vorschein, und diesmal erkannte sie ihn: Es war ihr gut aussehender Verehrer, ihr Vetter Straught. Hinter ihm entdeckte sie den leblosen Körper ihrer Schwester, der langsam nach vorn sank. Starr vor Entsetzen sah Kayleigh das Blut auf dem glockenblumenblauen Kleid ihrer Zwillingsschwester. Sie war außerstande, einen Schrei zu unterdrücken. Erst danach wurde ihr bewusst, dass sie damit wahrscheinlich ihr eigenes Todesurteil besiegelt hatte.
Sobald sie ihren Schrei hörten, riefen Straughts Leute aufgeregt durcheinander und deuteten auf den Hügel. Instinktiv zog sie sich zurück, aber nicht bevor ihr Blick den ihres Vetters traf.
Niemals hätte sie sich träumen lassen, dass sie mit der Zurückweisung ihres Vetters solch eine Wahnsinnstat provozieren könnte. Aber es war geschehen, vor ihren eigenen Augen. In einem kurzen Augenblick hatte er ihre Welt auf den Kopf gestellt. Und das, was sie sich für ihr Leben gewünscht hatte, war mit einem Mal zu einem brutalen Ende gekommen.
»Genau wie mit der anderen, Leute. Macht es genau wie mit der anderen«, befahl Straught seinen Männern. »Dann bringt sie mir, und wir legen sie neben ihre Schwester.«
Straughts Männer machten sich schon auf den Weg. Sie floh, und obwohl Tränen ihren Blick verschleierten und ihre langen Röcke sie behinderten, versuchte sie, so schnell wie möglich in dem Wald, der den See säumte, zu verschwinden. Aber die Stimmen der Männer, die ihr auf den Fersen waren, verstummten nicht. Sie schluchzte und wechselte die Richtung. Gegen alle Vernunft hoffte sie, am See eine gute Seele zu finden, die ihr helfen würde.
Aber sie wurde eingeholt und gefangen. Sobald sie den Wald hinter sich gelassen hatte, stand ein Mann vor ihr und hielt sie fest. Mit Gewalt zog er sie weiter den Abhang hinunter. Als sie am Seeufer angekommen waren, hob der schreckliche Gefolgsmann ihres Vetters das Messer. Das wilde Flackern in seinen Augen sagte Kayleigh, dass er es ihr direkt ins Herz stoßen würde.
Teil I:La Nouvelle-Orleans, Mai 1746
1
Keuchend erwachte sie aus ihrem Albtraum.
Sie fuhr sich mit den Händen übers tränennasse Gesicht. Ihr Herz war schwer, und sie hatte das Gefühl, in der schweren, feuchten Luft ersticken zu müssen.
Lange blieb sie so in der Dunkelheit liegen und dachte an Morna. Der Geist der Schwester schien ständig über ihr zu schweben, und sie sehnte sich so sehr danach, ihre Schwester bei sich zu haben. Es wäre wunderbar, die langen Nächte von Louisiana mit ihr gemeinsam zu erleben und sie als Freundin in dem schwierigen, einsamen Leben, das sie nun führte, an ihrer Seite zu haben.
Aber Morna kam nicht. Sie seufzte vor Enttäuschung und wusste, dass sie das tun musste, was sie schon tausendmal davor auch getan hatte. Sie versuchte, an eine glücklichere Zeit, an ein glücklicheres Leben in Schottland zurückzudenken, nach dem sie sich immer noch so sehr sehnte. Aber in dieser Nacht schien ihr auch der kleinste Trost versagt zu bleiben.
Plötzlich konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, wie sich französische Seide auf der Haut anfühlte. Sie konnte sich nicht mehr an die wohlige Wärme des Birkenfeuers in einer kühlen Nacht erinnern. Heute Nacht gelang es ihr nicht einmal, Mhor Castle unter den tanzenden Flocken des allerersten Schnees zu sehen. Die Vergangenheit entglitt ihr mehr und mehr.
Ein Jahr fort von zu Hause, da musste die Erinnerung ja allmählich verblassen, sagte sie sich. Aber dann schloss sie ihre Augen wieder ganz fest und zwang sich, an jede Einzelheit zu denken, die ihr nur einfiel, um gegen das Vergessen anzukämpfen.
»Kestrel hat mal wieder ihren Traum.« Die Bemerkung kam aus der dunklen Ecke der Hütte. Die Stimme nannte sie nicht Kayleigh, nicht bei dem Namen des jungen schottischen Mädchens aus ihren Träumen, sondern Kestrel. Kestrel – nach dem kleinen Falken aus der Alten Welt, der seinen Kopf immer gegen den Wind hält.
»Nein«, widersprach sie leise und versuchte, sich an das Wappen zu erinnern, das in das Besteck, das sie in Mhor benutzt hatten, graviert war.
»Ne, ne, Mädchen, du kannst mir nichts vormachen«, versicherte die Stimme leise. Man hörte ein Rascheln, dann bohrte sich ein langer knochiger Finger in ihre Rippen. »Du kannst machen, was du willst. Aber diesen verfluchten Tag in Mhor, den wirst du nie vergessen!«
»Ich habe Mhor vergessen. Mhor ist weg.« Die Worte entsprachen mehr der Wahrheit, als sie selbst für möglich gehalten hatte. Niedergeschlagen setzte sie sich auf.
»Komm, Mädchen. Wo ist dieser Kampfgeist, der mir getrotzt hat, als ich dich an jenem Tag in Mhor töten wollte, und der mir die Tat unmöglich gemacht hat? Und wir mussten fortlaufen, bis hierher?«
»Vielleicht ist er weg, Bardolph. Diese Hitze in Louisiana hat mir den letzten Kampfgeist geraubt.« Sie strich über das einfache Lager, das ihr als Bett diente. »Ich kann hier nicht einmal atmen. Oh, warum gibt es nicht wenigstens ab und zu einmal einen kühlen Wind?«
»Ich habe keinen Wind, aber heute Morgen habe ich dir etwas anderes mitgebracht, wonach du dich schon lange sehnst.«
Black Bardolph nahm den Kerzenständer aus Holz aus dem Fenster. Dann sah er sie mit dunklen, tief liegenden Augen erwartungsvoll an. Sie erhob sich von ihrem graugrünen Moosbett und schüttelte ihren zerschlissenen Unterrock aus. Ein winziges schwarzes Kätzchen krallte sich verschlafen an ihre Röcke, aber es konnte sich nicht halten und fiel zu Boden.
»Also, was für eine Überraschung hast du, Bardie? Gütiger Himmel, du bist aber zeitig aufgestanden – oder bist du etwa die ganze Nacht über weg gewesen?« Sie hob fragend eine Augenbraue und blickte ihn prüfend an. Bardolph war ein Nachtmensch. Das stand fest. Mit seinem knöchernen hässlichen Körper und seinem langen grauen Haar ging die Dunkelheit gnädiger mit ihm um als das Tageslicht. Er war nicht gerade jemand, den man gern ansah, weniger noch ein Mensch, den man als liebenswert bezeichnen konnte. Aber sie liebte ihn. Er hatte sie verschont und in diesem vergangenen Jahr versucht, das Leben für sie so erträglich wie möglich zu machen.
»Sieh mal. Hab’s auf einem Fensterbrett gefunden, wo’s heute Nacht zum Trocknen lag. Ich hätt’s ja schon eher gebracht, aber die alte Hexe, der es gehörte, lief wie ein Höllenhund hinter mir her!« Bardolph öffnete einen Beutel und holte einen lavendelfarbenen Unterrock hervor. Kestrel griff überglücklich danach und strich andächtig über die feine Seide.
»Oh, Bardie, du bist schlecht bis auf die Knochen«, flüsterte sie.
»Ja, ja, aber ich hab’s doch für dich getan. Was sollte ich schon mit so einem Ding anfangen? Probier ihn mal an, Mädchen. Wette, du hast vergessen, wie es ist, feine Kleider zu tragen.«
»Bestimmt hängt die Frau, der er gehört, sehr an ihm.« Kestrel zögerte.
»Die hat einen von jeder Farbe, hab ich gehört! Zieh ihn schon an!«
Sie nahm den Unterrock. Dann drehte sie Bardolph den Rücken zu und zog den Unterrock unter ihre zerschlissenen Röcke. Die Seide fühlte sich wunderbar an, auch wenn der Unterrock viel zu kurz für sie war.
»Sie sind einfach zu großzügig, Sir.« Dankbar küsste Kestrel Bardolph auf die Stirn.
»Ja, ja, das bin ich allerdings«, stimmte er erfreut zu. »Nun mach dich fertig, Mädchen. Es wird schon hell.«
»Und was hast du dir diesmal ausgedacht?«
Statt ihr zu antworten, schob Bardolph sie an die Waschschüssel.
Kayleighs Morgentoilette dauerte nicht lang – sie fuhr sich mit einem angefeuchteten Lappen übers Gesicht und kämmte ihr Haar mit den Fingern. Hier gab es keine nach Flieder duftenden, von flinken Händen vorbereiteten Bäder und keine Zofe, die ihr das Haar frisierte. Aber trotz Bardolphs spöttischen Bemerkungen über ihre Anstrengungen tat sie immer noch ihr Bestes, um einigermaßen anständig auszusehen. Sie würde sich nicht gehen lassen, egal, wie hart das Leben für sie auch geworden war.
Und ihr Leben war wirklich hart. Sie blickte auf und direkt in Bardolphs Augen. Nicht einmal sein hässliches Gesicht konnte ihr solch grauenhafte Schauder über den Rücken jagen wie die drohenden Schreckensbilder aus ihrem Traum. Es war wirklich eine Gnade, wenn man aus so einem Albtraum wieder aufwachte. Sie versuchte zu vergessen. Aber egal, wie sehr sie sich auch bemühte, den immer wiederkehrenden Traum aus ihrer Erinnerung zu löschen, es gelang ihr nicht. Tiefer Kummer machte sich in ihrem Herzen breit. Sie zog die Bänder ihres Mieders fester.
»O je!«, rief sie leise aus. »Jetzt ist es gerissen!« Sie blickte auf das zerrissene Band in ihrer Hand, dann schloss sie ihr Mieder so gut es eben ging. Arm, wie sie war, trug sie ihr Mieder ohne Korsett. Vor Monaten schon hatte sie die langen Eisenstäbe verkauft, um für das Notwendigste aufkommen zu können.
»Da ich dir jetzt den neuen Unterrock organisiert habe, brauchst du sicher auch ein Korsett, wie? Vielleicht sogar ein ganz neues Mieder?«, hänselte Bardolph.
»Und wo, denkst du, werden wir das Geld herbekommen, um diese Dinge zu kaufen?« Kestrel schüttelte den Kopf.
»Die Bonaventure läuft heute ein. Hab gehört, es sind ’ne Menge reicher Leute drauf. Sogar Thionvilles Tochter, die gerade aus Paris kommt.«
»Und du willst, dass ich dorthin gehe und ein paar Geldbörsen stehle?«
»O Mädchen, ich würde so üble Sachen ja selbst machen, aber du weißt ja, meine Schmerzen in den Gelenken! Und es ist schwer, in eine Tasche zu greifen, wenn die Hände zittern!«
»Ja, das kommt von dem vielen Rum. Er wird dich noch umbringen, Bardie.«
»Ich kämpfe ja gegen den Durst an. Wirklich. Aber es ist stärker als ich. Wenn du nur bei einem oder zwei Passagieren Erfolg hast, würde es fürs Erste reichen. Du könntest ein paar neue Sachen für dich kaufen, und ich könnte etwas Rum holen – gerade genug, damit die Hände aufhören zu zittern, verstehst du? Wie sieht’s aus, Mädchen? Die Bonaventure könnte ein guter Fang sein.«
»Dieser Unterrock ist eine reine Bestechung, stimmt’s, Bardie?«
»Ne, ne! Obwohl – ich hätte ihn auch verkaufen können ... aber ich hab’s nicht getan.«
»Ich merke sehr wohl, wenn ich bestochen werde.« Kestrel verschränkte die Arme über der Brust und blitzte ihn ärgerlich an. »Du bist durch und durch verdorben, Bardolph Ogilvie. Um deine Seele zu retten, braucht es mehr als Gottes Gnade.« Sie sah, wie er sich wand, aber als er sich mit seiner zitternden Hand durch sein Haar fuhr, empfand sie Mitleid. Das Trinken würde ihn noch umbringen, aber Rum war alles, wofür der verrückte Kerl lebte.
»Ich gehe, Bardie. Wenn die Passagiere wirklich so reich sind, wie du behauptest, denke ich, dass ihnen ein bisschen weniger Geld nicht übermäßig viel ausmacht.«
»Ach, du bist ein Engel, Liebes.« Er krampfte seine Hände zusammen, damit sie das Zittern nicht sehen konnte. »Du wirst nicht so lange brauchen, oder?«, fragte er wie ein kleines Kind.
»Nein, ich bin bald zurück.« Sie hob ihre Röcke und zog ihr sgian dhu, den schwarzen schottischen Dolch, aus dem Strumpfband. Es war ihr wertvollster Besitz in diesem neuen Leben. Sie hatte ihn vor einem Jahr auf dem Schiff von Glasgow geschenkt bekommen. Der frühere Besitzer war ein junger Mann gewesen, und kurz vor seinem Tod hatte er ihr klargemacht, dass sie den Dolch in der Neuen Welt sicher brauchen würde. Wie von ihm prophezeit, hatte sie schnell lernen müssen, damit umzugehen. Sie trug ihn stets bei sich.
»Ich hab dich gut geschult!« Bardolph lachte und ließ seine alten verfaulten Zähne sehen. »Du bist sehr schnell, Kestrel. Ich hoffe nur, du triffst nie auf einen, der schneller ist.«
Kestrel grinste nur. »Wenn es in der Hölle friert – dann wird die Zeit gekommen sein.« Sie steckte das Messer wieder in die Kalbsledertasche unter ihre Röcke. »Ich gehe jetzt zum Schiff.«
»Das ist gut, dann kommt wieder Geld in die Kasse! Wenn Straught uns jetzt sehen könnte! Wir sind noch lang nicht tot, bei Gott!« Er rieb sich in kindischer Vorfreude die Hände.
Bei der Erwähnung des Namens Straught wurde Kestrel eiskalt. Es gab nicht viele Dinge, die ihr den Mut nehmen konnten, aber allein der Name ihres Vetters genügte, ihr Schauder der Angst über den Rücken zu jagen. Er hatte ihre Zwillingsschwester umgebracht. Und er hätte auch sie getötet, wenn Bardolph nicht genau wie der Jäger in ›Schneewittchen‹ gehandelt hätte, der den Befehl seiner Herrin nicht befolgt hatte.
»Ja, ich wette, er hätte nie für möglich gehalten, dass ich meinen neunzehnten Geburtstag erlebe«, flüsterte sie leise.
Plötzlich ernüchtert, blickte sie sich in dem winzigen Loch um, in dem sie hausten. Das hier hatte wirklich nichts mehr mit dem luxuriösen Leben zu tun, das sie einst geführt hatte. Aber tief in ihrem Herzen sehnte sie sich danach, wieder die Lady zu sein, die sie einmal gewesen war.
»Du wirst eines Tages mit ihm abrechnen, Mädchen.« Bardolph schien ihre Gedanken gelesen zu haben.
»Nicht wir werden eines Tages abrechnen?«
»Nein, ich bin nur ein alter Kauz aus dem Armenviertel von Edinburgh. Ich habe nicht die Macht, an dem Vetter deines Vaters Rache zu üben.« Er versuchte zu lachen, aber die Kummerfalten in seinem Gesicht vertieften sich nur.
»Ich gehe eines Tages zurück, nicht wahr, Bardie? Und wenn ich erst wieder in Mhor bin, dann hat Erath Straught nichts anderes als den Galgen zu erwarten.«
»Ja, Mädchen, das stimmt! Die Leute glauben, dass du tot bist, aber wenn du dich in Mhor zeigst, werden sie erfahren, was wirklich geschehen ist. Sie werden wissen, dass deine Schwester nicht durch einen Unfall ums Leben kam. Es war Mord. Denk nur mal an die Folgen! O ja! Du kannst sicher sein, dass Straught der Gedanke an dich Tag und Nacht quält, ich wette, er hat nicht mehr ruhig geschlafen seit diesem Tag. Ständig wird er sich fragen, was aus dir geworden ist. Er kann nicht sicher sein, dass du tot bist und denselben Weg gegangen bist wie –«
»Nein! Sprich den Namen nicht aus!« Kestrel stöhnte und biss sich auf die Unterlippe. Ein Bild tauchte aus ihrem Unterbewusstsein auf – grelles Rot auf hellem Blau. Es war ihr Schwachpunkt, diese Erinnerungen an Morna.
Aber das Trauern um ihre Zwillingsschwester konnte ihr nicht helfen zu überleben. Es füllte ihr nicht den Magen, und es schützte sie auch nicht vor den Gefahren der Nacht. Nur stehlen sicherte ihr das Überleben. Weder die Tränen noch die Wünsche oder die Träume konnten etwas an ihrer Situation ändern.
Langsam kam sie wieder zu sich, und ihr jugendlicher Schwung kehrte zurück. Sie dachte an ihre Pläne – an die Schiffspassage nach Schottland. Es war schwierig, ihre Ersparnisse vor Bardolphs gierigen Fingern zu verbergen, aber sie hatte schon eine ganze Menge auf die Seite geschafft. Wenn ihre Beute heute einträglich sein würde, hatte sie vielleicht schon genug. Bald würde sie nach Mhor zurückkehren können, dachte sie jetzt wieder voller Zuversicht. Wie groß auch immer das Risiko war, es lohnte sich in jedem Fall.
»Die Bonaventure wartet!« Kestrel lächelte, als sie die Hütte verließ.
Der Gang zum Kai war nicht besonders angenehm. Wo Kestrel lebte, lungerten alte Saufbrüder herum. Als sie an den Männern vorbeikam, machte sich einer von ihnen einen Jux daraus, sich tief vor ihr zu verbeugen. Kestrel tat einfach so, als merke sie es nicht, und die anderen begannen, erst recht zu grölen.
»Mademoiselle! Wie hoch Sie Ihren Kopf tragen! Viel höher, als es Ihnen zusteht, finde ich!«, rief der Trunkenbold in gebrochenem Englisch. Die anderen, die bei ihm standen, brachen in schallendes Gelächter aus, aber Kestrel ging unbeirrt weiter.
Eine Hure kam auf sie zu und faselte irgendetwas Unverständliches. Es war offensichtlich, dass die abgehärmte Frau eine Münze wollte, aber Kestrel hatte nichts, was sie ihr geben konnte. Schließlich zerrte die Hure an Kestrels Rock. Als Kestrel auch noch gegen eine Mauer gedrückt wurde, zog sie ihren Dolch. Die Frau gab Fersengeld.
Kestrel wusste, dass man sie unter den Flussleuten nicht akzeptierte. Besonders die Huren, die am Kai standen, mochten sie nicht.
Die Männer jedoch, die sich noch nicht mit Alkohol ruiniert hatten, waren die Übelsten, und Kestrel ging ihnen möglichst aus dem Weg. Sie schienen Bardolph auf Schritt und Tritt zu umlagern – wie Verwandte, die nur auf die Testamentseröffnung aus waren. Kestrel wusste, dass sie nur auf Bardolphs Tod warteten und darauf, dass die hochmütige, unnahbare Frau an seiner Seite schutzlos und mutterseelenallein auf der Welt zurückblieb.
Kestrel runzelte bei diesem Gedanken die Stirn. Aber schnell schob sie ihn beiseite, denn sie war inzwischen am Hafen angelangt, und vor ihr lag die Bonaventure. Das Schiff musste irgendwann in den frühen Morgenstunden angekommen sein. Die Fracht wurde schon gelöscht. Kestrel sah sich aufmerksam nach der besten Goldquelle um.
Eine dürre Kuh ging schwerfällig die Leitplanke hinunter. Die Zuschauer verfolgten jede gequälte Bewegung des Tieres. Bei ihrem Anblick lief ihnen das Wasser im Munde zusammen. Rindfleisch war knapp in New Orleans, und die wertvolle Kuh würde man hüten wie einen Augapfel.
Aber Kestrel bemerkte einen Zuschauer, der von dem Anblick des Tieres nicht sonderlich beeindruckt zu sein schien. Sie trat hinter den riesigen Rumfässern hervor und beobachtete den Mann genauer. Er stand auf dem Zwischendeck des Schiffes, und sein Gesicht drückte Langeweile aus, als sei er nicht daran gewöhnt, hinter einem Rind von Bord zu gehen. Und er schien alles andere als erfreut über den Anblick der schmutzigen Bevölkerung von New Orleans zu sein.
Kestrel beobachtete ihn verstohlen. Er war ein gut aussehender Mann, nicht älter als fünfunddreißig. Er hatte breite Schultern und überragte die Matrosen, die auf den Decks herumliefen und dicke und schwere Taue sicherten. Aber nicht nur das Aussehen des Mannes weckte ihr Interesse. Es war etwas weit Verführerischeres. In den Falten seines leuchtend weißen Hemdes glitzerte ein riesiger Saphir.
Dieses Schmuckstück war wertvoll und schön. Es glitzerte in der Morgensonne, und Kestrel konnte den Blick kaum abwenden. Der Edelstein war weit mehr wert als eine Schiffspassage nach Schottland.
Kestrel seufzte. Sie würde ihr Messer brauchen, um den Edelstein zu bekommen. Und das war ein großes Risiko. Sie warf noch einen verstohlenen Blick auf den Mann und registrierte genau die Entschlossenheit, die um seinen Mund lag, und den Schimmer seiner blauen Augen – oder waren sie grün? Vielleicht war der Edelstein das Risiko doch nicht wert. Der Mann sah aus, als könnte er ihr Messer mit Leichtigkeit abwehren und gegen ihr eigenes Herz richten.
Aber sie konnte wenigstens versuchen, an seinen Geldbeutel zu kommen. Das war viel einfacher.
Kestrel musterte unruhig ihr Opfer. Er würde sie nicht zu fassen bekommen, versicherte sie sich selbst. »Also die Geldbörse«, flüsterte sie und schlich näher an die Gangway.
Die Passagiere der Bonaventure kamen die Gangway herunter. Zuerst eine sehr dicke Französin, gekleidet in kirschrote Seide, dann eine junge Frau in lindgrünem Brokat. Kestrel starrte sie neidisch an. Sie hätte zu gern ihre Hand ausgestreckt und den teuren Stoff berührt. Sie war erst zehn Jahre alt gewesen, als ihre Eltern an dem Fieber gestorben waren, aber immer noch konnte sie sich ziemlich genau daran erinnern, wie die Kleider ihrer Mutter den Steinboden in der Halle gestreift hatten und wie sich die schweren Seidenmäntel ihres Vaters angefühlt hatten.
Kestrel richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Kai, als die junge Französin den vornehmen Herrn mit dem Saphir ansprach.
»St. Bride, Sie werden doch Maman und mich besuchen? Wir kommen uns hier ohne Ihre Gesellschaft sicher ganz verloren vor. Wir sind an Paris gewöhnt und an das herrliche Leben dort. Diese primitive Stadt wird nur schwer zu ertragen sein.« Die junge Französin zog einen Schmollmund.
»Aber Lady Catherine«, antwortete der Mann namens St. Bride, »Ihre Maman wird Sie schon bald mit einem Comte verheiraten. Welchen Gefallen könnten Sie schon an meiner Gesellschaft finden? Ich fürchte, Sie werden mich als genauso einfach und barbarisch empfinden wie die Leute hier.« Er lächelte, und Kestrel sah, dass seine Augen türkis waren und in seinem attraktiven Gesicht weit mehr leuchteten als der blaue Stein, der an seinem Hemd steckte. Sie waren wie das Meer, genauso wechselhaft wie der Ozean – bereit, zu zerstören oder zu umschmeicheln. Unwillkürlich erschauderte Kestrel.
»Aber St. Bride« – die Wimpern der Französin senkten sich auf ihre gepuderten Wangen –, »Ihre Gesellschaft ist der jedes anderen Mannes vorzuziehen.«
»Du musst nicht so bitten, Catherine«, hörte Kestrel die Mutter der jungen Frau mit strenger Stimme sagen. »Um einen Mann einzufangen, muss man zurückhaltend sein! Komm jetzt!« Die Comtesse löste sich aus der Menge. Dann ließ sie sich in eine elegante vergoldete Kutsche helfen, die auf die beiden Frauen wartete. »Dein Vater erwartet uns«, rief die Mutter noch, bevor sie sich in die Brokatpolster des Wagens sinken ließ.
Eine bunte Menge von zerlumpten Menschen, Dirnen und Seeleuten stand in der Nähe der Kutsche. Kestrel wusste, dass nicht nur diese Zurschaustellung von Reichtum die Leute anlockte. Ehrfurcht und Angst zogen sie an. Die Kutsche konnte man leicht als eine von Thionvilles erkennen. Und Kestrel war plötzlich sehr glücklich, dass sie bisher mit ihrem Beutezug gezögert hatte. Jean-Claude de Thionville, Comte de Cassell, war kein Mann, dem sie Rede und Antwort stehen wollte. Nein, keinesfalls! dachte sie bitter und gleichzeitig amüsiert. Er war der größte Dieb von New Orleans, und mit all seinem Reichtum und dem Segen des Königs hatte der Comte die gesamte Stadt unter seiner Gewalt. Der einzige Unterschied zwischen ihm und solchen Leuten wie Bardolph war die Qualität seiner Kleider. Nein, sie war sicher, dass der Comte über die Konkurrenz nicht gerade erfreut wäre.
»Ich muss fahren, St. Bride. Sie werden kommen? Ich würde mich über einen Besuch sehr freuen!«, rief Lady Catherine. Kestrels Mund verzog sich vor Abscheu, als sie sah, wie sich St. Bride über Lady Catherines Hand beugte und sie an seine Lippen hob.
»Wir werden sehen, Mylady. Aber auszuschließen ist die Möglichkeit nicht.« St. Bride lächelte wie ein Wolf. Zynismus blitzte in seinen Augen auf, und Kestrel wusste instinktiv, dass er kein Mann war, dem man trauen konnte.
Endlich fuhr die Kutsche mit Lady Catherine und ihrer Mutter mit all dem Pomp und Getue ab, die eines Königs würdig gewesen wären.
Kestrel widmete jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Opfer. Die Menge hatte sich zerstreut, seit die Kutsche abgefahren war. St. Bride stand mit ein paar anderen Passagieren des Schiffes zusammen. Alle Männer, außer St. Bride, wandten ihr den Rücken zu. Er hatte ihr sein Gesicht zugewandt, und Kestrel bemerkte den harten Ausdruck, der darin lag. Obwohl sie es sich nicht eingestehen wollte, brachte dieses Gesicht sie fast dazu, einen Schritt zurückzuweichen. Sie schüttelte ihre Furcht jedoch ab und wagte sich ein Stück weiter vor. Er hatte sein Haar zurückgebunden, und jetzt sah sie auch, dass seine Schläfen silbergrau waren. Das Grau unterstrich seine hageren, kantigen Gesichtszüge und ließ sie beinahe gefährlich aussehen. Wieder war sie versucht, das Weite zu suchen.
Normalerweise kannte sie keine Angst. Schließlich stahl sie nun schon seit fast einem Jahr, und sie hatte nichts zu verlieren. Aber diesmal, während sie noch zögerte, um sich wieder Mut zu machen, war sie beunruhigt. Dieser St. Bride wirkte nicht gerade zugänglich oder nachgiebig.
Zögernd tat sie den ersten Schritt auf den Mann zu.
Sie wartete, bis St. Bride seinen Kopf leicht abwandte. Dann handelte sie. Sie schoss auf ihn zu, den Dolch in der Hand. Dann hob sie den teuren Rock des Mannes und durchtrennte den Lederriemen, an dem sein schwerer Beutel hing. Sie spürte, wie der Beutel in ihre Hand fiel, und in Sekundenschnelle war sie auf dem Rückweg. Ohne den Saphir natürlich. Es war sicher vernünftiger, dem Mann den Dolch nicht an die Kehle zu setzen, so schwer es ihr auch fiel, auf den Edelstein zu verzichten.
»He, du kleine Diebin, du hast meinen Beutel gestohlen!« Plötzlich legte sich eine große, starke Hand auf ihren Nacken. Sie kratzte und schlug um sich wie ein verängstigtes Kätzchen. Aber am meisten schockierte sie die Wärme seiner Hand auf ihrer Haut. Sie gab vor, einen Schwächeanfall zu erleiden. So wie ein Tier sich tot stellt, um mit heiler Haut davonzukommen.
»Nein, der Beutel war Ihnen heruntergefallen. Ich wollte ihn zurückgeben.« Kestrel rührte sich nicht. Sie blickte den großen Mann mit ängstlichen Augen an. St. Bride wirkte amüsiert, aber unglücklicherweise nicht so, als würde er ihr leicht vergeben.
»Ach nein, du wolltest ihn zurückgeben? Und dabei wolltest du in die entgegengesetzte Richtung davonlaufen?« St. Bride nahm ihr den Beutel aus der zierlichen Hand und steckte ihn in seinen Hosenbund. Seine Hand lag immer noch in ihrem Nacken. Dann wandte er sich einem seiner Gefährten zu und rief: »Was ist das für ein höllischer Ort, an den man uns gebracht hat? In was soll man hier investieren? In Bettler und Diebe?«
Aber Kestrel achtete nicht auf seine Worte. Sie starrte auf St. Brides breite, mächtige Brust. Der Saphir leuchtete so blau wie der Himmel in ihrer Heimat. Das war einfach zu viel! Sie konnte nicht widerstehen. Sobald sich St. Brides Aufmerksamkeit auf die anderen richtete, zog sie heftig an seinem Halstuch, riss den Saphir an sich. Überrascht ließ St. Bride sie einen Moment los, und sie war frei.
Aber schon wieder hatte sie den Mann unterschätzt. Er brauchte nur zwei Schritte, um sie einzuholen. Kurz bevor sie die Fässer erreichte, umfasste er ihre Taille und hob sie hoch. Aber beide unterschätzten den glatten Untergrund und fielen in den Matsch neben dem Gehweg.
St. Bride musste lachen, als er seine schmutzverschmierten Stiefel und die dreckige Hose sah, aber Kestrel war nicht sicher, ob dies ein gutes Zeichen war. Sein Lachen klang böse, alles andere als fröhlich. Sie wusste nicht, ob er sie gehen lassen oder ihr den Hals umdrehen würde. Er nahm ihr den Stein aus der Hand und steckte ihn in seine Hosentasche.
»Versuch’s nicht noch einmal, Mädchen! Ich warne dich.« Ihre Blicke trafen sich, und das eigenartige Leuchten in seinen Augen brachte sie aus der Fassung. Sie wehrte sich gegen seinen Griff, aber er zog sie nur noch näher an sich. Dann lächelte er sie mit einem Lächeln an, das ihr faszinierend und zugleich verwerflich erschien.
»Nein, lassen Sie mich los!«, schrie Kestrel und hämmerte mit den Fäusten gegen seine Brust. Sie konnte nur noch auf die Gnade des Mannes hoffen, falls er überhaupt so etwas wie Mitgefühl besaß, aber dessen war sie sich alles andere als sicher. »Ich bin nur ein armes, schwaches Mädchen, das etwas Geld braucht. Haben Sie doch Mitleid mit einem Kind, ich weiß, dass Gott in seiner Güte Ihnen eine gute Tat für den Rest Ihres Lebens vergelten wird.«
Sie sah ihn an und hoffte gegen alle Vernunft, dass er sie nicht den Behörden übergeben würde. Sie war noch nie in einem Gefängnis gewesen, aber Bardolph hatte ihr erzählt, dass es dort schlimmer war als am Hafen. Es wimmelte von Ungeziefer, und es stank und war dreckig. Sie erschauderte allein bei dem Gedanken.
»Kind?«, imitierte er ihren gälischen Akzent. Dann schob er ihr Hemd beiseite und entblößte die weiche, volle Wölbung ihrer Brust. »Du bist kein Kind. Und irgendwie« – er griff nach ihrem Kinn und zwang sie, ihn anzusehen – »irgendwie scheinst du mir ein bisschen zu gebildet und zart, um als Diebin deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weshalb stiehlst du, Gassenmädchen?«
»Lassen Sie mich los!«, rief sie. Sie ging auf seine seltsam scharfsinnige Bemerkung lieber gar nicht ein. »Bitte«, stieß sie hervor. Ihre dunkelblauen Augen, die von dichten schwarzen Wimpern umrahmt waren, flehten ihn an.
»Seit wann kennen Taschendiebe das Wörtchen ›bitte‹?«, fragte er mit ruhiger Stimme. Eine ganze Weile musterte er sie prüfend, und sie wurde rot – seinen Augen entging nichts; nicht ihre zarte Haut, nicht die weichen Rundungen ihres Körpers, auch nicht die Narben an ihren Waden, die von dem Leben zeugten, das sie seit einem Jahr führte.
Plötzlich war ihr klar, dass sie gewonnen hatte. Er war ein Mann von schnellen Entschlüssen und würde seine Zeit nicht damit vergeuden, eine Diebin vor den Richter zu führen. Er hatte anderes zu tun.
»Ferringer, lassen Sie Malcolm dieses Stück Dreck ins Gefängnis bringen. Sie ist eine kleine Taschendiebin. Und sie hat obendrein Ihre Kleider ruiniert.« Ein kleinerer Mann, von dem Kestrel bisher nur den Rücken gesehen hatte, hob seinen Fuß, um nach ihr zu treten. Sie sah nicht mehr von ihm als seine teuren Schuhe mit den kunstvollen Silberspangen, dennoch wich sie der Attacke geschickt aus – aber St. Bride entkam sie nicht.
»Eine Taschendiebin ist sie, aber immerhin ist sie auch eine Frau!« St. Bride erhob sich und warf dem Mann, der versucht hatte, nach ihr zu treten, einen wütenden Blick zu.
»Ich habe gar nicht die Absicht, sie ernstlich zu verletzen. Aber wir müssen die Verbrecher bestrafen. Dieser Ort ist nicht einmal halb so zivilisiert wie Savannah.« Während der kleinere Mann sprach, betrachtete Kestrel sein Gesicht genauer. Ihre Augen weiteten sich, und sie starrte den Mann mit einer eigenartigen Faszination an. Sie war wütende Opfer ihrer Raubzüge gewohnt, aber beim Anblick dieses Mannes setzte ihr Herz einen Schlag aus.
Er war klein, aber trotzdem war er im Grunde gut aussehend. Seine feinen Gesichtszüge und der rotblonde, zu einem Zopf geflochtene Schopf waren beeindruckend. Seine etwas zu schmalen Lippen wirkten vielleicht ein wenig brutal, und seine aristokratische Nase war zwar etwas zu lang, aber gerade diese Mängel verliehen seinem Gesicht etwas Interessantes. Die grauen Augen erschienen ihr so vertraut wie die nordatlantische Meeresküste.
Kestrel schaute dem Mann genauer in die Augen. Sie waren ja gar nicht grau – im Inneren war ein ganz kleiner roter Fleck, ein Satansmal.
Ihr Mund öffnete sich, und ein Schauder lief ihr über den Rücken, als würden die kalten Finger des Todes ihr Herz umklammern. Sie stand ihrem Feind gegenüber – dieser Mann war Straught. Sie betete, dass er sie nicht erkennen möge. Aber das war eher unwahrscheinlich. Schließlich war sie nicht mehr die elegante Herrin eines schottischen Schlosses, sondern eine Bettlerin und Taschendiebin. Nein, Straught würde sie nicht erkennen.
Für ihn war Kayleigh auf mysteriöse Weise verschwunden. Er wusste nicht, dass Black Bardolph Ogilvie, einer seiner Helfershelfer, sie verschont und mitgenommen hatte. Straught hatte nicht gewusst, dass Bardolph unter ständigen Schmerzen litt und fürchtete, bald nutzlos für seinen Herrn und ohne Arbeit zu sein, und dass er jemanden zum Überleben brauchte – jemanden, der für ihn stahl, damit er Rum kaufen konnte, und ihm half, sich in der Neuen Welt zurechtzufinden.
Nein, dieser Mann hatte keine Ahnung, was aus Kayleigh geworden war. Vielleicht dachte er sogar, dass sie nicht mehr am Leben war.
Kestrel wollte kein zweites Mal von diesem Mann bedroht werden. Langsam wich sie einen Schritt zurück, obwohl St. Bride sie immer noch festhielt.
»Lassen Sie mich gehen«, bat sie mit leiser Stimme, die ihre Furcht verbarg.
»Erst, wenn ich es für richtig halte.« St. Bride blickte voller Wärme auf das fremde schöne Wesen, das er in seinen Armen hielt.
»Lassen Sie mich los!«, schrie sie in Panik. Ihr Dolch lag fast in Reichweite neben ihnen im Schlamm.
»Wenn du ein gutes Mädchen bist, werde ich dir ein Geldstück schenken. Aber hör auf, gegen mich anzukämpfen!«, forderte St. Bride gereizt.
Sie weigerte sich. Die grau-roten Augen des Teufels mit Namen Erath Straught belauerten sie, und sie spürte, dass der Engel des Todes von Sekunde zu Sekunde näher auf sie zukroch. Bei Gott! – Er hatte sie doch erkannt!
»Ich sagte, lassen Sie mich los!«, schrie sie und wand sich in den Armen des Mannes. Endlich gelang es ihr, den Dolch an sich zu nehmen. St. Bride, der nichts gemerkt hatte, fasste nach ihrer Hand, und die Schneide des Dolchs grub sich tief in das zarte Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Du kleines Miststück!«, brüllte er zornig. Blut tropfte auf ihren Rock. In seinem Schmerz ließ er sie los, und sie verlor keine Zeit. Wie der Blitz war sie fort. Er blieb zurück mit nichts als der Erinnerung an schlanke, schmutzverschmierte Waden und mitternachtsblaue Augen.
2
»Es war Straught, das steht fest«, stieß Kestrel, immer noch atemlos von ihrer Flucht, aus.
»Aber wie ist das möglich? Wie konnte er uns finden?« Bardolph nahm einen großen Schluck aus der Flasche. Seine Finger zitterten so sehr, dass er kaum in der Lage gewesen war, die Flasche zu entkorken. »Diese Augen. Sie lassen dich an den Teufel glauben, wirklich. Wenn du diese Augen gesehen hast, dann war der Mann Straught.«
»Ich habe seine Augen gesehen«, antwortete sie ruhig. »So viele Dinge habe ich vergessen, aber an diese Augen werde ich mich ein Leben lang erinnern.«
»Verdammt, ohne Geld kommen wir hier nicht weg!«, fluchte Bardolph. »Dieser Engländer mit dem Schmuck – seine Seele sei verflucht für die Gesellschaft, in der er sich bewegt!«
»Ich werde eine Geldbörse bekommen. Ich versuch’s noch mal.« Kestrel sah an ihrem blutbefleckten Rock hinunter. In Gedanken versunken, sagte sie: »Ich will nur schnell das Blut abwaschen ...«
»Kestrel.« Bardolph griff nach ihrem Arm. »Es hängt alles von dir ab. Ich hab dein Leben einmal gerettet. Aber ich kann’s kein zweites Mal tun.« Sie sah, dass Bardolph genauso große Angst hatte wie sie. Er zitterte sogar. Der alte Trunkenbold hatte wahrscheinlich nur eine einzige gute Tat in seinem ganzen Leben vollbracht, aber er würde teuer dafür zahlen müssen, wenn Straught sie je fand.
»Diesmal sorge ich dafür, dass uns nichts geschieht, Bardie. Irgendwie komme ich an Geld, und wir gehen von hier weg – das verspreche ich dir.« Nervös goss sie Wasser aus einem Eimer auf ihren Rock. Als das Blut nur noch ein undefinierbarer Fleck unter vielen anderen war, wrang sie den Stoff aus und verließ die Hütte.
Der Tag war lang und mühsam. Um die Dinge nicht noch schlimmer zu machen, konnte Kestrel es nicht riskieren, zurück zum Hafen zu gehen. Nach ihrem Ärger mit St. Bride würde dort bestimmt jeder nach dem blutrünstigen Mädchen Ausschau halten, das ihm die Hand aufgeschlitzt hatte. Deshalb blieb sie bei den Baracken und hoffte, dass sie dort einem herumirrenden Soldaten etwas Gold aus der Tasche ziehen konnte.
Aber an diesem Tag hatte sie kein Glück. Sie verabscheute die Gegend um die Baracken, denn sie war noch schlimmer als der Hafen. Die Männer mit ihren dreieckigen Hüten und den langen blauen Jacken schrien ihr Obszönitäten zu und gestikulierten mit ihren Bajonetten. Es war schauderhaft.
Immer mehr französische Soldaten wurden auf sie aufmerksam und versuchten, nach ihr zu greifen. Sie ahnten nicht, dass Kestrel ihnen am liebsten die Kehle aufgeschlitzt hätte. Erst als sie endlich merkten, wie ernst das Mädchen es mit ihrem glänzenden Elfenbeinmesser meinte, ließen sie es in Ruhe.
Dunkelheit senkte sich über die Baracken, und Kestrel war sich im Klaren, dass sie aufgeben und mit leeren Taschen nach Hause gehen musste. Um die Soldaten musste man nachts einen großen Bogen machen, und schon wurden die ersten Kerzen in den halb verfallenen Gebäuden angezündet. Obwohl die Luft schwül war, überliefen Kestrel eiskalte Schauer. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie allein sie im Grunde war.
»Jeune fille! Jeune fille!«
Kestrel wirbelte herum. Obwohl sie sicher war, dass ihr Vetter Straught kein Wort Französisch beherrschte, fürchtete sie, dass er sie gefunden hatte und nach ihr rief. Sie hätte vor Erleichterung fast laut gelacht, als sie den betrunkenen Soldaten aus einem der Barackenfenster lehnen sah. Kestrel verschwand schnell in der Dämmerung.
»Ich hoffe, das Dach bricht über ihren Köpfen zusammen!«, fluchte sie leise und entdeckte mit Genugtuung einen besonders heruntergekommenen, verlausten Wachtposten. Obwohl ihre Wut auf diese Männer, die sie immer anpöbelten, sie ablenkte, war ihr doch die Gefahr bewusst, in der sie sich befand. Sie musste zu Bardolph zurück und konnte nur hoffen, dass der morgige Tag erfolgreicher sein würde.
Sie mied den Hafen, überquerte den Kai und blieb einen Moment zögernd stehen, um die vielen Hütten, die dicht am Mississippi standen, zu überblicken. Die Wände waren aus Balken errichtet, die man tief in den sandigen Grund geschlagen hatte, und die Dächer waren spärlich mit trockenen Palmenblättern gedeckt, durch die abends dünne Rauchsäulen aufstiegen. Die Leute machten kleine Feuer, um sich ihr armseliges Essen zuzubereiten.
Es war ein trauriges Dasein, das sie hier am Fluss führten, dachte Kestrel, während sie das Tanzen und Flackern des Lichts zwischen den Balken der Hütten betrachtete. Ihr Heim hielt nur so lange wie das Holz, das in den durchnässten Boden geschlagen worden war, und das war kurz genug. Wenn das Wasser im Fluss stieg, waren sie gezwungen, auf eine Anhöhe zu ziehen und ihre Hütten dort neu aufzubauen. Welch ein Kontrast zu den kleinen Steinhütten, die verstreut über die Bergschluchten Schottlands lagen! Ihr jedenfalls war es immer so vorgekommen, als würden die Steinkaten seit Menschengedenken an ihrem Platz stehen – sie waren unverwüstlich wie das Hochland selbst.
Kestrel fragte sich, was wohl aus den Robertson-Jungs, den Kindern ihres Schäfers, geworden war, die in einer solchen Kate gewohnt hatten. Die Nachricht von der letzten großen Schlacht in Schottland war bis nach New Orleans gedrungen, und Kestrel wusste, dass sie in der Nähe von Inverness stattgefunden hatte. Man sprach davon, dass sich dort alles sehr verändert hatte.
Kestrel rannte den Kai hinunter und versuchte nicht einmal, den Mengen von Flusskrebsen auszuweichen, die ihr im Wege lagen. Erst als sie an den Nachbarhütten angekommen war, wurde sie langsamer.
Sie musste Straught entkommen, und sie musste sich beeilen und zu Geld kommen. Leidenschaftlich verfluchte sie diesen St. Bride und seine Schnelligkeit. Sie erinnerte sich nur zu gut an das herrliche Gewicht seines Geldbeutels, den sie kurz in ihren Händen gehalten hatte. All ihre Sorgen hätten ein Ende gehabt, dachte sie, wenn dieser Brite nicht gewesen wäre. Sie und Bardolph hätten diesem elenden Leben entkommen können.
»Ich hatte kein Glück«, sagte sie, als sie die Hütte betrat. Es war zu dunkel, um Bardolph sehen zu können. Als er keine Antwort gab, sprach Kestrel trotzdem weiter, weil sie vermutete, dass er zu betrunken war, um sich eine Fackel anzuzünden und sie zu begrüßen. »Aber morgen wird es mir gelingen. Dann bekomme ich Geld. Wenigstens hat Straught nicht die leiseste Idee, wo wir uns aufhalten.«
Sie spürte das weiche Fell, das sich zur Begrüßung an ihren Beinen rieb. »Mo Chridhe, ach, du hast Hunger!« Sie hob ihr schwarzes Kätzchen hoch. Dann tastete sie sich durch den dunklen Raum zum Tisch, auf dem Kienspan lag, und suchte den Feuerstein, um Licht zu machen. Dann wandte sie sich wieder dem Tier zu.
»Haben wir denn gar keinen Fisch für dein Abendessen?« Sie bemerkte Bardolph nicht, der ausgestreckt auf dem Boden lag, als sie aus einer Steingutschüssel eine getrocknete Makrele für das Kätzchen herausnahm. Aber plötzlich vernahm sie ein gurgelndes Geräusch. Sie starrte in die Ecke, aus der es kam.
»Kestrel«, murmelte Bardolph. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. Seine Kehle war von einer Seite bis zur anderen durchschnitten.
»Mein Gott, mein Gott! Was ist geschehen?« Sie schlug die Hände vor den Mund und lief zu ihm.
»Kestrel, es war Straught.«
»Nein, das ist nicht wahr. Er weiß nicht, wo wir leben«, flüsterte sie. Sie war wie gelähmt bei dem Anblick von so viel Blut. Sie drückte Chridhe fest an ihre Brust, bis es dem Kätzchen zu viel wurde und es miaute.
»Er hat es herausbekommen ... er hat es herausbekommen. Kestrel ... vielleicht etwas Wasser. Sei ein gutes Mädchen.« Bardolphs Stimme war kaum hörbar.
Ihre Hand zitterte so, dass es ihr kaum gelang, den Schöpflöffel aus dem Eimer zu heben. Sie klammerte sich immer noch verzweifelt an Chridhe und brachte Bardolph das Wasser. Dann half sie ihm, einen Schluck zu trinken. Wieder das gurgelnde Geräusch. Es war klar, dass er dem Tode nahe war.
»Versprich mir, dass sie mich hier nicht liegen lassen. Ich werde bis in alle Ewigkeit keine Ruhe finden, wenn ich nicht ordentlich unter die Erde komme. Versprich es mir, Kestrel.« Er streckte flehend seine Hand aus.
»Bardolph, beweg dich nicht. Du bist ... zu verletzt«, rief sie wie betäubt.
»Ich hab dich gerettet, Mädchen. Vergiss das nicht. Als du keine Hoffnung mehr hattest, habe ich dir welche gegeben!«, flüsterte er und zog an ihren Röcken. Die Anstrengung raubte ihm den letzten Atem. »Vielleicht kannst du Rache nehmen. Vielleicht kannst du es tun ... Kayleigh.« Immer noch klammerte er sich an sie. Er schloss die Augen und bereitete sich auf sein Ende vor.
»Bardolph!« Sie schüttelte seinen bewegungslosen Körper. »Lass mich nicht allein! Du darfst nicht sterben!« Starr vor Angst zog sie seine schlaffe Hand an ihre Brust. Chridhe miaute. Das Tierchen wollte fort, aber Kestrel wollte das Kätzchen nicht auch noch verlieren. Chridhe war das Einzige, was ihr auf der ganzen Welt noch geblieben war. Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie hätte sich am liebsten auf Bardolphs Totenlager geworfen, um Trost bei ihm zu finden.
Es gelang ihr, sich etwas zu beruhigen und sich ihre schreckliche Lage zu vergegenwärtigen. Sie war dumm gewesen zu glauben, dass Straught mit seinen kalten gefühllosen Augen sie nicht am Hafen erkannt hatte. Er war ihretwegen gekommen, und er hatte sie gefunden. Der Ort war zu klein, als dass man sich vor ihm hätte verstecken können.
Kestrel wischte sich die Tränen von den Wangen und setzte sich. Chridhes seidenes Fell unter ihrer Hand war tröstlich, aber die Gedanken, die durch ihren Kopf wirbelten, raubten ihr beinahe den Atem. »Was soll ich jetzt tun?«, flüsterte sie mit vor Angst wie wild klopfendem Herzen. »Was soll ich jetzt nur tun?«
»Still, Kayleigh. Beweg dich nicht«, flüsterte eine Männerstimme hinter ihr. Der schmeichelnde Tonfall verursachte ihr eine Gänsehaut. Eine warme weiche Hand legte sich um ihren Hals. »Wirf das Messer weg, Kayleigh, und dreh dich langsam.«
Sie schloss ängstlich die Augen. Ihre Hand griff nach dem Messer am Strumpfband, aber sie hatte nicht den Mut zuzustoßen.
Plötzlich tauchte ein riesiger Kerl vor ihr auf. Der Dolch fiel ihr aus den Händen. Der Kerl packte sie bei den Schultern und presste sie an seine Brust. Dann erlaubte er ihr, sich umzudrehen.
Straughts Augen starrten sie hasserfüllt an.
»Du bist also hierhergekommen, um mich zu töten, mein lieber Vetter Erath?«, flüsterte sie und warf ihren Kopf zurück. »Du und deine Bande von Halsabschneidern! Wie gut erinnere ich mich an diese Männer, die an jenem letzten Tag in Mhor nach mir gesucht haben. Du bist ein Feigling! Eine ganze Armee von Männern gegen zwei junge Mädchen ...«
»Du bist trotzdem davongekommen.«
»Und ich werde wieder davonkommen!«, schrie sie.
»Ach, aber diesmal war es wirklich leicht, dich einzufangen! Vergib mir, dass ich so lange gebraucht habe, dich zu finden. Aber hätte ich gewusst, dass du mich schon gleich am Hafen empfangen würdest, hätte ich nicht zugelassen, dass mich meine Geschäfte in Mhor und in London so lange aufhalten.« Straught fuhr mit einem warmen Finger über ihren zierlichen Hals, dann trat er zurück.
Sie zuckte unter seiner Berührung zusammen. Chridhe mochte die Umstände genauso wenig wie sie und fauchte in ihren Armen, als wollte sie ihre Herrin beschützen.
»Was kann ich für dich tun, Kayleigh? Oder heißt du jetzt Kestrel? So jedenfalls nannten dich die kleinen Huren, als ich dich beschrieb und ihnen ein bisschen Gold gab.« Straught lachte. »Sie mögen dich nicht besonders! Wenn du nicht so eigensinnig gewesen wärst, würden wir beide und Morna jetzt ein glückliches Leben in Mhor führen.«
Kayleigh drehte das Gesicht zur Seite. Sie durfte jetzt nicht an Morna denken, aber es war ihm gelungen, Schuldgefühle in ihr zu wecken. Oh, wie sehr sie wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Wie anders würde sie handeln!
Straught beobachtete ihre Reaktion. Dann wurde er nachdenklich und kratzte sich den Kopf. »Trotz allem, was geschehen ist, verspüre ich so etwas wie Familienbewusstsein, und ich will dir aus dieser misslichen Lage heraushelfen. Es gab schließlich eine Zeit, in der ich dich zu meiner Frau machen wollte.« Er räusperte sich und blickte sie an. Kestrels Nerven waren zum Zerreißen gespannt.
»Wenn ich gewusst hätte«, begann sie, aber er schnitt ihr das Wort ab.
»Was? Wenn du gewusst hättest, dass ich deine Schwester und dich umbringen könnte, hättest du mich geheiratet? Ha! Wie großzügig von dir, Kayleigh! Du musst wirklich schrecklich böse auf mich sein, dass ich dir die Dinge nicht vorher erklärt habe. Alles wäre so anders gekommen!«
»Ja, alles wäre dann anders!«, schrie sie. »Weil ich dich unterschätzt habe, klebt jetzt das Blut meiner Schwester an meinen Händen. Ich hätte sie retten können, wenn ich geahnt hätte, wozu du fähig bist!«
Straughts folgende Worte kamen leise und weich. »Nein, das hättest du nicht tun können, meine Liebe. Wenn du gewusst hättest, was ich tun würde, hättest du so reagiert, wie ich es von dir erwartet hätte. Du hättest mir ins Gesicht gespuckt und mich ins Gefängnis werfen lassen.« Er lächelte grimmig. »Aber die Dinge können sich ändern. Was empfindest du jetzt für deinen Vetter, Mädchen?« Er trat einen Schritt vor, und instinktiv wich sie zurück.
»Dachte ich es mir doch«, meinte er trocken. Dann fasste er unter ihr Kinn und hob ihr Gesicht an. »Wenn ich dich so ansehe, frage ich mich, ob du es dir noch leisten kannst, so hochmütig zu sein.«
Sie antwortete nicht. Ihre Angst war so groß, dass sie keinen Laut herausbrachte.
»Ich könnte dich mit ins Hochland nehmen, Kayleigh. Möchtest du das?« Straught ließ ihr Kinn los und begann, mit den Quasten seiner goldbestickten Jacke zu spielen. Sein vornehmes Äußeres stand in scharfem Widerspruch zu dem des ungehobelten Riesen hinter ihm. Er wandte ihr wieder seine Aufmerksamkeit zu, und seine Blicke trafen ihre.
Lächelnd fuhr er fort. »Aber natürlich müsste ich dir die Zunge herausschneiden, damit du nicht über Dinge reden kannst, die besser unausgesprochen bleiben. Aber du könntest immerhin in dein Zuhause zurückkehren. Das wäre nicht so schlecht. Dann gäbe es keinen unangenehmen Klatsch mehr über Mhor Castle. Denk nur, wie reizend das wäre!«
Sie schwieg immer noch. Chridhe schlug mit der Pfote verspielt nach einer Haarlocke. Blind für das menschliche Leid, das um sie herum herrschte, versuchte das Kätzchen seiner Herrin zu zeigen, dass es hungrig war und immer noch auf das Abendessen wartete. Plötzlich schien Straught die Situation amüsant zu finden.
»Hat die Katze deine Zunge verschluckt, meine Liebe?«, fragte er und begann schallend zu lachen. Als er sich beruhigt hatte, fuhr er fort. »Ach ja, vielleicht reicht es ja gar nicht, deine Zunge herauszuschneiden. Ich erinnere mich, dass du schon als Kind schreiben konntest. Wir müssten dir auch die Hände abhacken.« Er griff grob nach ihrer schmutzigen Hand. Kestrel sprang bei seiner Berührung zurück und direkt an die Brust des anderen, der sie immer noch festhielt.
»Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe!«, kreischte sie. Und sie hasste sich selbst für die Angst und die Schwäche, die sich in ihrer Stimme offenbarten.
»Bedenke doch, Kayleigh. Ich gebe dir noch diese eine Chance. Ich möchte dich nicht töten – es wäre eine Sünde, ein so bezauberndes Wesen wie dich umzubringen.« Straught trat vor, und sie zuckte wieder zurück. Ruhig sagte er: »Meine Liebe, warum denkst du nicht an deinen Vater? Er hätte es so gewollt. Ich bin schließlich sein Vetter. Er bewunderte mich, und er hätte gewünscht, dass ich mich um dich kümmere, damit du nicht mutterseelenallein in der weiten Welt bist.«
»Wie kannst du nur so lügen! Mein Vater hatte Mitleid mit dir, Erath. Du warst nur ein armer Verwandter! Es tat ihm leid, dass du so wenig Vermögen hattest und in schlechte Gesellschaft geraten bist. Darum hat er dir Mhors Jagdhaus überlassen, aber er hätte dir niemals etwas geben dürfen. Du hast ihn verraten – du hast seine Tochter ermordet! Du ekelhaftes Scheusal!« Sie war glücklich, dass endlich die Wut in ihr überhandnahm. Sie trat vor, aber der Kerl, der sie an den Armen festhielt, zog sie mit Gewalt zurück an seine Brust.
»Du kleines Luder, ich bin und war immer der rechtmäßige Erbe von Mhor, nicht so wie Mornas Kerl, der so scharf auf dieses dumme Ding war!«
»Mornas Verlobter war ein guter Mann. Er hätte sie glücklich gemacht... er hätte jedes Mädchen glücklich gemacht«, verteidigte sie Duncan.
»Und ich hätte dich