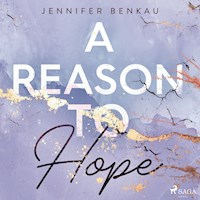Kämpferische und gewalttätige Frauen in der italienischen Malerei von 1470 bis 1660 E-Book
Irene Tischler
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Kunst - Übergreifende Betrachtungen, Note: 1,00, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Institut für Kunstgeschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn brave Mädchen/Frauen in den Himmel kommen, böse aber überall hin, was passiert dann mit mordenden Göttinnen, gepanzerten Jungfrauen nach der Schlacht, listigen Heroinen oder Fürstinnen, die Tugend und gewaltige Macht für sich beanspruchen? Die vorliegende wissenschaftliche Abschlussarbeit stellt den Versuch dar, auf Fragen des Bildthemas der kämpferischen und gewalttätigen Frauen differenzierte Antworten zu finden. Bildanalytisch vorgehend, wurde zuerst eine ikonographische Beschreibung des Dargestellten geleistet, deren Ergebnisse dann zu einem Vergleich mit primären Quellen, wie zeitgenössischer und klassischer Literatur herangezogen wurden. Anschließend vervollständigten indirekte Quellen, die die zeitgenössischen, kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse beleuchten, die Verortung des Kunstwerks, also ihre Bezugsetzung zu AutorIn, Umfeld und eventuellen Pendants und die Erkenntnisse der aktuellen, wissenschaftlichen Sekundärliteratur den Bedeutungshorizont der Bilder. Die rekonstruierte Bildaussage macht deutlich wie der scheinbare Widerspruch des Themas der kämpferischen/bewaffneten und gewalttätigen/handgreiflichen Frau zur traditionellen, dominierenden Auffassung der Frau als passives, (geistig) schwaches, abhängiges, friedfertiges/gewaltloses etc. Wesen in der italienischen Malerei dieses Zeitraumes verarbeitet wurde. Mittels verschiedener Analysekategorien konnte nachgewiesen werden, dass sich bildliche Repräsentationen von so charakterisierten Frauen in hochkomplexen Kontexten von Gewalt, Macht und Autonomie bewegen. Das thematisch sehr umfangreiche Gebiet wurde beschränkt auf zwei heidnische Heroinen, nämlich Erminia, der sarazenischen Prinzessin und Camilla, der Heerführerin der römischen Epoche, die römischen Göttinnen Minerva und Diana und die alttestamentarischen Figuren Jaël und Judit, welche daraufhin anhand 17 ausgewählter malerischer Bildwerke besprochen wurden. Die bildlichen Repräsentationen von kämpferischen und gewalttätigen Frauen in der italienischen Malerei von 1470 bis 1660 – das wurde in differenzierten Analysen nachgewiesen – sind somit nicht Ausdruck eines Vorzeichenwechsels der Geschlechterverhältnisse und -Identitäten, vielmehr erbrachte meine Diplomarbeit den Nachweis der Komplexität, Ambivalenz und Polydimensionalität des Diskurses über dieses Thema in Kontexten von Gewalt, Macht und Autonomie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
INHALTSVERZEICHNIS
I. FRAGESTELLUNG
II. STELLUNGEN UND BEDEUTUNGEN VON FRAUEN IN DER ZEIT VON 1470 BIS 1660
III. THEMA „KÄMPFERISCHE UND GEWALTTÄTIGE FRAUEN" IN JENER ZEIT
IV. HEIDNISCHE HEROINEN
1. Literarische Quellen - Allgemeine Ikonographie
2. Bild 1: Guercino: Erminia und der Schäfer (siehe Abbildung 2)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
3. Bild 2: Sandro Botticelli: Camilla bändigt den Kentauren (siehe Abbildung 4)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
4. Conclusio „Sterbliche heidnische Heroinen"
V. GRIECHISCHE GÖTTINNEN MINERVA
1. Literarische Quellen - Allgemeine Ikonographie
2. Bild 3: Artemisia Gentileschi: Minerva (siehe Abbildung 8)
(a) Biographisches zur Malerin
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
3. Bild 4: Andrea Mantegna: Minerva verjagt die Laster aus dem Garten der Tugend (siehe Abbildung 10)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
4. Bild 5: Elisabetta Sirani: Minerva kleidet sich an (siehe Abbildung 13)
(a) Biographisches zur Malerin
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
5. Conclusio „Minerva"
VI. GRIECHISCHE GÖTTINNEN DIANA
1. Literarische Quellen - Allgemeine Ikonographie
2. Bild 6: Tiziano Vecellio: Tod des Aktaion (siehe Abbildung 17)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
3. Bild 7: Tintoretto: Tod der Niobiden (siehe Abbildung 18)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
4. Conclusio „Diana"
VII. BIBLISCHE GESTALTEN: JAEL
1. Literarische Quellen - Allgemeine Ikonographie
2. Bild 8: Artemisia Gentileschi: Jael und Sisera (siehe Abbildung 22)
(a) Hintergrund
(b) Beschreibung
(c) Ikonographie - Details
3. Bild 9: Lodovico Cardi Cigoli: Jael und Sisera (siehe Abbildung 23)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
4. Conclusio „Jael"
VIII. BIBLISCHE GESTALTEN JUDIT
1. Literarische Quellen - Allgemeine Ikonographie
2. Bild 10: Fede Galizia: Judit mit dem Kopf des Holofernes (siehe Abbildung 27)
(a) Biographisches zur Malerin
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
3. Bild 11: Giorgione: Judit mit dem Haupt des Holofernes (siehe Abbildung 28)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
4. Bild 12: Cristofano Allori: Judit mit dem Haupt des Holofernes (siehe Abbildung 31)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
5. Bild 13: Botticelli: Die Rückkehr Judits nach Betulia (siehe Abbildung 36)
(a) Hintergrund
(b) Beschreibung
(c) Ikonographie - Details
6. Bild 14: Michelangelo Buonarroti: Judit und Holofernes (siehe Abbildung 39)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
7. Bild 15: Artemisia Gentileschi: Judit und ihre Hausangestellte (Pitti) (siehe Abbildung 41)
(a) Hintergrund
(b) Beschreibung
(c) Ikonographie - Details
8. Bild 16: Caravaggio: Judit tötet Holofernes (siehe Abbildung 42)
(a) Biographisches zum Maler
(b) Hintergrund
(c) Beschreibung
(d) Ikonographie - Details
9. Bild 17: Artemisia Gentileschi: Judit tötet Holofernes (Uffizi) (siehe Abbildung 44)
(a) Hintergrund
(b) Beschreibung
(c) Ikonographie - Details
10. Conclusio „Judit"
IX. ERKENNTNISSE ÜBER DAS THEMA „KÄMPFERISCHE UND GEWALTTÄTIGE FRAUEN IN DER ITALIENISCHEN MALEREI VON 1470 BIS 1660"
X. ABBILDUNGSNACHWEIS
XI. BIBLIOGRAPHIE
Dreifach gelobte hohe Frau,
gewalt'ge, bleib uns gnädig.
Die vorliegende Arbeit wurde von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold- Franzens-Universität Innsbruck, Österreich, im Sommersemester 2004 und nach Begutachtung durch Herrn Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph Bertsch als Diplomarbeit angenommen.
I. FRAGESTELLUNG
In meiner Arbeit möchte ich malerische Werke aus der Zeit von 1470 bis 1660 untersuchen, mit dargestellten Frauenfiguren, an denen ein kämpferischer oder gewalttätiger Charakter manifest ist.
Hierzu wählte ich folgende feminine Gestalten in die erste Analysegruppe: die zwei heidnischen Sterblichen Erminia, sarazenische Prinzessin im Waffenrock, sowie Camilla, die jungfräuliche Heerführerin der römischen Zeit. Die zweite Gruppe an schlagkräftigen Frauen beleuchtet die römischen Göttinnen: Minerva, deren glänzende Waffen schon allein, den GegnerInnen Angst einzujagen scheinen und Diana, Jägerin, die auch Menschen tötet. Die dritte und letzte, christlich geprägte Untersuchungsgruppe hat sich auf zwei Heroinen eingeengt: Jael, die Sisera tötete und die keusche Witwe Judit, welche Holofernes ermordete. Für die vorliegende Studie ausgewählt wurden diese Gestalten, da sie bewaffnet oder eine Waffe führend dargestellt wurden. Einige sind gerade in eine gewalttätige Aktion verwickelt; alle bieten einen bellicosen Aspekt.
Wichtig war mir der Rückgriff auf Werke, zu denen bereits die Grundlagen wissenschaftlich erarbeitet wurden und die im kulturellen Gedächtnis eine Verankerung gefunden haben. Daraus und aus dem Interesse an der Epoche der italienischen Renaissance, die als Zeit der Wiedergeburt der KünstlerInnen betrachtet wird, ergab sich ein bearbeitbarer Zeitrahmen, der mit dem Schaffensjahr des chronologisch ersten Bildes beginnt und mit jenem des chronologisch letzten endet.
Vom Vorgehen her werde ich in einem ersten Schritt die historische Stellung und Bedeutung von Frauen zu jener Zeit herausarbeiten. Anschließend gehe ich auf das Thema der kämpferischen und gewalttätigen Frau/Frauen in seiner historischen und politischen Verfasstheit näher ein, was als Vorbereitung für die Analyse dient. In einem zweiten Schritt widme ich mich der Analyse von nicht weniger als siebzehn Bildern, die unter drei Kategorien subsumiert wurden: sterbliche heidnische Heroinen (Erminia und Camilla), römische Göttinnen (Minerva und Diana) sowie biblische Gestalten (Jael und Judit). Danach werde ich auch Auskunft über die MalerInnen, deren Oeuvre und eventuell ergänzende Bilder geben. Nur marginal werde ich dann auf die malerischen und kompositorischen Qualitäten verweisen, nämlich dort, wo es sich um relevante Informationen für die Fragestellung handelt. Nicht ohne genauer auf den aussagekräftigen, literarischen Hintergrund des jeweiligen Bildes zu sprechen zu kommen, werde ich jede Darstellung im Detail beschreiben. Dadurch wird klarer werden, inwiefern es Übereinstimmungen oder Differenzen im ikonographischen Bereich zwischen Literatur und Malerei gibt. Viel liegt mir zudem an der Charakterisierung der Heroine, ihrer GegnerInnen und Begleiterinnen. Darüber hinaus werde ich über Deutungsmöglichkeiten und Wertungen intellektueller und wissenschaftlicher Herkunft berichten und diese zueinander in Bezug setzen. Meine geschlechtersensible Fragestellung fokussiert dabei auf den verschiedenartigen und visuell kommunizierten Relationen zwischen Kampf und Gewalt, Autonomie und politischem Handeln.
II. STELLUNGEN UND BEDEUTUNGEN VON FRAUEN IN DER ZEIT VON 1470 BIS 1660
Der Körper einer Frau wurde in der Zeit von der Renaissance bis zum Frühbarock, auf den Erkenntnissen Aristoteles, Hippokrates und Galens basierend, als Abweichung vom Körper eines Mannes aufgefasst. Der männliche Körper galt als Norm. Das Entstehen von menschlichem Leben wurde als Einpflanzung des männlichen Samens in den femininen Körper ausgelegt. Die Kenntnis der Eizelle datiert erst in die späte Neuzeit. Das bedeutete, dass die Zeugung allein durch einen Mann vollzogen wurde, der Körper einer Frau hingegen eine schützende und nährende Hülle darstellte, ohne die keine Entwicklung von Statten gehen könne. Diese Vorstellung ging einher mit der allgemeinen Annahme, dass Frauen kein schaffendes Potential besäßen. Weder wären sie zu wissenschaftlicher Bildung noch zu technischen Erkenntnissen oder gar politischen Entscheidungen fähig. Ihnen wurde der reproduktive und damit der passive Anteil am menschlichen Leben zugesprochen. Vor allem die Erziehung der (femininen) Kinder und die Organisation des Haushalts wurden aufgrund dieser gesellschaftlichen Einstellungen zu ihren Aufgaben. Das kreative und aktive Potential aber wurde fast ausschließlich dem männlichen Geschlecht zugestanden. Aus dieser grundlegenden Dichotomie wurden, wie Foucault nachwies[1], noch weitere gegensätzliche Eigenschaften und Zuständigkeitsbereiche abgeleitet, die Frauen und Männer charakterisierten:
Die bedeutendsten Zuschreibungen, die auf ein menschliches Wesen angewendet werden konnten, wurden in solch ein binäres und hierarchisches Schema gebracht. Das männliche auf der einen Seite galt dem femininen Geschlecht auf der anderen Seite als grundsätzlich vorrangig.
Von der wichtigsten Kategorie: gut/gerecht/schön, eine Einheit, die von Platonismus und christlicher Lehre propagiert wurde, war bis jetzt noch nicht die Rede. Der christliche Gottesbegriff, der eine große Präsenz hatte - davon ist zweifellos auszugehen - wurde dabei mit einem Maximum und dem Superlativ des Guten, Gerechten und Schönen konnotiert. Dem göttlichen Prinzip diametral entgegen gesetzt stand nach christlicher Auffassung der Teufel, als Inkarnation des Bösen und Monströsen. Ausgehend von der aristotelischen Dichotomie Männer - gut und Frauen - schlecht[2] , wurde propagiert, dass Frauen dem Bösen und Teuflischen leichter verfielen als Männer[3]. Hier traf sich die antik-heidnische Tradition mit der biblischen Exegese, die eine/jede Frau als potenzielle Verführerin eines/jeden Mannes deutete und auf sie die Erbsünde zurückführte.
Nachdem nun die Gründe für die Misogynie, jedenfalls Abwertung von Frauen, des 14. bis 17. Jahrhunderts untersucht wurden, muss auch die entgegensetzte Strömung, die Philogynie, näher betrachtet werden. Seit Christine de Pizan (siehe Abbildung 1), die profeministische Debatte mitinitiiert hatte, betrachteten viele Personen das feminine Geschlecht als dem männlichen Geschlecht mindestens gleichwertig.
Abbildung 1: Christine de Pizan und Minerva
Die intellektuellen Fähigkeiten von Frauen und Männer schätzten diese Personen als gleichwertig ein. Der Grund für weniger oder geringere intellektuelle Leistungen von Frauen wurde in der mangelhaften bis nicht vorhandenen Ausbildung von Frauen entdeckt und diese wurde nun rigoros eingefordert. Daneben wurde auch die moralische Kompetenz von Frauen beleuchtet, und hier wurde dem femininen Geschlecht mitunter eine größere Kapazität konstatiert.[4] Damit Hand in Hand ging auch eine Neubewertung und Neuauslegung des Bibeltextes, wobei das feminine Geschlecht auch als Krönung der Schöpfung gedeutet wurde. Allein die körperlichen Fähigkeiten fanden bei der Diskussion nicht so richtig Eingang. Nur gelegentlich, wurde auf einzelne physisch herausragende Frauen jener Zeit verwiesen, die von der philogynen Partei als Vorbild und Ideal präsentiert werden konnten. Es scheint, dass das Urteil Castigliones (II libro del Cortegiano), der selbst den hohen Damen das Reiten und die Beschäftigung mit Waffen nicht zugestand[5], großen Einfluss hatte.
Neben dieser theoretischen Schiene darf nicht auf die praktische vergessen werden, nämlich auf die Wirkung von Frauen auf ihr Umfeld und die Gesellschaft, die durch ihre Taten und Leistungen bewiesen, zu was allem sie fähig waren. Kämpfende, schriftstellerisch tätige, malende, regierende, handwerklich tätige usw. Frauen gab es, und sie machten zweifellos Eindruck auf ihre Umgebung. Die Arbeit und Aktivität von Frauen kann als Verdienstquelle, Zeitvertreib oder Aufgabe des Standes interpretiert werden.
Die genannten Tätigkeitsbereiche von Frauen werden nun kurz beleuchtet, um die Orte von Frauen jener Zeit, die sich in den Bildern mitmanifestiert haben, aufzuzeigen. Ich starte mit der Gruppe von Regentinnen. Eine Frau konnte zu j ender Zeit die Regentschaft eines Landes übernehmen, vorausgesetzt dass sie ihren abwesenden Ehemann oder minderjährigen Sohn vertrat.[6] Diese Aufgabe, die den Zweck verfolgte, die patriarchale Verfassung zu erhalten, bot Frauen die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme und Mitbestimmung. Caterina Sforza soll hier als ein Beispiel von vielen Persönlichkeiten genannt werden. Ihre Person, die sich großer Bekanntheit[7] erfreute, vereinte das Wirken einer Regentin mit dem einer Befehlshaberin.[8]
Auch von Soldatinnen und Befehlshaberinnen in der Schlacht wird berichtet[9], weswegen ich auch mit einigen Worten auf diese zweite Gruppe zu sprechen kommen möchte. Dass regierende Frauen an der Spitze ihrer Heere in den Kampf zogen, mag weniger abwegig erscheinen. Dass sich aber gewöhnliche Frauen als körperlich, waffentechnisch und/oder strategisch fähig erwiesen und im militärischen Bereich mitmischten, unterstreicht ihre aktive Präsenz. „Eine Frau namens Lippa (Filippa) aus dem romagnolischen Raubrittergeschlechter der da Barbiano führte in den Jahren 1399, 1401 und 1404 nach der Gefangennahme ihres Ehemannes und ihres Bruders in der Umgebung Bolognas ihre Leute selbständig in den Krieg gegen die Feinde ihrer Familie."[10] Dieses Beispiel steht aber nicht isoliert da, wie Samuel weiß. Die „Liste der Gelegenheitskriegerinnen der neueren Zeit in Europa ließe sich beliebig verlängern"[11], schreibt dieser.
Eine dritte Gruppe umfasst Handwerkerinnen und Arbeiterinnen. Indem sie Geld verdienten, ernährten sie ihre Familien und verbesserten ihre Zukunftaussichten. Einige konnten dadurch den Beruf in der Familie halten.[12] Allerdings notiert Hufton, dass „i[m] Italien in der Frühen Neuzeit ein Mann, der den Unterhalt von Frau und Töchtern nicht innerhalb seines Hauses gewährleisten konnte, in der Achtung der Gemeinschaft nicht hoch [stand]"[13].
Schließlich, als vierte Gruppe, seien im weitesten Sinn künstlerisch tätige Frauen vorgestellt, die Malerinnen, Autorinnen, Philosophinnen, Humanistinnen, Bildhauerinnen usw. waren. Wenn sie nicht aus ähnlichen Beweggründen wie jene Frauen der vorhergehenden Gruppe in die Arbeitswelt eintraten, dann kamen sie vielleicht aus purem Interesse dazu. Damit meine ich, dass durch Baldassare Castigliones Il libro del cortegiano angeregt, die oberen Schichten danach strebten, ihre Töchter künstlerisch zu fördern, was den Marktwert der Bräute zudem erhöhte.[14]
An dieser Stelle möchte ich kurz über die Ausbildung von Malerinnen von 1470 bis 1660 Bericht erstatten. Nahezu alle Malerinnen wurden von ihren malenden Vätern ausgebildet, so z. B. Pulisena Nelli (1523 Florenz - 1588 Florenz), Lavinia Fontana (1552 Bologna - 1614 Rom), Artemisia Gentileschi (1597 Rom - 1653 Neapel), Elisabetta Sirani (1638 Bologna - 1665 Bologna). Sofonisba Anguissola (1532/1535 Cremona - Palermo 1625) wurde von ihrem Vater, der ein begüterter Edelmann war, zu verschiedenen Malermeistern geschickt, welche die junge Dame ausbildeten[15]. Dort war sie aber offenbar ein „zahlender Gast"[16]. Über Giovanna Garzonis (1699 Ascoli Piceno - 1670 Rom) Ausbildung ist nicht viel bekannt, außer dass sie von einem florentinischen Maler ausgebildet wurde, fernab ihrem Geburtsort Ascoli Piceno.[17] Für das 15. Jahrhundert gibt es keinen Beweis für die Ausbildung von Frauen in einer Bottega, nicht einmal die Töchter von väterlichen Meistern durften in dessen Werkstatt als Lehrling arbeiten.[18]
Die Nennung der Orte aktiver, schaffender Frauen dieser Zeit führte somit vor Augen, dass die theoretische Debatte über das Geschlecht in einen praktischen Diskurs eingebettet war.
Als letzter Punkt der philogynen Debatte, nach theoretischer Descriptio und faktischen Verortungen, soll noch das Wort auf die Praescriptio kommen. Ab der Renaissance tritt nämlich der christliche Tugendkatalog für die Frau stark in Erscheinung, der Beständigkeit (Constantia), Demut (Humilitas), Geduld (Patientia), Frömmigkeit und Mitleid (Pietas), Bescheidenheit (Modestia) und Mäßigung (Temperantia) fordert. Als eine unerlässliche Tugend - für die Frau- gilt aber vor allem die Keuschheit (Castitas), die im Tugendideal des Mannes nie vorkommt. Als Garantin für die Keuschheit ist die Schamhaftigkeit (Pudicitia) oft genug postuliert und für die adelige Frau schon im 15. Jahrhundert im Tugendkatalog nachgewiesen worden.[19] Es bleibt zu vermerken, dass die Tugend der Keuschheit auch für Heroinen große Bedeutung hatte. Hingegen war die Charakterisierung der Männer als mutiges und kräftiges Geschlecht[20], zugleich die Anforderung an sie. Eine Praescriptio, die sich im Idealbild einer Frau allerdings nicht fand[21]. Allein in Torquato Tassos Discorso della Virtu feminile e donnesca (1582) gibt es die feminine Stärke (Fortezza) und Klugheit (Prudenza), jedoch nur bei der adelige Dame und nicht bei gewöhnlichen Frauen aus dem Volk. Solche donne heroiche seien den gewöhnlichen Männern in ihren Tugenden überlegen und den heroischen Männern gleichgestellt. Diese Ansicht wird uns beim ersten zu besprechenden Bild Erminia bei den Hirten noch beschäftigen.
Die Aufregung in dieser Zeit wird offensichtlich, wenn nunmehr die beiden Seiten der Geschlechterdebatte klar zu Tage liegen. Auf der einen Seite die antifeministische oder frauenabwertende Partei, die mit Sicherheit die größere und einflussreichere war. Auf der anderen Seite jedoch die ihr Paroli bietende profeministische Partei. Zahlreiche Traktate über Stellung, Wesen und Aufgaben einer Frau stehen in ebendiesem Kontext geben den zu besprechenden Bildern dieser Abschlussarbeit einen Hintergrund.
Mit einigen wertschätzenden Attributen für Frauen möchte ich dieses einführende erste Kapitel beenden. Im Allgemeinen wurde einer intellektuell tätigen Frau das Kompliment einer virilis femina zugesprochen. Wenn es sich um eine tatkräftige, kämpferische Frau handelte, konnte sie auch mit dem Titel virago geehrt werden[22]. Diese Wortwahl bringt jedoch zugleich eine grundgelegte Verehrung der Männer als tätig-aktive und zugleich geistige Wesen zum Ausruck. King notiert hierzu, dass „Frauen, die die Grenzen der Geschlechtsdefinition überschritten, gehasst und gefürchtet [wurden], wie eine überreiche frauenfeindliche Literatur bezeugt. Doch weckten außerordentliche Frauen [...] auch Bewunderung - eben deshalb, weil ihre Leistungen die eines Mannes waren."[23] Wenn in dieser Tradition Thomas von Aquin schreibt: „homo est naturaliter politicus, id est, socialis", bezieht sich die Aussage auf das männliche Geschlecht, aber nicht zugleich auch auf das feminine Geschlecht. Frauen werden damit mit den Worten der frühen Gender-Vordenkerin Simone de Beauvoir als „das Andere" gedacht und auch in diesem Geiste erzogen.[24] In der Konsequenz bleiben Männer handelnde Subjekte, ganz im Unterschied zu Frauen, die in der Passivität verharren (müssen).[25]
Das 17. Jahrhundert bildete zwei weitere Begriffe für starke, kämpferische und zuweilen gewalttätige Frauen in einer heroischen Tradition aus. Es sind dies „femme forte" und „amazone chretienne"[26].
III. THEMA „KÄMPFERISCHE UND GEWALTTÄTIGE FRAUEN" IN JENER ZEIT
„Das Schwert gilt als Männlichkeitssymbol schlechthin. Es verkörpert Stärke, Macht, Aktivität, Aggression und die Bereitschaft zur unbedingten Verteidigung der körperlichen Unversehrtheit. Schwerter und andere Waffen werden dem Mann zugeordnet, sie gehör(t)en zu seinem Alltag. Frauen dagegen werden in kultur- und epochenübergreifenden Gesellschaften als das Pendant zum Männlichen begriffen: Ist der Mann aktiv, sind sie passiv; ist er aggressiv, haben sie friedfertig zu sein. So fällt ihnen vielfach die Bestimmung zum „Opfer" zu, das erleidet und erduldet. Aggressivität, Verletzung und Mord durch Waffengebrauch bei Frauen werden nach wie vor tabuisiert"[27], sind grundsätzliche Anmerkungen zum ausgewählten Thema aus einem Ausstellungskatalog.
Dass es aber gewalttätige, kämpfende, kriegerische und bewaffnete Frauen gab, zeigen uns nicht nur die archäologischen Befunde, also Gräberfunde[28], neben künstlerischen Zeugnissen, sondern auch überlieferte literarische Texte. Bekundungen des menschlichen Lebens beweisen die Existenz solcher Frauen in allen Zeiten. Die oben beschriebene Dichotomie kann durch die binäre Zuschreibung Männer - kriegerisch und Frauen - friedfertig ergänzt werden. Daher bekundeten Frauen, die diese konstruierte Geschlechtergrenze überschritten, ein starkes, geradezu subversives Interesse an Autonomie und Macht.[29] Dass es in der Kunst aber vorrangig um die Darstellung friedlicher Frauen und kämpferischer Männer ging und selten um die Visualisierung und Beschreibung kämpferischer Frauen, offenbart jedes Kunstlexikon.
Warum es gerade in der Zeit von 1470 bis 1660 vermehrt[30] zu Darstellungen von Gewalttaten kam, darunter solchen, die Frauen an Männern vollziehen, ist noch nicht untersucht worden. Ich kann hierfür keine Erklärung bieten, nur auf die Zeitgeschehnisse verweisen, die nicht ohne Bedeutung sind für das künstlerische Schaffen.
Wertheimer meint: „Nicht das Mittelalter, das den Einsatz der Gewalt letztlich stets an faktischen oder scheinbaren Kategorien der Transzendenz orientiert hatte, sondern die Renaissance ist die hohe Zeit moderner Grausamkeit. Die umfassende Autonomie- und Säkularisierungsbewegung der Neuzeit erst öffnete den Weg zu eigenverantwortlichen, selbst konzipierten Formen individueller Aggression und Destruktion".[31] Damit scheint ein aktuelles Thema jener Zeit, die Individualität, angesprochen, die in den Bereich der Darstellung von kämpferischen und gewalttätigen Frauen stark hineinspielt. „Die „ Wiedergeburt" bestand eigentlich in dem neu erworbenen Bewusstsein von der, - um auf eine zentrale Schrift (um 1460) dieser Zeit von Pico della Mirandola anzuspielen - „Würde des Menschen". Das menschliche Wesen wurde zunehmend als schöpferisch und selbständig begriffen. Auch in der Kunst zeigte sich diese, unter anderem. durch die Antikenrezeption und den Humanismus gespeiste Begeisterung vieler Personen über ihr Mensch-Sein und dessen Möglichkeiten. So konzipiert, erscheint der Mensch - ein Begriff der wie bereits ausgeführt männlich konnotiert war - als ein Wesen der Freiheit, welches, mit eigenem Willen und Tat-Kraft ausgestattet, die Wahl hat, ein Dasein als „Engel oder Bestie" zu führen."[32]
Die angesprochene Autonomie von Personen blieb dabei aber immer einer Obrigkeit unterstellt, die die Subjekte in ihrer Wesensart bestimmen, wie es sich selbst. Damit Hand in Hand geht die Macht religiöser Instanzen, die ebenfalls als Obrigkeit zu verstehen sind. Wertheimer formuliert hierzu: „Die Psychologie des frühen Christentums konzentriert sich auf den Raum der individuellen Erfahrung. Sie solidarisiert sich substantiell mit der Position des Erleidenden, erhöht sie modellhaft zu der des Märtyrers. Orientiert an der Passion Christi entwickelt sich ein neuer Heroenkult aus der Sicht des Opfers."[33] Die ersten nachchristlichen Jahrhunderte zeigten demnach eine Verdrängung der siegreichen, heroischen Person als Identifikationsfigur. Im Mittelalter fand erneut eine Aufwertung der siegreichen heroischen Person statt, deren Tod ähnlich dem vom MärtyrerInnen erschien. Für die Zeit zwischen dem 15. und 17.
Jahrhundert lässt sich also eine parallele, positive Identifikation mit siegreicher und unterlegener Person konstatieren.[34]
An dieser Stelle muss auch der Glaube an das Schicksal kurz beleuchtet werden. Tenner zeigt auf, dass bis zum 15. Jahrhundert die Idee des allmächtigen Schicksals, das von Gott legitimiert ist, vorwiegt. Die humanistische Bewegung griff diese Ansicht an und forderte die Kontrolle über das menschliche Handeln für das Individuum ein. Machiavelli kam vom Glauben an das allmächtige Schicksal vollends ab und postulierte, dass es leicht durch Virtu zu lenken sei. Der Begriff der Virtu, der bei einigen der ausgewählten Bilder eine Rolle spielt, besaß hauptsächlich in der obersten Schicht der Bevölkerung eine große Bedeutung. Regierende dieser Zeit strebten nach dem Ideal der Virtu, was bedeutete, dass sie sich im Kampf bewähren und gleichzeitig als gebildet und moralisch korrekt gelten wollten.[35] Isabella d'Este, kann als besonders herausragendes Beispiel angeführt werden. Sie vertrat ihren Mann in den Regierungsgeschäften bei dessen Abwesenheit, war für den wirtschaftlichen Aufschwung Mantuas durch ihre Einführung von Stoffgroßbetrieben verantwortlich, war ihren Söhnen Beraterin und Kämpferin bei der Erlangung eines guten Postens und tat sich als Retterin von vielen Zufluchtsuchenden beim Sacco di Roma hervor.[36] Auch die übrigen Schichten versuchten ihre Virtu zu erreichen, indem sie sich vor allem moralisch tugendhaft zeigten. Im 16. Jahrhundert scheint wiederum eine Rückkehr zum Glauben an das mächtige Schicksal stattgefunden zu haben.[37]
Die überaus reiche und literarisch fundierte Bildtradition des Themas der kämpferischen, bewaffneten und aggressiven Frau muss aber neben dem aufgezeigten ideengeschichtlichen und sozialen Kontext, welche mit den Schlagworten Individualität und Obrigkeit übertitelt werden können, auch mit wirtschaftlichen und politischen Zeithintergründen kurzgeschlossen werden. Hohe Steuern, Ernteausfälle, städtische (Klein-)Kriege, der Dreißigjährige Krieg, öffentliche Exekutionen, die Pest u. a. haben die Menschen jener zwei Jahrhunderte sicher mitgeprägt und sich auch in den bildnerischen Werken manifestiert. Wie bereits bekundet, kann auf diese Zusammenhänge nur verwiesen werden. Eine ausführliche Untersuchung würde den vorgegebenen Rahmen dieser Arbeit mehr als sprengen.