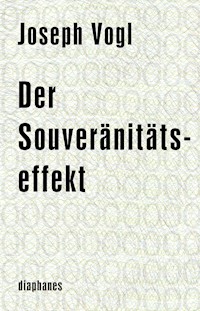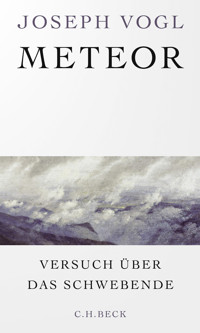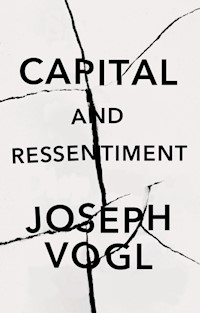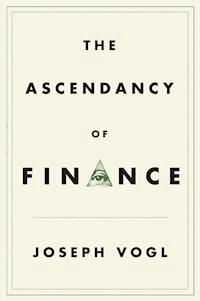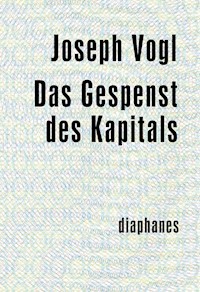11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"DER KLÜGSTE MANN, DER MIR JEMALS BEGEGNET IST." ROGER WILLEMSEN
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung. Joseph Vogl rekonstruiert in seiner brillanten Analyse, wie im digitalen Zeitalter ganz neue unternehmerische Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über nationale Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen.
Drei Thesen zum gegenwärtigen Zeitalter enthält das neue Buch von Joseph Vogl, der seit seinem Bestseller "Das Gespenst des Kapitals" zu den interessantesten Wortführern einer neuen Generation von Kapitalismuskritikern gehört. Erstens: Der Internet- und Plattformkapitalismus der Gegenwart (von Amazon bis Google) ist die jüngste Metamorphose eines Finanzregimes, das sich in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und die Bewirtschaftung von Informationen als attraktive Quelle der Wertschöpfung erkannt hat. Zweitens: Diese Fusion von Finanzökonomie und Kommunikationstechnologien etabliert neue Paradigmen der Macht, deren Resultat fragmentierte Öffentlichkeiten, gesellschaftliche Schismen und Demokratieverlust sind. Drittens: Affektökonomien mit dem Treibstoff des Ressentiments stabilisieren die Dominanz dieses neuen Plattformkapitalismus auf Kosten des Gemeinwohls.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joseph Vogl
Kapital und Ressentiment
C.H.Beck
Zum Buch
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung. Joseph Vogl rekonstruiert in seiner brillanten Analyse, wie im digitalen Zeitalter ganz neue unternehmerische Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über nationale Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen.
«Beinahe alles, was Vogl schreibt, elektrisiert.»
Christian Geyer, FAZ
Über den Autor
Joseph Vogl ist Professor für Neuere deutsche Literatur, Literatur- und Kulturwissenschaft/Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin und Permanent Visiting Professor an der Princeton University. Sein letztes Buch Der Souveränitätseffekt war 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik nominiert.
Inhalt
Vorbemerkung
1. Kapitel: Monetative Gewalt
2. Kapitel: Informationsstandard – zur Episteme der Finanzökonomie
3. Kapitel: Plattformen
4. Kapitel: Kontrollmacht
5. Kapitel: Spiele der Wahrheit
Exkurs: Fabel und Finanz
6. Kapitel: Die List der ressentimentalen Vernunft
Anmerkungen
1. Kapitel: Monetative Gewalt
2. Kapitel: Informationsstandard – zur Episteme der Finanzökonomie
3. Kapitel: Plattformen
4. Kapitel: Kontrollmacht
5. Kapitel: Spiele der Wahrheit
Exkurs: Fabel und Finanz
6. Kapitel: Die List der ressentimentalen Vernunft
Literaturverzeichnis
Gesetze, Urteile, Berichte, Programme
Vorbemerkung
Im Titel Kapital und Ressentiment wird das Bindewort ‹und› einer kritischen Belastung ausgesetzt. Es verweist auf die Frage, wie sich der Aufbau neuer unternehmerischer Machtformen im digitalen Kapitalismus mit der Aushöhlung demokratischer Prozeduren und Institutionen kombiniert. Dabei wird eine Spur verfolgt, die von der Herrschaft der Finanzindustrie über die Entstehung der Plattformökonomie bis hin zu den Dynamiken und Stürmen auf den aktuellen Meinungsmärkten führt.
Einige zentrale Thesen bestimmen den Parcours der folgenden Kapitel. So wird die gegenwärtige Internetindustrie zunächst als Erneuerung eines Finanzregimes begriffen, das sich seit den 1970er Jahren formierte und über diverse Krisen hinweg mit der Bewirtschaftung von Informationen aller Art eine neue Quelle der Wertschöpfung erschloss. Information ist zur wichtigsten Ressource im gegenwärtigen Kapitalismus geworden. Die damit verbundenen Geschäftsmodelle sind zudem einer engen Wahlverwandtschaft zwischen Finanzwesen und Kommunikationstechnologien geschuldet. Was man heute Digitalisierung nennt, ist nicht einfach durch die Umwandlung analoger Werte in digitale Formate und durch die Ausbreitung solcher Technologien in alle möglichen sozialen, politischen und ökonomischen Bereiche charakterisiert. Elektronische Netzwerke haben vielmehr eine effektive Fusion von Finanz- und Informationsökonomie ermöglicht, die eine schnelle Expansion des Finanzsektors und die Hegemonie des Finanzmarktkapitalismus bewirkte. Damit ist einerseits eine wirtschaftliche Handlungsmacht entstanden, die über nationale Grenzen hinweg in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften interveniert. Andererseits haben die Privatisierung des Internet, rechtliche Privilegien und die Kommerzialisierung von Information seit den 1990er Jahren auch zur Aufzucht neuer Medienkonzerne geführt, deren Geschäft in der Aneignung von öffentlichen Infrastrukturen, in der Ausweitung privater Kontrollmechanismen und in der Erzeugung und Belieferung von Informationsmärkten besteht. Im Zusammenhang von Netzwerkarchitekturen, Plattformindustrie und Digitalfirmen sind die Steuerung von Gesellschaften und die Beherrschung öffentlicher Sphären selbst zu einem unternehmerischen Projekt geworden. Die damit ausgelösten Debatten über fragmentierte Öffentlichkeiten und politische Polarisierung, über Demokratieverlust und eine aktuelle Konjunktur der Verlogenheit werden schließlich zum Anlass genommen, das Wechselverhältnis zwischen Wirtschaftsprozessen, Weltbezügen und Affektökonomien zu verfolgen. Dabei kommt dem Sozialaffekt des Ressentiments eine privilegierte Position zu: Im gegenwärtigen Wirtschaftssystem fungiert er als Produkt und Produktivkraft zugleich und trägt gerade mit seinen politischen und sozialen Erosionskräften zur Stabilisierung des Finanz- und Informationskapitalismus bei. – Diese Thesen sollen weder Epochenhermeneutik betreiben noch generelle Zeitdiagnosen ausstaffieren. Sie stützen eine kurz gefasste Theorie der gegenwärtigen Lage allerdings darin, dass sie sich auf jene Umstände und Bedingungen beziehen, die eine Verständigung über diese Gegenwart und deren Herstellung erst ermöglichen.
1. Kapitel
Monetative Gewalt
In der Wirtschaftsgeschichte werden große Umbrüche weniger durch schallende Ereignisse als durch unmerkliche Drehungen langfristiger Tendenzen markiert. Während sich die letzte Finanzkrise als lautstarkes Ende einer finanzkapitalistischen belle époque bemerkbar machte, hat eine pedantische Zählung seit den siebziger Jahren mehrere Hundert Banken- und Währungskrisen registriert, die von der Herstatt-Pleite 1974 bis zum Zusammenbruch des Dotcom-Marktes im Jahr 2000 reichten.[1] Solche Serien bieten hinreichendes Material dafür, dem jüngeren Finanzsystem eine strukturelle Instabilität zu attestieren, in der Turbulenzen und Crashs zu Routinen wurden und der Begriff der Finanzkrise selbst seine Verweiskraft auf den Charakter außerordentlicher Marktbegebenheiten verlor: Die ‹Krisen› sind stationär geworden. Vor allem aber zeichnet sich darin die allmähliche Verfertigung eines ökonomischen Regimes ab, in dem seit vier Jahrzehnten das Zusammenwirken von misslichen Umständen, Zwangslagen, neuen Geschäftsideen, rabiaten politischen Interventionen und ideologischen Konjunkturen zu einem Ausbruch des Finanzkapitals aus seiner wohlfahrtsstaatlichen Einhegung geführt hat, um nun das Geschick von Nationalstaaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften zu diktieren.
Vor diesem Hintergrund konnte das Vierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder als Ausnahmeperiode erscheinen, als goldenes, aber versunkenes Wirtschaftsidyll, in dem unter dem Eindruck der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Desaster der zwanziger und dreißiger Jahre die Rettung des Kapitalismus auf der Geschäftsgrundlage gemäßigter Varianten versucht wurde. Denn über alle kontroversen Bewertungen dieser Nachkriegszeit hinweg musste man konzedieren, dass damals starke Gewerkschaften und Bankenregulierung, Kapital- und Währungskontrollen, eine defensive Konjunktur-, Steuer- und Sozialpolitik, langfristige Investitionen und Massenproduktion, niedrige Zinsraten und überschaubare Gewinnspannen zumindest vorübergehend zu industriellem Wachstum, Lohnsteigerungen und zu einer Moderation in der Einkommens- und Vermögensverteilung geführt hatten. Wie einstmals von Max Weber, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes oder Karl Polanyi in Aussicht gestellt, schienen die Zeiten entfesselter Märkte eines extremistischen Kapitalismus endgültig vorbei zu sein, und noch 1968 galt die Hoffnung, dass mit den bestehenden wirtschaftlichen Institutionen und Instrumenten westlicher Industriestaaten unkontrollierte Inflationen und Depressionen verhindert, Wirtschaftswachstum verstetigt und «gesamtgesellschaftliche Prozesse» optimiert werden könnten. Es handelte sich, kurz gesagt, um eine Epoche, die von der Hoffnung auf peace and plenty, auf «Wohlstand für alle» und den Aussichten geprägt war, Verteilungskämpfe durch erwartbare Wachstumsdynamiken zu entschärfen.[2]
Die Erosion dieser sozialen und politischen Kompromissformeln verlief dann über einige Stationen, in denen sich eine Verschiebung ökonomischer Kräfte mit der Verlagerung politischer Entscheidungsmacht kombinierte. Dabei wurden die Trendumkehr wie deren Scheitelpunkt durch zwei hinreichend diskutierte Daten markiert. Das betrifft einerseits das Ende des Abkommens von Bretton Woods in den Jahren 1971 und 1973, also jener 1944 beschlossenen Nachkriegsordnung, die mit der Bindung wichtiger Währungen an den Dollar und des Dollars an Gold stabile Devisenkurse und somit Sicherheiten im internationalen Waren-, Kapital- und Zahlungsverkehr garantieren sollte. Was immer den Untergang dieser Finanz-, Währungs- und Wirtschaftsepoche ausgelöst haben mag: eine zunehmende Mobilität im internationalen Kapitalverkehr und eine expansive US-Geldpolitik, die Verwandlung der USA von einem internationalen Gläubiger zu einem globalen Schuldner, die Anhäufung von ausländischen Dollarguthaben, das anwachsende Defizit der USA durch den Vietnamkrieg und steigender Inflationsdruck, eine Suche nach höheren Kapitalrenditen aufgrund sinkender Profitraten in amerikanischen Unternehmen, Exportüberschüsse vor allem in Deutschland und Japan oder das Missverhältnis zwischen amerikanischen Verpflichtungen und Goldreserven – es wurde damit jedenfalls ein Scheitern komplexer finanzpolitischer Konstruktionen sowie ein langsamer, aber endgültiger Übergang von Warengeld zu Kreditgeld, zu ungedeckten Währungssystemen mit fluktuierenden Wechselkursen vermerkt. Damit wurden nicht nur neue Märkte für neue Finanzprodukte – wie Währungsderivate – geschaffen, sondern insgesamt ein nahezu exponentielles Wachstum der umlaufenden Geldmenge initiiert.[3] Auf Devisenmärkten werden heute weltweit – und zwar täglich – fünf Billionen Dollar umgesetzt.
Andererseits haben steigende Inflationsraten, Stagnation und sinkende Produktivität in den Vereinigten Staaten drastische Leitzinserhöhungen der Federal Reserve unter Paul Volcker zwischen 1979 und 1981 motiviert. Sie haben das Kunststück vollbracht, die Handelsdefizite und Auslandsschulden der USA zu deren Vorteil zu wenden und internationales Überschusskapital mit hochverzinsten Anlagen an die Wall Street zu lenken. Auch wenn Volckers Entscheidung wohl eher improvisierten und intuitiven Charakter besaß, schlug sich der Erfolg solcher Inflationsbekämpfung neben einer Festigung des Dollarkurses in einer folgenreichen Umverteilung von Vermögen und Einkommen nieder. Während die Profitraten für Banken und Finanzinstitute, für Wertpapiere, Anleihen, Aktien und große Kapitalvermögen anstiegen und 70 % der Gewinne aus europäischen Handelsüberschüssen zurück in die New Yorker Finanzmärkte flossen, wurden Schulden verteuert, Lohnsteigerungen gebremst, die Einnahmen von produzierender Industrie, von Kleingewerben und Landwirtschaft reduziert. Dem Anwachsen des Finanzsektors und den Erträgen aus Finanzkapital standen Rezession, Schuldenkrisen der Dritten Welt und steigende Arbeitslosigkeit gegenüber. Mit unsichtbarer Hand wurden Einkommensanteile von 55 % jener Haushalte, die keine oder negative Finanzwerte besaßen, auf die oberen 45 % verteilt.[4]
Expandierende Finanzmärkte und Schuldenökonomie haben in den siebziger Jahren also die Hegemonie des US-amerikanischen Kapitalismus unter veränderten Vorzeichen gesichert und damit den Rahmen für die Abarbeitung jener liberalistischen Programme geboten, die erstmals unter der Militärdiktatur Chiles seit 1973 getestet und nach der politischen Ankunft von Thatcher und Reagan ab den achtziger Jahren in unterschiedlichen Abfolgen, Zeitspannen und Versionen durchgesetzt wurden. Die Maßnahmen erstreckten sich vom Kampf gegen Gewerkschaften und Arbeitsmarktreformen über die Privatisierung von sozialer Vorsorge, öffentlichen Aufgaben und Dienstleistungen bis zur umfassenden Revision von Unternehmens-, Vermögens- und Einkommensteuern, zur gezielten Förderung von Kredit- und Finanzmärkten sowie zur Entlastung von Kapitaleinkünften. Dabei hat dieses Gemisch aus heterogenen Entwicklungen und konzertierten Aktionen einen systemischen bzw. systematischen Zusammenhang mit der Flankierung durch prominente Institutionstypen erhalten. So hatte der 1945 gegründete Internationale Währungsfond (IMF) – um ein Beispiel neben anderen Organisationen wie Weltbank oder GATT bzw. WTO zu nennen – zunächst die Aufgabe, internationale Geldpolitik zu koordinieren und mit Ausgleichszahlungen mögliche Spannungen im System fixer Wechselkurse zu moderieren. Nachdem allerdings der IMF mit dem Zusammenbruch des Weltwährungssystems und der Aufkündigung des Abkommens von Bretton Woods vorübergehend funktionslos geworden war, hat man seit den 1970er Jahren sein Aufgabengebiet neu erfunden und eine Instanz geschaffen, die nun die Einhaltung von Stabilitätskriterien angesichts flottierender Devisenkurse kontrollieren und zudem als lender of last resort für Zentralbanken und Regierungen auf den internationalen Finanzmärkten fungieren sollte.[5]
Damit begann die große Zeit jener ‹Strukturanpassungsprogramme›, mit denen Weltbank und IMF – unter Mithilfe der OECD – auf die Schuldenkrisen in Lateinamerika und Asien reagierten, Kreditvergaben an Entwicklungs- und Schwellenländer mit Reformbedingungen verknüpften, die entsprechenden sozioökonomischen Entwicklungsperspektiven verallgemeinerten und schließlich für die Ausrichtung der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik sorgten. Die wesentlichen Programmpunkte wurden im so genannten Washington Consensus von 1989 resümiert und umfassten neben den Forderungen nach Haushaltsdisziplin, der Reduktion von Staatsausgaben, Steuerreformen und Privatisierung von Staatsunternehmen auch marktorientierte Zinssätze und Devisenkurse, Investorenschutz, die Deregulierung von Märkten, die Liberalisierung des Kapitalverkehrs samt Erleichterungen für ausländische Investitionen. Mit diesen Richtlinien einer finanzökonomischen global governance ging es den internationalen Finanzinstitutionen nicht nur um eine Veränderung staatlicher Strukturen und wirtschaftspolitischer Voraussetzungen, sondern um eine gezielte Unterstützung spezifischer Interessengruppen und Agenturen.[6] Auch wenn diese Politik immer wieder für gescheitert erklärt wurde[7], lässt sich in ihr die Blaupause für jene jüngeren Regierungsexperimente erkennen, mit denen man innerhalb der Eurozone das an Entwicklungs- und Schwellenländern erprobte Spektrum von Austeritätsprogrammen – Stabilitäts- und Fiskalpakt, Schuldenbremsen, Haushaltsdisziplin, Privatisierungen – noch einmal exekutierte.
Schließlich wurde eine solche Konditionierung politischer Entscheidungsprozesse auch durch eine Funktionsänderung von Zentralbanken im 20. Jahrhundert forciert. Während Nationalbanken aus der notorischen Verschuldung frühneuzeitlicher Territorialstaaten sowie deren Bewirtschaftung durch private Gläubiger hervorgingen und – wie die Bank von England 1694 – zum Zweck einer dauerhaften Staatsfinanzierung, zur Verwaltung von Staatsdefiziten gegründet wurden, wuchs diesen Instituten allmählich ein erweiterter Aufgabenbereich zu. Er ergab sich aus jeweils konkreten historischen Situationen und umfasste etwa das Monopol von Notenausgabe und Geldschöpfung, die Sicherung des Bankensystems, die Sorge um den Wert der Währung, die Regulierung der umlaufenden Geldmenge oder die Fragen von Preisstabilität, Zinspolitik und Inflationsbekämpfung. Dabei waren es vor allem die Einbrüche von Banken-, Finanz- und Währungskrisen seit Ende des 19. Jahrhunderts, die die Ausrichtung vorbildlicher Exemplare – vom Federal Reserve System in den USA (1913) über die Deutsche Bundesbank (1957) bis zur Europäischen Zentralbank (1992 bzw. 2007) – bestimmten und sich in drei wesentlichen Tendenzen niederschlugen. Sie wurden als Sicherungsanstalten für das Finanz- und Währungssystem konzipiert, die zugleich als bankers’ bank, als Dienstleister für Banken und Finanzmärkte für die Bereitstellung von Kapitalreserven in Not- und Schieflagen zu sorgen hatten. Damit ist auch der besondere legale Status dieser Banken verbunden, der durch eine formale Abdichtung bzw. Immunisierung gegen andere Regierungsorgane gekennzeichnet ist. Ausgehend von der engen Kopplung zwischen Zentralbanken, Kreditinstituten und Finanzsystem hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann das Dogma der ‹Unabhängigkeit› von Zentralbanken durchgesetzt, spätestens seit den 1990er Jahren und am radikalsten vielleicht für die EZB: Nach Artikel 107 des Vertrags von Maastricht (1992) darf die EZB bei der Ausübung der ihr «übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten» eben keine «Weisungen von Organen oder Einrichtungen der [europäischen] Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderer Stellen einholen oder entgegennehmen.»
Man hat es also mit der Bildung von Regierungsenklaven zu tun, die gegenüber allen anderen Regierungsorganen unabhängig sind und sich insbesondere jeder Kontrolle durch die legislative Gewalt entziehen. Das hatte weitreichende Konsequenzen und führte eine strikte und bisweilen verfassungsrechtlich verankerte Abtrennung souveräner Aufgaben wie Geld- und Währungspolitik von nationalstaatlicher Wirtschafts- und Fiskalpolitik herbei. Mit Berufung auf die liberale Doktrin des Monetarismus, die eine mehr oder weniger mechanische Verknüpfung zwischen Geldmenge und Wirtschaftsentwicklung unterstellt, wurde damit eine technokratische Abwicklung politischer Entscheidungen gebahnt und Geldpolitik dem Idol eines ‹regierungslosen Regierens› überstellt. Nicht zuletzt hat man damit eine radikale Einseitigkeit, eine einseitige Verantwortlichkeit der Zentralbanken programmiert. Zum einen wurde jede Rechenschaft gegenüber gewählten Regierungen, gegenüber einem demokratischen Stimmvolk annulliert. Es handelte sich darum, die finanzökonomische Marktordnung gegen «die Tyrannei der zufälligen Mehrheit von Volksvertretungen» (Knut Wicksell) zu schützen, und gerade mit Blick auf den Euro und die EZB machte man keinen Hehl daraus, dass es darum ging, die «lästigen Eingriffe demokratisch gewählter Akteure in das Wirtschaftssystem» zu verhindern.[8] Anderseits bezieht sich deren Rücksicht auf die Stimmungen des Finanzpublikums, und zur Sicherung von Währung und Geldwert sind sie vor allem jenen Investoren und Akteuren verpflichtet, die die Dynamiken auf den Finanzmärkten diktieren. Als Regierungsinstitute bieten Zentralbanken also eine Art Minderheitenschutz für die Vertreter der Finanz gegenüber wechselhaften demokratischen Mehrheiten; über Zentralbanken sind Finanzmärkte und deren Agenturen zu einem integralen Bestandteil von Regierungspraxis geworden und manifestieren sich dort mit ihrer para-demokratischen Natur.
Erst mit der Vielfalt und mit dem Zusammenspiel solcher politischen, institutionellen und doktrinären Eingriffe wurden die Voraussetzungen zur Förderung des jüngeren Finanzmarktkapitalismus geschaffen und die Fundamente zu jenem globalen Massenexperiment gelegt, das seit vier Jahrzehnten auf eine ‹Finanzialisierung› von Volkswirtschaften, von ökonomischen und sozialen Infrastrukturen insgesamt setzt. Hervorgegangen aus den Anstrengungen, mit denen man sich insbesondere in den USA von den wirtschaftlichen und politischen Zwangslagen seit Ende der sechziger Jahre zu befreien versuchte, wurden dem Finanzsektor neue Aktionsradien in der Ausübung politischer Entscheidungsmacht eröffnet. Dies zeichnete sich zunächst in einer doppelten Expansion von Finanztransaktionen ab, die sowohl deren Wachstum wie deren Ausdehnung betraf. So ist das globale Volumen der Finanzbeziehungen zwischen 1980 und 2007 um mehr als das Siebzehnfache angestiegen. Das Handelsvolumen der New Yorker Börse hat sich von neunzehn Millionen Dollar täglich im Jahr 1975 auf 109 Millionen täglich im Jahr 1985 multipliziert, der Handel mit Derivaten und Verbriefungen hat sich von 1998 bis 2008 nahezu verzehnfacht, Finanzanlagen haben 2007 eine Größe von 355 % des Weltbruttoinlandsprodukts erreicht; und die Geschäfte in so genannten Schattenbanken – Geschäfte also, die abseits von Regelvorgaben wie Eigenkapitalrichtlinien und Mindestreserven stattfinden – haben 2008 einen Umfang von 140 %, 2015 von 150 % der weltweiten Wirtschaftsleistung angenommen. Dies wurde von einer Vervielfachung der Schulden in öffentlichen, vor allem aber in privaten Bereichen begleitet: Am Beispiel der USA stiegen sie von 155 % (1980) auf 353 % (2008) des Bruttoinlandsprodukts. Und wiederum in den USA ist der Anteil der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranchen (FIRE: finance, insurance, real estate) am Inlandsprodukt im Verhältnis zur Güterproduktion von ca. 30 % Anfang der sechziger Jahre auf über 90 % um 2010 gewachsen.
Damit war ein Prozess verbunden, in dem sich der industrielle Gewinnanteil am Gesamtergebnis unternehmerischer Renditen kontinuierlich reduzierte. Er fiel in den USA der siebziger Jahre von vierundzwanzig Prozent auf vierzehn bis fünfzehn Prozent und wurde in den 1990er Jahren von der Profitquote der Finanz-, Versicherungs- und Immobiliengeschäfte überholt. Dies war auch einem Umbau von Unternehmensstrukturen geschuldet, der sich nicht bloß in Fusionen und Konzentrationen, in der Auslagerung von Arbeitskräften sowie in der Privilegierung von shareholder-Interessen, von kurzfristigen Ausschüttungen an Aktionäre gegenüber langfristigen Investitionen manifestierte, sondern auch in der Umlenkung von Profiten in Finanzmärkte und in der Verwandlung von Großunternehmen zu Finanzierungsgesellschaften: Der größte Gewinnanteil von Firmen wie General Electric oder Ford Motor Company stammt nicht aus dem Absatz von Industrieprodukten, sondern aus Finanzdienstleistungen; und wenn etwa Nike die Einnahmen zwischen 2002 und 2005 um 470 % steigern konnte, so lag das nicht am Verkauf von Turnschuhen und Trikots, sondern an den Erträgen aus Zinsen und Dividenden. In den USA flossen im Jahr 2000 die Hälfte aller Investitionen von Nichtfinanzfirmen in den Finanzsektor, und 2001 fielen dort mehr als 40 % aller Unternehmensgewinne in der Finanzindustrie an.[9]
Die Finanzialisierung ist also strukturell geworden. Versehen mit akademischem Segen, der – wie am Beispiel der Efficient Market Hypothesis – gerade den Finanzmärkten perfekten Wettbewerb, ideale Preisbildungsmechanismen, rationale Aktionsweisen und optimale Informationsverteilung attestierte, ist sie durch die wachsende Bedeutung von finanzökonomischen Motiven, Akteuren, Instrumenten und Institutionen für die Bedingungen materieller Produktionen sowie für die Dynamik von heimischen und internationalen Märkten charakterisiert. Sie prägt die Art und Weise, mit der die Akkumulation von Finanzkapital zu einer dominierenden Macht in der Strukturierung des sozialen und politischen Feldes geworden ist. Einerseits wurde mit der Stärkung von Pensionsfonds und finanzdefinierter Daseinsvorsorge, mit der Molekularisierung des Wettbewerbs und der Förderung prekärer Beschäftigung, mit der Erhöhung von Verschuldungsrisiken über Konsumkredite, Kreditkartensysteme, Ausbildungskosten oder Hypotheken eine zunehmende Inklusion von Bevölkerungen in den Wertschöpfungsprozess der Finanzmärkte garantiert; der Betrieb des Kapitalmarkts verlangt die stetige Erschließung neuer Ressourcen und erhebt einen Anspruch, den man bisweilen auch ausdrücklich formuliert: «Die Welt braucht unsere Führung» – so hat etwa Larry Fink[10], der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, die Zukunftsvision der Finanzindustrie zusammengefasst.
Andererseits hat sich die systematische Stärkung von Finanzmärkten und deren Institutionen als Umverteilungsprogramm für Einkommen und Vermögen bewährt, das inzwischen hinreichend dokumentiert worden ist. Die Zahlen und Dynamiken sind weitgehend bekannt und ähneln sich in den meisten gegenwärtigen Industriestaaten. So hat die Expansion von Kapitalmärkten zu einer Freisetzung von Divergenzkräften und dazu geführt, dass etwa in Europa seit der Jahrtausendwende das Volumen von Privatvermögen das Vier- bis Sechsfache des gesamten jährlichen Nationaleinkommens beträgt und dass die Kapitalrendite die langfristige Wachstumsrate der Wirtschaftsleistung deutlich übersteigt. Das schlug sich in der Spreizung von niederen und hohen Einkommen, von Lohneinkünften und Vermögensgewinnen nieder.[11] Zwischen 1988 und 2008 wurden 44 Prozent des Einkommenszuwachses von den reichsten fünf Prozent, fast zwanzig Prozent von nur einem Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung erzielt. Von 1999 bis 2009 sind die Einkommen der untersten zehn Prozent der Haushalte in Deutschland um 9,6 Prozent geschrumpft, die der obersten zehn Prozent um 16,6 Prozent gewachsen; die Realeinkommen von Lohnabhängigen gingen zwischen 2005 und 2015 um ca. drei Prozent zurück. 2007 besaßen zehn Prozent der reichsten Haushalte zwei Drittel des gesamten privaten Nettovermögens, ein Prozent mehr als ein Drittel davon, und die Spitzengruppe von 0,1 Prozent hielt einen Anteil von 22,5 Prozent; die gesamte untere Hälfte 1,4 Prozent. Deutlicher noch in den USA: Dort konzentrierten sich 43 Prozent des gesamten Nettovermögens von Privathaushalten beim reichsten Prozent der Bevölkerung, 83 Prozent bei den reichsten zehn Prozent. Der Anteil der ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung am Gesamteinkommen sank von 20 Prozent im Jahr 1980 auf 12 Prozent im Jahr 2018, begleitet von einer Absenkung der realen Mindestlöhne seit den achtziger Jahren. Zudem gehören die Länder mit besonders dominanter Finanzindustrie wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten heute zu jenen westlichen Gesellschaften, die die geringste Aufwärtsmobilität aufweisen.[12]
Selbst nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise setzte sich diese Tendenz fort. Laut einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verfügten 2019 zehn Prozent der höchsten Einkommen über 49 Prozent der globalen Lohnsumme, wobei die untere Hälfte nur mit 6,4 Prozent, das untere Fünftel mit weniger als einem Prozent daran partizipierte. Das betrifft auch die Stagnation oder den Rückgang geringer Einkommen in den Jahren nach 2008. Insbesondere in Deutschland haben von den anschwellenden Exportüberschüssen der letzten Jahre fast ausschließlich zehn Prozent der reichsten Haushalte profitiert, und das durch den Immobilienboom im selben Zeitraum um drei Billionen Euro erhöhte Privatvermögen kam ebenfalls mit mehr als der Hälfte dem reichsten Zehntel zugute, während fast vierzig Prozent der Bevölkerung kein Vermögen oder nur Schulden besitzen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ermittelte im Jahr 2020, dass das reichste Prozent der Bevölkerung rund 35 Prozent des individuellen Nettovermögens, das reichste Zehntel über 67 Prozent, die untere Hälfte aber nur ein Prozent besitzt. Und die 45 reichsten Haushalte haben so viel Vermögen, wie die schwächeren fünfzig Prozent zusammen.[13] Abgesehen davon, dass Finanzkrisen stets von einer Umverteilung von unten nach oben begleitet werden, lässt sich allgemein und spätestens seit Anfang der Achtziger eine Entwicklung beobachten, in der sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts – in westlichen Industriestaaten und insbesondere in den USA – vom Wachstum der Einkommen von neunzig Prozent der Bevölkerung abgekoppelt hat und schließlich Zweifel daran aufkommen ließ, ob die Berechnung von Bruttoinlandsprodukten ohne Berücksichtigung von konkreten Vermögens- und Einkommensverteilungen überhaupt noch sinnvolle Wirtschafts- und Wohlstandsindikatoren liefern könne.[14]
Solche Hyperkonzentration von Einkommen und Vermögen ist nicht nur ein Indikator für die ökonomischen Transformationen der letzten Jahrzehnte. Der Zusammenhang von Überakkumulation und Ungleichheit zeigt auch eine Subordination sozialer und ökonomischer Reproduktion unter die Reproduktionszyklen des Finanzkapitals an. Darin lässt sich ein allmählicher Wandel in der Organisation von Regierungstechniken erkennen, der zum Status Quo des Finanzregimes geführt hat und wenigstens fünf grundlegende Merkmale aufweist. So kann erstens mit dem Terminus der ‹Finanzökonomie› heute weder ein rein ökonomischer Sachverhalt noch ein spezielles Marktsystem gemeint sein. Die langwierige Verfertigung des gegenwärtigen Finanzregimes ist mit der dogmatischen Gegenüberstellung von Staat und Markt, Politik und Wirtschaft nicht fassbar, und die so genannte Liberalisierung von Märkten und insbesondere von Finanzmärkten seit den 1970er Jahren lässt sich nicht einfach als Rückzug von regulativen Autoritäten begreifen. Vielmehr konnte man nachweisen, dass die Nachfrage nach Regulierungen, nach Regelungspraxis, nach Regulierungsinstrumenten und Regulierungsagenturen proportional zur Privatisierung von staatlichen Aufgaben und Unternehmen angestiegen ist.[15] Gerade die vehemente Durchsetzung, Stärkung, Sicherung und Legitimation von Marktmechanismen hat eine Fülle von öffentlichen, halb-öffentlichen und privaten Einrichtungen auf den Plan gerufen, die von einer Vervielfältigung und Verstreuung von Regierungsfunktionen zeugen und sich in internationalen Gremien, Assoziationen, Vertragswerken und Lobbygruppen verkörpern. Sie operieren gleichsam pluralistisch und auf verschiedenen Ebenen; und als Elemente und Gestalten einer finanzökonomischen global governance charakterisieren sie nicht nur ein Regime, das ausgehend von Nordamerika und Europa auf Initiative der führenden Wirtschaftsmächte realisiert werden konnte. Die wechselseitige Durchdringung von nationalstaatlichen Organen, internationalen Organisationen und Netzwerken, privaten Agenturen, Unternehmen und Marktprozessen hat vielmehr ein vielschichtiges Geflecht aus Regelordnungen unterschiedlicher Dichte und Reichweite ergeben. Marktkräfte werden durch eine Proliferation von Regulierungsinstanzen forciert, während umgekehrt die Dynamiken und Akteure des Markts an eine Verdichtung von Regelsystemen appellieren. Regierungsfunktionen und marktbasierte Aktionsweisen sind in ein bi-polares Binnenverhältnis zueinander getreten und definieren ein Wirtschafts- und Finanzsystem, das den Titel eines regulativen Kapitalismus verdient.[16] Die liberale Fiktion von ‹freien›, ‹effizienten› oder ‹unregulierten› Märkten, die sich glücklich und autonom abseits von Regierungsinterventionen entfalten sollen, verliert hier jeden analytischen Wert. Gerade die Liberalisierung von Märkten und Finanzmärkten hat ein globales Programm von Regelungen und Re-Regulierungen hervorgerufen. Als Machtform eigener Sorte hat das Finanzregime damit einen diagrammatischen Charakter angenommen: Es strukturiert einen Immanenzraum, in dem souveräne Befugnisse, Regierungsaktionen, Geschäfte und Marktoperationen ineinander verfließen. Die Statik politischer – etwa nationalstaatlicher – Architekturen wird von der dynamischen Axiomatik des Finanzkapitals durchzogen, das sich von territorialen Bindungen löst und sich mit der Generierung eigener Regeln und Abhängigkeiten als eine «kosmopolitische, allgemeine, jede Schranke, jedes Band umwerfende Energie»[17] manifestiert.
Mit den Prozessen der Finanzialisierung wurde also der Übergang von einer geopolitischen zu einer geoökonomischen Ordnung vollzogen. Darin hat sich das Finanzregime als eine inter- oder transgouvernementale Handlungsmacht installiert, die rechtlich und institutionell unklar verortet ist, die formale Autorität von Regierungen ergänzt bzw. ersetzt, die Distinktionen von öffentlich und privat unterläuft und unmittelbar in Volkswirtschaften, in die Regierungspolitik alter Nationalstaaten interveniert. Als spezielle Technologie in der Ausübung von Regierungsmacht kann das Finanzregime damit zweitens den Charakter einer vierten Gewalt beanspruchen, die sich mit besonderem Eskalationspotential und als Monetative[18] neben der Dreifaltigkeit von legislativen, exekutiven und juridischen Regierungsgewalten behauptet. Gerade das Krisenmanagement seit 2007 hat gezeigt, wie sich die Bildung transnationaler Souveränitätsreservate mit den Agenturen monetativer Gewalt kombinierte. So zeichnete sich insbesondere die Politik der Eurozone dadurch aus, dass sie unter Einklammerung rechtlicher Rücksichten und parlamentarischer Beteiligung sowie über die Aussetzung formaler Verfahrenswege und demokratischer Gepflogenheiten operierte. Unterschiedliche Gremien wie ‹Troika›, ‹Quadriga›, die ‹Institutionen› oder die ‹Eurogruppe› haben europäischen Schuldnerstaaten – denen eine gut aufgelegte Finanzwelt die anspielungsreichen Akronyme PIIGS oder GIPSI verpasste: Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien – nicht nur die üblichen Maßnahmenpakete wie Privatisierungen, Einsparungen, Personalabbau, Verschlankung des Gesundheitswesens, Arbeitsmarktreformen, Kürzung von Sozialleistungen, Löhnen und Renten oder die Einschränkung gewerkschaftlicher Rechte verordnet. Zur Befriedigung der Interessen von Anleihegläubigern wurden vielmehr mit direkten Eingriffen in nationale Budget-, Steuer- und Arbeitsgesetzgebungen souveräne Befugnisse ausgeübt, die durch die Rechtslage der Eurozone nicht unbedingt gedeckt waren. Dies erscheint umso bemerkenswerter, als manche dieser Gremien selbst allenfalls improvisierten und informellen Charakter besitzen und als unklar verortete Exekutivorgane legislative Prozesse initiierten. Die so genannte Eurogruppe etwa – bestehend aus den Finanzministern der Euro-Staaten, dem EZB-Präsidenten, dem für Wirtschaft und Finanzen zuständigen EU-Kommissar und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des IMF – kontrolliert zwar die Einhaltung von Stabilitätskriterien sowie Haushaltspolitik und öffentliche Finanzen der Euro-Länder, ist aber als eigener Posten nicht in der europäischen Gesetzgebung vorgesehen und zudem keiner regulären europäischen Institution samt Parlament rechenschaftspflichtig. Als einmal in den Verhandlungen über Liquiditätshilfen für Griechenland nach der Legitimität der Entscheidungen der Eurogruppe und ihres Präsidenten gefragt wurde, kam unverzüglich folgende Auskunft zurück: «[R]echtlich existiert die Eurogruppe nicht, weil sie nicht Teil der EU-Verträge ist. Es ist eine informelle Gruppe der Finanzminister der Mitgliedstaaten der Eurozone. Es gibt keine schriftlichen Regeln, wie sie ihre Geschäfte führt, und deshalb ist der Präsident [der Eurogruppe] nicht an rechtliche Vorschriften gebunden.»[19]
Es verwundert also nicht, dass öffentliche wie private Vertreter des Finanzregimes zuweilen demokratische Übergriffe beklagten und etwa daran gemahnten, dass Wahlen nicht die «Wirtschaftspolitik beeinflussen» sollten oder demokratische Verfassungen ein «problematisches politisches Erbe» darstellten und mit den aktuellen finanzökonomischen Notwendigkeiten «unvereinbar» wären.[20] Auch in diesen Besorgnissen artikuliert sich die Spannung zwischen demokratischen Prozeduren und Finanzordnung, deren globale Machtökonomie sich in Europa reproduzierte. Vom Kampf gegen rechtliche und politische Schranken bei der Verabschiedung der ersten Rettungspakete bis hin zur besonderen Regierungsgewalt von verschiedenen EU-Organen haben sich über Staatsgrenzen hinweg Figuren exzeptioneller politischer Macht ausgeprägt. Als hätte man Milton Friedmans Ratschlag beherzigt, Wirtschaftskrisen als Chancen zur Realisierung des politisch Unbequemen zu ergreifen[21], wurde das Gelegenheitsfenster der letzten Krise dazu genutzt, neue Handlungsspielräume zu erschließen, politische Prioritäten zu setzen, die Interessen der Finanzindustrie zu sichern und über konstitutionelle Bedenken hinweg Entscheidungsmacht neu zu sortieren. Darüber hinaus wurden die damit verbundenen Ausnahmebefugnisse sogleich auf Dauer gestellt: sei es durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, jene Zweckgesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Organe bei der Entscheidung über Notkredite völlige Immunität genießen und mit ihren Direktiven außerhalb jeder parlamentarischen und judikativen Kontrolle stehen; sei es durch den europäischen Fiskalpakt und durch die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, welche die EU-Kommission und den Europäischen Rat in besonderen Situationen zum unmittelbaren Durchgriff auf die Haushaltspolitik von Einzelstaaten ermächtigen. Im Sinne einer «ungeschriebenen Notstandsverfassung» wurden dabei europarechtliche Gesetzgebungsverfahren umgangen. Innerhalb bestehender Rechtsordnungen ist eine rechtlich nicht formalisierte Sekundärstruktur geschaffen worden, die als außerordentliche Handlungsreserve für stationäre Krisensituationen fungiert.[22] Bis heute gehört es zur Ausrichtung europäischer Regierungskunst, dass die Verletzung ökonomischer Austeritätskriterien vehement sanktioniert, der Bruch mit rechtstaatlichen und demokratischen Normen eher dezent abgemahnt wird, und wahrscheinlich war diese Krisenpolitik wesentlich für die Freisetzung europäischer Zentrifugalkräfte verantwortlich.