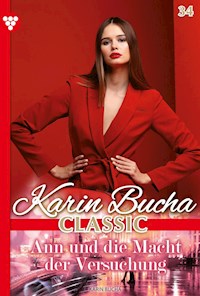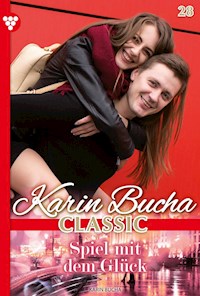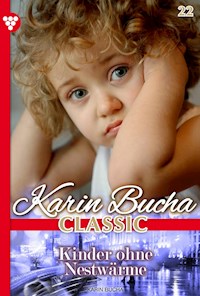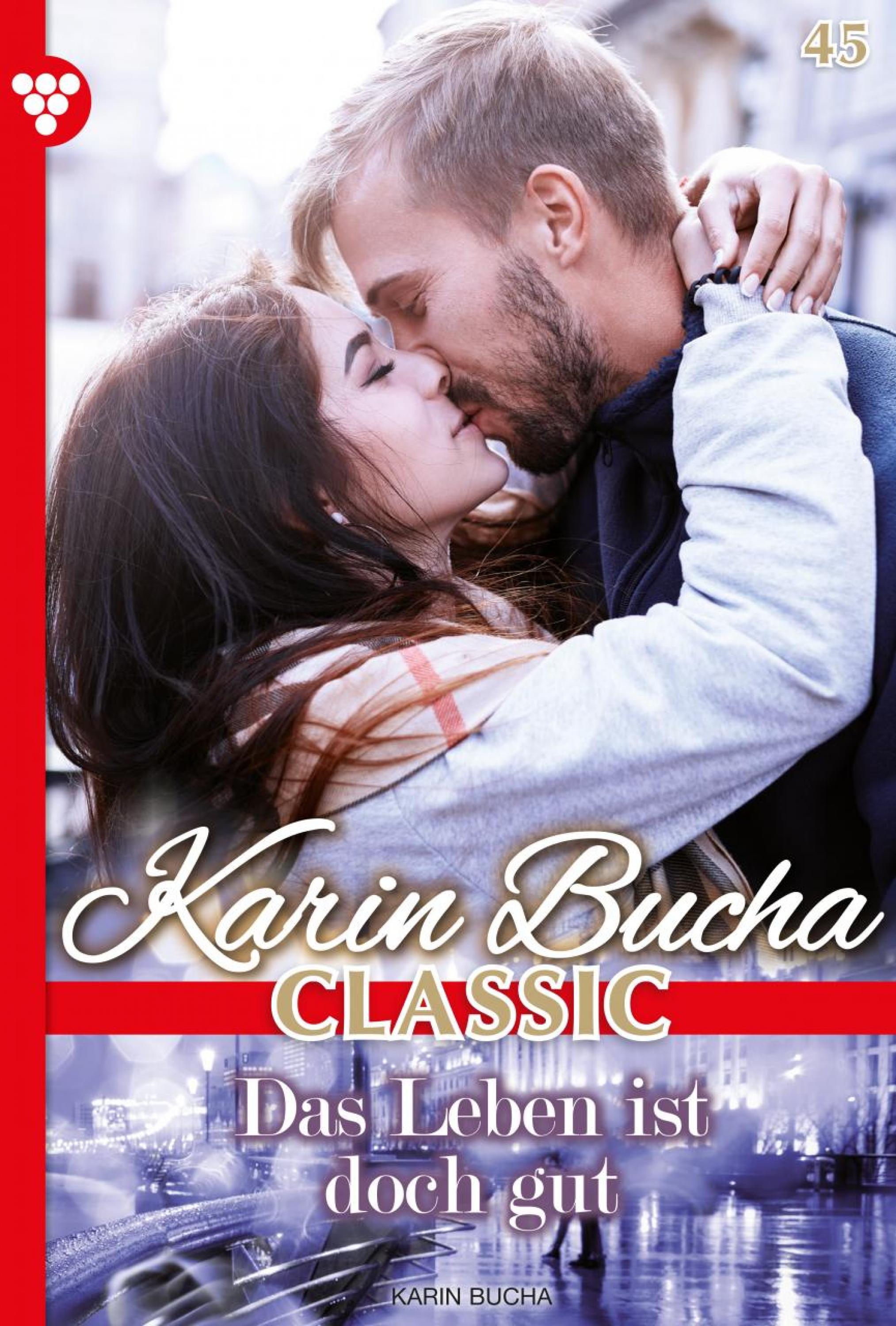
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. »Du mußt mich anhören, Beate, du mußt.« Mit einem Griff dreht der große Mann mit den blauen Augen das zierliche dunkelhaarige Geschöpf zu sich herum. »Muß ich dir erst sagen, wie sehr ich dich liebe? Ich bitte dich, sei ehrlich zu mir. Oder – liebst du mich nicht so sehr, wie ich angenommen habe?« Beate Reichert windet sich, aber sie kann sich nicht von Peter Warburg lösen. In ihren tiefblauen Augen glänzen Tränen. »Liebst du mich?« fordert die Stimme kurz und hart. »Ja, Peter«, flüstert sie erstickt. »Liebes!« Er läßt ihre Handgelenke los und schließt sie in seine Arme. Sein Mund sucht ihre Lippen. Er küßt sie zuerst zart und innig und dann immer leidenschaftlicher. Als er sie endlich freigibt, ist ihr Gesicht tränen-überströmt, aber die Augen leuchten vor Glück. »Und nun erzähle mir, weshalb wir uns trennen sollen«, spricht er mit tiefer Zärtlichkeit. »Wer fordert das von dir, denn daß es nicht von dir kommt, davon bin ich überzeugt.« »Mein Vater, Peter!«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 45 –Das Leben ist doch gut
Karin Bucha
»Du mußt mich anhören, Beate, du mußt.« Mit einem Griff dreht der große Mann mit den blauen Augen das zierliche dunkelhaarige Geschöpf zu sich herum. »Muß ich dir erst sagen, wie sehr ich dich liebe? Ich bitte dich, sei ehrlich zu mir. Oder – liebst du mich nicht so sehr, wie ich angenommen habe?«
Beate Reichert windet sich, aber sie kann sich nicht von Peter Warburg lösen. In ihren tiefblauen Augen glänzen Tränen.
»Liebst du mich?« fordert die Stimme kurz und hart.
»Ja, Peter«, flüstert sie erstickt.
»Liebes!« Er läßt ihre Handgelenke los und schließt sie in seine Arme. Sein Mund sucht ihre Lippen. Er küßt sie zuerst zart und innig und dann immer leidenschaftlicher. Als er sie endlich freigibt, ist ihr Gesicht tränen-überströmt, aber die Augen leuchten vor Glück.
»Und nun erzähle mir, weshalb wir uns trennen sollen«, spricht er mit tiefer Zärtlichkeit. »Wer fordert das von dir, denn daß es nicht von dir kommt, davon bin ich überzeugt.«
»Mein Vater, Peter!«
Betroffen hält er den Atem an. »Dein Vater?« wiederholt er ungläubig und schüttelt dann heftig den Kopf. »Ausgeschlossen, Beate, da steckt mehr dahinter.«
Peter schließt sie abermals in seine Arme. Er fühlt, wie unglücklich sie ist, und seine Nähe gibt ihr Schutz vor etwas, das sich wie ein Ungewitter zu nähern droht und sie beide verschlingen will.
»Ich werde mit deinem Vater sprechen, Beate«, entschließt er sich und wiegt sie wie ein Kind in seinen Armen. »Er muß mir eine Erklärung geben.«
Sie hebt sich auf die Zehenspitzen und drückt ihren weichen Mund auf seine Lippen, auf die Wangen und legt dann ihr Gesicht schmeichelnd in seine warme, gute Hand. »Komm in einer Stunde, Peter, dann ist Vater ausgeruht. Und nun, auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen!« flüstert er und preßt die Lippen zusammen. Er sieht der schlanken, enteilenden Gestalt solange nach, bis sie zwischen den Bäumen verschwunden ist.
Sie haben sich bei den Birken getroffen, heimlich, als hätten sie etwas zu verbergen; dabei weiß es das ganze Dorf, daß sie sich lieben und zusammengehören.
Langsam macht er kehrt und geht dem Eichenhof zu, auf dem die Warburgs seit Generationen sitzen. Es ist der größte und schönste Hof weit und breit, und Peter liebt ihn unendlich.
Schön, wunderschön – sinnt er – und doch ist es anders auf dem Hof geworden, seitdem sein Vater von einem Baum erschlagen wurde und seine Brüder erwachsen sind und auf Nachbarhöfen einheirateten.
Warum er sich nur nicht mit seinem ältesten Bruder Franz und dessen Frau Magda vertragen kann? Warum setzen sie ihm, dem Jüngsten, so viel versteckten Widerstand entgegen, den er mit aller Ehrlichkeit und Offenheit nicht zu brechen vermag?
Eigentlich gleicht das Anwesen mit dem hellen Wohnhaus, den grünen Fensterläden und den weitläufigen Nebengebäuden mehr einem Herrensitz.
Das Wohnhaus besitzt eine große Halle mit einem Kamin, der im Winter angenehme Wärme verbreitet. Die Wände sind dunkel getäfelt und mit Geweihen geschmückt. Eine gewundene Treppe mit kunstvoll geschnitztem Geländer führt in das erste Stockwerk.
Links von der Halle liegt das Wohnzimmer der Familie mit dem anschließenden kleineren Arbeitskabinett. Rechts davon das Eßzimmer, das fast einem Saal gleicht, und daneben ein kleiner Salon, den ausschließlich Maria Warburg benutzt.
Diesen kleinen, geschmackvoll ausgestatteten Raum sucht Peter auf, findet ihn leer und geht hinüber in das große Wohnzimmer.
»Peter!«
Er hört die Stimme seiner Mutter aus dem Kabinett kommen und tritt ein.
»Hier bist du, Mutter«, sagt er, und seine Augen leuchten auf. Auch Maria Warburg ist hochgewachsen und blauäugig. Seit dem Tod ihres Mannes führt sie die Geschäfte vorbildlich, von Franz und Peter unterstützt.
Bei seinem Eintritt schließt sie die Schublade des wuchtigen Schreibtisches. Sie ist blaß, und ihre Züge wirken verstört.
»Suchst du etwas, Mutter?« erkundigt Peter sich und kommt langsam näher. Unsicher sieht sie ihn an, um dann abermals die Schublade zu öffnen.
»Ich suche die viertausend Mark, die mir der Viehhändler Frickemeyer gebracht hat«, erklärt sie nervös, und ihre Hände zittern dabei. »Ich habe sie in das mittlere Fach geschlossen – und jetzt sind sie verschwunden.«
»Das ist doch wohl nicht möglich, Mutter.« Peter lacht sorglos auf und stellt sich neben sie. Wann hätte seine ordnungsliebende Mutter einmal etwas verlegt? Gemeinsam sichten sie alle Papiere, die griffbereit das Fach ausfüllen. Von dem Geld ist nichts zu sehen.
»Komisch, Mutter«, unterbricht Peter die Stille. »Vielleicht hast du sie in den Geldschrank gelegt?«
»Da habe ich bereits nachgesehen – leider umsonst«, erwidert sie leise, bedrückt.
»Hast du schon mit Franz darüber gesprochen?«
»Ja«, sagt sie und läßt sich in den ausladenden Sessel sinken. Sie hebt die Augen. Wie ein Schleier liegt es über den blauen, ehrlichen Augen. »Peter, warst du am Schreibtisch?«
»Gewiß, Mutter«, gibt er sofort zu. »Ich suchte die Milchabrechnung.«
»Also doch«, murmelt sie und unterbricht sich rasch. Peter wird stutzig.
»Was willst du damit sagen, Mutter?« Das Lachen ist auf seinen Zügen ausgelöscht.
»Franz hat gesehen, wie du dich am Schreibtisch zu schaffen machtest, Peter. Du und ich, wir beide besitzen allein die Schlüssel zu ihm.«
»Mutter!« Das klingt wie ein Aufschrei. Peter scheint langsam die Ungeheuerlichkeit zu begreifen. »Du – du willst doch nicht etwa behaup-
ten –«
Nein! Er wagt es nicht auszusprechen und weiß, auch seine Mutter glaubt es nicht.
»Franz meinte –«
»Laß Franz aus dem Spiel, Mutter.« Das klingt schroff und unzugänglich. »Warum, das weiß ich nicht, aber Franz haßt mich.«
Jetzt ist es Maria Warburg, die bis ins Herz hinein erschrickt.
»Nein! Nein!« wiederholt sie mit einer Heftigkeit, die im krassen Widerspruch zu ihrer sonstigen Sanftheit steht. »Du urteilst zu hart, Peter, das ist nicht wahr, er haßt dich nicht –«
»Wie konnte er sonst behaupten, ich hätte das Geld genommen?« Er bemerkt, wie alles Blut aus dem Antlitz der Mutter entweicht und weiß, daß er auf dem richtigen Weg ist.
»Was hat er dir einzureden versucht, Mutter«, fordert er mit eiskalter Ruhe. »Bitte, sag mir die Wahrheit. Ich werde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen.«
Um Gottes willen! Nein! Nur keinen Streit zwischen den Brüdern.
»Bitte, setz dich, Peter«, haucht sie und ringt um ihr inneres Gleichgewicht.
Gehorsam nimmt Peter im Sessel, dem Schreibtisch gegenüber, Platz. Er sieht, wie ihre Hand zum Telefon greift, wie sie den Hörer abnimmt.
»Hier Warburg, spreche ich mit Herrn Kleeberg persönlich? Gut. Ich warte.«
Wenige, aber bedrückend wirkende Minuten vergehen, dann hört er seine Mutter weitersprechen. »Guten Tag, Herr Kleeberg. Wann wird der Wagen meines Sohnes Peter ausgeliefert? Heute noch? Gut, dann können Sie auch den Scheck gleich mitnehmen. Wie hoch, bitte?«
Wieder vergehen ein paar angstdurchzitterte Sekunden, dann sagt sie tonlos:
»Viertausend Mark? Mein Sohn hat sie schon bezahlt? Danke schön, Herr Kleeberg.«
Langsam legt Maria Warburg den Hörer in die Gabel. Sie wagt nicht zu ihrem Jüngsten hinzublicken.
Unheilvoll lastet die Stille zwischen den beiden Menschen, die sonst ein Herz und eine Seele waren. Ja, Maria Warburg liebt ihren Jüngsten mit einer Stärke, vor deren Ausmaß sie manchmal selbst erschrickt.
»Mutter«, wiederholt er. »Glaubst du wirklich, ich könnte dich bestohlen haben?«
»Franz meint…« Ihre Hände bewegen sich ziellos. Nirgends finden sie einen Halt. Schließlich stößt sie mit tränenerstickter Stimme hervor. »Peter, ach, Peter, warum hast du dich nicht an mich gewandt? Ich hätte dir das Geld sofort gegeben.«
»Franz will mich vernichten. Bitte, Mutter, glaube an mich. Ich habe mir das Geld erspart. Du kennst meinen größten Herzenswunsch. Ich wollte dich mit dem Wagen, der mir allein gehören sollte, überraschen. Wie soll ich dir beweisen, daß ich das Geld nicht genommen habe?«
»Peter«, flüstert sie, bis in Herz ergriffen. Sie glaubt ja an ihn. Sie gibt auch zu, daß Franz das Mißtrauen in ihr gesät hat. Warum hat sie nicht geschwiegen?
Peter richtet sich entschlossen auf. »Ob du an mich glaubst oder nicht, Mutter: ich kann nicht mehr länger neben Franz auf dem Hof arbeiten. Er ist der Erbe, ich habe zu weichen. Du mußt selbst einsehen, daß das nicht länger so weitergeht. Bisher habe ich zu allem geschwiegen, aus Liebe zu dir, Mutter. Das ist die reine Wahrheit. Ich gehe – und ich betrete den Hof nicht eher wieder, bis die Sache mit dem Geld geklärt ist!«
»Peter«, verzweifelt streckt sie ihm die Hände entgegen. »Wohin willst du gehen, Peter? Ich bitte dich, deswegen geht man doch nicht aus dem Elternhaus. Der kleine Zwischenfall wird sich aufklären.«
»Laß mich meinen Weg gehen, Mutter.« Entschlossener Wille spricht aus ihm. »Ich kann nur in einer sauberen Atmosphäre leben, arbeiten und glücklich sein. Franz und seine Frau haben die Luft auf unserem Hof verpestet. Es tut mir nur unendlich leid, daß ich dich nicht mitnehmen kann, Mutter. Dir wird es nicht gut bei Franz ergehen, das weiß ich.«
»Peter!«
»Ich versuche bei Ernst Reichert unterzukommen. Ich liebe Beate. Wo ich arbeite, ist gleich. Meine Hände kann ich überall regen, und wenn ich für Beate schaffe, das gibt mir noch mehr Antrieb.«
»Ernst Reichert?« Sie legt das Gesicht in die Hände und schluchzt laut auf. Ein Warburg will den Eichenhof verlassen? Er will für andere arbeiten?
»Hast du etwas dagegen, Mutter? Haben Gerhard und Otto nicht auch den Eichenhof verlassen? Du hast sie mit deinem Segen ziehen lassen. Ich tue also nichts anderes als meine älteren Brüder, wenngleich der Anlaß auch ein anderer ist. Es geht einfach nicht mehr, Mutter, das mußt du einsehen. Ich schwöre dir, ich habe das Geld nicht gestohlen –«
»Peter, keiner behauptet das, am allerwenigsten ich. Ich glaube dir. Genügt dir das nicht?« Sie hebt das tränennasse Gesicht, und Peter nimmt sie in seine Arme und küßt sie.
»Das genügt mir, aber für Franz ist der Vorfall ein gefundenes Fressen. Ich hätte die Hölle auf dem Hof. Das kannst du nicht von mir verlangen, Mutter.«
Die beiden Menschen, die sich
umschlungen halten, fahren wie auf einem Unrecht ertappt auseinan-
der.
Maria Warburg richtet sich auf und sieht dem langsam näherkommenden Sohn Franz aus verweinten Augen, nunmehr wieder in tadelloser Haltung entgegen.
»Es wird sich finden«, beharrt sie. »Es muß sich finden, Franz. Du wirst über den Vorgang Stillschweigen bewahren. Es wissen nur wir drei darum.«
Er lacht böse auf. »Mit deinem Goldsohn kann ich natürlich nicht in Konkurrenz treten. Er ist nun einmal der Allerbeste in deinen Augen.«
»Das ist nicht wahr.« Ihre Augen blitzen ihn an. »Ich habe mir immer Mühe gegeben, eine gerechte Mutter zu sein. Über was kannst du dich beklagen?«
»Laß das doch«, mengt Peter sich angewidert in das Gespräch. »Franz hat dir schon sehr oft weh getan.«
»Du bittest wohl um schön Wetter«, höhnt Franz und stemmt die Hände auf die Sessellehne.
»Ich gehe jetzt, Mutter«, sagte Peter, ohne des Bruders Einwurf zu beachten. Er neigt sich über sie und küßt sie auf die Wange. »Wir sehen uns heute noch einmal, dann erfährst du alles Weitere.«
»Suchst du die viertausend Mark?« Franz Warburgs Stimme ist mit Hohn getränkt.
»Vielleicht noch mehr«, erwidert Peter zweideutig und geht rasch davon. Ihm ist, als verfolge ihn ein schmerzlicher Seufzer aus dem Mund seiner Mutter. Doch unbeirrt, ohne sich umzuwenden, setzt er seinen Weg fort.
Die Haustür fällt dumpf ins Schloß, und Maria Warburg birgt ihr Gesicht in den Händen.
Ihr Peter geht! Wird sie ihn halten können, mit ihrer ganzen Liebe, mit allem Vertrauen?
Bevor Peter Warburg nun Georg Reichert aufsucht, geht er noch einmal in den Schuppen, wo der Treibstoff für die landwirtschaftlichen Maschinen steht. Ein ganz kleines Lächeln steht in seinen Mundwinkeln. Zu dem Dieselöl hat sich ein Kanister mit Benzin gesellt. Für seinen neuen Wagen, auf den er sich mit übergroßer Erwartung gefreut hat – und jetzt hat sich auf diese Freude Kummer wie ein Aschenregen gelegt.
Er sieht sich aufmerksam um und kontrolliert jede Ecke, damit ja nichts passieren kann. Dann erst verläßt er den Schuppen, der sich den Stallungen anschließt. Langsam wandert er über das Land. Sengend ist die Hitze. Beate – denkt er – und Mutter, die beiden liebsten Menschen, die die Erde für ihn trägt.
Es müßte Regen geben, sinnt er weiter, die Erde ist ausgetrocknet und zerrissen.
Er erreicht den Reicherthof, der kleiner als der Eichenhof, aber in mustergültiger Ordnung ist.
Georg Reichert, ein großer, hagerer Mann, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg hält und viele Freunde besitzt, ist der erste Arbeiter auf seinem Hof.
»Guten Tag«, sagt er frostig, als Peter Warburg in seinem Zimmer erscheint, das vor der Hitze abgedunkelt ist und die Einrichtung schwach erkennen läßt.
»Setzen Sie sich, Peter«, spricht Reichert kurz angebunden.
Peter bleibt stehen, und Reichert setzt noch hinzu: »Auch gut, wir haben uns nicht viel zu sagen.«
»Herr Reichert«, beginnt Peter und spürt, wie ihm die Zunge am Gaumen klebt vor Hitze und vor Erregung. »Ich will es auch kurz machen. Ich bitte Sie um Beates Hand. Wir lieben uns!«
Mit einem Ruck erhebt Reichert sich. In seinen Augen blitzt es. »Mehr nicht?«
»Doch«, fährt Peter unbeirrt fort. »Und dann möchte ich Sie um Arbeit bitten. Es sind Umstände eingetre-
ten –«
»Ich weiß, Peter«, unterbricht Reichert ihn mit einer schroffen Handbewegung. »Sparen Sie sich jede Erklärung. Meine Antwort sollen Sie auch gleich hören. Ich gebe meine Tochter keinem Dieb.«
Peter starrt den Mann an, als sehe er ein Gespenst. Er taumelt einen Schritt vorwärts, und es sieht aus, als wolle er den Mann, der diese furchtbare Beschuldigung ausgesprochen hat, an die Kehle gehen.
»Herr Reichert, woher wissen
Sie –?«
»Es genügt, d a ß ich es weiß. Woher, spielt dabei keine Rolle.«
Keiner von den beiden Männern hat gesehen, daß Beate ins Zimmer gehuscht ist. Schwer atmend lehnt sie am Türrahmen. Ihre Augen irren von einem zum anderen. Sie preßt die Hand an den Mund, um den Aufschrei zu unterdrücken.
»Ich schwöre Ihnen –«
»Schwören Sie lieber nicht, Peter.« Die Stimme Reicherts ist ruhig und gelassen. »Können Sie beweisen, daß Sie kein Dieb sind?«
»Peter ist kein Dieb!«
Reichert und Peter bemerken Beate, die mit dieser wie ein Entsetzensschrei klingenden Behauptung sich in die Unterhaltung eingeschaltet hat.
Sekunden vergehen. Beate stellt sich wie selbstverständlich neben Peter, und unwillkürlich legt er seine Rechte um ihre Schulter. Ihre Nähe gibt ihm die Besonnenheit zurück.
Reichert betrachtet die beiden Menschen lange und eingehend. Ihm ist hundeelend zumute. Sein schönster Traum, Peter und sein einziges Kind ein Paar, zerstört.
»Vater, ich bitte dich, höre Peter doch an.« Beates warme, flehende Stimme reißt ihn aus seinen unerfreulichen, trübsinnigen Gedanken.
»Willst du einen Mann heiraten, auf den man mit Fingern weist?«
»Aber es ist doch nichts bewiesen, Vater. Ich bitte dich, hilf Peter, hilf uns, wenn du mich lieb hast.«
Reichert zögert. Die Stimme seines einzigen Kindes berührt sein Herz. Hat sie recht? Tausendmal recht? Wenn man Peter nur ansieht, kommt einem alles töricht und unwahrscheinlich vor.
Im selben Augenblick reißt der Großknecht die Tür auf und brüllt in den Raum.
»Der Eichenhof brennt!«
Die Tür fliegt wieder ins Schloß, und die drei, zunächst wie erstarrt dastehenden Menschen, erwachen in einer grausamen Wirklichkeit.
»Komm«, sagte Peter kurz und zieht Beate an der Hand mit sich. Sie rennen gemeinsam dem Eichenhof zu.
Mutter! Mutter! denkt Peter nur, dabei hält er Beates Hand fest umschlossen, als suche er Halt bei ihr. Der Eichenhof, die geliebte Heimat, in Flammen? Dazu die Hitze! Man wird viel zu wenig Wasser zum Löschen finden.
Die beiden abgehetzten Menschen finden ein heilloses Durcheinander auf dem Hof vor. Tiere schreien in Todesnot, Menschen hetzen durcheinander.
Die Dienstboten des Hofes haben eine Kette gebildet und mit allen möglichen erreichbaren Gefäßen versuchen sie, aus dem nahen Teich das löschende Wasser heranzutragen. Die Feuerwehr ist noch nicht eingetroffen.
Peter wirft sich den Flammen entgegen, rücksichtslos dringt er in den Pferdestall ein, und tatsächlich kommen einige der Tiere ins Freie galoppiert, andere laufen aber hinein in die Glut.
Die Stallungen sind bereits niedergebrannt und langsam, aber sicher greift das Feuer auf das Wohnhaus über.
Peter arbeitet wie ein Wahnsinniger. Er sucht seinen Bruder Franz, kann ihn aber nirgends finden. Da stellt er sich an die Spitze der Leute und versucht, das Schlimmste abzuwenden. Vergeblich!
Zu allem Unglück hat der Wind, so schwach er auch ist, sich gedreht und treibt die Flammen dem Wohnhaus zu. Das knistert und kracht.
»Mutter! Mutter!« ruft er verzweifelt und stürmt in das Haus. Keine Antwort. Flammen schlagen ihm entgegen.
»Peter! Ich bin hier, Peter!«
»Hör doch auf, Peter«, fleht Beate ihn an. »Es hat doch keinen Zweck mehr. Bitte, hör auf.«
»Wo ist Mutter?« keucht er. Sie zerrt ihn am Arm mit sich. Auf der Bank des Gartenhäuschens, das abseits liegt und unbewohnt ist, sitzt Maria Warburg; sie hält die kleine wimmernde Franzi in ihren Armen.
»Mutter!« Die Freude, die Mutter unversehrt vor sich zu sehen, dazu die unmenschliche Anstrengung rauben ihm den letzten Rest seiner Kraft.
Vor Beates Füßen bricht er zusammen.
*
Der Eichenhof ist bis auf das Gartenhaus mit seinen beiden Zimmern und der kleinen Küche ein Raub der Flammen geworden.
Als Peter erwacht, liegt sein Kopf in seiner Mutter Schoß, und Beates Hände versuchen, seine Wunden zu verbinden.
»Wo ist Franz?« ist sein erster Gedanke.
»Drüben!« Seine Mutter weist auf die rauchenden und schwelenden Trümmer. »Dort, wo einst der Eichenhof war«, sagt sie mit stumpfer Gleichgültigkeit.
»Ich muß hinüber.« Er ist nicht zu halten, und Beate eilt hinter ihm her.
Peter biegt um die schwarze Mauerecke, den schäbigen Rest des einstigen Stallgebäudes, hört seinen Namen fallen und tritt sofort zurück in den Schatten.
Reichert, der Bürgermeister des Ortes, und der Polizeimeister unterhalten sich mit Franz Warburg.
»Dieselöl befand sich im Schuppen und –« Franz Warburg stockt.
»Und!« fordert der Wachtmeister.
»Ein Kanister Benzin.«
»Ach so, verstehe, für Ihren Privatwagen.«
»Nein«, gibt Franz Warburg ruhig zurück. »Wir fahren einen Diesel. Der Kanister gehört meinem Bruder.«
»Nun reden Sie schon, Mann«, fordert der Polizeimeister ärgerlich. »Wozu braucht Ihr Bruder Benzin?«
Franz zuckt mit den Achseln, und Peter, dem kein Wort entgeht, taumelt gegen den Rest der Schuppenwand. Ihm schmerzt nicht nur jedes Glied, er vermag auch nicht mehr richtig zu denken. Er möchte vorwärtsstürmen und der Unterhaltung Einhalt gebieten. Er spürt, wie sich etwas um ihn schlingt, was ihn zu vernichten droht.
»Keine Ahnung«, hört er Franz sagen.
»Das sieht verdammt nach Brandstiftung aus«, kommt es aus dem Mund des Polizeimeisters.
Beate, die still neben Peter steht, umklammert, von Entsetzen geschüttelt, seinen Arm.
»Das ist doch nicht möglich«, stammelt sie mit bebenden Lippen. »Komm, Peter, bitte, komm!«
Sie zerrt ihn mit sich, und Peter folgt ihr. Sie gehen nicht zu Maria Warburg zurück, sie schlagen den Weg zum Reicherthof ein. Niemand begegnet ihnen. Alles befindet sich an der Brandstelle.
Doch keiner ahnt, daß man Peter, den blonden, allseits beliebten Peter, der Brandstiftung bezichtigt.
Franz gibt auf jede Frage die gewünschte Auskunft, bis sich das Bild immer mehr abrundet.
»Es wird notwendig sein, daß eine Kommission aus der Stadt die Angelegenheit untersucht«, meint der Polizeimeister abschließend. »Die Versicherung wird alles einleiten.«
*
Zur selben Zeit steht Beate vor Peter Warburg. Sie hat die Arme um seinen Hals gelegt und zieht seinen Kopf zu sich herab.
»Du mußt verschwinden, Peter«, raunt sie ihm beschwörend zu. »Du hast gehört, was man dir vorwirft. Es ist alles Unsinn, ich weiß das. Alles spricht gegen dich. Du warst, bevor du zu uns kamst, im Schuppen.«
»Beate«, stöhnt Peter und preßt sie an sich. »Ich habe mich überzeugt, ob alles in Ordnung war. Es war alles in Ordnung. Ich kann das einfach nicht begreifen.«
»Man will dich vernichten, Peter, glaube mir«, spricht sie weiter im beschwörenden Ton. »Den Grund kenne ich nicht. Doch du kannst dich nicht verteidigen, falls man dich einsperren sollte. Du mußt frei sein – dann kannst du für deine Unschuld kämpfen. Du mußt gehen, ganz gleich, wohin. Hörst du denn nicht? Du darfst auch keine Zeit verlieren, Liebster. Wenn mein Vater kommt, mußt du fort sein.«
»Ich bin kein Feigling«, preßt er zwischen den Zähnen hervor.
»Denke an mich, an unsere Liebe, Peter. Ich verlasse dich nie.«
Ausgepumpt, wie ein Sack, läßt er sich auf einen Stuhl nahe der Tür fallen. Beate ist hinausgehuscht. Sie kehrt mit einem Sportanzug ihres Vaters zurück und beginnt ein geschäftiges Treiben.
»Schreib mir, Peter«, flüstert sie abschiednehmend und bitterlich weinend an seinem Hals. Sie läßt sich herzen und küssen, liegt noch einmal selbstvergessen in Peters Armen – dann ist sie allein, allein mit ihrer Sorge um den geliebten Mann und mit ihrer Angst vor dem Kommenden.
Peter irrt zunächst umher. Er wandert durch den Wald, der ihm von Kindheit an vertraut ist. Er läuft kreuz und quer, und als es zu dunkeln beginnt, sieht er sich unter den Birken, wo er sich am Vormittag mit Beate getroffen hat.
Er lehnt sich gegen den hellschimmernden Stamm. Sind wirklich erst Stunden vergangen, daß aus einem sorglosen jungen Menschen ein gehetzter und geächteter Mann wurde?
*
Maria Warburg sitzt bei Anbruch der Dunkelheit immer noch auf der Bank vor dem Häuschen, das, von wildem Wein umrankt, in einen kleinen Garten gebettet, recht nett aussieht.
Sie hat die Hände im Schoß zusammengelegt und starrt aus großen Augen, in denen die ganze Trostlosigkeit ihrer Lage liegt, hinüber zu dem einst so stattlichen Anwesen.
Sie ist im Schmerz wie erstarrt. Es ist aber nicht allein der trostlose Anblick der rauchenden Trümmer, der sie in diesen Zustand versetzt hat…
Ihr Herz schlägt wie wild in der Brust. Sie weiß alles von Franz. Schonungslos, als wolle er sich auf irgendeine Weise und für irgend etwas rächen, hat er ihr den Verdacht, der auf Peter lastet, mitgeteilt.
Der Verstand hat alles aufgenommen, doch ihr Herz hat alles abgelehnt. Nie – niemals hat Peter das getan, dessen man ihn anklagt.
Und nun ist er fort! Ist es Recht oder Unrecht? Hätte er nicht allen Anschuldigungen trotzig die Stirn bieten müssen? Sie hebt den Kopf. Hinter dem Wald steigt der Mond auf und bescheint mit seinem gelblichen Licht die Trümmerstätte und auch die einsame Frau auf der Bank.
Sie lauscht. Da ist es wieder, dieses raschelnde Geräusch, und dann steht eine hohe Gestalt vor ihr.
»Peter!«
»Mutter!«
Sie sieht, wie er vor ihr niedersinkt, und spürt seinen Kopf in ihrem Schoß. Ihre zitternden Hände streicheln immerzu über seinen blonden Haarschopf.
»Du bist doch nicht fort, mein lieber, lieber Junge!« raunt sie voll Glück, und ihre starre Haltung verliert sich. Ihre Stimme ist weich, mit Zärtlichkeit getränkt.
»Ich konnte nicht gehen, ohne Abschied von dir zu nehmen, Mutter«, flüstert er zurück und hebt die verdunkelten Augen zu ihr auf.
»Es ist ja alles nicht wahr, Peter. Es kann nicht wahr sein, was man dir vorwirft.«